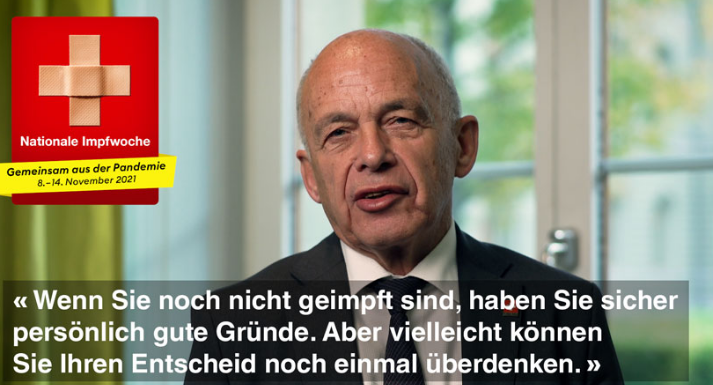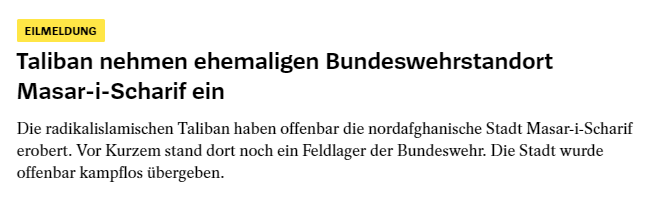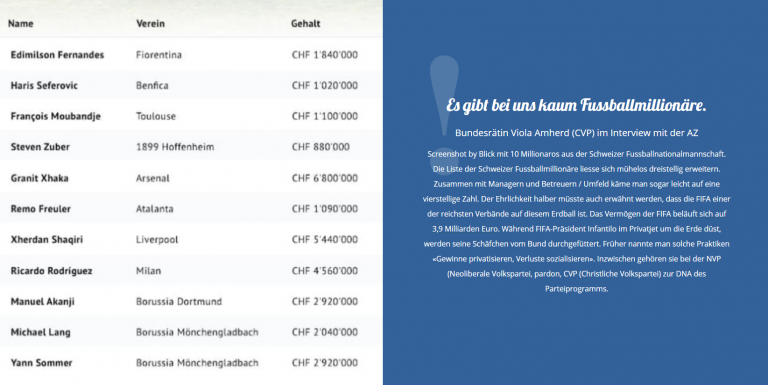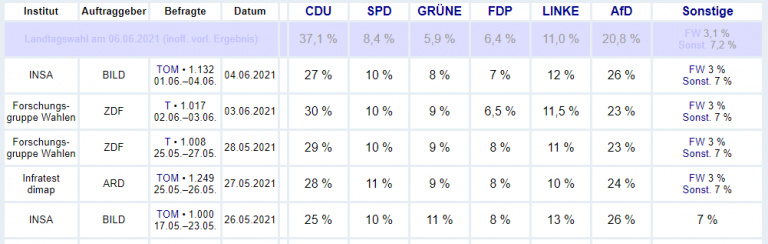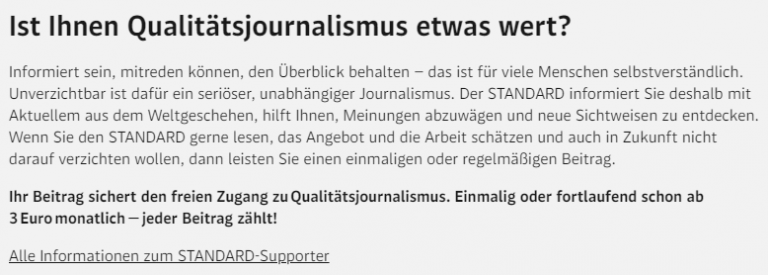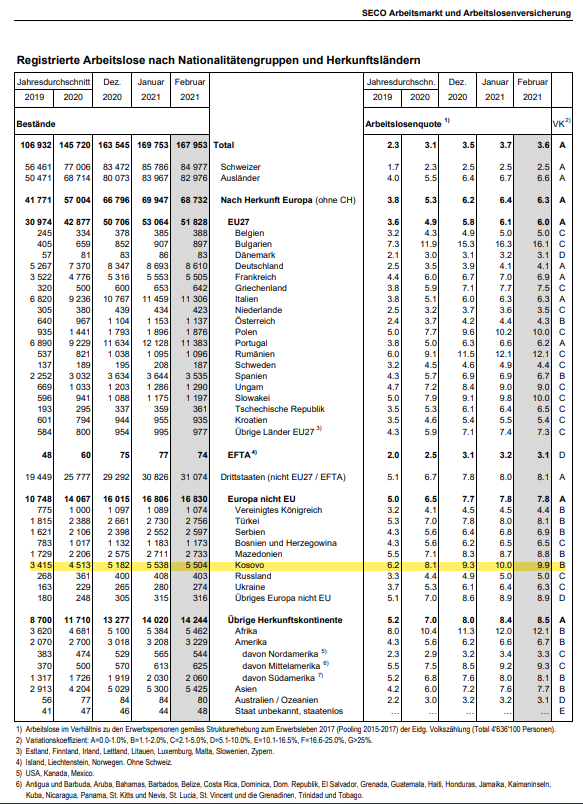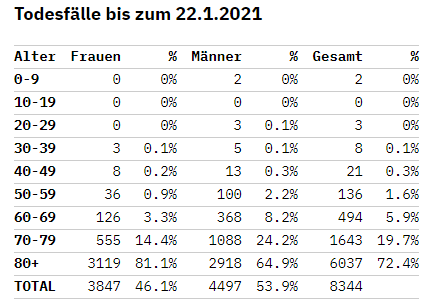Schlagzeilen des Tages
-
31.12.2021 - Tag der Schweizer Qualitätsmedien
Aus «ästhetischen Gründen»: China erteilt Fussball-Nationalspielern Tätowierverbot
Die chinesische Regierung hat sämtlichen Fussball-Nationalspielern verboten, sich neue Tattoos stechen zu lassen.
Der Machtapparat in Peking will reine Haut bei seinen Kickern: Die chinesischen Fussball-Nationalspieler sollen nach dem Willen der Regierung ihre Tätowierungen entfernen lassen. Zudem ist es den Spielern ab sofort «strikt verboten», sich neue Tattoos stechen zu lassen, heisst es in einer Stellungnahme der nationalen Sportbehörde von Beginn der Woche.
Den U20-Nationalteams sei es zudem verboten, Nachwuchstalente mit Tätowierungen zu nominieren. Fussballspieler sollen anhand der neuen Regeln «ein positives Beispiel für die Gesellschaft» abgeben.
Der Grund für Messis Abwesenheit?
In der Vergangenheit haben die Nationalspieler ihre Tätowierungen bereits mit entsprechender Kleidung oder Bandagen verdeckt, um nicht mit der Kommunistischen Partei in Konflikt zu geraten.
Von Chinas Internetnutzern wurde die Massnahme vor allem zynisch kommentiert. «Jetzt habe ich endlich den Grund gefunden, warum Messi nicht beim chinesischen Nationalteam aufgestellt wird», schrieb ein Nutzer auf der Online-Plattform Weibo. Schreibt SRF.
Da gäbe es spannendere Clickbaiting-Vorkommnisse aus China, über die unser aller Zwangsgebühren-Qualitätsjournalismus-Medium berichten könnte. Um nur ein Thema zu nennen, das im Leutschenbachquartier sträflich vernachlässigt wird:
In China ist ein Sack Reis umgefallen!
Happy New Year und denken Sie bei der kommenden Abstimmung über das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien vom 13. Februar 2022 kurz über den «Schweizer Qualitätsjournalismus» nach, bevor Sie ihr Kreuzchen machen. Für das Massnahmenpaket sind maximal 151 Millionen Franken vorgesehen.
-
30.12.2021 - Tag der österreichischesn Homoerotik
Der neue Chef von Kurz ist Paypal-Gründer und Trump-Fan
Am Donnerstag ist bekannt geworden, dass der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz einen neuen Job antreten wird. Sein künftiger Arbeitgeber machte sich als Tech-Unternehmer einen Namen.
Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ist im Dezember von allen politischen Ämtern zurückgetreten. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Verdachts auf Korruption. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wechselt der 35-Jährige nun in die Privatwirtschaft.
Er tritt einen Managerposten in den USA an. Dort wird er im ersten Quartal 2022 als Global Strategist bei der Investment-Firma Thiel Capital beginnen. Das Jahressalär von Kurz soll deutlich über jenen 312’000 Euro liegen, die er brutto als Kanzler verdient hatte.
Thiel Capital gehört dem Tech-Unternehmer Peter Thiel. Der in Frankfurt am Main geborene 54-Jährige besitzt neben der deutschen auch die neuseeländische und die US-Staatsbürgerschaft. Thiel gründete 1998 gemeinsam mit dem heutigen Tesla-CEO Elon Musk den Bezahldienst Paypal und war der erste Investor von Facebook und Vorstandsvorsitzender von Palantir, ein US-amerikanischer Anbieter von Software und Dienstleistungen, der sich auf die Analyse grosser Datenmengen spezialisiert, und der immer wieder für Kontroversen sorgt. In den vergangenen Tagen war spekuliert worden, dass Kurz einen Posten bei Palantir antreten werde.
Kurz und Thiel kennen sich seit vielen Jahren
Kurz kennt den Milliardär Thiel seit vielen Jahren. Von der Münchner Sicherheitskonferenz 2017 – Kurz war damals Aussenminister – existiert sogar ein gemeinsames Foto. Kurz schrieb dazu auf Twitter: «Grossartig, dich kennengelernt zu haben. Danke für die Möglichkeit.» Kurz und Thiel sollen damals schon über die Digitalisierung gesprochen und sich danach nie aus den Augen verloren haben. Diese Vertrauensbasis dürfte Österreichs Ex-Kanzler nun dabei geholfen haben, nach dem Polit-Aus rasch den topdotierten Managerposten an der US-Westküste ergattert zu haben.
Kurz hat ein Faible für Kalifornien und seine Tech-Giganten. Er reiste wiederholt als Aussenminister und Kanzler an die Westküste der USA. Im Oktober wäre wieder ein Trip angestanden – durch die Politaffäre kam es nicht mehr dazu. Er ist ebenso geplatzt, wie eine Laudatio, die Kurz in Berlin auf Peter Thiel halten hätte sollen. Der Investor und Multi-Milliardär bekam dort den Frank-Schirrmacher-Preis verliehen.
Thiel war Berater von Donald Trump
Seit 2017 ist Thiel mit dem Finanzexperten Matt Danzeisen verheiratet. 2007 wurde er durch das US-Klatschblog «Gawker» als homosexuell geoutet. Im Prozess des ehemaligen Wrestlers Hulk Hogan gegen das Online-Portal übernahm er Hogans Anwaltskosten in Höhe von zehn Millionen Dollar. Gawker hatte ein Sexvideo von Hogan veröffentlicht und wurde zu einem Schadensersatz von 115 Millionen Dollar verurteilt. Infolgedessen ging «Gawker» pleite.
Im Wahlkampf 2016 spendete der Multimilliardär Thiel 1,25 Millionen Dollar an Donald Trump, und war später gar Berater des damaligen US-Präsidenten. Am 22. Juli 2016 hielt der Tech-Unternehmer auf dem Parteitag der Republikaner in Cleveland unter Applaus der Teilnehmenden eine Rede, in der er Trump als Retter der Nation präsentierte und sagte: «Ich bin stolz, homosexuell zu sein. Ich bin stolz, ein Republikaner zu sein. Vor allem bin ich stolz, Amerikaner zu sein!» Schreibt 20Minuten.
Ob der dreifache Ex-Kanzler Sebastian Kurz dem bekennenden Homosexuellen Thiel die 2'500 Schmuddelbilder zum Bewerbungsgespräch mitbrachte, ist nicht bekannt.
Erinnern wir uns: Die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft stellte auf dem Diensthandy von Thomas Schmid, dem mächtigen Intimus von Kurz, schlüpfrige Chats («Ich liebe meinen Kanzler») und 2.500 Penisbilder sicher, was dann zum sogenannten «Beidl»-Skandal führte, mit dem die Entglorifizierung von Kurz begann.
«Im Taburaum der Homoerotik blühen offenbar neue Polit-Seilschaften, die von den Medien aus Angst vor dem Vorwurf der Homosexuellenfeindlichkeit geschont werden», schrieb das Online-Portal «Fuchsbriefe».
Da passt ja das Zitat von Willy Brandt zum seinerzeitigen Mauerfall wie die Faust aufs Auge: «Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört». Auch wenn es sich im Falle von Sebastian Kurz um ein einen «Kanzlerfall» handelt.
-
29.12.2021 - Tag der Bundesrats-Tweets
Die Arbeit der Schweizer Regierung in Zahlen
Der Bundesrat hat noch nie so viele Geschäfte behandelt wie 2021. Jede 2. Medienkonferenz hatte Corona zum Thema.
• Sitzungen: 53
• Geschäfte 3085
• Medienkonferenzen 75
• Tweets 1430
Schreibt das Portal der Schweizer Regierung.
Statt dem Defätismus zu huldigen, sollten wir alle stolz sein auf unsere Regierung. 1'430 Tweets im Jahr 2021! Das muss man erst mal schaffen.
Das sind immerhin 3,917808219178082 Tweets pro Tag, Ihr unverbesserlichen Meckerer*innen, die Ihr stets ein Haar in der Suppe findet.
Da ist es doch mehr als nur verständlich, dass die Bundesverwaltung 2021 ein paar Tausend Leute zusätzlich einstellen musste.
Oder etwa nicht?
-
28.12.2021 - Tag des Russenklons
Luxuslimousine von Aurus: So fährt Präsident Wladimir Putin: Hier kommt der Russen-Rolls
Einmal eine echte Staatskarosse fahren: Ab sofort kann jeder die Limousine bestellen, in der auch Russlands Staatspräsident Wladimir Putin chauffiert wird. Und das sogar zum überschaubaren Tarif.
Senkrechter Frontgrill, glatte Felgen, schmale Scheinwerfer und irre Abmessungen – das muss ein Rolls-Royce Phantom sein. Sieht aber nur so aus: Denn der Aurus Senat läuft seit 2018 in Russland als Staatslimousine vom Band. Bei der Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin wurde der Russen-Rolls erstmals präsentiert. Jetzt kann ihn jeder bestellen.
Seit 2012 trieb der russische Präsident das Projekt voran: Putin hatte genug von den altbackenen Zil-Limousinen, in denen sich schon sowjetische Machthaber über Jahrzehnte chauffieren liessen. Und auch vor Staatskarossen von Mercedes wollte er nicht länger posieren müssen. Als Chef der neuen Marke Aurus wurde Ex-Mercedes-Manager Gerhart Hilgert geholt, der sich mit Luxus auskennt. Das Moskauer Fahrzeuginstitut NAMI entwickelte mit Staatssubventionen die Modelle Senat mit 3,30 und Senat Limousine mit 4,30 Metern Radstand und Panzerung – in letzterem lässt sich seit 2018 Wladimir Putin fahren. Vor zwei Jahren schaute sich sogar Bundesrat Ignazio Cassis die Limousine am Genfer Autosalon genauer an.
Rolls made in Russland?
Die Inspirationen fürs Aussen und Innen holten sich die Aurus-Designer aber nicht bei Mercedes, sondern deutlich sichtbar im britischen Goodwood – bei Rolls-Royce. Die kurze Version des Senat mit 5,63 Metern Länge wirkt auf den ersten Blick wie der Phantom von Rolls-Royce. Und auch im Interieur haben Sitze, Vorhänge, Echtholz-Paneele und das Cockpit eher britischen Style. Technisch ist alles vom Feinsten: Digitale Instrumente, Flachbildschirme auf der Rückbank, gekühltes Barfach und ein ganzer Sack voll Assistenzsysteme gehören zur Ausstattung.
Elektroversion geplant
Beim Antrieb half Porsche auf die Sprünge: Unter der riesigen Haube liefert ein 4,4-Liter-V8 mit zwei Turboladern 598 PS; zusätzlich gibts eine Hybridisierung per 63 PS starkem Elektromotor, den Waffenhersteller Kalaschnikow zuliefert. Eine reine Elektroversion soll ebenso wie eine mit Brennstoffzelle schon in der Pipeline sein. Allerdings nur fürs Ausland – im riesigen Russland findet man zwar noch im hintersten Winkel eine konventionelle Tankstelle. Aber keine Ladesäulen oder Zapfanlagen für Wasserstoff.
Nachdem bisher nur Regierung und Kreml-Chef Aurus fahren durften, wird jetzt die Produktion hochgefahren: Bis zu 5000 Autos sollen pro Jahr vom Band laufen, davon 70 Prozent für den Export. Ausserdem sollen künftig weitere Modelle auf gleicher Plattform kommen – vor allem SUVs. Und der Preis für den Senat? Geradezu ein Schnäppchen mit ab rund 18 Mio. Rubel, umgerechnet rund 221'000 Franken. Denn ein Rolls-Royce Phantom schlägt mit mindestens einer halben Million Franken zu Buche. Schreibt Blick.
Wer es sich leisten kann, 221'000 Franken für ein Auto auszugeben, wird wohl eher das Original wählen. Die Mehrkosten von 279'000 Franken für das Prestige, das dem unverschämt geklonten Russenschlitten fehlt, sind in diesen Kreisen vernachlässigbar.
-
27.12.2021 - Tag der zugemüllten Städte
Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: 110 Millionen für Umstieg auf Mehrweg und Einwegpfand
Das Klimaschutzministerium fördert den Umstieg auf Mehrwegflaschen und Einwegpfand auf Plastikflaschen und Dosen mit 110 Millionen Euro. Beim geplanten Pfandsystem bekommen kleine Greißler 100 Prozent der Kosten für den Rückgabeautomaten ersetzt, kündigte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) an. Sie bezeichnet das Projekt, dessen Umsetzung sehr viel Überzeugungsarbeit und Gespräche erfordert habe, als Meilenstein.
Das neue Abfallwirtschaftsgesetz sieht vor, dass ab 2025 beim Kauf von Einweggetränkeverpackungen ein Pfand fällig wird, das die Kunden wieder zurückbekommen, sobald sie die Verpackung zurück in das Geschäft bringen. Schon ab 2024 kommt eine verbindliche Mehrwegquote schrittweise in die Geschäfte. Ab dann soll es in allen Supermärkten wiederbefüllbare Getränkegebinde geben. Ab 2024 wird es damit in allen Geschäften und auch in allen Kategorien Produkte in Mehrweg geben. Nicht nur beim Bier, sondern auch bei Säften, Mineralwasser oder Milch.
2,5 Milliarden Plastikflaschen jährlich
Jedes Jahr fallen in Österreich über 900.000 Tonnen Plastikmüll an. Rund 50.000 Tonnen davon sind nur Getränkeverpackungen. Das sind beinahe 2,5 Milliarden Flaschen und Dosen, die oft in der Natur landen. Die Kritik von Umweltschutzorganisationen, wonach die neuen Regelungen zu spät kommen, wies Gewessler zurück. Diese Zeit sei notwendig, um die benötigten Anlagen zu bauen und Automaten überall aufzustellen.
Die genauen Rahmenbedingungen werden im kommenden Jahr ausgearbeitet. Man müsse den Händlern die nötige Zeit geben, um umzustellen. So müssten beim Mehrweg Abfüllanlagen und Waschanlagen gebaut werden, die Logistik aufgebaut und umgestellt werden. Beim Pfand müssen die Supermärkte intern umstellen und teilweise umbauen. "Wir wollen die Zeit bestmöglich dazu nutzen, dass wir die Rahmenbedingungen sicherstellen, damit es vom Tag eins funktioniert." Derzeit hätte ein Großteil der Supermärkte überhaupt keine Infrastruktur für die Rücknahme, weil sie das bisher gar nicht gemacht haben. "Es ist eine große Systemumstellung."
Förderungen für Händler
Wichtig ist für Gewessler, dass die Händler bei der Umstellung unterstützt werden. Investitionen in den Bau oder die Erweiterung von Abfüll- und Waschanlagen für Mehrweggebinden und Normflaschen werden mit Fördersätzen von 40 bis 60 Prozent unterstützt. Diese Fördersätze sind die höchstmöglichen nach europäischem Beihilfenrecht und ihre Anwendung richtet sich nach der Unternehmensgröße – kleinere Unternehmen bekommen höhere Fördersätze.
Auch bei den Rückgabeautomaten für PET-Flaschen und Metalldosen im Lebensmitteleinzelhandel spielt die Unternehmensgröße eine wesentliche Rolle bei der Förderhöhe. Denn Kleinstunternehmer bekommen 100 Prozent der Kosten für den Rückgabeautomaten ersetzt. Größere Unternehmen bekommen 40 bis 60 Prozent an Förderung. Dieses Förderprogramm beginnt schon Mitte/Ende März 2022. Schreibt DER STANDARD.
Geht doch. Man muss es nur wollen.
Nicht nur das Klima wird Österreichs «Abfallwirtschaftsgesetz» begrüssen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger in den von rot/grünen G(r)üselparteien regierten und dementsprechend zugemüllten Städten.
Bleibt die Hoffnung, dass solch ein Gesetz irgendwann auch in der Schweiz den Weg durchs Parlament bis hin zur Volksabstimmung finden wird. Die Zeit und das Stimmvolk sind mehr als reif dafür.
-
26.12.2021 - Tag der Talibanfische mit der Scharia
Männliche Schlammteufel sperren das Weibchen so lange in ihre Höhle ein, bis es die Eier abgelegt hat. Schreibt der Zoo Basel auf Facebook in einer Bildbotschaft.
Als Gleichstellungsbeauftragter des Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli bin ich zutiefst schockiert. Wo bleibt der Aufschrei der Grünen Parteien? Wo die Sanktionen der EU gegen diese furchtbaren Machos? Hat sich die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock im feinsten Denglisch (formerly known as «Matteneglisch») vor laufenden Kameras zu diesem drängenden Thema geäussert?
Nein! Hat sie nicht. Niemandem scheint das Wohl der Schlammteufelinnen am Herzen zu liegen. Und dies mitten in der Weihnachtszeit. Man stelle sich vor, das wäre vor etwas mehr als 2'000 Jahren in Betlehem passiert! Unvorstellbar, dass Josef seine Maria in einem Ziegenstall eingesperrt hätte.
Einmal mehr dürfen wir dankbar sein, dass es die SVP mit ihrer Ethikkommission ANUS gibt. ANUS-Präsident Lukas Reimann, Jurist und Nationalrat aus Wil SG, hat sich denn auch bereits positioniert:
«ANUS kann das frauenverachtende Verhalten dieser muslimischen Taliban-Fische nicht tolerieren. Wir setzen uns konsequent für die Rechte der muslimischen Frauen, Fische und Aquarien ein. So wie wir in der Schweiz Minarette und Burka mit je einer «Volchs»-Abstimmung gebodigt haben, werden wir auch die muslimischen Frauen der Schlammteufel von ihrer seelischen Pein erlösen. Jesus Christophorus, pardon, Jesus Christus hat uns schliesslich auch von der Erbsünde erlöst.»
Wenn das keine frohe Botschaft vom Herrliberg, pardon, aus Wil ist, was dann?
Um allfälligen Klagen vorzubeugen sei hier festgehalten, dass es sich bei diesem Beitrag um Satire handelt! Die Luzerner Staatsanwalt unterscheidet nicht zwischen subtiler und geschmackloser Satire. Rechtschreibfehler sind so oder so nicht strafbar.
Foto Zoo Basel
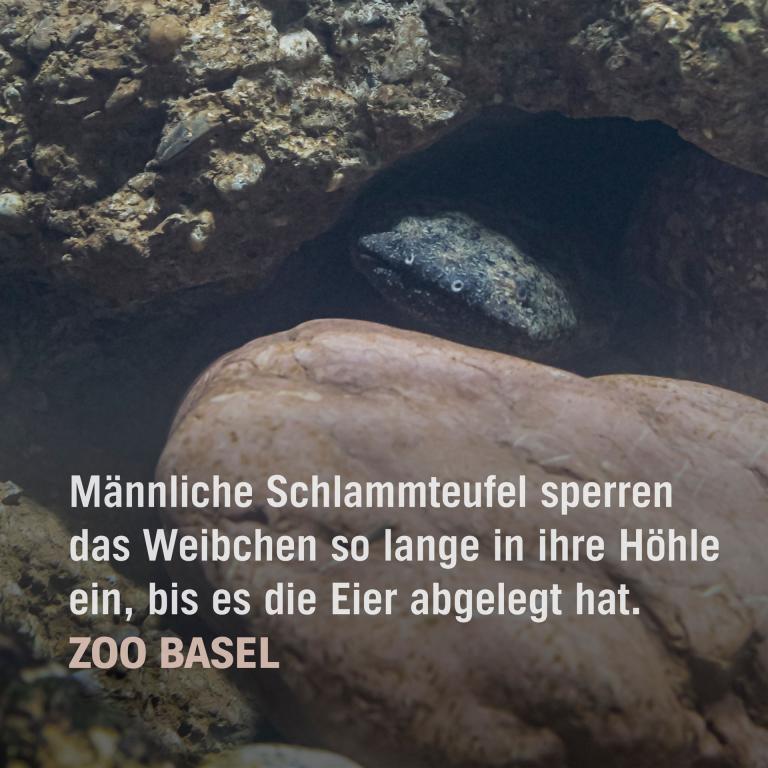
-
25.12.2021 - Tag des «grossen Propheten»
Manöver «Grosser Prophet»: Iran übt Angriff auf Israels Atomforschungszentrum
Zum Abschluss einer fünftägigen Militärübung hat die iranische Armee mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Die Übung diene als Warnung an Israel, sagte Armeechef Mohammad Bagheri am Freitag im Staatsfernsehen. Teheran verfüge über "Hunderte Raketen, die ein Land zerstören können, das es wagen würde, den Iran anzugreifen", sagte Bagheri.
Auch der Chef der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, richtete sich mit einer Drohung an Israel. Das Manöver sei eine "ernste Warnung an die Vertreter des zionistischen Regimes", erklärte er. "Sollten sie den geringsten Fehler machen, werden wir ihnen die Hand abschneiden."
Auf einem Video der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim war zu sehen, wie Raketen und Drohnen starten und später ein Ziel treffen, das wie ein Nachbau des israelischen Atomforschungszentrums Dimona aussieht.
Die Militärübung "Großer Prophet" hatte am Montag in den Provinzen Bushehr, Hormozgan und Khuzestan begonnen, die alle am Persischen Golf liegen. Dass bei dem Manöver auch ballistische Raketen eingesetzt wurden, verurteilte am Freitag die britische Regierung scharf.
Ballistische Raketen seien eine "Bedrohung für die regionale und internationale Sicherheit", hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in London. Ihr Einsatz sei ein "eklatanter Verstoß gegen die UN-Resolution 2231, die den Iran dazu verpflichtet, keinerlei Aktivitäten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen zu unternehmen, die dazu geeignet sind, Atomwaffen zu transportieren".
Atomgespräche in Wien
Das Manöver erfolgte vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran in Wien. Die Verhandlungen gestalteten sich nach Angaben von Diplomaten zuletzt als äußerst schwierig, die US-Regierung bereitet sich nach eigenen Angaben bereits auf ein Scheitern der Verhandlungen vor.
Die USA waren 2018 aus dem vom damaligen Präsidenten Donald Trump als völlig unzulänglich kritisierten Atomabkommen ausgestiegen und hatten erneut massive Sanktionen gegen den Iran verhängt. Danach zog sich Teheran ebenfalls schrittweise aus der Vereinbarung zurück. Israel lehnt das internationale Atomabkommen mit dem Iran vehement ab. Die Bedrohung durch den Iran war auch Thema eines Treffens des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und dem nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am vergangenen Mittwoch. Schreibt DER STANDARD.
Übung macht den Meister. Dieses geflügelte Wort trifft aber im Fall Araber vs. Israelis nicht zu. Schon bei den Sechstagekriegen im vergangenen Jahrhundert hatten 100 Millionen Araber den vier Millionen Israelis nichts entgegenzusetzen ausser grossmäuligen Ankündigungen.
Als Israel den ganzen Sinai erobert hatte und mit seiner schlagkräftigen Truppe vor Kairo stand, wussten auch die Söhne des «grossen Propheten», wo der Bartli den Most holt.
Sich bei kriegerischen Auseinandersetzungen mit Israel auf den «grossen Propheten» zu verlassen ist für die Araber (und Iraner) eine zum Scheitern verurteilte Strategie. Das wird auch immer so bleiben. Und das ist gut so.
-
24.12.2021 - Tag der singenden Wuchtbrummen
BEATRICE EGLI, YANN SOMMER, LARA GUT: Das sind die schönsten Schweizerinnen und Schweizer des Jahres
Die «Glückspost» hat auch dieses Jahr wieder die beeindruckendsten Schweizer Promis gekürt. An der Spitze stehen zwei Sport-Profis, die mit ihrem Talent und Charme überzeugen konnten. Schreibt 20Minuten.
Über Geschmack lässt sich bekannterweise streiten. Da kann es durchaus passieren, dass sogar eine singende Wuchtbrumme zum Schönheitsideal erklärt wird.
Zu hoffen bleibt allerdings, dass dieser Entscheid nicht auch noch dem Coronavirus zugeschrieben wird, das ja unsere Geschmackssinne beeinträchtigen soll.
-
23.12.2021 - Tag der Umerziehungs-Camps
Corona-Ausbruch in China: Harter, plötzlicher Lockdown für 13-Millionen-Metropole Xi'an
Nach einigen Dutzend Corona-Infektionen im chinesischen Xi'an sind massive Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner der Metropole verhängt worden. Seit Mitternacht dürfen sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, Ausnahmen gibt es kaum.
Harter und plötzlicher Lockdown in der chinesischen Stadt Xi'an. Nach einigen Dutzend Corona-Infektionen sind massive Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner der Metropole verhängt worden. Seit Mitternacht dürfen sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, Ausnahmen sind kaum erlaubt. Jede Familie kann ein Mitglied bestimmen, das alle zwei Tage einkaufen gehen darf, wie die Stadtregierung in ihrem Erlass mitteilte. Die Behörden meldeten am Donnerstag 63 lokale Infektionen. Der Ausbruch sei durch «importierte Fälle» ausgelöst worden, hiess es.
Ob es sich bei dem Virus um die neue Omikron-Variante handelt, wurde nicht mitgeteilt. Neben dem Lockdown in der Provinzhauptstadt von Shaanxi sollen auch millionenfache Corona-Tests dabei helfen, den Ausbruch einzudämmen. Infizierte und ihre engen Kontaktpersonen sollen ins Spital oder in Quarantäne gebracht, alle Übertragungswege unterbrochen werden. Schulen wurden geschlossen - ebenso Geschäfte, die nicht zwingend für die Versorgung notwendig sind. Auch Verkehrsverbindungen wurden weitgehend unterbrochen. Ein grosser Teil der Flüge nach Xi'an wurde gestrichen.
Mit derart rigiden Massnahmen hat China, das eine Null-Covid-Politik verfolgt, das Virus weitgehend in den Griff bekommen. Seit mehr als einem Jahr ist es um die Pandemielage in der Volksrepublik deutlich besser bestellt als in vielen anderen Ländern. Das tägliche Leben und die Wirtschaft haben sich längst normalisiert. Allerdings hat die ansteckendere Delta-Variante seit Herbst mehrere Ausbrüche verursacht. Und jetzt fürchten Verantwortliche die hochinfektiöse Omikron-Variante, die sich noch schneller ausbreitet. In sechs Wochen sollen in Peking die Olympischen Winterspiele beginnen. Schreibt Blick.
13 Millionen Chinesinnen und Chinesen von einer Minute auf die andere eingesperrt. Also rund fünf Millionen Menschen mehr als die gesamte Schweiz an Einwohnern hat, dürfen wegen 63 lokalen Coronavirus-Infektionen ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Wer sich dagegen sträubt oder gar ein Trychler-Hömmli anzieht, wandert augenblicklich ins Umerziehungs-Camp. Die Uiguren können ein Lied davon singen.
Sowas schafft wirklich nur eine Diktatur. Die bisherige Bewältigung der Coronapandemie in China gibt den dortigen Machthabern allerdings recht.
Trotzdem sollten wir uns hierzulande glücklich schätzen, in einer Demokratie leben zu dürfen. Auch wenn wir dafür ein paar Tausend hirnverbrannte Trychler in Kauf nehmen müssen.

-
21.12.2021 - Tag der Linken und Netten mit ihren Haarwuchstabletten
Hongkonger boykottieren nach Reformen die Wahlen: Nur 30 Prozent stimmten über neues Parlament ab
Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, da fanden in Hongkong die letzten freien Wahlen statt. Diese gewann das Demokratie-Lager sehr zum Ärger Pekings. Denn damit hatte auch die "schweigende Mitte" ihre Sympathie mit den jungen Demonstranten auf der Straße zum Ausdruck gebracht.
Am Wochenende haben die Hongkonger nun abermals gewählt, und zwar ihr Parlament. Was die Bewohner der chinesischen Sonderverwaltungszone von Wahlen mittlerweile halten, zeigt sich indirekt in der Wahlbeteiligung. Nur 30 Prozent der Wahlberechtigten gaben überhaupt ihre Stimme ab. Bei den Parlamentsjahren vor sechs Jahren waren es noch doppelt so viele gewesen. Viele haben nach dem "Nationalen Sicherheitsgesetz", das Peking im Juli 2020 verkündet hatte und welches de facto die Autonomie der Stadt beendete, keine Hoffnung mehr, dass demokratische Wahlen etwas verändern können.
Frei im westlichen Sinne waren die Wahlen zum Parlament, dem "Legislative Council", kurz "LegCo", allerdings noch nie – was Demokratieaktivisten immer wieder kritisierten. Nun aber kamen neue Regeln hinzu: Die LegCo ist von 70 auf 90 Sitze vergrößert worden, von denen dürfen aber nur 20 statt bisher 35 direkt gewählt werden. Die restlichen Sitze sind für Peking-freundliche Gruppen reserviert. Alle Kandidaten müssen zudem "Patrioten" im Sinne Pekings sein.
Carrie Lam, die Peking-freundliche Regierungschefin Hongkongs, verteidigte die Wahl: Eine hohe Wahlbeteiligung sei nicht das Ziel gewesen. Das "neue Wahlsystem habe reibungslos funktioniert".
Hohe Haftstrafen gegen Aktivisten
Erst vor einer Woche hatte ein Gericht in Hongkong hohe Haftstrafen gegen Demokratieaktivisten verhängt. Darunter befand sich auch der Medienunternehmer Jimmy Lai. Dessen regierungskritische Zeitung "Apple Daily" war im vergangenen Jahr eingestellt worden. Lai ist nun zu 14 Monaten Haft verurteilt worden, weil er eine Mahnwache für das Tiananmen-Massaker 1989 organisiert hatte. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch verurteilten das Urteil als "kafkaeskes Gegenteil von Gerechtigkeit".
Das jährliche Gedenken an die Opfer des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking war dieses Jahr erstmals von den Behörden in Hongkong verboten worden. Die Sonderverwaltungszone war bisher der einzige Ort innerhalb des Machtradius der Kommunistischen Partei Chinas gewesen, an dem dies noch möglich war. Auch diese Tatsache zeigt, wie ernst es dem Regime in Peking ist, die Autonomie der Stadt völlig zu beenden.
Ab 2014 hatten Studenten und Aktivisten immer wieder mehr Demokratie in der Sonderverwaltungszone gefordert. Die Proteste verliefen zum größten Teil friedlich, zu gewaltsamen Übergriffen aber kam es durch Polizei und von Peking organisierten Gegendemonstranten. Noch im Dezember 2019 zeigte sich die Bewegung siegessicher.
Wenige Wochen später erklärte die WHO das neue Sars-Cov2-Virus zur Pandemie. Demonstrationen waren von nun an verboten. Im Sommer folgte das Nationale Sicherheitsgesetz. Zahlreiche Aktivisten, darunter Joshua Wong, sitzen heute im Gefängnis oder wurden ins Exil gedrängt. Schreibt DER STANDARD.
Viel mehr als 30 Prozent Wahlbeteiligung hat auch die Vorzeigedemokratie Schweiz bei vielen Urnengängen nicht zu verzeichnen. Es sei denn, es geht wieder mal um vernachlässigbaren Chabis wie Minarette und Burkas.
Was mich an diesem Artikel aber wirklich schockiert, ist die Titelzeile. Ausgerechnet das linke Blatt DER STANDARD, Liebling aller Salonsozialisten Österreichs, Sprachrohr der NGOs und die Mutter aller Linken und Netten mit den unverzichtbaren Haarwuchstabletten, verlässt den Pfad der Tugend der ansonst beispiellos gepflegten Gendersprache: Nicht nur «Hongkonger» schwänzten die Wahlen. Auch die «Hongkongerinnen» glänzten durch Abwesenheit.
-
20.12.2021 - Tag der Druckerschwärze am Allerwertesten
Toilettenpapier wird laut Hersteller sehr viel teurer
Sie waren eines der begehrtesten Produkte in der Pandemie. Nun könnte sämtliches Hygienepapier bald 20 Prozent teurer werden. Laut Hersteller Essity seien die Rohstoffpreise „durch die Decke gegangen“, hinzukommen erhöhte Logistikpreise und -probleme.
Toilettenpapier, Taschen- und Küchentücher dürften deutlich teurer werden: Der große Hersteller von Hygienepapier Essity hat drastische Preiserhöhungen angekündigt. „Wir als Essity werden die Preise um insgesamt knapp 20 Prozent erhöhen müssen, um die Kostenentwicklung auszugleichen“, sagte der Chef des Konsumgütergeschäfts von Essity, Volker Zöller, dem Nachrichtenportal „T-Online“. „Was sich die letzten Wochen in unserer Branche getan hat, ist nicht mehr normal.“
Die Preiserhöhungen begründet der Konzern mit deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Besonders die Zellstoffpreise seien „durch die Decke gegangen“. Dazu kämen die momentanen Logistikprobleme.
„Die Logistikpreise haben sich zum Teil vervierfacht. Das hat die Lage zusätzlich verschärft“, sagte Zöller. „In den nächsten Monaten wird sich die Lage nicht entspannen. Preiserhöhungen sind daher unausweichlich.“
Man werde alsbald in Gespräche mit dem Handel eintreten, wenn nicht schon geschehen. „Mit den meisten Kunden haben wir offene Verträge, da können wir schneller reagieren. Doch auch langfristige Verträge müssen dringend angepasst werden“, betonte Zöller.
„Ich gehe davon aus, dass sich die Kostenentwicklung auch in den Regalpreisen widerspiegeln wird.“ Essity vertreibt Marken wie Zewa, Tempo und Tork. Schreibt DIE WELT.
Kacken wird teuer. Bald können sich nur noch die Reichen den täglichen Stuhlgang leisten.
Feiern nun die guten alten, selbst zugeschnittenen Papierschnipsel aus Zeitungspapier ein Revival?
Aber Vorsicht! BLIGG-Fötzeli hinterlassen meistens Druckerschwärze am Allerwertesten.
-
19.12.2021 - Tag der Flatterfeigen vom Herrliberg
Christoph Blocher: Eine neue Partei?
Es ist häufig so, dass Leute, die in einem einzigen Punkt einer Meinung sind, glauben, eine neue Partei gründen zu müssen. Und so lese ich, dass Gegner des Covid-Gesetzes genau das tun wollen.
Ich habe immer wieder Neugründungen von Parteien erlebt. Die Autopartei entstand aus der begreiflichen Unzufriedenheit von Bürgerlichen gegen eine weitverbreitete Verachtung des Autos und der Automobilisten. Aber mit diesem Thema allein konnte sich diese Partei auf die Dauer nicht halten. Sie ging in der SVP auf, weil diese die Anliegen der Autopartei auch ernst nahm.
Noch früher gab es die Republikaner und die Nationale Aktion. Ihnen ging es allein um das wichtige Problem der Überfremdung und der grossen Zuwanderung. Sobald andere Fragen kamen, war man uneinig. Weil die SVP bei der unkontrollierten Zuwanderung eine klare Linie vertrat und den Kampf für ein griffiges Ausländer- und Asylrecht führte, gingen die neuen Parteien praktisch unter.
Die Covid-Gesetz-Gegner operierten aus ganz verschiedener Optik: Es gab einige, denen ging es um grundsätzliche Werte wie Freiheit, Abneigung gegen obrigkeitlichen Zwang und Staatsdiktat. Genau dies waren die Gründe, weshalb die SVP ihre Nein-Parole beschloss. Andere Gründe hatten esoterische Linke, ganz grundsätzliche Impfgegner, Gegner der Schulmedizin und viele andere. Wenn die Pandemie und die Impfstreitigkeiten einmal vorbei sind, werden sie sich unmöglich zusammenfinden. Eine heterogene neue Ein-Themen-Partei nützt auch wenig.
Es wäre besser, diejenige Partei zu stärken, die bei allen Themen für eine sichere Zukunft in Freiheit kämpft. Und dies nicht nur beim Covid-Gesetz, sondern auch bei der Bekämpfung der künftigen Stromknappheit, der Sicherung unserer Lebensgrundlagen, für die einheimischen Arbeitsplätze, oder beim Einsatz für weniger Steuern, Abgaben und Gebühren und und und... Schreibt Christoph Blocher in der «Verlegerkolumne» seiner Gratiszeitungen.
Scheint, als ob dem SVP-Feldmarschall vom Herrliberg die Hämorrhoiden flattern. Könnte ja durchaus passieren, dass seine «Trychler»-Truppe bei kommenden Wahlen ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel nicht mehr bei der SVP macht, sondern bei der neuen «Freiheitspartei». Querulanten sind in der Regel nicht unbedingt zuverlässig und richten ihre Fahnen nach dem Wind. Das weiss auch Blocher.
Und buhlt entsprechend bereits um die schwarzen Schafe der Hirnverbrannten und Abtrünnigen für seine SVP: «Es wäre besser, diejenige Partei zu stärken, die bei allen Themen für eine sichere Zukunft in Freiheit kämpft.»
Dass solche Neugründungen von Parteien, die – monothematisch ausgerichtet – einzig und allein der Obstruktion dienen, in der Regel keine nennenswerte Zukunft haben, beschreibt der «Verleger» absolut richtig.
Die Vollpfosten der esoterisch angehauchten Meute der Verschwörungstheoretiker*innen und Coronaleugner*innen bis zu den Impfgegnern*innen dem linken Spektrum zuzuordnen, ist allerdings eine infantile wenn nicht gar senile Einschätzung des Gesalbten vom Herrliberg.
Vermutlich Blochers üblichem Reflex geschuldet, wonach alle, die nicht zu hundert Prozent seiner Meinung sind, politisch links stehen.
Reflexe und Hämorrhoiden haben eine Gemeinsamkeit: «Irgendwann bekommt sie jedes Arschloch», wie schon der grossartige Billy Wilder treffend die Flatterfeigen beschrieben hat.
Warum Hämorrhoiden im Volksmund allerdings als Flatterfeigen bezeichnet werden, ist umstritten. Eine These besagt, dass sie in der frühgeschichtlichen Zeit der Menschheit mit Feigen medizinal behandelt wurden, eine andere will wissen, dass sie wie das Blatt eines Feigenbaums flattern sollen.
Womit auch diese brennende Frage der Menschheit ein für allemal geklärt wäre.
-
18.12.2021 - Tag der Krypto-Tulpenblase
Bitcoin schwächelt: Banges Warten auf den nächsten Crash
Eigentlich hätte das Kryptojahr mit Feierlaune enden sollen. Nach 2013 und 2017 war auch in diesem Jahr mit einem Kursfeuerwerk gegen Jahresende gerechnet worden. Denn in den vorangegangenen Zyklen schlug sich Bitcoin immer im Jahr nach dem sogenannten "Bitcoin Halving" besonders gut. Darunter versteht man die Halbierung der Bitcoins, die in einem bestimmten Zeitraum produziert werden können. Das geschieht alle vier Jahre und sorgt dafür, dass Bitcoin über Jahre und Jahrzehnte ein immer rareres digitales Gut wird.
Rallye – Crash – Rallye
Nach einer enormen Preisrallye, die von vergangenem November bis diesen Mai andauerte, folgte ein erster Crash. Nach dem neuerlichen Anstieg auf knapp 70.000 Dollar am 10. November geht es seither steil bergab. Auch am Freitag gab der Bitcoin-Preis weiter auf 45.500 Dollar nach, der Rest des Kryptomarkts inklusive großer Coins wie Ethereum, Solana und Cardano zeigte sich mit einem Minus von zwischenzeitlich acht bis zehn Prozent ebenfalls tiefrot.
Die negative Preisentwicklung der vergangenen Wochen spiegelt sich auch im Sentiment der Kryptoanleger wider. Der berühmt-berüchtigte "Fear & Greed Index", ein Online-Tool, das die Angst bzw. die Gier auf Basis von Social Media, Nachrichten und anderen Quellen misst, zeigte am Freitag den niedrigen Wert von 23 an. Übersetzt in Worte bedeutet diese niedrige Zahl: "extreme Angst". Die Furcht, dass Bitcoin vor dem nächsten kapitalen Absturz steht und damit vielleicht ein längerer Abwärtstrend eingeläutet werden könnte, ist also definitiv da.
Bestand auf Kryptobörsen nimmt ab
Diverse Kenner der Kryptoszene vermuten allerdings, dass der Vier-Jahre-Zyklus aus mehreren Gründen verworfen werden kann bzw. die Wellen, mit denen Bitcoin im Großen nach oben steigt und dann wieder zusammenfällt, länger dauern. Gegen einen unmittelbaren Totalcrash spricht auch, dass auf den großen Kryptobörsen der Bitcoin-Bestand abnimmt.
Das wird so gedeutet, dass finanzkräftige Käufer den niedrigeren Preis derzeit eher ausnützen, nachkaufen und diese Bitcoin in sichere externe Wallets fernab von Kryptobörsen verstauen. Im Mai etwa war auf den Börsen ein Zufluss an Bitcoin zu vermerken, bevor der Preis von über 60.000 Dollar auf 30.000 Dollar crashte – eben weil viele Großinvestoren verkauften. Da dies jetzt anders ist, glauben viele in der Kryptoszene, dass die derzeitige Schwäche nur vorübergehend sein wird.
Einen Strich durch die Rechnung könnten allerdings externe Faktoren machen. So sorgt die Angst vor der Corona-Variante Omikron auch an den Börsen für Nervosität. Dazu kommen die Entscheidungen der US-Notenbank Fed sowie neue Regulierungsankündigungen hinsichtlich des Kryptomarkts. Nicht alles davon scheint negativ für Bitcoin und andere digitale Assets. Für die anvisierten 100.000 Dollar bis Jahresende dürfte es für Bitcoin aber zeitlich knapp werden. Schreibt DER STANDARD.
Warum nur erinnern mich die unsäglichen daily news unbedarfter Bullshit-Agenturen über die Berg- und Talfahrten der Kryptowährung «Bitcoin» an den ersten Börsencrash der Weltgeschichte, ausgelöst durch die Tulpenblase?
-
17.12.2021 - Tag der gespaltenen Gesellschaft
Finanzminister Maurer übt Kritik am Covid-Management des Bundesrats: «Es gibt Dinge, die man in diesem Land nicht mehr laut sagen darf»
Bundesrat Ueli Maurer blickt besorgt auf die Verschuldung und Spaltung des Landes durch die Covid-Krise. Er fordert mehr gegenseitiges Verständnis und wieder mehr Mut, Probleme anzugehen – und übt Kritik am eigenen Regierungsgremium.
Bundesrat Ueli Maurer (71) zeigt sich besorgt über den Zustand des Landes. Die Covid-Pandemie treffe die Schweiz im Herzen. Insbesondere mit der Spaltung des Landes bekundet der Bundesrat Mühe. Im «Weltwoche Daily»-Gespräch mit Verleger und SVP-Nationalrat Roger Köppel (56) plaudert Maurer dazu aus dem Nähkästchen. Ausgerechnet am Tag, bevor der Bundesrat am Freitag neue Corona-Massnahmen bekannt gibt. Maurer wundert sich über das Corona-Krisenmanagement des Bundesrats, ohne den zuständigen Gesundheitsminister Alain Berset beim Namen zu nennen.
Maurer wird von Parteikollege Köppel vertraulich geduzt und in der Wandelhalle des Bundeshauses erst auf sein Finanzamt angesprochen. Die Schweiz habe «noch nie in so kurzer Zeit so viele Schulden gemacht, auch im Zweiten Weltkrieg nicht», sagt der Finanzminister. Doch das nehme «niemand ernst». Diese «gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit der Verschuldung» beschäftigt Maurer. 35 Milliarden Franken betrage die neue Schuldenlast der Schweiz. Dafür sollen über die nächsten 12 Jahre jährlich etwa drei Milliarden zurückbezahlt werden, etwa drei Prozent des Budgets von 80 Milliarden – «damit wir wieder robust sind für die nächste Krise». Doch man wolle das «Geld weiter ausgeben für Konsum, und das ist falsch», sagt Maurer.
Schnell finden die beiden Herren zum Chefthema, der Corona-Politik des Bundesrates. Im Trychler-Hemd abgebildet zu werden, hatte den Zürcher Bundesrat ja auch zahlreichen Rückmeldungen beschert. Untergraben tut Maurer das Kollegialitätsprinzip nicht, doch er wählt deutliche Worte: «Was mich beschäftigt: Es gibt Dinge, die man in diesem Land nicht mehr laut sagen kann, nicht mehr laut sagen darf. Man wird sofort in eine Ecke gedrängt. Das passiert mir als Bundesrat, und das passiert Tausenden, Zehntausenden von Leuten auch.»
«Schade für die Schweiz»
Das sei für die Schweiz «sehr gefährlich, wenn man in einer Demokratie nicht mehr sagen darf, was man denkt. Dann ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt, und das ist vielleicht die grösste Gefahr dieser Krise, die wir jetzt erleben. Sofort jemanden in eine Ecke zu drängen.» Maurer pocht auf Verständnis und gegenseitigen Respekt. Geimpfte und Ungeimpfte: Alle würden den gleichen Respekt verdienen. «Diese Selbstverständlichkeit wird infrage gestellt», sagt Maurer, «und das ist schade für die Schweiz.»
Ob er sich fürs Jahr 2022 zum Vorsatz genommen habe, jetzt Klartext zu reden, fragt Köppel. «Ich spreche Klartext im Bundesrat, das ist auch mein Gremium», sagt Maurer. Er halte es für wichtig, dass die Schweiz im kommenden Jahr zu einer «offenen Gesprächskultur findet. Dass man wieder sagen darf, was man denkt».
Er erlebe das in seinem Umfeld sehr oft, dass «Leute sich nicht mehr getrauen, dass sie sich vom Staat abkapseln, den Staat nicht mehr ernst nehmen. Das ist das Gefährlichste, das uns passieren kann. Alle würden gebührenden Respekt verdienen». Man könne eine andere Meinung haben, aber sie in eine Ecke zu stellen, das gefährde die Demokratie.
Kritik an Covid-Management des Bundesrats
Roger Köppel schneidet die Spitalbettenkapazitäten an. «Es wird erstaunlicherweise wenig darüber gesprochen. Wir befinden uns in einer Art Kriegsfall mit dem Virus, wird gesagt, da muss die Schweiz doch aufrüsten», meint der Nationalrat.
Der Bundesrat habe in dieser Covid-Krise «alles geregelt», sagt Maurer, «nur die Spitalbetten nicht. In dieser Zeit würde eine Reserve gebraucht. Das müsse im Bundesrat noch diskutiert werden: Wir schreiben offenbar vor, wie viele Personen einer Familie zusammen Weihnachten feiern dürfen, aber zu den Spitalbetten machen wir nichts. Wir bräuchten eine Reserve, um die Spitzen aufzufangen. Die Feuerwehr muss bereit sein – es brennt im Gesundheitswesen, aber wir sind offensichtlich nicht in der Lage, etwas zu unternehmen.»
Maurer: «Um diese Frage hat sich der Bundesrat immer gedrückt. Das ist auch im Gesetz nicht vorgesehen, auch jetzt nicht.» Dabei gehe es der Schweiz noch immer «gut»: «Wir sind satt, sozusagen, wir sind nicht mehr bereit, auf Sonderfälle zu reagieren. Wir sind unflexibel geworden. Risiken schalten wir aus. Risiken, die wir nicht wollen, die schalten wir aus. Wir müssen wieder risikobasiert werden.»
Maurer wünscht sich «mehr Mut»
Maurer fordert, dass Menschen «sich wieder damit abfinden müssen, dass Dinge passieren, die wir nicht beeinflussen können, die wir nicht voraussehen. Darauf müssen wir uns flexibler einstellen.» Maurer wünscht sich auch «mehr Mut», auf solche Vorkommnisse zu reagieren. Schreibt unser aller Bligg.
Bundesrat Maurer hat sicher in Vielem recht, was er dem Maschinengewehr Gottes, sprich der rhetorischen Massenvernichtungswaffe von Jesus Christophorus Blocher ins Notizbüchlein plapperte. Apostel «Roscheeee» Köppel verewigt denn auch die Gedanken des Schweizer Finanzministers im Trychler-Hömmli befehlsgemäss und prompt in der neuen Bibel des Allerheiligsten vom Herrliberg, genannt «DIE WELTWOCHE».
Nach meiner subjektiven Meinung hat Ueli Maurer als Schweizer Finanzminister während der Pandemie keinen schlechten Job gemacht. Er könnte sich eigentlich zurücklehnen und die kommenden Festtage geniessen. Er hat in herausfordernden Zeiten getan, was er tun musste.
Dass er aber immer wieder in die alten Reflexe als ehemaliger SVP-Parteipräsident zurückfällt, ist schade und wird seiner Leistung als Bundesrat nicht gerecht. Ausgesprochen dumm und frei von jeglichen Geschichtskenntnissen sind seine Äusserungen bezüglich Spaltung der Schweizer Bevölkerung. Da überschätzt er die tatsächliche Bedeutung der SVP-Spezialtruppe der Trychler in der Schweizer Gesellschaft gewaltig. Sowohl in Bezug auf die intellektuellen Fähigkeiten der esoterischen Seuchenvögel wie auch deren Mannschaftsstärke.
Je nach Lage der politischen, wirtschaftlichen, religiösen oder gesellschaftlichen Verhältnisse war die Schweiz seit ihrem Bestehen schon immer gespalten in divergierende Gruppen. Bundesrat Maurer – und notabene auch die heutzutage leider etwas unbedarften Journalisten*innen – sollten vielleicht einmal ein Gespräch mit meinem wandelnden Geschichtslexikon Res Kaderli führen. Das würde ihr Wissen über die Schweizer Geschichte und warum sich die Eidgenossen seit jeher die Köpfe einschlugen enorm beflügeln.
Auch wenn heute die lautstarken Schlachten verbal und in den Echokammern des Internets und sinnbefreiten Demonstrationen in Schweizer Städten mit Trychel-Klängen und absurden Schlagworten wie «Freiheit» geführt werden, erinnere selbst ich mich an Szenen aus meiner Kindheit, wie tief die politischen Gräben auch damals zwischen den «roten» und «schwarzen» Familien das Dorf durchzogen, wenn gerade Wahlen anstanden. Ganz zu schweigen von den religiösen Diskrepanzen zwischen Katholiken und Protestanten.
Wir täten gut daran, unsere Zeit nicht mit dämlichen Clickbaiting-Artikeln über die «Spaltung der Gesellschaft» zu verplempern. Geschätzte 4'000 Querulanten in lächerlichen Hemden spalten keine Gesellschaft.
Auch wenn Coca Cola, das «Playboy»-Magazin und die F/A-18-Bomber aus den USA nicht schlecht waren, sollten wir uns hüten, jetzt auch noch die medialen Bullshit-Schlagwörter vom westlichen Hegemon zu übernehmen.
-
16.12.2021 - Tag des Altruismus
Weltärztechef kritisiert: Impfstoff-Hersteller sollen weniger verdienen
Der Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, fordert, dass die Gewinne von Impfstoffherstellern begrenzt werden sollen.
Der Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery (69), spricht sich laut einem Medienbericht für die Begrenzung der Gewinne von Impfstoff-Herstellern aus.
Biontech habe 375 Millionen Euro vom deutschen Staat bekommen für die Entwicklung eines Impfstoffes, sagt Montgomery dem Sender RTL einer redaktionellen Fassung zufolge. Dann habe der Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gewinn von sieben Milliarden Euro ausgewiesen.
«Hier bin ich schon dafür, dass man die Gewinne mit staatlichen Massnahmen beschränkt oder aber das Geld nutzt, um damit Impfstoff zu kaufen für die armen Menschen in der Welt», sagte Montgomery. Schreibt Blick.
Lieber Doktor Frank-Ulrich Montgomery, der Sie Chefarzt des Weltärztebundes sind: Ihre hehre Kritik ist nobel und ehrt Sie. Allerdings sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass der Kommunismus gescheitert ist und selbst im kommunistischen China nur noch als Schimäre besteht. Rückt doch im Land des Lächelns unter Führung der KP China beinahe täglich ein neuer Milliardär in die «Hall of Fame» der Superreichen auf.
Sollten die globalen Pharmafirmen zu dem von Ihnen geforderten Altruismus staatlich gezwungen werden, gibt es für die von Ihnen vertretene Klientel der Ärzte quasi von einem Tag auf den anderen keine Pillen, Impfstoffe oder gar Chemotherapien mehr zur Behandlung von Patienten.
Ob das Ihre Kollegen schätzen würden, die an den Pharma-Produkten teilweise exorbitant mitverdienen, darf bezweifelt werden. Ganz abgesehen vom weltweiten Massensterben.
Von Doktor zu Doktor: Lieber Herr Montgomery, die Wirtschaft hat noch nie nach dem Mutter Theresa-Prinzip funktioniert. Und das wird sie auch nie.
-
15.12.2021 - Tag der Zofinger Cleverness im Umgang mit Zahlen
Finanzielle Punktlandung beim Entwässerungsplan für das Mühlethal
Der behördenverbindliche Generelle Entwässerungsplan (GEP) zeigt auf, wie das Abwasser abzuleiten ist und die Gewässer geschützt werden können.
In den vergangenen Jahren wurde der GEP des Zofinger Ortsteils Mühlethal aus dem Jahr 2002 mit der Erarbeitung des GEP der 2. Generation auf den neuesten Stand gebracht. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Zustandsprüfungen des Abwassernetzes zeigen, dass sich das öffentliche Abwassernetz dank der Investitionen der vergangenen Jahre grundsätzlich in einem guten Zustand befindet.
Nun liegt die Abrechnung für das Projekt mit budgetierten Bruttokosten von CHF 290'000 vor. Dabei zeigt sich eine Kreditunterschreitung von 1,7 Prozent oder knapp CHF 5'000. Der Kanton hat sich erwartungsgemäss an den GEP-Kosten mit CHF 41'000 beteiligt. Schreibt die Stadt Zofingen in ihrem Newsletter.
Während es die Stadt Luzern schafft, den Budgetrahmen für die Wahlkampagne «Autofreie Bahnhofstrasse» dermassen zu überziehen, dass die Kosten letztendlich unvorstellbare 1,6 Millionen Franken laut Luzerner SVP betragen, glänzt die Stadt Zofingen stets mit Kreditunterschreitungen. Wie macht sie das?
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder hat die Stadt Zofingen ein knallhartes Kostenmanagement oder sie kalkuliert von allem Anfang an zu hoch, so dass stets eine Kostenunterschreitung vermeldet werden kann. Beide Varianten sind clever und beruhigen die Gemüter der Steuerzahler*innen der Stadt Zofingen. Ausserdem hält man sich damit die aufmüpfige SVP vom Leibe.
-
14.12.2021 - Tag der Roadmap
Schweiz und China verabschieden Roadmap
Am 13. Dezember 2021 führte das SECO unter Leitung von Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit, einen tripartiten Dialog mit dem chinesischen Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit (MoHRSS) durch. Die tripartiten Delegationen tauschten sich per Videokonferenz aus und unterzeichneten eine Roadmap zur Vertiefung der Zusammenarbeit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen und diskutierten die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Die Schweiz drückte ihre tiefe Besorgnis über Berichte von Verletzungen der grundlegenden Rechte bei der Arbeit in Xinjiang aus.
Anlässlich des Treffens unterzeichneten Boris Zürcher und der chinesische Generaldirektor Hao Bin eine Roadmap zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, insbesondere zur Förderung der Sozialpartnerschaft und mehr und besseren Arbeitsplätzen im Rahmen der Digitalisierung der Arbeitswelt und Erholung von der Covid-19 Pandemie. Die Unterzeichnung stellt einen Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit dar, die auf einer Absichtserklärung von 2011 basiert.
Die Schweiz und China tauschten Erfahrungen im Bereich neuer Arbeitsformen und der wachsenden Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften aufgrund der Digitalisierung der Arbeitswelt aus. Die Schweiz drückte ihre Besorgnis über Berichte von willkürlichen Internierungen und Zwangsarbeit in Xinjiang aus und forderte China dazu auf, die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit als Mitgliedstaat der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu respektieren und die Kernübereinkommen Nr. 29 und 105 der IAO zur Zwangsarbeit zu ratifizieren. Die Vertreter der Schweizer Sozialpartner unterstützten diese Forderung und teilten ihre Bedenken. Schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in seiner Medienmitteilung.
Die «Roadmap» ist ein seit Anfang der 2000er Jahre auch im deutschen Sprachraum verbreiteter Anglizismus, der in manchen Milieus – insbesondere in Wirtschaft, Politik und Medien – gerne als Synonym für eine Strategie oder einen Projektplan verwendet wird. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet der Begriff wörtlich Strassenkarte. Im Rechtschreibduden ist er seit der Ausgabe 2004 aufgeführt. Schreibt Wikipedia.
Was will uns Wikipedia mit der Erklärung über die Bedeutung des Wortes «Roadmap» sagen? Wer keine Strategie hat, seinem Gegenüber aber den Pelz waschen will ohne ihn nass zu machen, nennt die angeblichen Leviten «Roadmap».
Es ist ja auch putzig, wenn die Schweiz im Kreise der hehren westlichen Wertegemeinschaft ihre «tiefe» Besorgnis über die eingesperrten Muslime*innen im Uiguren-Camp in Xinjiang gegenüber dem chinesischen Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit (MoHRSS) zum Ausdruck bringt.
Wetten, dass Boris Zürcher mit den Augen geblinzelt hat, während er seinem chinesischen Gegenüber die «Schweizer Besorgnis» – vermutlich in einem einzigen Satz – nebenbei erwähnte.
Wohlwissend, dass die Schweiz gemessen an der Einwohnerzahl nicht mal eine grössere Stadt in China repräsentieren würde, wird der chinesische Generaldirektor Hao Bin wohl verständnisvoll gelächelt haben.
Zurückblinzeln geht ja bei Chinesen nicht. Ein Ding der Unmöglichkeit mit asiatischen «Schlitzaugen», wie schon der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger in seiner «Schlitzaugen-Rede» im Jahr 2016 feststellte, für die er sich anschliessend auf Druck aus Peking gebührend entschuldigen musste.
Unabhängig von Einwohnerzahlen und «Schlitzaugen» weiss Hao Bin ganz genau, wer von wem abhängig ist und ohne chinesische Hilfe nicht mal einen PC starten kann, geschweige denn in der Lage ist, eine Kolumne beim Artillerie-Verein Zofingen digital zu veröffentlichen.
Dass die Bürgerinnen und Bürger der Weltmacht nicht mit den Augen blinzeln können, ist unter diesen Voraussetzungen vernachlässigbar. Alles klar? Ni Hao.

-
13.12.2021 - Tag der Superreichen und der Werftarbeiter
Luxus in der Pandemie: Markt für Superjachten verzeichnet Rekordzuwachs
Corona hat unter den Reichen die Sehnsucht nach luxuriösen Rückzugsorten befeuert. Und welches Domizil würde sich dafür besser eignen als eine Superjacht? Die Auftragsbücher bersten.
An den noblen Küstenabschnitten dieser Welt gibt es wohl kaum etwas Auffälligeres als Superjachten. Auftragszahlen, Preise und die Namen der Besitzer werden dagegen mit umso größerer Entschiedenheit verschwiegen. Gleichwohl gelangen immer wieder ein paar Daten an die Öffentlichkeit. Bislang zum Beispiel berichteten Brancheninsider immer wieder, dass die Coronapandemie die weltweite Nachfrage nach diesen schwimmenden Palästen regelrecht befeuert habe. Doch nur wenige können sich so recht vorstellen, wie so ein Boom aussieht, in einem Segment, das allenfalls für die oberen Zehntausend dieser Welt reserviert ist.
Jetzt liefern die Zahlen der neuesten Ausgabe des Global Order Book von »Boat International« aus der der »Guardian« zitiert, einen der wenigen konkreteren Einblicke. Danach erreichte die Zahl der Schiffe, die sich weltweit im Bau oder in Auftrag befinden, 2021 einen neuen Rekordstand: Insgesamt sind es mehr als 1200 Superjachten – ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
»Der Markt war noch nie so in Bewegung«, zitiert der »Guardian« Will Christie, der nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren wohlhabende Interessenten mit spezialisierten Werften zusammenbringt. »Viele Leute schätzen in Zeiten der Pandemie die zusätzliche Sicherheit auf einer Jacht fernab der Massen. Das Internet und die Technologien zum sicheren Austausch von Daten ermöglichen ihnen dabei, von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten.«
Inzwischen hat sich dem Bericht zufolge sogar ein reger Markt für Kapazitäten in den Werften entwickelt. Laut Christie seien die Auftragsbücher der Branche in der Regel bis 2025 voll – und die Nochreicheren (und Ungeduldigeren) würden hohe Prämien ausloben, um den Slot eines anderen zu übernehmen. Wie hoch der Preis ist, um den Stapellauf ein paar Jahre früher – die Lieferzeiten ziehen sich wegen der langen Bauzeiten recht lange hin – feiern zu können, darüber gibt es jedoch keine Angaben.
Der »Guardian« erwähnt allerdings auch die Kritiker des Trends. Denn Superjachten fressen Ressourcen in obszönem Ausmaß, beim Bau ebenso wie im täglichen Gebrauch. Selbst vor Anker und wenn der Eigner gar nicht an Bord ist, ist der Energieverbrauch enorm. »Es ist dekadent. Die Reichen haben keinen Vertrag mit den Verpflichtungen, die mit der kollektiven Verantwortung für das Schicksal des Planeten einhergehen«, sagte Peter Newell, Professor für internationale Beziehungen an der Sussex University. Schreibt DER SPIEGEL.
Geht's uns schlecht? Den Superreichen jedenfalls nicht.
Aber bevor wir alle jetzt vor Neid platzen: Die Werftarbeiter können wenigsten positiv in die Zukunft des neuen Jahres blicken.
-
11.12.2021 - Tag der üppigen Luzerner Bamten-Pensionen
BVG-Rente reiche nicht: Bundesrat hält an seinem Ruhegehalt fest
Die Bundesrätinnen und Bundesräte wollen nicht wie normale Arbeitnehmende in eine Pensionskasse einzahlen. Sie beharren darauf, nach Beendigung ihrer Regierungszeit ein Ruhegehalt von fast einer Viertelmillion abrufen zu können.
Die Mitglieder der Landesregierung möchten sich ihre heutigen Ruhestandsgehälter nicht nehmen lassen – und sich diese vor allem nicht selbst streichen.
Es gebe viele offene Fragen bei einer neuen Ruhestandsregelung für Bundesräte und andere gewählte Magistratspersonen, führt die Regierung als Grund dafür ins Feld, weshalb sie an der heutigen Regelung nicht rütteln will. Sie hat einen Bericht zur Ruhestandsregelung anfertigen lassen.
Spezialfall Bundesrat
Während Otto Normalbürger als Angestellte in eine Pensionskasse (BVG) einzahlen, ist das aus Sicht der Landesregierung für Bundesräte nicht für zumutbar. So könnten die Betroffenen nur ungenügend abgesichert werden. Die Amtsdauer von Magistratspersonen sei zu kurz, um das benötigte Kapital anzusparen, schrieb der Bundesrat am Freitag. Er befürchtet, eine BVG-Rente würde zu mager ausfallen.
Als Hintergrund: Bundesrätinnen und Bundesräte verdienen im Jahr 454'581 Franken (Stand 1. Januar 2021).
Heute erhalten Mitglieder der Landesregierung, Bundesrichterinnen und -richter sowie Bundeskanzler nach ihrem Rücktritt oder einer Abwahl keine ordentliche Rente. Stattdessen können sie ein Ruhegehalt beziehen. Dieses entspricht der Hälfte des Jahreslohns während der Amtszeit. Ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte erhalten also inzwischen rund 227'000 Franken im Jahr.
Lex Blocher
Auslöser für die Diskussion um Ruhegehälter für einstige Bundesräte war die Forderung des alt Bundesrats Christoph Blocher (81, SVP), sein Ruhegehalt rückwirkend doch noch zu bekommen. Der Milliardär hatte anfangs nach seiner Abwahl auf das Ruhegehalt verzichtet.
Der Bundesrat hatte Blocher das geforderte Geld – 2,7 Millionen Franken – zuerst einfach auszahlen wollen. Nach heftiger öffentlicher Kritik entschied die Regierung, Blocher «nur» 1,1 Millionen Franken zu zahlen. Die Bundesrats-Rente solle höchstens 5 Jahre zurück ausbezahlt werden.
Mit dem Bericht, den die Landesregierung ausarbeiten liess, befolgt sie auf einen Auftrag des Ständerats. Dieser hatte 2020 ein Postulat von Peter Hegglin (Mitte, ZG) unterstützt, das vom Bundesrat verlangt, Alternativen zum heutigen System aufzuzeigen. Schreibt Blick.
Wenn ein ehemaliger Luzerner Kantonsrat und Gesundheitsdirektor seit über 20 Jahren knapp 180'000 Franken Rente pro Jahr bezieht und ehemalige Stadtpräsidenten der Stadt Luzern über 200'000 Franken until the End of Life einkassieren, ist das Viertelmilliönchen pro Jahr für einen Bundesrat eher bescheiden bemessen.
-
10.12.2021 - Tag der österreichischen Kanzler-Utopien
Ist Herbert Kickl auf dem Weg zur Kanzlerschaft?
Man kann sich aktuell nur herzlich bei all jenen Politikerinnen und Politiker bedanken, die gerade dabei sind, sich selbst ihr im metaphorischen Sinne politisches Grab zu schaufeln und Wert darauf legen, dass sie alle anderen gleich mitnehmen. Vielen Dank an alle, die auf dem besten Wege sind, Herbert Kickl den Wahlsieg seines Lebens zu bescheren und es noch nicht einmal bemerken.
Ein Tipp am Rande: Da das böse Erwachen üblicherweise erst nach der Wahl eintritt, weil man die Masse an Menschen, die die Schnauze gestrichen voll hat, aus irgendeinem unverständlichen Grund zu übersehen präferiert, gratulieren Sie sich dann selbst im Spiegel, dass Sie mit Ihrer Politik höchstpersönlich Heinz-Christian Straches Nachfolger auf den Thron verholfen haben und es Ihnen egal war. Ob da die guten Neujahrswünsche etwas bringen, bleibt zu bezweifeln.
Die hohe Kunst des Führens
Führung ist eine Fähigkeit, die nicht jeder beherrscht. Persönlichkeiten, die diese besitzen, wissen, dass es äußerst unklug ist, sich auf Machtkämpfe einzulassen, bei denen beide Seiten sowohl voneinander abhängig sind als auch verlieren - eine Lose-lose-Situation sozusagen. Nur ein Narr wäre so einfältig sich auf so etwas einzulassen. Ein Schelm, wer Böses bei diesem Vergleich denkt. So verständlich die Reaktionen der hilflosen politischen Würdenträger derzeit sind, so einfach wäre die Lösung. Diese würde jedoch ein so großes Maß an Klugheit und Integrität verlangen, wie es in der aktuellen Regierung höchstens mit einer wohlwollenden Lupe zu finden ist. Der Mut einen Schritt zurück zu treten, die Menschen zu beruhigen und ihnen Angebote statt Strafen anzubieten, wäre ein probates Mittel, die Situation friedlich in den Griff zu bekommen.
Aber offensichtlich greifen die Damen und Herren Politiker nun auf jene Mittel zurück, die ihnen augenscheinlich selbst in ihrer Genese zuteilgeworden sind, in der nicht auf sie eingegangen wurde, sondern die eiserne Faust der Erziehung mit Worten, welche so ähnlich klingen wie “nur die Harten kommen in den Garten“, auf sie herab schmetterte ohne dass ihre Bedürfnisse oder Tränen etwas gezählt hätten. Sie alle haben die Kränkungen vergessen, die damit einhergegangen sind und ihnen bis heute in verschiedenen Bereichen Probleme bereiten. Da sie es selbst schließlich auch ausgehalten haben, kann es nun gar keinen anderen Weg geben. Sie sitzen mit Tunnelblick ohne Empathie in ihren Ämtern und können nicht glauben, dass andere Mittel besser und wirksamer wären. Sie können nicht wahrhaben, dass es möglicherweise an ihnen liegt und nicht an den Maßnahmen. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass das, wie sie regieren und unter anderem mit dem Virus umgehen, möglicherweise nur das Abarbeiten persönlicher, kindlicher Konflikte ist. Sie haben auf ihrem Lebensweg schlichtweg ihre Menschlichkeit eingebüßt und gelernt, wie man mit Machtgehabe und dergleichen an die Spitze kommt. Dabei könnte man das alles so viel leichter erreichen. Aber wenn nicht die Weihnachtszeit eine Zeit des aufeinander Zugehens ist, welche dann?
Kickl ante portas
Nein, es ist nicht Hannibal vor den Toren, obwohl so mancher Babyelefant in letzter Zeit gesichtet wurde, es ist der neue mehr oder weniger starke Mann der FPÖ, der dem Lager der Impfverweigerer eine Heimat bietet. Weder die SPÖ noch die liberalen Neos haben die Zeichen der Zeit erkannt und versucht, den Maßnahmenskeptikern eine Heimat zu bieten. Somit könnte es bei den nächsten Urnengängen heißen “The winner takes it all, The loser's standing small". Denn dreimal darf man raten, wohin die Stimmen der Frustrierten wandern werden. Sicher nicht in signifikanter Art zu ÖVP, Grünen, Neos oder SPÖ, denn sie alle blasen ins selbe Horn der Alternativlosigkeit. Einzig die MFG kann den Aufstieg des Bergsteigers noch leicht bremsen. “Mit einem Wisch ist alles weg“, so ein bekannter Werbespruch. Bauen wir diesen aus, kann man die kreative Linie der Regierung so subsummieren: “Mit einem Stich ist alles weg“. Okay, vielleicht mit zwei, drei oder mehr, aber so kleinlich wollen wir nicht sein.
Wenig Vertrauen in die Politik
Ein Studienfach der Medizin ist die Pathologie, welches sich mit toter Materie beschäftigt. So ist es wenig verwunderlich, dass angehende Ärzte über ein Mindestmaß an - nennen wir es resistenten Magen - verfügen müssen, um ihr Studium zu bewältigen. Da ist es wenig verwunderlich, dass derartige Erfahrungen auch abhärten können und eine Impfung relativ locker gesehen wird. Für manche das aber ein Eingriff in den intimsten Bereich des Menschen - nämlich den Körper. Wenn dieser nun noch dazu von Politikern verordnet wird, die durch ständige Wechsel an der Spitze nicht gerade über das höchste Vertrauen in der Bevölkerung verfügen, ist das Resultat der Abwehr nicht ganz unverständlich. Die Impfbereitschaft wird sich nicht nur auf physiologischer Ebene abspielen, sondern sie benötigt einen Gleichklang aus den Parametern Körper, Seele und Geist, um bei den Betroffenen etwas zu bewirken. Schreibt Daniel Witzeling in seiner Kolumne im STANDARD.
Daniel Witzeling: Der Name scheint Programm zu sein. Immerhin schreibt er seine Kolumne mit einem gewissen Wortwitz. Das war's denn aber auch schon.
Die Titelzeile, einzig und allein dem Clickbaiting geschuldet, hat er wohlweislich mit einem Fragezeichen ausgestattet. Dass Kickl niemals österreichischer Bundeskanzler wird, ist auch ihm bewusst und fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Weder ist Kickl ein Trump, auch wenn er die gleiche Klaviatur wie «The Donald» ziemlich gut beherrscht, noch ist Österreich die USA, wo «The winner takes it all, the loser's standing small» in der Verfassung verankert ist.
Die absolute Mehrheit bei Parlamentswahlen zu erreichen, ist durch das österreichische Parteiengefüge beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Angenommen, Kickl würde seine FPÖ zur stärksten Partei hochjazzen, würde ihn selbst dies noch lange nicht zum Kanzler befördern. Dazu bräuchte er einen Koalitionspartner und der ist (derzeit) nirgendwo sichtbar. Es sei denn, der dreifach zurückgetretene Ex-Kanzler Kurz kehrt in die Politik zurück. Der skrupellose Sebastian würde zur Not auch mit einem Besenstiel koalieren.
-
9.12.2021 - Tag der Phantomdiskussionen
Umfrage: Jeder Elfte würde alte Menschen vom Wahlrecht ausschliessen
Sollen alte Staatsbürger bei Wahlen über die Zukunft Österreichs entscheiden – während junge Menschen wegen ihres Alters oder wegen einer fremden Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen sind? Diese Frage ist nicht rein akademisch zu sehen, auch wenn sie von Rechtswissenschaftern sehr ernsthaft diskutiert wird: Bei einem Symposion der Universität Innsbruck rechnete kürzlich der Völkerrechtsprofessor Andreas Müller vor, dass die bei bundesweiten Wahlen übliche Wahlbeteiligung von 75 Prozent bedeutet, dass nur die Hälfte der Bevölkerung tatsächlich wählt.
Die Hälfte ist nicht repräsentiert
Die andere Hälfte ist demokratisch nicht repräsentiert – denn 1,5 Millionen Ausländer sowie Kinder und Jugendliche unter 16 dürfen in Österreich etwa bei Nationalratswahlen nicht wählen. Dabei hat Österreich einen im EU-Vergleich weit gefassten Zugang zum Wahlrecht – junge Menschen ab 16 sind sonst nur in Malta aktiv wahlberechtigt. Und es gibt auch nur wenige Einschränkungen, wenn etwa ein Gericht Schwerverbrechern temporär das Wahlrecht entzieht.
Politisch ist umstritten, ob Österreich nicht etwa Zuwanderern den Erwerb der Staatsbürgerschaft (und damit des Wahlrechts) erleichtern sollte. Die SPÖ hat dafür im Sommer einen Vorstoß gemacht – und DER STANDARD ließ im August bei 800 repräsentativ ausgewählten Wahlberechtigten (online und persönliche Interviews) erheben, ob diese Forderung mehrheitsfähig wäre.
Kurz gesagt: Sie ist es nicht.
69 Prozent der Befragten sagten bei einer Market-Umfrage im Sommer, dass der Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht erleichtert werden sollte. Auffallend ist, dass jüngere Befragte eher für Erleichterungen sind – und dass es unter den erklärten Grünen-Wählerinnen und -Wählern als einziger Gruppe eine Mehrheit für eine Erleichterung beim Wechsel der Staatsbürgerschaft gibt.
Einschränkung des aktiven Wahlrechts
Und wenn man weiter fragt, entdeckt man, dass viele Menschen, die in Österreich das Wahlrecht haben, dieses eher noch einschränken würden. Zwar meinen 82 Prozent, dass die derzeitige Regelung – alle Staatsbürger ab 16 dürfen wählen – insgesamt gut sei. Aber weitere Vorschläge einer Einschränkung begegnen dann doch gewissen Sympathien.
So erklärt jeder elfte Befragte, dass sehr alten Menschen das Wahlrecht entzogen werden sollte – unter den sehr jungen Befragten sind sogar mehr als 20 Prozent der Meinung, dass Senioren nicht wählen dürfen sollten.
Ein Entzug des Wahlrechts bei geistiger Behinderung erscheint jedem Dritten wünschenswert (diesem Vorschlag folgen vor allem Anhänger von FPÖ und ÖVP). Jeder vierte Befragte würde Menschen mit extremen politischen Haltungen von der Wahlurne fernhalten. Und rund die Hälfte würde Auslandsösterreichern das erst 1989 erstrittene Wahlrecht wieder entziehen.
"Das Verständnis, dass ein allgemeines gleiches Wahlrecht eben alle einschließt, auch die, die sich nicht auskennen oder die keine guten Staatsbürger sind, ist nicht bei allen verankert", stellt Market-Wahlforscher David Pfarrhofer fest. 14 Prozent sagen etwa, dass Steuerschuldner nicht wählen dürfen sollten, und gar 71 Prozent finden, Staatsverweigerer sollten kein Wahlrecht haben. "Dabei wird sich wohl niemand Gedanken darüber machen, wie man das eigentlich feststellen kann und wie viel Willkür hier Platz greifen könnte", sagt Pfarrhofer.
Klar gegen Ausländerwahlrecht
Eine klare Ablehnung gibt es für das Ausländerwahlrecht – und zwar auch für Unionsbürger. Dabei ist im Gemeinschaftsrecht bereits seit 1957 festgeschrieben, dass innerhalb der EU nicht wegen der Staatsbürgerschaft diskriminiert werden darf (Art 18 AEUV). Der Innsbrucker Europarechtsprofessor Werner Schroeder vertritt die Ansicht, dass Unionsbürger eben keine Ausländer sind und sich die EU-Staaten angesichts der erwünschten Freizügigkeit der europäischen Bürger von der althergebrachten Idee eines "Staatsvolks" verabschieden müssten. Allerdings gibt es dazu keine Rechtsprechung des EuGH.
Eine andere Idee der Ausweitung des Wahlrechts wurde immer wieder von (katholischen) Familienorganisationen vorgebracht – und vom neuen Wifo-Chef Gabriel Felbermayr im Gespräch mit der "Zeit" aktualisiert: Es geht um die Forderung, dass Eltern für ihre Kinder Stimmrechte bekommen sollten: Wer drei Kinder hat, bekäme dann drei zusätzliche Stimmen.
Auch diese Idee ließ DER STANDARD in der repräsentativen Umfrage vorlegen.
Knapp zwei Drittel lehnen sie ab. Wobei die schärfste Ablehnung aus der Gefolgschaft der ÖVP kommt – aber auch Befragte mit Kindern im Haushalt meinen mehrheitlich, dass Kinder in der demokratischen Willensbildung unberücksichtigt bleiben sollen. Schreibt DER STANDARD.
Den Alten das Stimmrecht zu entziehen, wird immer wieder diskutiert. Ist aber eine reine Phantomdiskussion. Selbst wenn eine entsprechende Abstimmung zustande käme, würde sie wohl in keiner einzigen westlichen Demokratie zum gewünschten Ziel führen.
Das würde die Bundes- oder Staats-Verfassung der einzelnen Länder definitiv verhindern. «Die Würde des Menschen ist unantastbar» steht so oder in ähnlicher Form in beinahe jeder Verfassung demokratischer Staaten als Präambel auf der ersten Seite.
Zumal für Verfassungsänderungen in jeder westlichen Demokratie Hürden aufgebaut sind. In der Schweiz zum Beispiel das «Ständemehr». Andere Staaten verlangen eine Zweidrittelmehrheit (Bundesrepublik Deutschland) oder eine entsprechende Wahlbeteiligung, die weit über 50 Prozent hinausgeht.
-
8.12.2021 - Tag der unbefleckten Empfängnis
Der Feiertag Mariä Empfängnis
In Sachen infantiler Volksverblödung bleiben sich die monotheistischen Religionen mit ihren Vorzeigegöttern, angefangen bei Jehova über Jesus Christus bis hin zu Allahu akbar, wirklich nichts schuldig.
Mariä Empfängnis ist ein christlicher Feiertag vor Weihnachten. Heute, am 8. Dezember 2021, feiern die Katholen weltweit die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter Maria. Es geht dabei nicht – wie von manchen angenommen – um die Empfängnis Jesu im Mutterleib Marias; Gefeiert wird die Empfängnis Marias im Körper ihrer Mutter Anna, wo sie ohne Erbsünde gezeugt wurde.
Ob es damals die künstliche Befruchtung schon gab, lässt die Bibel in weiser Voraussicht offen.
Was bedeutet unbefleckte Empfängnis – Der Versuch einer Erklärung (Video)
-
7.12.2021 - Tag der britischen Lifestyledrogen
Boris Johnson will Drogennutzern den Reisepass wegnehmen
Eine Million Menschen in Großbritannien haben einer von der britischen Regierung beauftragten Studie zufolge im vergangenen Jahr Kokain konsumiert, 300.000 nutzten regelmäßig Crack und andere Opiate. Fast acht Milliarden Pfund, also etwa 9,5 Milliarden Euro, werden in dem Land mit 67 Millionen Einwohner am Drogenschwarzmarkt Jahr für Jahr umgesetzt. Zu einem hohen Preis: Schätzungen zufolge wird der Konsum verbotener Drogen 2021 mehr als 4.500 Menschen das Leben kosten oder gekostet haben.
Für Boris Johnson, dem konservativen Regierungschef, sind diese Zahlen Grund genug zum Handeln. Er will nicht nur den illegalen Suchtmitteln samt Dealerinnen und Dealern den Krieg erklären, sondern auch den Konsumentinnen und Konsumenten. In seinem Zehnjahresplan, den er am Montag vorstellte, soll nun der Druck auf "Lifestyle-Konsumenten" erhöht werden – mittels zum Teil neuartiger Strafen.
Weil nach Ansicht der Regierung vor allem wohlhabende Nutzerinnen und Nutzer den Drogenhandel zum Florieren bringen, zielt Johnsons Maßnahmenkatalog besonders auf den sozialen Status von Verdächtigen ab. Der Premier verteidigte seinen Plan am Wochenende in einem Interview mit der Boulevardzeitung "Sun on Sunday": "Wir müssen uns neue Wege anschauen, wie wir sie (wohlhabende Drogenkonsumentinnen und -konsumenten, Anm.) bestrafen können. Es geht um Dinge, die sie tatsächlich in ihrem Leben stören."
Wie Fußball-Hooligans
Die Polizei kann demnach künftig die auf den Mobiltelefonen von geschnappten Dealerinnen und Dealern gespeicherten Kontakte heranziehen und die mutmaßliche Kundschaft – auch wiederholt – direkt vor Drogenmissbrauch warnen, wie es heißt. Wer beim Drogenkonsum erwischt wird, läuft zudem auch Gefahr, ähnlich wie amtsbekannte Fußball-Hooligans Reisepass oder Führerschein eine Zeit lang einzubüßen.
Darüber hinaus will die Regierung aber auch den Drogenbanden das Handwerk legen. Oftmals verfügten diese über ein regelrechtes Handelsnetz quer durch das Land, meist auf dem Rücken "verwundbarer" Jugendlicher, die von den Gangs als Drogenkuriere angeheuert werden. Auch die Behandlung von Drogensüchtigen soll forciert werden, in 50 Städten zwischen Dover und Belfast soll in Einrichtungen investiert werden, die sich der Entwöhnung von Abhängigkeit widmen.
Kritik
Die Opposition liest aus Johnsons Plan nicht allzu viel Gutes heraus. "Die Regierung macht viel zu viele Versprechen und scheitert dann an der Umsetzung", sagt Labour-Schatteninnenministerin Yvette Cooper. Niamh Eastwood, Direktorin des Londoner Thinktanks Release, der sich vor allem mit Drogenpolitik befasst, hält die Strategie der britischen Regierung für rückwärtsgewandt: "Der Fokus auf mehr Bestrafung ist nur eine Fortsetzung der alten Hardlinerpolitik, die wir schon seit Jahrzehnten in Großbritannien gehabt haben", sagte sie dem "Guardian". Während anderswo, neuerdings etwa in Deutschland, Cannabis legalisiert wird und in New York bald Konsumstuben eröffnet werden sollen, geht Großbritannien den umgekehrten Weg und "kopiert den Krieg gegen die Drogen eines Richard Nixon". Schreibt DER STANDARD.
Laut «World Drug Report 2019 der UNODC» aus dem Jahr 2019 liegt Grossbritannien nach den USA auf dem zweiten Platz der «Länderliste nach Kokainkonsum». Albanien ist inzwischen vom zweiten auf den dritten Platz abgerutscht. Die Schweiz tummelt irgendwo im Mittelfeld herum und Japan belegt zusammen mit Indonesien den letzten Platz.
Dass ausgerechnet Boris Johnson den Kampf gegen die «Lifestyledrogen» aufnehmen will, erstaunt und dürfte wohl eher eine Ankündigung sein, die wie so viele andere hehre Ankündigungen des britischen Premiers im Sand verlaufen.
Zumal sich etliche Leute beim Betrachten der Frisur von Johnson fragen, was der Typ wohl so alles raucht, schluckt oder snieft. Auch gewisse bizarre Reden von Boris Johnson lassen Schreckliches erahnen. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/johnson-rede-105.html
Zu den vorgesehen Massnahmen von Boris Johnson im Kampf gegen Windmühlen liegt es auf der Hand, wieder einmal den guten alten Bertolt Brecht aus der «Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens» zu zitieren: «Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein grosses Licht! Und mach dann noch 'nen zweiten Plan. Gehn' tun sie beide nicht.»
Wo Brecht recht hat, hat er recht.
-
6.12.2021 - Tag der Doktors der Rechtswissenschaften vom Herrliberg
Christoph Blocher: Überschätzte Infektionszahlen
Die Covid-Epidemie ist nicht besiegt. Die Impfung sorgt immerhin dafür, dass die meisten Menschen eine gewisse Zeit lang weniger gefährdet sind. Wir wissen auch, dass es eine dritte Impfung braucht.
Gegenwärtig steigen die Infektionszahlen wieder an. Doch diese Zahlen sind nicht entscheidend. Es ist nicht schlimm, wenn Menschen leicht erkranken und nachher dafür immun sind.
Nehmen wir zum Vergleich die Grippefälle: Man gibt doch nie bekannt, wie viele Menschen an Grippe erkrankt sind. Man weiss das auch gar nicht. Die Angesteckten liegen einige Tage im Bett, werden aber meist gar nicht registriert. Entscheidend sind nur die schwer verlaufenden Fälle oder gar die Grippetoten, wie sie 2015 gehäuft auftraten – ohne dass unsere Medien übrigens Alarm geschlagen hätten.
Wir müssen also auch bei Covid gar nicht wissen, wie viele sich angesteckt haben. Entscheidend ist, wie viele Fälle schwer verlaufen und wie viele Todesfälle wir haben. Vor allem aber auch: Welches sind die Kategorien dieser Todesfälle?
Nach meinen Informationen beträgt das Durchschnittsalter der Verstorbenen 89 Jahre. Das wäre ganz sicher nicht tiefer als der generelle Durchschnitt der Verstorbenen. Daneben achten wir natürlich darauf, dass wir uns nicht anstecken – genau wie bei der Grippe auch.
Es darf aber nicht sein, dass wir das öffentliche Leben von der Belegung der Spitalbetten abhängig machen. Dann muss man diese eben schaffen, unter Umständen auch vorübergehend und notfallmässig, wenn nötig mit Hilfe von Zivilschutz und Armee.
Wie ich höre, spricht man bei Konferenzen zwischen den Kantonen und dem Bund recht leichtfertig davon, das Leben wieder stillzulegen, weil man schliesslich das Personal in den Spitälern nicht habe. Hoffentlich hilft uns diese Pandemie wenigstens zu erkennen, wie wenig krisentauglich wir sind. Schreibt Christoph Blocher in der «Verlegerkolumne» seiner Gratiszeitungen.
Der alte Fuchs vom Herrliberg, Doktor der Rechtswissenschaften Christoph Blocher, sichert sich ab: «Nach meinen Informationen beträgt das Durchschnittsalter der (an Covid, Anmerkung) Verstorbenen 89 Jahre». Woher er diese Zahl hat, lässt er offen.
Wirklich verifizierbare Zahlen sind in der Tat kaum oder überhaupt nicht auffindbar. Spielt auch keine Rolle, selbst wenn 89 Jahre doch etwas hoch gegriffen zu sein scheint. Fakt ist und da muss man Blocher schon zustimmen, dass die überwiegende Mehrheit der Corona-Toten vermutlich weit über 70 Jahre alt war.
Ob sie allerdings «an» oder «mit» Corona gestorben sind, ist eine andere Frage, die derzeit in der Gesellschaft heftig und zu Recht diskutiert wird. Oder wie es Boris Palmer, deutscher Politiker der Grünen, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen und Enfant terrible etwas arg brutal und despektierlich formulierte: «Wir retten möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.»
To be honest bin auch ich dieser«Chum bring en hei»- Meinung, würde es aber eher mit einem buddhistischen Unterton und etwas höflicher ausdrücken: «Der Tod ist ein Spiegel, in dem sich der gesamte Sinn des Lebens widerspiegelt.» Oder wie im «Dhammapada», dem Meisterwerk der frühen buddhistischen Literatur, geschrieben steht: «Auch du wirst vergehen. Wenn du das weisst, wie kannst du dann streiten?» Was uns wohl sagen will, dass jeder Mensch irgendwann sterben wird und dass die Bekämpfung des Todes ab einem gewissen Alter nur noch einer längst überbordenden Gesundheitsindustrie und lächerlichen Länderstatistiken über die Lebenserwartung dient.
Ein bisschen mehr buddhistische Gelassenheit, verbunden mit der Akzeptanz unumstösslicher Naturgesetze, würde uns allen in Zeiten wie diesen gut tun. Auf den Doktor der Rechtswissenschaften vom Herrliberg darf man ruhig verzichten, auch wenn er für einmal mit seiner «Verlegerkolumne» nicht daneben liegt.
-
5.12.2021 - Tag des Balkanslangs
Volle Personenfreizügigkeit für Kroatien
Wie bereits Ende Oktober kommuniziert, kommen kroatische Arbeitskräfte ab dem 1. Januar 2022 in den Genuss der vollen Personenfreizügigkeit. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 3. Dezember 2021 die entsprechende Teilrevision der Verordnung über den freien Personenverkehr verabschiedet, welche die Einführung der vollen Freizügigkeit für Kroatien ermöglicht.
Das Protokoll III zum Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit der Europäischen Union sieht eine schritt- und etappenweise Öffnung des Zugangs von kroatischen Arbeitskräften und Dienstleistungserbringern aus Kroatien zum Schweizer Arbeitsmarkt vor.
Der Bundesrat hatte von der im Protokoll vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, ab dessen Inkrafttreten am 1. Januar 2017 für kroatische Staatsangehörige Einschränkungen wie Höchstzahlen für Bewilligungen oder eine vorgängige Prüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen beizubehalten.
An seiner Sitzung vom 1. Oktober 2021 hat der Bundesrat beschlossen, ab dem 1. Januar 2022 die uneingeschränkte Freizügigkeit für Kroatien einzuführen. Die Europäische Union wurde an der Sitzung des Gemischten Ausschusses Schweiz-EU vom 22. Oktober 2021 darüber in Kenntnis gesetzt. Kroatische Arbeitskräfte werden somit den Staatsangehörigen der übrigen EU/EFTA-Mitgliedstaaten gleichgestellt. An seiner Sitzung vom 3. Dezember 2021 hat der Bundesrat nun die dafür nötige Anpassung der entsprechenden Verordnung verabschiedet.
Sollte die Zuwanderung von kroatischen Arbeitskräften einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, kann sich die Schweiz auf eine Schutzklausel berufen und die Zahl der Bewilligungen für diese Personen ab dem 1. Januar 2023 und längstens bis Ende 2026 erneut begrenzen. Schreibt das Staatssekretariat für Migration in seiner Medienmitteilung.
Um wieder einmal Peter Scholl-Latour, leicht abgewandelt, zu zitieren: «Wer den halben Balkan aufnimmt, hilft nicht etwa dem Balkan, sondern wird selbst zum Balkan!»
Das ist in der Schweiz längst passiert. Es kommen ja nicht nur Menschen um zu bleiben. Sie bringen auch ihre Kultur mit. Das ist teilweise eine Bereicherung. Kann sich aber auch nachteilig auswirken.
Abgesehen vom Drogenhandel, religiöser Verblendung mit Allmachtsanspruch und der Kriminalstatistik ärgert mich vor allem die Dynamik der Sprachentwicklung in der Schweiz. Dass auch Sprache einer stetigen Wandlung unterliegt, ist mir klar. Ein natürlicher Prozess. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Ich finde die Originalsprache von Goethe heutzutage auch nicht mehr unbedingt sexy.
Dass sich die Schweizer Dialektsprachen aber ausgerechnet in diesen furchtbaren Balkanslang verändern, hauptsächlich geprägt von der albanischen Sprache der Unterschichten, geht mir wirklich gnadenlos auf den Wecker.
Wie auch die Tatsache, dass Hunderttausende registrierte und nicht registrierte, in der Schweiz ansässige Personen auf Jobsuche sind. Braucht es wirklich die Manpower aus dem Balkan, um die Schweizer Billigjobs zu besetzen, um die es vermutlich geht?
-
3.12.2021 - Tag der Luzerner Jungliberalen
Weiteres Giesskannenpaket zugunsten der einheimischen Medien: Bundesrat und Parlament empfehlen ein Ja
Die Bevölkerung informiert sich via lokale Medien über das aktuelle Geschehen in der Region und in der Schweiz. Weil die Werbegelder aber verstärkt zu den internationalen Internetplattformen abfliessen, sind viele einheimische Zeitungen verschwunden. Auch anderen Medien macht dies zu schaffen.
Bundesrat und Parlament wollen sie daher mit einem Massnahmenpaket stärken. «Die Vorlage sorgt dafür, dass unsere Bevölkerung auch in Zukunft in allen Landesteilen von einer vielfältigen Berichterstattung profitiert», sagte UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga bei der Erläuterung der Haltung von Bundesrat und Parlament. Das Massnahmenpaket zugunsten der Medien kommt am 13. Februar 2022 zur Abstimmung.
Damit die Bevölkerung weiss, was in ihrer Region und in der Schweiz geschieht, braucht es lokale Zeitungen, Lokalradios, Regionalfernsehen und einheimische Online-Medien, die darüber informieren. Sie decken Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport ab. Sie tragen mit ihren Berichten auch zur politischen Meinungsbildung und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Trotz ihrer Bedeutung sind die lokalen und regionalen Medien finanziell aber unter Druck geraten: Werbegelder fliessen verstärkt zu den grossen internationalen Internetplattformen ab. Das schwächt die Berichterstattung über das Geschehen vor Ort.
Darum wollen Bundesrat und Parlament die lokalen und regionalen Medien stärken. Dabei setzen sie auf bewährte Instrumente wie die Zustellermässigung für abonnierte Tages- und Wochenzeitungen sowie für Vereins- und Verbandszeitschriften. Der Bund vergünstigt schon heute deren Zustellung, indem er einen Teil dieser Kosten übernimmt. Die einheimischen Verlage können so mehr Geld in die redaktionelle Arbeit investieren.
Die Zustellermässigung wird mit dem Massnahmenpaket erhöht und auf mehr Zeitungen ausgedehnt, neu wird auch die Frühzustellung gefördert. Denn wer eine Zeitung abonniert hat, liest diese gern früh am Morgen. Zudem wird die Unterstützung für private Lokalradios und das Regionalfernsehen erhöht, und es kommt eine Förderung von einheimischen Online-Medien dazu. Die Massnahmen sind so ausgestaltet, dass kleine und mittlere Zeitungen und Online-Medien stärker profitieren (Degression). So wird die Berichterstattung in ländlichen Regionen und kleineren Städten gestärkt.
Die für das Massnahmenpaket maximal vorgesehenen Mittel von 151 Millionen Franken pro Jahr werden aus bestehenden Einnahmen sowie aus dem Bundeshaushalt finanziert. Es fallen keine neuen Abgaben an. Die Zustellermässigungen sowie die Unterstützung für die einheimischen Online-Medien sind zudem befristet, sie fallen nach sieben Jahren weg.
Gegen das Massnahmenpaket wurde das Referendum ergriffen. Das Referendumskomitee sieht darin eine Verschleuderung von Steuergeldern, welche die Verlage nicht bräuchten. Auch den kleinen Verlagen gehe es gut. Es sei schädlich, private Medien durch staatliche Gelder zu unterstützen. Damit verlören sie ihre Glaubwürdigkeit.
Stärkung der lokalen und regionalen Medien
Bundesrat und Parlament empfehlen, dem Massnahmenpaket zuzustimmen. «Die Vorlage sorgt dafür, dass die Bevölkerung auch in Zukunft in allen Landesteilen und Sprachregionen von einer vielfältigen Berichterstattung profitiert und regionale Zeitungen und Lokalradios hat, die über das Geschehen vor Ort berichten», sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga heute in Bern. «Wenn es in einer Region keine Zeitung oder kein Radio mehr gibt, fehlen wichtige Informationen.» Grosse internationale Internetplattformen berichten nicht darüber, was in den Regionen passiert. Und sie müssen sich nicht an journalistische Standards halten. «Umso wichtiger sind die lokalen und regionalen Medien. Mit der Vorlage werden sie gestärkt.»
Breite Unterstützung
Das Massnahmenpaket zugunsten der einheimischen Medien wird breit unterstützt. Für ein Ja engagieren sich beispielsweise die Medienverbände aus allen Landesteilen (Verband Schweizer Medien, Médias Suisse, Stampa Svizzera, Verband Schweizer Privatradios, Telesuisse, Radios Régionales Romandes, Verband Medien mit Zukunft), Aus- und Weiterbildungsinstitutionen (Journalistenschule MAZ, Centre de formation au journalisme et aux médias) sowie die Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB). Schreibt das Bundesamt für Kommunikation BAKOM in seiner Medienmitteilung.
Dass die mediengeilen Parlamentarier*innen inklusive Bundesrat der neuerlichen Giesskannen-Massnahme von 151 Millionen Schweizer Franken (in Worten: hundertundeinundfünzig Millionen) zustimmen, war zu erwarten. Es verwundert auch nicht, dass selbst die Apologeten der neoliberalen Parteifraktionen ihr Evangelium des Marktes, der alles regelt, über Bord werfen.
Da wird eine Branche mit Millionenbeiträgen künstlich beatmet, die längst im Koma liegt und dem Untergang geweiht ist. Steuergelder werden für unsägliche Medienbeiträge wie «Charlène und Albert sollen unter 700 Jahre altem Monaco-Fluch leiden» verschwendet, die wirklich niemand braucht, rein gar nichts mit journalistischen Standards zu tun haben und schon gar nicht mit der vorgeheuchelten regionalen Berichterstattung, dennoch aber bei 20Minuten auf der heutigen Frontseite zu finden sind.
So viel parlamentarische Zuwendung geniesst die AHV nicht, der angeblich eine Milliarde fehlen soll. Zur Sanierung der fehlenden Milliarde fällt den «Volchs»-Vertretern*innen nichts anderes ein, als das Eintrittsalter in die ordentliche Pensionierung von Jahr zu Jahr höher zu schrauben (Vorschlag der Luzerner Jungliberalen FDP). Da funktioniert der neoliberale Glaubenssatz vom alles regulierenden Markt auf einmal wieder.
-
29.11.2021 - Tag der FDP-Ankündigungsministerin Keller-Sutter
Schweiz und Côte d’Ivoire unterzeichnen drei Abkommen im Migrationsbereich
Bundesrätin Keller-Sutter hat am Donnerstag, 25. November 2021, anlässlich des offiziellen Besuchs des Innen- und Sicherheitsministers der Republik Côte d’Ivoire, Vagondo Diomandé, in Bern drei Abkommen im Migrationsbereich unterzeichnet. Die Abkommen ermöglichen es der Schweiz und Côte d’Ivoire, ihre Zusammenarbeit bei der Steuerung der Migration, insbesondere bei der Bekämpfung der irregulären Migration, im Interesse beider Parteien zu verstärken.
Die von der Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Karin Keller-Sutter, anlässlich des Besuchs des ivorischen Innen- und Sicherheitsministers Vagondo Diomandé unterzeichneten Abkommen waren vom Bundesrat am 17. September 2021 genehmigt worden. Insbesondere handelt es sich dabei um eine Absichtserklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Côte d’Ivoire im Migrationsbereich.
Die Elfenbeinküste spielt in Westafrika sowohl als Herkunfts- und Transit- als auch als Zielland eine wichtige Rolle im Migrationsbereich. Um zur Bewältigung der Migrationsherausforderungen in Côte d’Ivoire und in der Region beizutragen, will das Staatssekretariat für Migration (SEM) die ivorischen Behörden verstärkt bei der Steuerung der Migration unterstützen – auch indem es konkrete Projekte vor Ort umsetzt, beispielsweise bei der Bekämpfung des Menschenhandels.
Die Zahl der Asylgesuche ivorischer Staatsangehöriger in der Schweiz ist seit mehreren Jahren niedrig (140 im Jahr 2020), in anderen europäischen Ländern jedoch hoch.
Zusammenarbeit im Rückübernahmebereich
Das zweite unterzeichnete Abkommen ist ein Memorandum of Understanding, das die Verfahren zur Identifizierung und Rückübernahme irregulär in der Schweiz aufhältiger ivorischer Migrantinnen und Migranten regelt. Es soll die Zusammenarbeit mit Côte d’Ivoire, die auf operativer Ebene im Allgemeinen gut funktioniert, formalisieren. Ziel ist es, die praktische Organisation der Rückkehr, namentlich die Identifizierungsmodalitäten und die Ausstellung von Ersatzdokumenten, zu erleichtern. Die Schweiz hat bis heute mit insgesamt 64 Ländern Abkommen zum Rückkehrbereich abgeschlossen.
Das dritte Abkommen schliesslich sieht die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht für Inhaberinnen und Inhaber eines Diplomaten- oder Dienstpasses vor. Schreibt das Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD in seiner Medienmitteilung.
Die Ankündigungsministerin Keller-Sutter (FDP) vom EJPD feiert sich einmal mehr mit einem «erfolgreichen Migrationsabkommen» ab. Doch die Selbstbeweihräucherung der unseligen Lachnummer-Tante aus dem Bundeshaus wäre nicht vollständig ohne ein Keystone-Hollywood-Bildli zusammen mit dem Innen- und Sicherheitsminister der Republik Côte d’Ivoire, Vagondo Diomandé.
Wie wäre es, wenn Madame endlich ein vernünftiges Abkommen mit Eritrea abschliessen würde, dessen Bevölkerung immer noch Monat für Monat die drittgrösste Gruppe der Asylsuchenden in der Schweiz stellt?
Oder wie wäre es damit, das von der selbstverliebten und stets etwas zu auffällig geschminkten FDP-Ministerin abgeschlossene und entsprechend auch abgefeierte Abkommen vom Frühjahr dieses Jahres mit Algerien durchzusetzen? Von den inzwischen über 600 abschiebepflichtigen Algeriern wurde bisher keiner abgeschoben. Dafür fallen sie umso stärker in der Schweizer Kriminalstatistik auf. Und Monat für Monat als zweit- oder drittstärkste Gruppe der Asylsuchenden in der Schweiz.
-
28.11.2021 - Tag des markanten Anstiegs der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen
In der Genferseeregion waren 2019 erstmals über eine Million Beschäftigte tätig
Die Schweiz verzeichnete 2019 rund 5,3 Millionen Beschäftigte, was gegenüber 2018 einer Zunahme von 1,3% entspricht. In der Genferseeregion wurde erstmals mehr als eine Million gezählt, womit sie sich direkt hinter dem Espace Mittelland und Zürich einreiht. Zwischen 2011 und 2019 wurde innerhalb der Schweizer Wirtschaft knapp eine halbe Million neuer Arbeitsplätze geschaffen. Haupttreiber dieser Entwicklung war der tertiäre Sektor, in dem die Zahl der Beschäftigten um mehr als 450'000 anstieg. Soweit die jüngsten Ergebnisse der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) des Bundesamtes für Statistik (BFS).
Wie die jüngsten Ergebnisse des Referenzjahrs 2019 zeigen, setzt sich die Tertiärisierung der Wirtschaft fort. Im Zeitraum 2011–2019 stieg die Zahl der Beschäftigten im Dienstleistungssektor um durchschnittlich 50'000 pro Jahr an. Umgekehrt gingen im Primärsektor durchschnittlich 1500 Arbeitsplätze pro Jahr verloren. Die STATENT liefert seit 2011 wichtige Informationen zur Struktur der Schweizer Wirtschaft.
Im Zuge der Veröffentlichung der STATENT 2019 wurden die Ergebnisse der Zeitreihe 2011–2018 auf der Grundlage neuer Informationen revidiert. Betroffen waren insbesondere die Zahlen der Zeitspanne 2011–2014, für die die Anzahl Unternehmen nach unten korrigiert wurde.
100'000 Beschäftigte mehr in der Genferseeregion
Zwischen 2011 und 2019 nahm die Gesamtzahl der Beschäftigten in allen Grossregionen zu. Das stärkste Wachstum wurde in der Genferseeregion und in Zürich mit je über 100'000 zusätzlichen Beschäftigten verbucht. Die Genferseeregion schloss damit 2019 zu den Grossregionen mit mehr als einer Million Beschäftigten auf, namentlich zum Espace Mittelland und Zürich. Nahezu sechs von zehn Beschäftigten arbeiten in diesen drei Grossregionen.
Der Beschäftigungsanstieg ist in allen Kantonen zu beobachten. Die stärksten Zunahmen verzeichneten Zug (+14,3% Beschäftigte), Waadt (+13,3%), Genf (+12,2%) und Freiburg (+12,2%), die allesamt deutlich über dem Schweizer Durchschnitt liegen (+8,6%).
Markanter Anstieg im Gesundheits- und Sozialwesen
Die Beschäftigung entwickelte sich auf Ebene der Wirtschaftszweige unterschiedlich, auch im tertiären Sektor. Einige Dienstleistungsbranchen verbuchten zwischen 2011 und 2019 ein konstantes Wachstum und trieben die Tertiärisierung der Schweizer Wirtschaft weiter voran. Andere Wirtschaftszweige des tertiären Sektors registrierten dagegen ein Minus.
Am dynamischsten waren zwischen 2011 und 2019 das Gesundheitswesen mit einer Zunahme von nahezu 85'000 Beschäftigten (+24,7%), das Sozialwesen mit knapp 60'000 zusätzlichen Beschäftigten (+23,8%) und die öffentliche Verwaltung mit einem Plus von 47'827 (+12,3%). Umgekehrt war die Beschäftigung im Detailhandel und bei den Post-, Kurier- und Expressdiensten rückläufig (–12 000 bzw. –3,3% und –8183 bzw. –15,1%).
Immer mehr Unternehmen mit weniger als drei Beschäftigten
Zwei Drittel der Unternehmen in der Schweiz beschäftigen weniger als drei Personen. Zwischen 2011 und 2019 stieg die Zahl dieser Kleinstunternehmen von 348'000 auf nahezu 400'000 an (+14,9%), womit sich ihre Bedeutung für die Schweizer Wirtschaft weiter erhöht (+2,7 Prozentpunkte). Umgekehrt sind Unternehmen mit drei bis 49 Beschäftigten anteilsmässig weniger stark vertreten. Die Zahl der Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten blieb über die gesamte Zeitspanne stabil.
Grossunternehmen (mit 250 oder mehr Beschäftigten) vereinen die meisten Arbeitsstellen auf sich (37,7%). Ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung nahm zwischen 2011 und 2019 tendenziell zu (+1,1 Prozentpunkte). Der Anteil Beschäftigter in Unternehmen mit weniger als drei Beschäftigten blieb dagegen relativ stabil (+0,2 Prozentpunkte).
In der Schweizer Wirtschaft sind folglich zwei Trends auszumachen: Zum einen verfügt sie über relativ wenige Grossunternehmen, die aber stetig wachsen, und zum anderen über eine zunehmende Zahl an Kleinunternehmen, deren Grösse sich laufend verringert. Schreibt das Bundesamt für Statistik BFS in seiner Medienmitteilung.
Der markante Anstieg der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen ist nicht nur Anlass zur Freude. Im Gegenteil: Wir sollten uns Sorgen machen. Denn die beiden überbordenden «Wirtschaftszweige» Gesundheit & Soziales werden fast ausschliesslich direkt aus den Portemonnaies der Schweizer Bevölkerung bezahlt.
Wundern Sie sich also nicht mehr über die stetig steigenden Krankenkassenprämien. Denken Sie eher einmal darüber nach, was hier falsch läuft und was Sie vielleicht selber zu dieser kaum mehr zu beherrschenden Situation beitragen.
-
27.11.2021 - Tag der kriminellen Katholen
Betrug, Urkundenfälschung und Veruntreuung: Ehemaliger Pfarrer angeklagt
Die Staatsanwaltschaft Luzern hat die Untersuchung gegen einen 51-jährigen Schweizer abgeschlossen. Dem ehemaligen Pfarrer wird vorgeworfen, dass er von Privatpersonen arglistig Darlehen im Betrag von ca. 3.2 Millionen Franken bezogen hat und diese nicht zurückbezahlte. Zudem soll er unrechtmässig Geld von den Konten der Pfarrei für private Zwecke verwendet haben.
Die Staatsanwaltschaft hat den Beschuldigten beim Kriminalgericht des Kantons Luzern angeklagt. Sie fordert für ihn u.a. eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Durch das Verhalten des Beschuldigten wurden die Geschädigten im Zeitraum von 2009 bis 2018 arglistig getäuscht, da ihnen die Überprüfung seiner finanziellen Lage nicht möglich war. Der Verwendungszweck der Gelder konnte nicht überprüft werden. Gemäss Anklage nutzte er das ihm entgegengebrachte Vertrauen in seiner Stellung als Pfarrer bewusst aus.
Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage an das Kriminalgericht des Kantons Luzern überwiesen. Sie fordert für den Beschuldigten, welcher geständig ist, eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Zudem habe sich der Beschuldigte einer fachärztlichen Behandlung wegen Spielsucht zu unterziehen. Der Mann wird wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher Veruntreuung angeklagt. Bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Ein Verhandlungstermin ist noch nicht terminiert. Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung.
Hochwürgen! Als gläubiger Atheist bin ich schon etwas schockomatisiert über Ihr Tun und Handeln. Das sind doch alles vor den Augen Ihres Herrn verbotene Vergehen. Jedenfalls laut meinen spärlichen Bibel-Kenntnissen. Nur gut, dass die Absolution Ihrer Sünden durch eine Beichte in einer katholischen Pfarrkirche vor der Luzerner Staatsanwalt nicht Stand hält.
Warum nur, Hochwürgen, sind Sie nicht Politiker geworden? Da sind Delikte wie Raubzüge durch fremde Portemonnaies und Selbstbereicherung, für die Sie nun angeklagt sind, an der Tagesordnung. Peanuts, die kaum geahndet werden, teilweise sogar legal sind.
Zumal Sie seit der «Heirat für alle» Ihren Ministranten heiraten könnten, was Ihnen als hochwürgiger Pfarrer der Katholen verweht bleibt.
-
26.11.2021 - Tag der Freiheit für Betrüger
Nach Schaffhausen ermitteln bereits fünf weitere Kantone: Zertifikatsbetrug weitet sich aus!
Der Zertifikatsbetrug in Schaffhausen ist womöglich kein Einzelfall. Inzwischen gibt es auch in fünf weiteren Kantonen Verdachtsmomente, die missbräuchlich Covid-Zertifikate für Impfgegner ausgestellt haben könnten.
Das Kantonale Impfzentrum (KIZ) von Schaffhausen wird von einem Skandal erschüttert. Ein 20-jähriger Kantonsangestellter dürfte für Impfgegner gegen Bezahlung Hunderte gefälschte Zertifikate ausgestellt haben. Inzwischen sitzt der Hauptverdächtige mit zwei Komplizen in U-Haft. Gegen drei weitere Personen wird ermittelt (Blick berichtete).
Wie gut sind Covid-Zertifikate gegen Missbrauch geschützt? «Das Covid-Zertifikat ist technisch fälschungssicher. Ein Missbrauch aufgrund krimineller Absichten kann aber nicht ausgeschlossen werden», sagt Sonja Uhlmann, Sprecherin beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT), zu Blick.
Kantonsangestellte können das System austricksen
Die entscheidende Schwachstelle bleibt der Faktor Mensch. Wenn jemand das System aus der Amtsstube heraus mit missbräuchlichen Daten füttert, ist das kaum zu verhindern. Denn Zertifikatskäufer können von den zur Ausstellung legitimierten Kantonsangestellten vermeintlich «echte» Zertifikate mit gültigen QR-Codes erhalten. «Daher werden sie sowohl in Papierform als auch in der App als echt erkannt», so Uhlmann.
Das ist nicht nur in Schaffhausen ein Problem. Bei Blick melden inzwischen weitere Kantone entsprechende Verdachtsmomente. Etwa der Aargau: «Das Departement Gesundheit und Soziales hat bisher eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Fälschung von Covid-Zertifikaten eingereicht. Aus ermittlungstaktischen Gründen nennen wir keine Details zu den näheren Umständen», heisst es auf Anfrage im Departement von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Ein Vier-Augen-Prinzip sei aus «Kapazitätsgründen» nicht umsetzbar.
Die Verdachtsmomente häufen sich
Auch im Wallis wird ermittelt: «Bisher wurden zwei Anzeigen eingereicht, die sich jedoch auf Fälle beschränken, die in ihrem Ausmass begrenzt sind. Die Kontrollprozesse werden aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben», teilt das kantonale Gesundheitsamt mit.
In Basel-Land führt die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen eine beschuldigte Person, die Covid-Zertifikate gefälscht haben könnte. Weitere Angaben seien wegen der laufenden Untersuchung nicht möglich.
Alarmierende Signale kommen auch aus dem Nachbarkanton: «Wir haben kürzlich einen Hinweis auf einen Verdachtsfall im Impfzentrum erhalten und sind noch in Abklärungen», vermeldet Basel-Stadt. Im Thurgau könnte derweil eine zur Ausstellung berechtigte Person ebenfalls mindestens ein Zertifikat gefälscht haben. «Dies nehmen wir sehr ernst und gehen dem Hinweis nach», so das dortige Amt für Gesundheit.
«Ein Zertifikat kostet rund 800 Franken!»
Die Nachfrage auf dem Schwarzmarkt ist seit Einführung des 3G-Prinzips gross. Im Impfzentrum von Buchs SG könne man sich via Telegram oder Whatsapp bei einer Person melden, die direkt beim Impfzentrum arbeite, erzählt etwa Thomas S.*. Ein Freund von ihm habe ein gefälschtes Zertifikat bezogen. «Ein Zertifikat kostet rund 800 Franken.» Bezahlt werde via Bitcoin, um Anonymität zu gewährleisten.
Damit der Betrug nicht auffalle, würden die entsprechenden Impfdosen vernichtet. «Die ganze Kette wirkt bandenmässig organisiert», sagt S. Brisant: Der Kanton St. Gallen liess entsprechende Nachfragen zur Meldung bisher unbeantwortet.
Betrüger müssen mit empfindlichen Strafen rechnen
Klar ist: Das Ausstellen oder der Erwerb von Fake-Zertifikaten ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. «Wenn sich jemand der Urkundenfälschung schuldig macht, drohen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren und Geldstrafen», sagt Strafrechtsexpertin Sine Selman. Bei Kantonsangestellten, die gezielt in die eigene Tasche wirtschaften, steht auch Betrug im Raum. * Name geändert.Schreibt Blick.
Ohne Nachfrage der Impfverweigerer*innen kein Angebot. So einfach ist das!
Man darf sich schon langsam fragen, was das für Menschen sind. Die meisten von ihnen verweigern ohne nachvollziehbare Gründe die Impfung gegen das Coronavirus. Dafür poltern sie an ihren Demonstrationen mit Trychlen bewaffnet durch die Städte, keuchen das Wort «Freiheit» vor sich hin und bedienen sich ungeniert gefälschter Covid-Zertifikate.
Parasiten, die ohne persönlichen Beitrag von den Vorteilen des Impf-Zertifikats profitieren wollen. With a little Help von kriminellen Banden, die es ohne die Nachfrage nach Fake-Zertifikaten gar nicht geben würde. Der viel zitierte Markt regelt letztendlich auch Angebot und Nachfrage krimineller Produkte und Dienstleistungen.
Ist das die «Freiheit» für die sie auf die Strasse gehen? Freiheit für Betrüger? Sind diese esoterisch angehauchten Weltverschwörer*innen tatsächlich die hehren und über alle Zweifel erhabenen Ur-Eidgenossen, die von den SVP-Granden Blocher und Maurer und deren Fussvolk als Leuchttürme der Freiheit verhätschelt werden?
-
25.11.2021 - Tag der Ergänzungsleistungen
Bundesrat lehnt die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente ab
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 24. November 2021 beschlossen, dem Parlament die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» zur Ablehnung zu empfehlen. Die Finanzierung der Mehrkosten einer 13. AHV-Rente ist nicht sichergestellt. Zudem würden Bezügerinnen und Bezüger einer IV-Rente benachteiligt. Der Bundesrat will die laufenden Reformen zur Altersvorsorge prioritär behandeln. Diese sollen das Leistungsniveau der AHV und der obligatorischen beruflichen Vorsorge erhalten und das finanzielle Gleichgewicht der ersten und zweiten Säule sichern.
Die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» verlangt für Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente einen Anspruch auf einen jährlichen Zuschlag in Höhe eines Zwölftels der Jahresrente. Dieser Zuschlag soll weder zu einer Reduktion der Ergänzungsleistungen noch zum Verlust des Anspruchs auf diese Leistungen führen.
Der Bundesrat erachtet eine 13. AHV-Altersrente als nicht zielführend und mit der finanziellen Lage der AHV nicht kompatibel. Er findet es zudem nicht kohärent, für die Alters-, Hinterlassenen- und IV-Renten unterschiedliche Ansätze festzulegen. Dies würde zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung führen. Vor allem aber würde die 13. AHV-Altersrente die finanzielle Lage der AHV wesentlich verschlechtern und einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf im Ausmass von rund 4 Milliarden Franken pro Jahr, bis 2030 sogar von 4,7 Milliarden Franken jährlich auslösen. Er schlägt deshalb dem Parlament vor, die Initiative dem Volk zur Ablehnung zu empfehlen.
Laufende Reformen in der Altersvorsorge
Mit der Vorlage des Bundesrats zur Stabilisierung der AHV (AHV 21), die aktuell im Parlament beraten wird, soll die Finanzierung der AHV und die Erhaltung des Leistungsniveaus bis 2030 gesichert werden. Unter anderem sollen die Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand gewährleistet, das Rentenalter für Männer und Frauen bei 65 Jahren harmonisiert und Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration getroffen werden. Der Bundesrat wurde vom Parlament bereits beauftragt, bis Ende 2026 eine Vorlage der Stabilisierung der AHV für die Zeit von 2030 bis 2040 zu unterbreiten.
Das Eidgenössische Departement des Innern wird dem Bundesrat bis Ende Mai 2022 einen Botschaftsentwurf zur Ablehnung der Volksinitiative unterbreiten. Schreibt das Eidgenössische Departement des Innern EDI.
Ein Jahr hat, sofern ich mich nicht irre, 12 Monate und nicht 13. Die Haltung des Bundesrats ist somit nicht nur absolut verständlich, sondern auch gerechtfertigt. Oder wollen die Verfechter*innen der 13. AHV-Rente durch die anfallenden Kosten den Renteneintritt auf 90 Jahre hochschrauben? Das kann ja wohl kaum sein.
Zumal Menschen in der Schweiz gesetzlich verankerte Ergänzungsleistungen beziehen können, falls die AHV nicht ausreicht.
-
24.11.2021 - Tag der Lachnummern vom Schweizer Gastroverband
Steigende Fallzahlen, zwei Monate Zertifikatspflicht, kostenpflichtige Corona-Tests: So geht es den Schweizer Beizen im Corona-Herbst
Seit gut zwei Monaten kontrollieren die Beizen im Land fleissig Corona-Zertifikate und IDs. Der Branchenverband Gastrosuisse warnte eindringlich vor Umsatzeinbussen. Eine Blick-Datenauswertung zeigt nun, wie es wirklich um die Beizen steht.
Montagmorgen, 8 Uhr, am Bahnhof in Frauenfeld TG. Kaffee und Gipfeli gibt es hier für gut fünf Franken. Wer den Zmorge in der Bäckerei statt im Zug geniessen will, durchläuft das immer gleiche Spiel: Handy raus, QR-Code öffnen, ID bereithalten.
Seit gut zwei Monaten ist das Corona-Zertifikat in der Gastronomie Pflicht. Die Schweizer Beizerinnen und Beizer wehklagten laut, als die Pflicht am 13. September eingeführt wurde. Noch lauter dann, als die Corona-Tests am 11. Oktober kostenpflichtig wurden.
Gleich viel Umsatz wie vor Zertifikatspflicht
Casimir Platzer, Präsident des Branchenverbandes Gastrosuisse, warnte vor Umsatzeinbussen von bis zu 50 Prozent. Es kam nicht ganz so arg: Gastrosuisse selber krebste wenig später von seinem Schreckensszenario zurück. Gemäss einer Umfrage vom Oktober erlitten die Gastronomen seit Einführung der Zertifikatspflicht Umsatzeinbussen von durchschnittlich 28 Prozent.
Eine Blick-Auswertung der Umsatzzahlen in der Gastronomie zeigt nun: Aktuell werden in den Schweizer Beizen jeden Tag gut 14 Millionen Franken ausgegeben. Das ist gleich viel wie Mitte August, vor Einführung der Zertifikatspflicht. Die Zahlen stammen vom HSG-Projekt Monitoring Consumption Switzerland. Dieses misst sämtliche Kartenzahlungen in den Schweizer Restaurants.
Nach dem 13. September gab es zwar einen Einbruch. Ebenso, wenn auch auf tieferem Niveau, als die Tests am 11. Oktober kostenpflichtig wurden. Die Umsätze erholten sich danach aber wieder.
Weihnachtsgeschäft fällt ins Wasser
Allerdings: Der Trend zeigt nach unten. Das dürfte auch mit den aktuell stark steigenden Fallzahlen zusammenhängen, die viele von einem Restaurantbesuch abschrecken.
Kommt hinzu, dass die Vorweihnachtszeit für Gastronomen besonders wichtig ist. Die Umsätze müssten eigentlich durch die Decke gehen, statt nur auf August- und damit Sommerferien-Niveau zu dümpeln.
Die Zertifikatspflicht führt in den Beizen ausserdem zu Mehraufwand. Am Eingang, am Tisch, an der Bar müssen QR-Codes gescannt und IDs kontrolliert werden. Diskussionen über leere Handyakkus und vergessene Ausweise sind an der Tagesordnung.
Das geht den Beizern an die Substanz. Blick hat drei von ihnen durch den Corona-Herbst begleitet. Bruno Suter (60), der im Schwyzer Muotatal wirtet, bezeichnet das Zertifikat als «rote Linie» – und weigert sich, es zu kontrollieren. Aufgrund eines Schlupflochs lassen ihn die Behörden vorerst gewähren.
Remo Brülisauer (36) hat im Restaurant Schwägalp am Fusse des Säntis die ganze Schweiz zu Gast – und nimmt die Zertifikatspflicht locker: «Viel entscheidender ist für uns das Wetter.»
Andy Gröbli (51) und seine Pirates-Bar in Hinwil ZH wollen sich von der Zertifikatspflicht nicht unterkriegen lassen. «Entweder du heulst – oder du fragst dich, wie du das Beste aus der Situation machst.» Gröbli betreibt seit dem Herbst ein eigenes Testcenter. Wer sich dort testen lässt, erhält Pirates-Gutscheine obendrauf, sein Laden ist nun stets proppenvoll.
Gemeinsam haben die drei Beizer, dass sie sich Normalität zurückwünschen. Angesichts stark steigender Corona-Fallzahlen und neuerlicher Lockdowns im Ausland stehen die Chancen dafür allerdings nicht sonderlich gut. Schreibt Blick.
Der Schweizer Gastroverband ist nicht erst seit Corona eine unerschöpfliche Hexenküche für unsäglichen Alarmismus und Katastrophen-Prognosen, die mit der Realität meistens nur sehr wenig oder rein gar nichts zu tun haben.
Wie zum Beispiel die im Quartals-Rhytmus verbreiteten Schreckensmeldungen über das fehlende Gastropersonal. Dabei ist inzwischen hinlänglich bekannt, dass die Gastrobranche an der Misere wegen den nicht unbedingt attraktiven Arbeitsbedingungen selber schuld ist. Statt mit vernünftigen Angeboten und Ausbildungen bei Schülerinnen und Schülern sowie beim Heer der Arbeitslosen Personal langfristig zu rekrutieren, verlässt man sich lieber auf die billigeren Arbeitskräfte aus Osteuropa.
Dass der Gastroverband auch mit seinen Horror-Prognosen bezüglich Zertifikatspflicht einmal mehr völlig daneben lag, ist nur eine weitere Lachnummer einer Branche, die vom Bund mit Corona-Hilfsmassnahmen wie kaum eine andere bedient wurde.
Poltern, Jammern und Fake-Prognosen bringen halt mehr Beachtung, als ein simples «Danke schön». Die SVP lässt – einmal mehr – grüssen.
-
23.11.2021 - Tag der Luzerner Kokain-Nasen
Stark Alkoholisierte mit Auto und Velo in der Stadt Luzern unterwegs
An diesem Weekend kontrollierten wir diverse Auto- und Velofahrer, welche alkoholisiert unterwegs waren. Allein vom Samstagabend bis Sonntagabend wurden vier Autofahrer kontrolliert, welche beim Atemalkoholtest Werte zwischen 0.51mg/l – 0.87mg/l (1.02 – 1.74 Promille) hatten.
Eine Velofahrerin in der Stadt Luzern zeigte einen Wert von 0.81mg/l (1.62 Promille). Zudem wurde ein Autofahrer kontrolliert, welcher bei einem Drogenschnelltest positiv auf Kokain reagierte.
Wir haben den Autofahrern den Führerausweis abgenommen. Sie werden bei den zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt. Schreibt die Luzerner Polizei auf Facebook.
Wenn ich nicht gerade mit Bernhard Alpstaegs Maybach sondern zu Fuss in der Stadt Luzern unterwegs bin und einen Fussgängerstreifen überquere, denke ich mir oft, was hat denn dieser oder diese Velofahrer*in geraucht/gesnifft/inhaliert, wenn er/sie/es trotz Rotlicht an der Ampel im Höllentempo über den Fussgängerstreifen radelt, während die Autofahrer*innen gehorsam warten.
Dass mir die rasenden Küblers und Küblerinnen in Umkehr von Täter- und Opferrolle auch noch im gutturalen Luzerner Albanischslang zurufen «chasch nit luege, du alte Tubel» ärgert mich dann schon etwas. «Tubel» geht ja noch, aber alt bin ich nun wirklich nicht.
Dass die Pedalos inzwischen mit Kokain in der Nase unterwegs sind, wundert mich in Luzern, der Partnerstadt von Tirana und Pristina, nicht mehr.
Ich befürchte schwer, dass ich dereinst am Ende meiner Tage nicht standesgemäss von einem Rolls Royce mit Felix Blättler aus Hergiswil am Steuer, dessen wunderbarer Schäferhund immer auf dem Vordersitz im Rolls Platz nimmt, beim Überqueren eines Fussgängerstreifens überfahren werde, sondern von einem/einer durchgeknallten Zweiradlenker*in mit weisser Nase.
-
22.11.2021 - Tag der EU-Sanktionen
Reger Handel zwischen EU und Belarus trotz Sanktionen
Vor Tagen noch war es Polen, das am lautesten nach Sanktionen gegen Belarus rief. Alle EU-Staaten, die USA und am besten alle Staaten, die mit Belarus Handel treiben, sollten das Regime von Alexander Lukaschenko für dessen aggressive Migrationspolitik mit einem Import-Export-Stopp abstrafen. Doch inzwischen ist in Polens Hauptstadt Warschau kaum noch etwas davon zu hören.
Denn trotz Nachrichtensperre deckten unabhängige Medien in Polen auf, dass an den regulären Grenzübergängen zwischen Belarus und Polen jeden Tag mehrere Hundert Lkws in beide Richtungen abgefertigt werden. Der Handel zwischen beiden Ländern floriert wie eh und je.
Daran haben auch die bisherigen Sanktionen durch die Europäische Union nichts geändert. Nach der vom Lukaschenko-Regime klar gefälschten Präsidentschaftswahl vom 9. August 2020 brachte die EU zwar vier sogenannte Sanktionspakete gegen Belarus auf den Weg. Allerdings waren diese so konstruiert, dass weder die Schlüsselindustrien von Belarus noch der belarussische Handel mit EU-Staaten Schaden nahm.
Deutschland legt Gang zu
Trotz EU-Sanktionen wächst auch der Handel zwischen Belarus und Deutschland. So stiegen beispielsweise in den ersten drei Quartalen die belarussischen Ausfuhren in die Bundesrepublik um fast 51 Prozent auf mehr als 603 Millionen Euro. Gleichzeitig wuchsen laut Statistischem Bundesamt die deutschen Exporte in das osteuropäische Land um rund sechs Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Allein im September nahmen die Ausfuhren um mehr als zwölf Prozent zu.
Noch etwas sticht ins Auge: Das belarussisch-polnische Handelsvolumen ist allein im ersten Halbjahr 2021 auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar (2,22 Mrd. Euro) geklettert, der Import belarussischer Waren nach Polen erreichte einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen stammen vom Hauptstatistikamt in Warschau.
Belarussisches BIP legte kräftig zu
Auch die belarussische Wirtschaft wächst – trotz Sanktionen: Laut Statistikamt Belstat ist das belarussische Bruttoinlandsprodukt bis August 2021 um 3,0 Prozent gestiegen. Grund seien vor allem höhere Ausfuhren in EU-Länder. Insgesamt soll das Import-Export-Volumen in den ersten acht Monaten 2021 um ganze 40 Prozent zugelegt haben.
Auch wenn der gesamte belarussische Außenhandel mit keinen imponierenden Zahlen aufwarten kann, zeigt die Rangfolge der belarussischen Handelspartner doch, welche EU-Länder von Handelssanktionen ebenfalls betroffen wären.
Stark engagiert
Die wichtigsten Handelspartner sind die Nicht-EU-Länder Russland, Ukraine und China. Direkt danach folgen schon die drei EU-Länder Deutschland, Polen und die Niederlande. Bei scharfen Sanktionen würden diese Länder ebenfalls starke Verluste machen. Zumal rund 150 deutsche und knapp 500 polnische Firmen in Belarus investiert haben und dort oft Joint Ventures betreiben.
Bisher betreffen die vier EU-Sanktionspakete gerade einmal 166 Personen im direkten Umfeld von Alexander Lukaschenko. Sie wurden mit einem Einreiseverbot für die EU belegt, ihre Bankkonten im EU-Ausland wurden eingefroren und der Zugang zu Krediten in der EU gesperrt.
Sanktionen "symbolisch"
Betroffen von den bisherigen Sanktionen sind auch 15 staatliche belarussische Unternehmen, die mit Erdölprodukten und Kalidüngemitteln handeln. Die konservative polnische Tageszeitung Rzeczpospolita bezeichnet die Sanktionen als "symbolisch" und vor allem "für die Öffentlichkeit bestimmt". Die EU wolle den Eindruck erwecken, dass sie sich für die Opposition und die Menschenrechte in Belarus engagiere. Schreibt DER STANDARD.
Eine weitere Lachnummer der «symbolischen» EU-Sanktionen.
Auch die Schweizer Firma Stadler Rail hält trotz aller Kritik und Sanktionen wegen den politischen Zuständen in Weissrussland an ihrem Werk in der Nähe der Hauptstand Minsk fest. Eine Verlegung des Werks in die Ukraine sei nicht geplant, erklärte Konzernsprecher Fabian Vettori am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
Noch Fragen?
-
21.11.2021 - Tag der Stadt Baden
Asylstatistik Oktober 2021 – 1501 Asylgesuche
Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ist im Oktober 2021 gesunken. Mit 1501 Asylgesuchen wurden 42 weniger eingereicht als im Vormonat (-2,7 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Asylgesuche um 378 angestiegen. Wichtigste Herkunftsländer waren Afghanistan und die Türkei.
Die wichtigsten Herkunftsländer der Personen, die im Oktober ein Asylgesuch in der Schweiz eingereicht haben, sind Afghanistan mit 398 Gesuchen (87 mehr als im September), die Türkei (224 Gesuche; -78), Eritrea (147 Gesuche; -33), Algerien (110 Gesuche; +8) und Syrien (80 Gesuche; -30).
Von den 1501 im Oktober gestellten Gesuchen waren 1140 Primärgesuche (September 2021: 1107 Primärgesuche). Personen, welche ein Primärgesuch stellen, tun dies unabhängig von anderen Personen, die bereits um Schutz ersucht haben. Die wichtigsten Herkunftsländer bei den Primärgesuchen im Oktober 2021 waren: Afghanistan (361, +99), die Türkei (155, -61), Algerien (105, +4) sowie Irak (71, +45), Georgien (44, +6) und Eritrea (39, -2). Im Gegensatz dazu ist ein Sekundärgesuch die Folge eines bereits registrierten Asylgesuchs (beispielsweise Geburten, Familiennachzüge oder Mehrfachgesuche).
Das Staatssekretariat für Migration SEM erledigte im Oktober 2021 insgesamt 1241 Asylgesuche: Es wurden 264 Nichteintretensentscheide gefällt (davon 202 auf Grundlage des Dublin-Abkommens), 480 Personen erhielten Asyl und 254 wurden im Rahmen der erstinstanzlichen Erledigungen vorläufig aufgenommen. Die Zahl der erstinstanzlich hängigen Fälle nahm im Vergleich zum Vormonat um 328 auf 4206 zu.
Im Oktober haben 185 Personen die Schweiz kontrolliert verlassen oder wurden in ihr Herkunftsland oder einen Drittstaat rückgeführt. Die Schweiz hat bei 443 Personen einen anderen Dublin-Staat um Übernahme angefragt, 125 Personen konnten im selben Zeitraum in den zuständigen Dublin-Staat überführt werden. Gleichzeitig wurde die Schweiz von anderen Dublin-Staaten um Übernahme von 342 Personen ersucht und 50 Personen wurden der Schweiz überstellt.
Resettlement-Programm
Im Rahmen des Resettlement-Programms sind im Oktober 2021 54 Personen in die Schweiz eingereist. Der Bundesrat entscheidet alle zwei Jahre über ein Resettlement-Programm. Für die Jahre 2022 und 2023 hat er beschlossen, insgesamt bis zu 1600 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufzunehmen, die sich in einer prekären Lage in Erstaufnahmeländern befinden. Hinzu kommt ein Kontingent von bis zu 300 Flüchtlingen, die wegen der pandemiebedingten Verzögerung nicht im Rahmen des aktuellen Programms 2020/2021 aufgenommen werden können. Schreibt das Staatssekretariat für Migration SEM.
Das Jahr hat bekannterweise 12 Monate. 12 x 1'600 (Familiennachzug und Resettlement nicht eingerechnet) im Monatsdurchschnitt ergibt die Zahl von 19'200.
Die Stadt Baden zählte am 3.12.2021 exakt 19'439 Personen.
Alles klar?
-
20.11.2021 - Tag der Pampers
Joe Biden hat Sodbrennen und muss Einlagen tragen
Eine Besonderheit in der US-Politik ist, dass Präsidenten regelmässig offenlegen müssen, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist. Für Joe Biden war es das erste Mal als Präsident. Im Bericht wurden zwei Punkte hervorgehoben.
US-Präsident Joe Biden sind nach einer umfassenden medizinischen Untersuchung seine Amtsfähigkeit und ein guter gesundheitlicher Allgemeinzustand bescheinigt worden. «Der Präsident bleibt ein gesunder, kräftiger 78 Jahre alter Mann, der fit ist, erfolgreich die Pflichten der Präsidentschaft auszuüben», attestierte der Arzt im Weissen Haus, Kevin O’Connor, am Freitag dem Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber über die US-Streitkräfte.
Ausführlich listete der Arzt diverse Tests und Routine-Untersuchungen auf, die Biden über sich ergehen liess – darunter eine Darmspiegelung unter Vollnarkose. Der Präsident hatte daher am Freitag zeitweise die Amtsgewalt an seine Stellvertreterin Kamala Harris übergeben. Damit stand in den USA erstmals eine Frau an der Staatsspitze, wenn auch nur für rund 85 Minuten.
O’Connor hob in seinem medizinischen Bericht zwei Punkte hervor, die zuletzt mitunter für Nachfragen von US-Medien gesorgt hatten: Zum einen habe Biden sich bei öffentlichen Auftritten jüngst vermehrt geräuspert und gehustet, schrieb der Mediziner. Er führte dies auf gelegentliches Sodbrennen des Präsidenten zurück. Untersuchungen der Lunge und der Atemwege dagegen hätten keine Auffälligkeiten ergeben.
Zum anderen sei Bidens Gang etwas steifer als in der Vergangenheit, vor allem am Morgen. Dies sei vor allem auf allgemeine «Abnutzung» zurückzuführen, aber auch auf Verletzungen aus der Vergangenheit und ein neu entdecktes mildes Nervenleiden in den Füssen. Angeraten seien orthopädische Einlagen. Der Arzt vermerkte auch, dass Biden keine Zahnprobleme und keine Anzeichen für Hautkrebs habe. Auch der Zustand seiner Augen gebe keinen Grund zur Beunruhigung. Zudem rauche er nicht, trinke keinen Alkohol und treibe mindestens fünf Mal pro Woche Sport.
Biden nimmt der Untersuchung zufolge drei verbreitete verschreibungspflichtige Medikamente sowie zwei frei erhältliche Arzneimittel ein. Ausserdem trägt der Politiker Kontaktlinsen. Bei einer Grösse von 1,82 Metern wiegt er 83,46 Kilogramm. Damit hat er einen Body-Mass-Index (BMI) von 25 und ist normalgewichtig.
Der Gesundheitszustand des Präsidenten stösst in den USA auf gesteigertes öffentliches Interesse, insbesondere angesichts des hohen Alters des Amtsinhabers. Biden feiert an diesem Samstag seinen 79. Geburtstag. Er ist als ältester Präsident aller Zeiten ins Weisse Haus eingezogen. Schreibt 20Minuten.
Tja, so ist das halt ab einem gewissen Alter: Impotenz, Inkompetenz und Inkontinenz geben sich die Türklinke in die Hand und die Pampers-Industrie frohlockt.
Es sind aber auch positive Aspekte zu vermelden: Wenn sonst gar nichts mehr steif wird und jede «Würg-the-Gürk»-Aktion zur Mission impossible verdammt ist, lässt immerhin der steife Gang den früheren Stolz der Senioren auf die «deutsche Eiche» aus besseren Tagen nicht im Stich.
Wenigstens auf diesem Gebiet bin ich absoluter Experte. Herzlichst, Ihr Doktor Luzart. Have a nice Weekend.
-
19.11.2021 - Tag der verkauften Braut
Jakob R. musste wieder zu seiner 96-jährigen Mutter ziehen: Jetzt spricht das Opfer des Egli-Betrügers
Jakob R. hat durch eine fiese Masche 80'000 Franken verloren. Ein Betrüger gab vor, Beatrice Egli zu sein. Jetzt spricht das Opfer mit Blick.
Jakob R.* (60) aus dem Berner Oberland wurde um 80'000 Franken gebracht. Ein Betrüger gab sich online als Beatrice Egli (33) aus und behauptete, die Sängerin sei in Not. «Ich wurde über ein Internet-Portal kontaktiert und dachte, es wäre Beatrice Egli», erzählt Jakob R. im Gespräch mit Blick. Der Betrüger behauptete, ihr Management würde sie mobben und ihr keine Gagen ausbezahlen. Dem Fan wurde ein Treffen, gar eine Hochzeit versprochen, wenn er Geld zahle. Auch hatte er mit einem angeblichen Management Kontakt.
Dann der Schreck: «Nachdem ich ihr das Geld überwiesen habe, habe ich gemerkt, dass das nicht stimmen kann und ich betrogen wurde.» Jetzt sei das Geld fort, und er hoffe, dass er es wieder zurückbekomme. «In meiner Gutgläubigkeit habe ich das Geld investiert, mit der Annahme, dass ich alles wieder zurückbekomme.» Weil Egli auf dem Profilbild zu gesehen gewesen sei, sei er überzeugt gewesen, dass es sich um die Sängerin handle. Inzwischen hat er den Betrug bei der Polizei gemeldet. Seine finanzielle Situation ist schwierig: «Psychisch geht es mir nicht schlecht, aber ich habe null Franken auf dem Konto.» Zwischenzeitlich konnte er einen Job als Verkehrsregler im Stundenlohn fassen, damit er wieder etwas verdiene. Doch: «Das grosse Geld ist weg.»
Jakob R. lebt wieder bei seiner Mutter
Auch seine Schwester Kathrin R.* (62) hat sich zu Wort gemeldet und ist verzweifelt. «Es ist eine absolute Katastrophe. Der Fall hat unsere Familie komplett auf den Kopf gestellt», sagt sie zu Blick. Ihr Sohn und sie hätten Jakob R. sofort gewarnt, als sie merkten, dass es sich um Betrug handelt. «Ich bin mit den Nerven am Ende», so Kathrin R. Sie versuchten Jakob davon zu überzeugen, doch er wollte nicht hören: «Er sagte immer wieder: ‹Doch, das ist Beatrice. Wir lieben uns und wollen zusammenziehen.›»
Der Berner lebt bis 2020 vom Sozialdienst – seinen Job hatte er vor rund 20 Jahren verloren. Weil er durch den Betrug sein ganzes Erspartes ausgab, konnte er seine Miete nicht mehr zahlen. «Jetzt ist er zu seiner 96-jährigen Mutter gezogen», erzählt seine Schwester. Kathrin R. wünsche sich Frieden und dass er eine Wohnung für sich findet.
Der Betrüger versuchte es auch bei Werner F.* (72) aus Gunzgen SO. «Ich habe auf Facebook ein Bild von Beatrice Egli geliked. Danach hat mir jemand im Messenger geschrieben, von einem Profil, das aussah wie Beatrice Egli», erzählt er. Schon früh habe die Person ihn Schatz genannt. «Ich dachte schnell, dass es Fake sein könnte. Ich habe aber trotzdem zurückgeschrieben, weil es mich wundernahm, wie es weitergeht», betont der Solothurner, der sechs Jahre lang für die Kriminalpolizei arbeitete.
Als sie die Konversation auf Whatsapp verlegten, sei er erneut stutzig geworden. «Die Nummer sah sofort komisch aus. Durch die Vorwahl +234 fand ich dann heraus, dass die Nummer aus Nigeria stammt», so Werner F. Die Nachrichten, die Blick vorliegen, wurden immer fordernder. Erst verlangte die falsche Beatrice Egli Bilder von ihm, später forderte sie ihn auf, ihr Steam-Karten zu besorgen. Dabei handelt es sich um eine Guthabenkarte für den Onlineanbieter Steam, der Computerspiele verkauft.
F., der zu dem Zeitpunkt im Spital lag, zögerte das hinaus. «Wenn man richtig überlegt, merkt man, dass das Ganze nicht echt ist», sagt er. Und fügt hinzu: «Ich habe zum Glück nie Geld überwiesen. Man sollte hier immer sehr vorsichtig sein!» Schreibt Blick.
Mitleid mit Jakob R., den Blick seit Tagen durch den boulevardesken Fleischwolf dreht, bis von der Witzfigur aus dem Berner Oberland nichts mehr übrig bleibt, ist fehl am Platz.
Nicht nur, dass dem guten Jakob jeder Sinn für schöne Dinge fehlt, nein, auch ein paar Hirnzellen scheinen nicht mehr richtig sortiert zu sein. Fettfluten gibt's schliesslich auch unter 80'000 Franken im Angebot der Discounter.
-
18.11.2021 - Tag des Luzerner Ständerats Damian Müller
Die «Ehe für alle» tritt am 1. Juli 2022 in Kraft
Gleichgeschlechtliche Paare können ab dem 1. Juli 2022 heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Nach der Erwahrung des Abstimmungsergebnisses hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 17. November 2021 beschlossen, die Vorlage zur "Ehe für alle" auf diesen Zeitpunkt in Kraft zu setzen.
Die "Ehe für alle" wurde in der Volksabstimmung vom 26. September 2021 von einer klaren Mehrheit der Stimmberechtigten und von allen Kantonen angenommen. Das Parlament hat in den Übergangsbestimmungen eine zweistufige Inkraftsetzung beschlossen. Demnach tritt eine einzelne Bestimmung (Art. 9g Abs. 2 SchlT ZGB) bereits am 1. Januar 2022 in Kraft. Sie betrifft den Güterstand von gleichgeschlechtlichen Paaren, die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, welche in der Schweiz bisher als eingetragene Partnerschaft anerkannt wurde.
Das Gesetz sieht vor, dass die eigentliche Vorlage sechs Monate später in Kraft tritt. Gleichgeschlechtliche Paare können folglich ab dem 1. Juli 2022 heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Das Gesuch um Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens kann allerdings bereits vor diesem Datum eingereicht werden. Für die Umwandlung der eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe genügt eine gemeinsame Erklärung der Partnerinnen oder Partner gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten.
Keine neuen eingetragenen Partnerschaften mehr möglich
Ab dem 1. Juli 2022 können in der Schweiz keine neuen eingetragenen Partnerschaften mehr begründet werden. Diesen Paaren steht ab dann einzig die Ehe offen. Bereits bestehende eingetragene Partnerschaften können jedoch ohne spezielle Erklärung weitergeführt werden.
Schreibt das Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD in seiner Medienmitteilung vom 17.11.2021.
Ein historischer Moment! Zweifellos auch ein grosser Verdienst des Luzerner Ständerats Damian Müller, dass der gordische Knoten mit der Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Paare und Paarinnen dank seinem unermüdlichen Einsatz endlich gelöst werden konnte. Keine Frage.
Eine Frage, die uns alle aber brennend interessiert: Wird Damian «ich bin nicht schwul» Müller bei den nächsten National- und Ständeratswahlen bei seinem (ungefragt) geäusserten Statement bei den Wahlen 2019 bleiben, oder präsentiert er uns seine Braut?
Ich stelle mich jedenfalls als Brautführer zur Verfügung, egal ob Müllers Braut Üzgür oder Manuela heisst. Versprochen! Vielleicht kann ich sogar meinen Freund und Preisträger sämtlicher Schweizer Musik-Auszeichnungen Cyrill Schläpfer dazu bewegen, während der Trauzeremonie die «Waldstätter-Sinfonie» aufzuführen. Das wär dann aber ein Ding.
Cyrill Schläpfer: Der Mann der Töne konserviert
https://www.srf.ch/.../cyrill-schlaepfer-der-mann-der...

-
16.11.2021 - Tag der diebieschen Elstern
Oberkulm: Kosovare als «Falscher Polizist» festgenommen
Die Polizei nahm gestern in Oberkulm einen mutmasslichen Angehörigen einer Bande von Telefonbetrügern fest. Mit der Masche des falschen Polizisten hatten diese versucht, eine Seniorin zu betrügen.
Einbrecher seien in der Nähe und trachteten nach ihrem Vermögen, erklärte die Stimme am Telefon. Um ihr Geld zu schützen, müsse sie dieses sofort der Polizei übergeben, sagte ein Mann, der sich als Angehöriger der Kantonspolizei vorstellte. Diesen Anruf erhielt eine Frau aus Oberkulm am Montagmittag, 15. November 2021. Die Frau durchschaute den Schwindel, liess den Betrüger aber im Glauben, dass sie darauf eingehe. Prompt stand schon bald ein junger Mann vor der Haustüre.
Inzwischen hatte die Betroffene die Regionalpolizei Aargau-Süd verständigt, wodurch bereits zivile Fahnder der Kantonspolizei bereitstanden. Diese nahmen den Verdächtigen in der Folge fest. Es handelt sich um einen 30-jährigen Kosovaren aus Deutschland. Bei ihm dürfte es sich um den Angehörigen einer Betrügerbande handeln, der als Kurier die Wertsachen abholen sollte. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Telefonbetrüger, die sich als Polizisten ausgaben, waren gerade über das Wochenende wieder sehr aktiv. So verzeichnete die Kantonspolizei zahlreiche Meldungen über entsprechende Anrufe. Die Kantonspolizei warnt abermals vor dieser Betrugsmasche. Schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihrer heutigen Medienmitteilung.
Zuerst herzliche Gratulation an die Kantonspolizei Aargau, dass ihr endlich dank Mithilfe einer cleveren Aargauerin einer dieser fiesen Vögel aus dem Balkan ins Netz flatterte, die inzwischen den Kanton Aargau in Schwärmen heimsuchen. Dass es ein Kosovare ist, der die Schweizer Kriminalstatistik einmal mehr bereichert, wundert eigentlich niemanden.
Wundern würde uns lediglich, wenn der Vogel in einem Käfig landen würde. Wahrscheinlich blüht ihm ein harmloser Landesverweis von zwei drei Jahren. Wie wir Ornithologen aber längst wissen: Diebische Elstern kennen weder Gesetze, Grenzen noch Landesverweise. Die fliegen dahin, wo die wertvollsten Schmuckstücke locken, mit denen sie in Pristina ihre Nester schmücken.
-
15.11.2021 - Tag des österreichischen Lockdowns für Ungeimpfte
«Ab 00.00 Uhr...» spricht der österreichische Kanzler Schallenberg.
Ab 00.00 Uhr wird doch nicht etwa zurückgeschossen? Bei österreichischen Kanzlern weiss man ja nie...
-
14.11.2021 - Tag der hunrigen Möwen im Luzerner Herbstnebel
When Doves Cry
Dream, if you can, a courtyard
An ocean of violets in bloom
Animals strike curious poses
They feel the heat
The heat between me and you
Prince 1984 / Lucerne 12.11.2021
Mit einem einzigen Klick gelangen Sie zum (vermutlich) preisgekrönten Netflix-Kracher von Rolls Reuss-Fahrer Doktor LUZART aus Hollywood

-
13.11.2021 - Tag der Schweizer Impfwoche
Bilanz zur Impfoffensive: Jede Impfung zählt – und jede hat ihren Preis
Die Impfwoche neigt sich langsam dem Ende zu und es zeichnet sich ab: Zumindest in reinen Zahlen brachte diese Offensive nicht den grossen Schritt nach vorn.
Gesundheitsminister Alain Berset legte die Latte von Beginn an tief. Einen Zielwert mit einer Mindestzahl an neu Geimpften nannte er bewusst nie. «Wenn man irgendeine Grenze setzen würde, dann heisst es, das ist einfach ein Erfolg oder Misserfolg. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist: Jede zusätzliche Impfung hilft uns.» Tatsächlich wurden in der ersten Wochenhälfte gemäss BAG insgesamt leicht mehr Impfdosen verabreicht als im selben Zeitraum in der Woche davor, aber immer noch deutlich weniger als in den Vergleichsperioden im Oktober.
Damit sei wenigstens ein gewisser Effekt sichtbar, sagt Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren. «Wir haben uns auch nicht die Illusion gemacht, dass es sich jetzt mehrere Prozentpunkte hinaufbewegt. Insofern sind wir zufrieden, dass wir einen Effekt sehen, aber wir sind jetzt auch nicht begeistert, wie er ausfällt.» Beim Bund bleibt der Projektleiter der Impfoffensive, Michael Beer, dabei: Jede Impfung zählt.
«Schon eine Stabilisierung, so wie es aktuell aussieht, ist eine gute Nachricht», sagt Beer. Denn: «Jede nächste Impfung ist schwieriger als die vorhergehende. Das Ziel war wirklich, die Leute anzusprechen, die noch unentschlossen sind. Und ich glaube, das ist uns gelungen.» So wurden etwa im Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof, durch den täglich rund 300'000 Pendlerinnen und Pendler strömen, in der ersten Wochenhälfte 670 Personen zum ersten Mal geimpft.
Damit habe man in etwa gerechnet, sagt der Leiter des Zürcher Gesundheitsamts, Peter Indra, zu der Bilanz. «Wir erhoffen uns aber durch diese Wirkung des Impfdorfs, durch die Symbolkraft des Impfdorfs im Hauptbahnhof, dass jetzt wirklich ein Ruck durch die Bevölkerung geht und alle, die noch unentschlossen sind, sich doch noch zu einer Impfung entschliessen werden.»
Preis pro Impfung «nicht der grosse Faktor»
Fürs Impfdorf, Impfbusse oder -nächte haben die Kantone beim Bund rund 20 Millionen Franken beantragt, wobei der Bund als Maximum fast das Fünffache zur Verfügung gestellt hat. Wenn dereinst endgültige Zahlen vorliegen, lässt sich der Preis pro einzelne Erstimpfung berechnen. Wer so kalkuliert, wird wohl feststellen: Jede Impfung zählt nicht nur, sie kostet auch einiges.
In St. Gallen sagt Gesundheitsdirektor Bruno Damann: «Am Schluss werden wir schauen, wie viel Geld das gekostet hat, pro Impfung zum Beispiel. Aber die Pandemie hat schon so viel Geld gekostet, dass das nicht mehr der grosse Faktor ist.» Oder wenn man einen Vergleich von Berset heranzieht: Die ganze Impfung dürfte den Bund am Ende ähnlich viel kosten wie ein paar Tage Gratistests. In der Pandemie gehen die Millionen im Grundrauschen der Milliarden unter. Schreibt SRF.
«In der Pandemie gehen die Millionen im Grundrauschen der Milliarden unter.» Gut geschrieben! Nennen wir das Kind beim Namen: Die Impfwoche war ein sündhaft teurer Flop.
Dass diese inszenierte Impfwoche nicht das Gelbe vom Ei sein würde, war abzusehen. Man darf sich im Nachhinein schon fragen, welche infantilen Marketingkoryphäen diesen lächerlichen «Make your Day»-TikTok-Schwachsinn dem Bundesrat untergejubelt haben.
Wer einen auf TikTok macht, muss auch TikTok liefern. Das geben aber abgehalfterte Cervelat-Promis aus der Schweiz nun mal nicht her.
Dem Bundesrat sei an dieser Stelle dringendst empfohlen, Robert Blys Buch «Die kindliche Gesellschaft» zu lesen und die Werbeagenturen des Bundes zu hinterfragen. Eine SPIEGEL-Studie wäre ebenfalls hilfreich, die untersucht, wo und wann sich Social-Media-Werbung lohnt.
Auch wenn die Werbe- und Marketingfritzen vor lauter TikTok irgendwie nicht mehr richtig ticken, sei hier festgehalten: Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 von STATISTA sind es vorwiegend Kinder und Jugendliche von 12 bis 14 Jahren, die in der Schweiz TikTok nutzen. In dieser Altersgruppe haben 95,8 Prozent der Befragten die App installiert. Unter den 9 bis 11-Jährigen sind es 90 Prozent, obschon die Anwendung laut AGB erst ab 13 Jahren offiziell erlaubt ist. Ab dem Alter von 20 Jahren geht der Nutzeranteil auf 21,4 Prozent zurück.
Was sagt uns das? Rund 78 Prozent der erwachsenen Schweizer Bevölkerung hat mit TikTok und all den andern Kindergarten-Instrumenten (wie Instagram usw.) nichts am Hut.
Dass damit die Schweizer Impfwoche scheitern musste, ist nur die logische Folge einer völlig verkorksten Werbestrategie, die am Zielpublikum vorbeizielte.
Die Impfwoche ausschliesslich als Entertainment zu verkaufen, wurde der Ernsthaftigkeit des Themas nicht gerecht. Dafür umso mehr dem «Grundrauschen der Corona-Milliarden».
Oder wie der St. Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann meint: «Die Pandemie hat schon so viel Geld gekostet, dass das nicht mehr der grosse Faktor ist.» Für einen Staatsbeamten sind halt 20 Millionen zum Fenster hinausgeworfene Schweizer Franken vermutlich nur Peanuts.
Doch irgendwer wird irgendwann dafür bezahlen. Wer, wenn nicht die TikTok-Generation? Bundesrat Ueli Maurer wird es definitiv nicht sein.
-
12.11.2021 - Tag der FDP-DNA
Bundesrätin Keller-Sutter ist empört: «Belarus produziert Migrationsströme»
Justizministerin Karin Keller-Sutter fordert humanitäre Hilfe an der EU-Ostgrenze. Europa dürfe sich aber nicht erpressen lassen.
An der belarussisch-polnischen Grenze spielt sich eine humanitäre Tragödie ab. Was denken Sie, wenn Sie diese Bilder von frierenden und kranken Menschen sehen?
Ich bin sehr empört. Vor allem, weil ich die Hintergründe kenne. Die Personen, die jetzt an der Grenze in Polen und Litauen stehen, kommen mit Visa, die Belarus ausgestellt hat. Man muss davon ausgehen, dass das Land damit gegen die EU-Sanktionen protestiert. Belarus versucht, die EU zu destabilisieren, indem es Migrationsströme «produziert». Ähnliches hat ja auch schon die Türkei versucht.
Sind es auch Flüchtende aus Afghanistan, die nach der Machtübernahme der Taliban das Land verlassen haben, die jetzt an die Tore Europas stossen?
Nein. Es sind meines Wissens vor allem Syrer und Iraker, die mit dem Flugzeug kommen. Sie werden danach von den belarussischen Behörden an die litauische und polnische Grenze transportiert. Die litauische Amtskollegin hat schon im August am Justiz- und Innenministertreffen in Slowenien Filmaufnahmen gezeigt, auf denen man sah, wie die belarussischen Sicherheitskräfte diese Menschen in den Schengenraum drängten. Jetzt spitzt sich im Winter die Situation zu.
Die Menschen an der Grenze werden zum Spielball eines machtpolitischen Konfliktes. Was kann die Schweiz tun, um diesen Leuten zu helfen?
Die Konfliktlösung ist in der EU im Gange. Ich glaube, dass die EU sehr klar reagieren muss. Ein Teil der Lösung liegt sicher auch in Russland, weil Belarus von Moskau protegiert wird. Eine Verteilung der Menschen auf die Schengen-Staaten kommt nicht infrage, weil die Erpressung sonst Wirkung hätte. Es handelt sich um illegale Migration, die Leute müssen zurückgeführt werden.
Dann frieren die Menschen an der Grenze. Kann das wirklich die Lösung sein?
Nein. Es braucht humanitäre Hilfe. Polen hat bis jetzt aber jede Unterstützung durch die Schengenstaaten abgelehnt. Die Menschen können auch in Belarus oder Polen ein Asylgesuch stellen.
«Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bedingungen für ein humanitäres Visum erfüllt sind.»Karin Keller-Sutter
Ist eine Aufnahme dieser Menschen in der Schweiz mittels humanitärer Visa ein Thema?
Nein. Für ein humanitäres Visum müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Die Person muss individuell an Leib und Leben bedroht sein und sie muss einen Bezug zur Schweiz haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bedingungen erfüllt sind.
Alexander Lukaschenko wird gerne als «letzter Diktator Europas» bezeichnet. Haben Sie ihn mal getroffen?
Nein!
Auch an der Schweizer Grenze treffen mehr Flüchtende ein – vor allem aus Afghanistan. Rüstet sich die Schweiz für eine neue Flüchtlingswelle?
Jene, die jetzt eintreffen, sind nicht infolge des Machtumsturzes der Taliban geflohen. Sie kommen vor allem aus der Türkei, wo sich Hunderttausende Afghaninnen und Afghanen aufhalten. Deren Ziel ist meist Deutschland oder Frankreich. Die Schweiz ist vorbereitet: Wir haben den Asylprozess optimiert, es gibt schnelle Verfahren. Mit den Kantonen gibt es auch eine Notfallplanung für die Unterkünfte.
Gibt es genügend Platz in den Asylzentren?
Wir haben bereits jetzt eine sehr angespannte Situation. Wegen Corona braucht es Distanzregeln und Quarantäneräume – es gibt kaum mehr Platz. Wir haben darum auch Unterkünfte zugemietet.
Wird in den Bundesasylzentren auch geimpft?
Ja, die Impfung wird angeboten. Anfänglich war die Impfquote sehr tief, jetzt liegt sie bei gegen 50 Prozent. Die Impfung wird zum Teil eben auch abgelehnt. Schreibt 20Minuten.
Wer hätte das gedacht? Bundesrätin Keller-Sutter ist empört. Über einen zweitklassigen Diktator von Putins Gnaden. Die medial inszenierte Empörung ist nichts anderes als eine weitere Lachnummer der FDP-Bundesrätin.
Ebenso gut könnte sich die gnädige Frau Keller-Sutter über sich selbst empören. Ihren markigen Worten folgen keine Taten. Fairerweise sei erwähnt, dass dieses Verhalten zur DNA von FDP-Politikern*innen gehört. Es sei denn, es geht um brachial neoliberale Themen nach Gutsherrenart längst vergangener Epochen. Da folgen die Taten stets auf dem Fuss.
Wie wäre es, wenn die empörte Dame vor ihrer eigenen Departementstüre wischen würde? Sie schafft nämlich selber gewisse Migrationsbewegungen. Ähnlich dem zweitklassigen Diktator im Narrenkostüm aus Belarus.
Seit Jahr und Tag strömen Monat für Monat laut Asylstatistik vom Staatssekretariat für Migration (SEM) ein paar Hundert Migranten*innen aus Algerien, Marokko und weiteren Maghreb-Staaten in die Schweiz, denen zum grössten Teil nicht nur der Asylstatus verweigert wird, sondern auch das Bleiberecht. Oder um Keller-Sutters eigene Worte zu benützen: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bedingungen für ein humanitäres Visum erfüllt sind.»
Doch Rückführungen finden nicht statt. Hunderte von Algeriern treiben trotz Abschiebungs-Entscheid ihr kriminelles Unwesen hierzulande, wie die kantonalen Polizeikorps beinahe im Tages-Rhythmus verkünden.
Die Luzerner Polizei kann ein Lied davon singen. Wochenenden am Luzerner Bahnhof mit drei (!) Fällen von algerischen Messerstechern an einem einzigen Samstag sind leider keine Seltenheit mehr.
Die Aargauer Polizei erlebt ähnliches mit den Goldstücken aus Algerien. Da fallen schon 15-Jährige Buben aus dem Maghreb als waschechte Ganoven auf.
Dabei rühmte sich doch die medienverliebte Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) nach ihrem Besuch in Algerien im Frühjahr 2021 vor laufenden Kameras, die Probleme mit der algerischen Regierung gelöst zu haben, die partout ihre eigenen Staatsbürger – wie auch Marokko – aus vermutlich nachvollziehbaren Gründen nicht «zurücknimmt». Wer nimmt schon gerne arbeitsscheue Kriminelle zurück?
So wie es vermutlich ebenfalls gute Gründe gibt, weshalb die reichen arabischen Staaten wie Saudi Arabien und die Emirate keine, aber auch wirklich keine ihrer salafistischen Brüder und Schwestern als Asylanten aufnehmen, dafür aber ein Millionenheer von fleissigen Asiaten beschäftigen.
Aber eben: Schall und Rauch gehören halt auch zur DNA der FDP, die nur mit dem Blick auf die nächsten Wahlen agiert, statt diesen ach so vielgepriesenen «Rechtsstaat Schweiz» umzusetzen.
-
11.11.2021 - Tag der bewusstseinserweiternden Substanzen
Berufseinstieg als Psychotherapeut: «Ich tue mich schwer mit Menschen, die Depressionen haben und gleichzeitig Marihuana rauchen»
Schon zur Schulzeit schütteten Frischgetrennte Johannes Lindner ihr Herz aus, heute arbeitet er als selbstständiger Psychotherapeut. Hier erzählt er, wie er Patienten hilft – und wo für ihn Schluss ist.
Der Start ins Arbeitsleben ist aufregend, anstrengend – und oft ganz anders als geplant. In der Serie »Mein erstes Jahr im Job« erzählen Berufseinsteiger:innen, wie sie diese Zeit erlebt haben. Diesmal: Johannes Lindner, 33, hat in Bremen Psychologie studiert, eine dreijährige Ausbildung zum Psychotherapeuten absolviert und sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht.
»Auf dem Schulhof war ich immer der Typ, zu dem die Frischgetrennten liefen und sich ausheulten. Menschen können sich mir gut öffnen – woran das liegt, kann ich gar nicht sagen. In der Mittel- und Oberstufe hatte ich außerdem einen sehr coolen Sozialwissenschaftslehrer, der viel Psychologie mit uns gemacht hat. So kam ich zum Studium. Für Bachelor und Master habe ich zusammen fünf Jahre gebraucht. Die wirkliche Keule war aber die anschließende dreijährige Ausbildung – insbesondere das 18-monatige klinische Praktikum. Ich hatte mehr als einen Vollzeitjob und bekam dafür nur 250 Euro im Monat. Ohne Kredit oder Unterstützung von außen konnte das niemand schaffen, schließlich kostet die Ausbildung selbst noch mehrere Tausend Euro. Mittlerweile gab es zum Glück eine Ausbildungsreform. Wer jetzt anfängt zu studieren, bekommt seine Approbation, also die staatliche Zulassung als Psychotherapeut:in, schon direkt nach dem Studium – und die anschließende Weiterbildung wird nach Tarifvertrag mit monatlich etwa 4000 Euro vergütet.
Nach der Ausbildung kam es für mich nicht mehr infrage, mich anstellen zu lassen. Ich tue mich schwer mit Regeln und Autoritäten. Familie und Freund:innen haben mir deshalb schon früher häufig geraten, mich selbstständig zu machen. Und so kam es dann auch: Ich habe mir einen Raum gesucht, eine Prepaidkarte fürs Handy gekauft, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, Online-Werbeanzeigen geschaltet und mir mithilfe eines YouTube-Tutorials eine Homepage gebastelt.
Zweifel zu Beginn
Irgendwann kam der erste Anruf. Das war aufregend: Kann ich das überhaupt? Wie funktioniert die Abrechnung mit Privatpatient:innen? Nach dem Termin fühlte ich mich aber total erleichtert: Endlich gab es kein Ausbildungskorsett mehr, keinen Supervisor, mit dem ich Rücksprache halten musste. Ich allein trug die Verantwortung.
Inzwischen mache ich im Monat etwa 5000 Euro Umsatz. Davon gehen dann Steuern, Versicherungen, Altersvorsorge und die Fixkosten für meine Praxis ab, am Ende bleiben mir ungefähr 2800 Euro.
Wenn jemand bei mir eine Therapie machen möchte, läuft das so ab: Erst gibt es eine Probesitzung zum Kennenlernen. Beim zweiten Termin absolviere ich mit den Patient:innen eine standardisierte Untersuchung zu allen möglichen psychischen Erkrankungen. Beim dritten schauen wir uns das jeweilige Problem genauer an: Wie äußert sich etwa eine Depression, eine Sozialphobie, eine Bulimie bei der Patientin oder dem Patienten? Während des vierten Termins besprechen wir die Lebensgeschichte der Patient:innen.
Basis ich ein Behandlungsangebot erstelle. Dann können die Patient:innen entscheiden, ob sie es annehmen möchten. Ob die Kosten übernommen werden, bestimmt eine Gutachterin oder ein Gutachter, das dauert etwa sechs bis zehn Wochen.
Ich behandle zum Beispiel Patient:innen, die unter Panikattacken leiden und keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzen. Solche Fälle lassen sich mit Expositionsverfahren behandeln. Bedeutet: Die Patient:innen stellen sich ihren Ängsten – und können so erfahren, dass die starken Gefühle und Körpersymptome nicht schlimmer werden, sondern von allein abflauen.
Ich finde, als Psychotherapeut:in sollte man in der Lage sein, jeden Menschen wertzuschätzen und nicht frühzeitig zu urteilen. Manchmal muss man sich aber auch eingestehen, dass die Chemie einfach nicht passt. Ich tue mich beispielsweise schwer mit Menschen, die Depressionen haben und gleichzeitig Marihuana rauchen. Auch wenn ich nachvollziehen kann, dass die Selbstmedikation schlechte Gefühle erträglicher macht: THC hat einen viel zu starken und nachhaltigen Einfluss auf das Denken und die Motivation. Dagegen kann eine Psychotherapie wenig ausrichten.
Mehr Anfragen seit Corona
Sorgen, dass zu wenige Patient:innen zu mir kommen, hatte ich nie. Es ist ja bekannt, dass mehr Menschen eine Therapie benötigen, als Psychotherapeut:innen Kapazitäten haben. Corona hat dieses Problem noch einmal verstärkt. Auch ich bekomme zurzeit mehr Anfragen, als ich annehmen kann – vor allem von jungen Menschen. Nicht mehr zum Sport, auf WG-Partys oder in Kneipen und Discos gehen zu können, hat viele in die Einsamkeit getrieben. Das ist gerade für junge Menschen, die sich ausprobieren wollen, eine riesige Belastung.
Für mich und meine Kolleg:innen ist es schwer, wenn das E-Mail-Postfach mit Anfragen verzweifelter Menschen vollläuft. Ich entscheide dann nach Dringlichkeit. Dass ich nicht allen helfen kann, musste ich erst einmal akzeptieren. Ich arbeite in Teilzeit und mache nicht mehr als 24 Patient:innenstunden pro Woche, so habe ich genug Energie für alle.
Trotz all der Strapazen, in der Ausbildung und im Job, ist und bleibt die Psychotherapie mein Traumberuf. Ich habe eine echte Neugier an Menschen – und den Willen, etwas zum Guten zu beeinflussen.« Schreibt DER SPIEGEL.
«Ich tue mich beispielsweise schwer mit Menschen, die Depressionen haben und gleichzeitig Marihuana rauchen», sagt mein Berufskollege* Johannes Lindner.
Dieser Aussage kann ich nicht nur beipflichten, sondern gehe sogar einen Schritt weiter: Ich tue mich mit allen Menschen schwer, die Drogen konsumieren. Egal, ob es sich um Mary Jane, Kokain, Heroin, LSD, Crystal Meth oder andere, angeblich «bewusstseinserweiternde» Scheisse handelt.
* Es sei festgehalten, dass ich meinen Doktortitel als Psychiater von der Luzerner Staatsanwaltschaft erhalten habe.
-
10.11.2021 - Tag der SVP-Sekte
Experte: «Neues Video ist verstörend»: Trychler driften jetzt in Verschwörer-Szene ab
Auf Telegram kursiert ein neues Video der Freiheitstrychler. Dort greift die Bewegung auch Verschwörungstheorien auf. Ein Experte erklärt, weshalb die Gruppe damit eine Grenze überschritten hat.
Eine Covid-19-Spritze aus Holz, die über einem Feuer verbrennt. Ein Plakat des Bundeshauses, das wie eine Marionette von riesigen Händen gesteuert wird. Und ein Ballon mit dem Symbol des «Great Reset» («Der grosse Neustart»): Auf Telegram kursiert ein neues Video der Freiheitstrychler, das diverse Fragen aufwirft.
Bekannt geworden war die Gruppierung mit ihren auffälligen Auftritten im Herbst 2020. «Engagierte Urschweizer» nannten sich die Trychler, die sich «mit Herz und Hand für die verfassungsmässigen Rechte» einsetzen. Als Massnahmen-Kritiker sind sie heute an den meisten Corona-Demonstrationen in der Schweiz dabei. Von Verschwörungstheorien war bisher nie die Rede. Das hat sich jetzt geändert.
«Sie outen sich eindeutig als Verschwörungstheoretiker»
Für den Sozialwissenschaftler Marko Kovic (36) ist klar: «Die Freiheitstrychler outen sich mit dem Video eindeutig als Verschwörungstheoretiker.» Das Symbol des «Great Reset» sei international bekannt. «Es steht für eine weltweite Corona-Verschwörungstheorie, die besagt, dass alles inszeniert ist und eine dunkle Weltmacht die Pandemie für ihre Zwecke nutzt», sagt Kovic zu Blick.
Der Begriff «The Great Reset» wurde im Mai 2020 vom deutschen Wirtschaftswissenschaftler und WEF-Gründer Klaus Schwab (83) verwendet, als die Welt zum ersten Mal die volle Wucht der Corona-Pandemie zu spüren bekam. Er war der Meinung, dass der Kapitalismus an sich grüner, nachhaltiger und sozialer werden müsse, um einen globalen wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen.
Zahlreiche Corona-Skeptiker änderten kurzerhand den Sinn von Schwabs Aussage: Für sie war «The Great Reset» der Beweis, dass die Eliten der Welt in der Pandemie den passenden Grund gefunden hatten, eine «neue Weltordnung» zu errichten.
«Diese Botschaften machen Dialog unmöglich»
Das Plakat des Bundeshauses, das von fremden Mächten gesteuert wird, sei laut Kovic ein weiteres Symbol für diese Verschwörung. «Klarer könnte die Verbindung zum ‹Great Reset› im Video nicht sein», sagt er. Wie lange die Freiheitstrychler schon an diese Erzählung glauben, sei fraglich. «Es ist möglich, dass sie erst kürzlich abgedriftet sind oder aber dass sie von Anfang an Verschwörungstheoretiker waren.»
Das Video überschreitet für Kovic eine Grenze. «Es ist verstörend. Und es geht eine Stufe weiter, als sich bloss für die verfassungsmässigen Rechte einzusetzen.» Über die Corona-Massnahmen lasse sich diskutieren, meint Kovic. «Aber die Botschaften im Video liegen nicht mehr im Rahmen des politischen Diskurses. Sie machen einen Dialog unmöglich.»
Nähe der Szene zu Verschwörungstheorien wird deutlich
Kovic betont, dass nicht alle Corona-Skeptiker automatisch an solche Theorien glauben. Aber er sagt: «Am Beispiel der Freiheitstrychler sieht man, dass die Nähe zu Verschwörungstheorien in der Szene der Massnahmengegner sehr präsent ist.» Wer in der Schweiz monatelang sagt, er lebe in einer Diktatur, sei nur wenige Schritte von Veschwörungstheorien entfernt.
«Es ist gefährlich, dass die Freiheitstrychler diese Botschaften so offen präsentieren», sagt Kovic. Sie hätten viele Sympathisanten, die nun damit konfrontiert würden – und sich schlimmstenfalls davon angezogen fühlten und radikalisieren liessen. «So sind die Freiheitstrychler Superspreader von Verschwörungstheorien.» Schreibt Blick.
Und täglich grüsst das Murmeltier. Zusammen mit gewissen SVP-Politikern*innen unterstützt Blick mit seiner atemlosen Liveticker-Berichterstattung über jeden Furz der glockenschwingenden Verschwörungstheoretiker deren unerträglichen Bullshit.
Während die hehren SVP-Politiker*innen für ein paar Wählerstimmen ihr gewohnt schmutziges und demokratiefeindliches Verhalten an den Tag legen, betreibt der Boulevard von der Zürcher Dufourstrasse nichts anderes als widerwärtiges Clickbating zum eigenen Wohl sowie Werbung für psychisch Gestörte.
Niemand braucht Informationen über die SVP-Sekte der hirnverbrannten Esoteriker*innen und Verschwörungstheoretiker*innen in ihren abstrusen Trychler-Klamotten, die selbst von einem Bundesrat getragen werden, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, weil Ueli Maurer ja noch im Amt ist.
Sinnvoller wäre es, diese dialogunfähigen Menschen in ihrer Telegram-Bubble, dem bevorzugten Medium für Kriminelle, Drogenhändler und geistig Verwirrte schmoren zu lassen. Sollen sie sich in ihrer Blase der grenzenlosen Dummheit austoben. Bis der Spuk irgendwann ein Ende findet und einem neuen Platz macht.

-
9.11.2021 - Tag der Dummheit
«Dummheit hat Hochkonjunktur»
«Dialogbereitschaft ist zwar prinzipiell zu befürworten und eine gute Sache. Allerdings nur, wenn sie auf beiden Seiten vorhanden ist. Alles andere benennt man besser als das, was es ist. Nämlich eine zweckbefreite und absehbar ergebnislose Kombination zweier Monologe, und spart sich Mühe, Ärger und Zeit, mit Menschen zu diskutieren, die das Recht auf eine eigene Meinung mit dem Recht auf eigene Fakten verwechseln. Es ist blauäugig, zu glauben, man müsse den Dialog offen halten. Die Regierung muss einfach entscheiden – und zwar auf der Basis der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse».
Sagte die bekannte österreichische Neurologin und Buchautorin Heidi Kastner in einem Interview mit der SonntagsZeitung. Mein Freund und «wandelndes Lexikon» Res hat mir dieses hervorragende Interview über die menschliche Dummheit, die derzeit Hochkonjunktur feiert, zugespielt. Den Link zum Artikel der SonntagsZeitung hier aufzuführen bringt nichts. Es handelt sich um einen Bezahlartikel mit entsprechender Paywall.
Der hier publizierte Interviewausschnitt bestätigt mein gestriges Säusel Gebräusel zur «nationalen Schweizer Impfwoche», in dem ich mich über den Schwachsinn der hinausgeworfenen Bundesmillionen in meiner gewohnt hysterischen Art echauffierte. Meine Empfehlung an die Schweizer Regierung entsprach exakt derjenigen von Frau Kastner. 2G verordnen und die Sache mit den Covidioten hat sich! Ende Gelände. Wer beim Autofahren die Sicherheitsgurten nicht umschnallt, muss schliesslich auch mit Konsequenzen rechnen: Von der Busse bis hin zum Unfalltod.
Das hat inzwischen selbst unser aller Boulevardblatt «Bligg» erkannt: «Wenn die Impfquote nicht endlich steigt: Experten werben für 2-G-Regel» schreiben die Wortmächtigen von der Zürcher Dufourstrasse.
Was lernen wir daraus? Die tägliche Schlagzeile des Artillerie-Vereins Zofingen ist stets der Zeit voraus. Auch wenn grössenwahnsinniges Eigenlob gewaltig zum Himmel stinkt: Dies musste jetzt einmal gesagt werden.
Es gibt aber auch andere, die mit kruden Äusserungen zum Himmel stinken. You never walk alone. Wie wahr!
Unglaublich wie SVP-Bundesrat Ueli Maurer um den Brei herumeiert, um ja keine Trychler-Wähler-Stimme zu verlieren. Scheint als ob er gar nicht interessiert ist, dass die Abstimmung über das Coronagesetz vom Schweizer «Volch» angenommen wird.
Wer sich in Zeiten der Not nicht auf seine Regierung verlassen kann, verliert den Halt. Wer das gesagt hat, weiss ich nicht mehr. Vielleicht war ich es.
Da ist er wieder, mein ganz persönlicher Grössenwahn.
-
8.11.2021 - Tag der fehlenden AHV-Milliarde
Impfung gegen Covid-19: Die nationale Impfwoche beginnt – das müssen Sie wissen
Die Impfwoche in Kürze: Die Kampagne startet mit einem Event auf dem Berner Bundesplatz. Im Zentrum der rund 100 Millionen Franken teuren Aktionswoche steht die Information, etwa mittels Plakaten von über 80 Persönlichkeiten aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Politik.
Hemmschwelle fürs Impfen senken: Um den Zugang zur Impfung noch leichter zu machen, werden in vielen Teilen der Schweiz die Öffnungszeiten der Impfzentren verlängert, die Zahl der Impfstandorte erweitert und – wie in Bern – um Pop-up-Impfmöglichkeiten in Einkaufszentren ergänzt. Vielerorts sind Impfbusse, -trucks und mobile Impfequipen unterwegs.
Ungewöhnliche Impfstationen: In Zürich kann man sich in einem Tram impfen lassen, auf dem Rhein sogar auf dem Wasser. Die beiden Basler Halbkantone lassen ein Impfschiff vom Anker. Ein ganzes Impfdorf wird in der Halle des Zürcher Hauptbahnhofes aufgebaut.
Beratung und Information wird grossgeschrieben: Im Kanton Schwyz oder im Kanton Nidwalden touren Impfmobile durch die Region. Fachpersonen beantworten Fragen und informieren. Im Tessin beantwortet der Kantonsarzt in einem Live-Chat auf Whatsapp und Messenger direkt Fragen zur Impfung.
Impfen geht durch den Magen: Selbst mit kulinarischen Angeboten sollen die Menschen zur Impfung bewogen werden. In Zürich etwa mit Kaffee und Berliner, in Genf mit Glühwein, Tee und heissen Marroni.
Impfequipe auf Bestellung: Zum Impfen gar nicht erst aus dem Haus muss man im Kanton Luzern. Hier kommt das Impfteam für Familien oder Gruppen ab fünf Personen direkt nach Hause. Daheim abgeholt und gratis zum Impfen gefahren wird man in Appenzell Ausserrhoden: Ein Impftaxi kommt in Heiden und Herisau zum Einsatz.
Dank Kurzhypnose zum Piks: Mit Impfnächten, zusätzlichen Walk-in-Angeboten und sogar Kurzhypnosen sollen Unentschlossene in der Ostschweiz von einer Impfung gegen das Coronavirus überzeugt werden. Personen mit Angst vor Spritzen könnten sich in Ausserrhoden in einer hausärztlichen Praxis «unter Kurzhypnose» impfen lassen.
Impfen statt schlafen: Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt die nationale Impfwoche mit einer Impfnacht am 12. November in Muttenz. Auch in Zürich gibt's die «Lange Nacht der Impfung»: Am 12. und 13. November sind die Apotheken dafür bis Mitternacht geöffnet.
Per Impfung zur Verlosung: Diejenigen, die während der nationalen Impfwoche in Genf ihre erste Dosis erhalten, können an einer Verlosung teilnehmen, um einen «einzigartigen Genfer Moment» zu gewinnen. Dazu gehört etwa eine Führung durch den historischen Regierungsbunker mit Mauro Poggia, eine Abseilaktion unter Polizeibegleitung oder die Möglichkeit, ein gepanzertes Fahrzeug auf dem Rollfeld des Flughafens zu fahren.
Prominente zeigen Flagge fürs Impfen: In Obwalden beispielsweise machen sich 27 Persönlichkeiten für die Impfoffensive stark. In Uri sind es gar 82 Politikerinnen und Politiker von Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene, sowie Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.
Konzerttour in fünf Schweizer Städten: Musikerinnen und Musiker wie Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu, Kunz, Baschi, Anna Rossinelli und Sophie Hunger spielen während der nationalen Impfwoche auf. Die fünf Konzerte in Thun, Lausanne, Sitten, St. Gallen und Luzern sind bereits ausgebucht. Wegen der Covid-Einschränkungen sind pro Konzert nur 500 Personen zugelassen. Schreibt SRF.
Idioten, Glockenschwinger und SVP-Verschwörungs-Hydranten aus der Impfgegnerszene mit abgehalfterten Schweizer Musik- und Showstars wie Baschi & Co. an Konzerten sowie politischer Cervelat-Prominenz zur Corona-Impfung bewegen?
Da kommt tatsächlich zusammen was zusammen gehört.
Und dafür hat der Bundesrat knapp 100 Millionen Schweizer Franken den Kantonen zur Verfügung gestellt, um eine total verblödete und von 24-Stunden-Entertainment längst durchgeknallte Gesellschaft zu mobilisieren?
Verschärfte 2G-Massnahmen hätten vermutlich das gleiche, wenn nicht gar ein besseres Resultat erzeugt.
PS: In der AHV-Kasse fehlt (angeblich) eine Milliarde Schweizer Franken. Die Corona-Pandemie kostet uns bis jetzt das zig-fache. Alles klar? Danke, liebe Trychler. Danke SVP.
-
7.11.2021 - Tag des Sternenhimmels im Rolls Royce
Neuer Ghost Black Badge: Bei Rolls-Royce wirds finster
Der Ghost ist bei Rolls-Royce sozusagen das Einstiegsmodell. Was den britischen Luxus-Autobauer nicht davon abhält, ihm als Black Badge eine finstere Optik und mehr PS zu spendieren.
«Dirty Rolls» nannten sie ihn in den Salons der britischen Aristokratie. Charles Rolls (1877–1910), einer der Gründer der britischen Nobelmarke Rolls-Royce, kam immer mit weisser Krawatte an Events seiner Universität. Bloss war der Schlips schwarz vor Ölflecken – und Rolls war das egal. Kleiderordnung? Konventionen? Er pfiff drauf.
Mit der gleichen Einstellung verdüstert jetzt Rolls-Royce sein Einstiegsmodell zum Ghost Black Badge. «Keine Submarke, sondern eine zweite Haut, eine Art Leinwand für unsere besonderen Kunden, um ihre Individualität auszudrücken», erklärt Torsten Müller-Ötvös, der CEO der britischen Marke in den Händen von BMW. Böser Mummenschanz für Ehrenfrauen und -männer sozusagen. Mit einem Preisschild von wohl um die 370'000 Franken. Mindestens.
Der Phantom ist eigentlich die Rolls-Royce-Ikone, aber bald nach dem Neustart der Marke unter BMW-Regie fragten Kunden nach gleichem Luxus, aber mit weniger Prunk. Ab 2009 wurde so der kleine Rolls namens Ghost zum meistverkauften Modell der Marke und letztes Jahr aufgefrischt. Doch die Black-Badge-Version kam Müller-Ötvös erst nach einem kleinen Schock in den Sinn: Ein Kunde schickte seinen Rolls zum Tuner, von wo er mit Kühlerfigur, Felgen, Interieur und Details in Tiefschwarz zurückkam. Dieses Geschäft wollte der Rolls-Royce-CEO dann wohl selber machen – und bietet die Black-Badge-Politur längst auch für andere Modelle an.
Schwarz ist die beliebteste Farbe
Jeder Ghost kann in einer von 44'000 Lackfarben geliefert werden, aber die überwältigende Mehrheit bestellt ihn nun in Schwarz. Der Grill und die Kühlerfigur Spirit of Ecstasy werden dunkel verchromt; die 21-Zoll-Räder werden mit 44 Lagen Karbon überzogen. Ein Rautenmuster aus Karbon- und Metallfasern wird mit mehreren Lagen gepressten Holzes zusammengebacken und in die Armaturentafel eingelassen. Die Uhr trägt eine mit 152 LEDs beleuchtete Frontplatte, im Dachhimmel strahlen 90'000 Lichtpunkte als Sternenhimmel.
Unter der endlosen Haube säuselt der wohl letzte Verbrennungsmotor in einem Rolls-Royce. Bloss die 29 Zusatz-PS des V12 sind bei 600 PS Gesamtleistung kaum spürbar. Dafür beherrscht er dank neuem Auspuffresonator jetzt auch böses Brüllen. Einen Sportmodus gibts natürlich nicht – Ehrenmänner und -frauen rennen nicht, sie schreiten. Trotzdem gibts einen sogenannten Low-Modus, der die Fahrwerksdämpfer versteift und Gaspedal und Acht-Stufen-Automatik schärfer stellt. Trotz identischer Fahrleistungen wie beim normalen Ghost fühlt sich der Black Badge so dynamischer und sportlicher an. Und irgendwie düsterer. Schreibt Blick.
Egal ob düster oder Regenbogenfarben: Rolls Royce bleibt Rolls Royce. Welches andere Gefährt kann schon einen Sternenhimmel mit 90'000 Lichtpunkten bieten?
Siehste!
-
6.11.2021 - Tag des Sempachersees
NOVEMBER AM SEMPACHERSEE - Life is önly Röck n' Röll
Wo chom i här, wo gohn i he?
Die philosophische Frage. Muss mal den Yves Bossart fragen.
Häbed alli ä guets Woche-Änd!
Hier gehts zum Super-Netflix-video!
-
5.11.2021 - Tag der kriminellen Zentralschweizer High-Society
Der Luzerner Buchhalter Besiam U. (34) steht wegen betrügerischem Konkurs vor Gericht: Pro Pleite kassierte der Kosovare 5000 Franken
Der Luzerner Buchhalter Besiam U. beerdigte für Geld eine Firma nach der anderen. Dafür stand er am Donnerstag vor dem Luzerner Kantonsgericht.
Der Schweizer mit Wurzeln im Kosovo erscheint in Jeans, dunklem Kapuzenpulli und Turnschuhen vor dem Kantonsgericht Luzern. Er macht eine ernste Miene. «Es geht um viel», sagt Besiam U.* (34) zu Blick. «Wenn ich so lange ins Gefängnis muss, kann ich meine Firma nur schwer weiterführen.»
Vor dem Luzerner Kriminalgericht kassierte der diplomierte Buchhalter in erster Instanz eine teilbedingte Freiheitsstrafe über 26 Monate, davon soll er 10 Monate im Gefängnis absitzen. Das Gericht verurteilte ihn wegen betrügerischem Konkurs, Unterlassung der Buchführung, Urkundenfälschung, Misswirtschaft, Beschäftigung und Vermittlung von Ausländern ohne Bewilligung, versuchtem Diebstahl und Zivildienstverweigerung.
Für Geld marode Firmen bestattet
Ein wichtiger Punkt auf der Liste der Delikte ist die Tätigkeit als sogenannter Firmenbestatter: Zwischen 2014 und 2019 ritt er 14 Firmen kontrolliert und bewusst in den Konkurs. Pro Beerdigung kassierte er im Schnitt 5000 Franken. Neben den ganzen Baufirmen beerdigte er auch das Restaurant Ochsen in Sempach LU.
Wie das funktionierte, erzählt er Blick nach der Verhandlung: «Es waren allesamt marode Unternehmen, die dem Staat Sozialabgaben ihrer Angestellten schuldeten. Ich übernahm die Firmen und liess sie in den Konkurs laufen. Die Ex-Besitzer gründeten parallel einfach eine neue Firma und waren fein raus.»
Die Spielsucht beherrschte ihn
Er habe das Geld dringend gebraucht. Er sagt: «Ich war spielsüchtig, ich überlegte nicht. Heute bereue ich es. Ich würde das sicher nicht mehr machen.» Die Zeit als Firmenbestatter hat für den Geschäftsmann noch jahrelang Folgen. All die negativen Einträge und Schulden seien auf seinen Namen eingetragen worden, obwohl er dafür gar nicht verantwortlich gewesen sei.
Vor Gericht beteuert er, dass er mit den Machenschaften von früher nichts mehr am Hut habe. «Ich versuche, Fuss zu fassen mit meiner neuen Tiefbaufirma. Die Auftragseingänge sind gut. Das Geschäft läuft», sagt er. Mit einem Teil der Erträge wolle er nun seinen Schuldenberg abbauen. Sein Anwalt fordert darum auch eine mildere Strafe als die Vorinstanz. Er findet 18 Monate bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren angemessen.
Staatsanwalt will lange Gefängnisstrafe
Der Staatsanwalt plädiert hingegen für eine härtere Gangart. Er fordert eine unbedingte Gefängnisstrafe von 40 Monaten: «Der Beschuldigte hat bereits neue Verurteilungen. Eine Strafe über fünfeinhalb Monate hat er bereits abgesessen, die hat ihn auch nicht von weiteren Delikten abgehalten. Da hilft nur eine unbedingte Gefängnisstrafe.»
Das Kantonsgericht fällt in den kommenden Tagen das Urteil. Es wird den Parteien schriftlich zugestellt. Schreibt Blick.
It takes two to tango!
Dass ein kosovarischer Strohmann den Kopf hinhält und kriminelle Nägel mit Köpfen macht, verwundert niemanden. Das ist nun mal gang und gäbe auf dem Balkan. Wo krimineller Rauch aufsteigt, ist meistens ein Mitglied der Balkan-Connection involviert.
Doch Besiam U. hatte in Bau- und Finanzbranche bestens bekannte, honorige Auftraggeber aus dem Umfeld Schweizer KMU-Unternehmen zwischen Rain und Dagmersellen, deren Namen ich hier nicht nennen will. Jedenfalls nicht heute.
Einer von diesen grossartigen Schweizer Unternehmern, meistens mit seiner Lebensabschnittspartnerin aus dem Balkan im Maserati oder im noch protzigeren Lincoln auf der Haldenstrasse unterwegs wo die feinen Luzerner Hotels zu finden sind, sass ja nicht umsonst mehrere Tage in einem Luzerner Gefängnis in Untersuchungshaft.
Der andere war vermutlich auf Grund seiner gesellschaftlichen Stellung und seinen Finanzkonglomeraten selbst für die Polizei untouchable. Obschon ER der eigentliche Kopf des Betrugs war und das Drehbuch dazu schrieb. Mister Maserati war dafür schlicht und einfach zu dumm. Nur mit Bauernschläue lässt sich so ein gewaltiges Ding nicht drehen.
Dass Blick den Schweizer Hintermännern (noch) nicht nachgeht, erstaunt mich. Kommt aber vielleicht noch. Denn das wäre die interessante Story!
Der Kosovare ist in diesem Kriminalstück, über das sich trefflich mit Blick auf gewisse High-Society-Kreise aus der Zentralschweiz ein spannender Kriminalroman schreiben liesse, eher ein willfähriges Opfer denn Täter. Für die «grossen Ideen», wie man den Staat um Riesenbeträge prellt, waren andere zuständig.
Ich glaube, ich nehme mit Besiam U. mal Kontakt auf. Wird Zeit, dass ich endlich ein spannenden Kriminalroman mit Netflix-Qualitäten komponiere! Bevor mein Freund Cyrill Schläpfer die Idee aufgreift und den Nobelpreis als «bester Zentralschweizer Kriminalschriftsteller» erhält. Der Sürill hat ja wirklich genug Preise in seinem Leben gewonnen!
Während ich vor gefühlt tausend Jahren lediglich mit der Auszeichnung «sexiest man alive» am Sunset-Boulevard in Hollywood gewürdigt wurde. Die ich erst noch in einem Shop kaufen musste.
-
4.11.2021 - Tag der lauwarmen FDP-Fürze
Strafen bis zu 300 Franken: Das Liegenlassen von Abfall soll neu schweizweit gebüsst werden
Manche Kantone und Städte kennen bereits Bussen fürs Littering. Nun will die Umweltkommission eine nationale Handhabe einführen.
Ein ausgespuckter Kaugummi, ein weggeworfener Zigarettenstummel oder eine liegen gelassene Hamburgerverpackung. Jedes Mal könnte dies eine Busse von bis zu 300 Franken geben, wenn es nach den Plänen der nationalrätlichen Umweltkommission geht.
FDP-Nationalrat Matthias Jauslin hat zusammen mit einer Subkommission die Vorschläge für den Littering-Gesetzesartikel erarbeitet und sagt, die Busse solle abschreckend sein: «An einem Montagmorgen an einem Bahnhof in der Schweiz ist es katastrophal, wie das aussieht. Es kann doch nicht sein, dass die Gesamtheit der Bevölkerung für diese Umweltsünden, die hier begangen werden, bezahlen muss.»
Entsorgungskosten in Millionenhöhe
Gegen 200 Millionen Franken kostet die Entsorgung jährlich. In vielen Städten und Kantonen gibt es bereits Bussen fürs Littering. Im Kanton Freiburg droht eine Busse von 50 Franken. Im Kanton Bern 80 Franken und im Aargau 300 Franken.
Wieso braucht es da noch den Bund, der Vorschriften macht? Diese Frage beantwortet Matthias Jauslin so: «Wenn ein Kanton eine Lösung hat und ein anderer Kanton hat keine Lösung, dann ist für die Bevölkerung nicht klar, was jetzt gilt. Wenn wir flächendeckende Lösungen haben über die ganze Schweiz, dann ist auch die Akzeptanz viel höher.»
Andere setzen lieber auf Aufklärung
Doch nicht alle in der Kommission waren Feuer und Flamme für das Bussenregime. Mike Egger von der SVP findet, anstelle einer Busse brauche es Aufklärung: «Wir müssen den Menschen verständlich aufzeigen, warum Littering zu wirklichen Problemen führen kann und was für Auswirkungen auch auf die Tierwelt bestehen können.»
Bis Mitte Februar 2022 läuft die Vernehmlassung. Es kann gut sein, dass es Kritik an den hohen Bussen gibt und der Littering-Artikel wieder auf dem Müllhaufen der gut gemeinten, aber nicht mehrheitsfähigen Vorschläge entsorgt wird. Schreibt SRF.
Dass Littering vor allem in den Schweizer Städten nicht nur immense Kosten verursacht, sondern auch die Lebensqualität stark beeinträchtigt, steht ausser Frage. Auf dem Land sieht es immerhin noch ein bisschen besser aus.
Nur: Was FDP-Nationalrat Matthias Jauslin zusammen mit seiner Subkommission ausgebrütet hat, stellt sich einmal mehr als typischer lauwarmer FDP-Furz heraus. Viel Luft und Biswind, aber keine Substanz.
Die meisten Kantone haben längst ein vom Wahlvolk angenommenes Litteringgesetz. Wie zum Beispiel der Kanton Luzern seit über 10 Jahren. Doch was nützt ein Litteringgesetz, wenn es nicht umgesetzt wird?
Fragen Sie mal einen Luzerner Polizisten, ob er/sie/es in den letzten zehn Jahren je eine Litteringbusse ausgestellt hat! Die Antwort wird Sie nicht überraschen. Gesetze zu verabschieden ist das Eine. Sie jedoch umzusetzen verlangt politische Unterstützung. Und die fehlt durchs Band weg.
-
3.11.2021 - Tag von Ruedi Walter
Aus den Memoiren von Doktor Luzart
Ruedi Walter, Schauspieler und Comedian – Unvergessen. Ein Stück Schweizer Kulturgeschichte aus einer vorsintflutlichen Zeit, in der Comedians noch mit Bildung und Intelligenz brillierten.
Atemlos sassen wir als Kinder in der Stube und hörten die Sendungen von «Radio Beromünster», wie das Schweizer Radio damals noch hiess, mit Ruedi Walter und Margrit Rainer. Fernsehen gab es zu diesen Zeiten noch nicht. Jedenfalls nicht in den Bauernstuben.
Ruedi Walter brachte mich als Jugendlichen mit dem auf den ersten Blick etwas absurden Theaterstück «Warten auf Godot» von Samuel Beckett zusammen, in dem die beiden Protagonisten Estragon und Wladimir auf einen Unbekannten, Godot, warten. Informationen zu Beckett musste man sich in der Pfarreibibliothek holen, da Internet noch nicht existierte.
Mangels Pornhub leihten sich die älteren Buben in der Bibliothek jeweils ein Buch von Rubens aus. Nicht weil sie Informationen über den Maler Rubens suchten, sondern weil das Buch voll war mit Bildern halbnackter Frauen mit üppigen Figuren. Der Pfarrer wunderte sich, dass dieses Buch stets ausgeliehen war und freute sich über die kunstbeflissene Dorfjugend.
Sie sehen: Boys will be boys. Das war schon immer so. Eine herrlich verrückte Zeit vor der Digitalisierung. Ohne persönliche Kreativität lief rein gar nichts. So bastelte mir beispielsweise mein älterer Bruder mit einem Detektor und einer kleinen Blechdose ein Radio, mit dem sich «Radio Beromünster» verbotenerweise auch Abends im Bett hören liess.
Ich möchte nicht einen Tag aus diesen unbeschwerten Zeiten vermissen, auch wenn ich heute den Segen der Digitalisierung trotz aller Schattenseiten geniesse.
Hier geht es zum unvergesslichen Video mit Ruedi Walter
Wikipedia schreibt: Ruedi Walter, Sohn eines Vertreters, absolvierte die Kantonale Handelsschule in Basel. Als Jugendlicher war er Mitglied des CVJM. Er begann eine «Praktikantenlehre» bei der Handelsfirma für Bäckereibedarf Bopp & Co., die in seinem zweiten Lehrjahr in Konkurs ging.
Um nach der Rekrutenschule einer zwangsweisen Offiziersausbildung entgehen zu können, ging er an Sprachschulen in Paris und London, wo er als Volontär beim Teegrossisten «Twining Crossfield» arbeitete und später auf eigene Rechnung mit Tee handelte. Wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs kehrte Walter 1939 in die Schweiz zurück, wo er Ende April 1939 in der Werbeabteilung bei Maggi in Kemptthal zu arbeiten begann und Militärdienst leistete. Danach wurde er bei Maggi Büroleiter des Basler Depots. Theater, das «Theäterle», betrieb er zunächst als Freizeitbeschäftigung.
Mit seiner sechs Jahre jüngeren Schwester Gertrud – der späteren Gertrud Kessel – nahm er Schauspielunterricht bei Eva Bernoulli und Gustav Hartung. Zudem hatte er Sprech- und Gesangsstunden bei Margit von Tolnai. Während der Kriegsjahre trat er zum ersten Mal auf die Bühne: im Basler Stadttheater, 1944 bei der Soldatenbühne Bärentatze und im Cabaret Kaktus. Nach dem Krieg schloss er sich 1948 dem «Cabaret Cornichon» an.
Die Kleinbühne hatte aber ihre besten Zeiten bereits hinter sich; die Stücke, die er spielte, gerieten rasch in Vergessenheit. Dafür machte Walter eine Bekanntschaft, die sein weiteres Wirken prägte: Margrit Rainer, mit der er eine langjährige künstlerische Partnerschaft einging. Er war mit der Schauspielerin Irène Camarius (Marthe Irène Liechti) verheiratet, die mit ihm in vielen Bühnenstücken auftrat und sich später vom Theater zurückzog. Das Paar hatte zwei Kinder.
Nach zwei Jahren «Cornichon» machten sich Margrit Rainer und Ruedi Walter selbstständig, um dann während Jahrzehnten als kongeniale Bühnenpartner in unzähligen Auftritten zu brillieren. Walter und Rainer waren auch dank ihrer Radiosendungen «Spalebärg 77a» und «Bis Ehrsams zum schwarze Kaffi» in den 1950er Jahren beliebt, bei deren Ausstrahlung jeweils die halbe Deutschschweiz vor dem Radio sass. Auch als Margrit Rainer 1982 starb, spielte Walter in etlichen Schweizer Filmen und Fernsehproduktionen und auch im Schweizer Nationalzirkus Knie weiter.
Walters Hauptbetätigungsfeld blieb aber die Bühne, er verkörperte rund 500 Figuren. Er überzeugte, ob als «Bäuerlein Heiri» in der «Kleinen Niederdorfoper» oder als «Estragon» in «Warte uf de Godot». Seinen Ruf als Volksschauspieler erwarb er sich nicht zuletzt mit seinen Rollen in den oft lokalpatriotisch angehauchten Zürcher Musicals von Werner Wollenberger, Hans Gmür, Max Rüeger, Karl Suter (Text), Hans Moeckel und Paul Burkhard (Kompositionen): Neben der «Kleinen Niederdorf-Oper» waren dies Stücke wie «Eusi chlii Stadt», «Golden Girl» und «Bibi Balu». Zum Schauspiel-Ensemble dieser Musicals gehörten neben Ruedi Walter und Margrit Rainer auch Ines Torelli, Inigo Gallo, Edi Huber, Vincenzo Biagi, Jörg Schneider, Paul Bühlmann und andere.
Bis zu seinem Tod stand Ruedi Walter auf der Bühne und vor der Kamera, obwohl sein Augenlicht in den letzten Jahren stark nachliess. Am Schluss spielte er fast blind. Walter starb an Komplikationen einer Knie-Operation.

-
2.11.2021 - Tag der unverbindlichen Klimagipfel
UN-Klimakonferenz: 100 Staaten wollen bis 2030 Entwaldung stoppen
Auf dem Weltklimagipfel in Glasgow haben sich mehr als 100 Staaten verpflichtet, die Zerstörung von Wäldern und anderen Landschaften bis 2030 zu stoppen. Dies hat die britische Regierung, die der UN-Konferenz vorsitzt, am späten Montagabend bekanntgegeben. Die beteiligten Länder, darunter Deutschland und die gesamte EU, repräsentieren 85 Prozent der weltweiten Waldfläche, also etwa 34 Millionen Quadratkilometer.
Mit dabei sind die Staaten mit den größten Wäldern überhaupt, also Kanada, Russland, Brasilien, Kolumbien, Indonesien sowie China, Norwegen und die Demokratische Republik Kongo. Für das Vorhaben werden bis 2025 etwa 12 Milliarden US-Dollar (10,3 Milliarden Euro) an öffentlichen Geldern mobilisiert. Hinzu kommen 7,2 Milliarden US-Dollar (6,2 Mrd. Euro) private Investitionen.
Wälder gelten als die Lunge unseres Planeten, sie nehmen etwa ein Drittel der jährlich vom Menschen ausgestoßenen CO2-Emissionen auf. Doch schrumpfen sie bedenklich, wie es in der Mitteilung weiter hieß: Jede Minute gehe eine Fläche von etwa 27 Fußballfeldern verloren.
Brasilien verschärft Klimaziel für 2030
Unterdessen hat Brasilien, das mehr als die Hälfte des riesigen Amazonas-Regenwaldes beheimatet, sein Klimaziel für 2030 verschärft. "Die von unserem Land bis 2020 erzielten Ergebnisse zeigen, dass wir noch ehrgeiziger sein können", sagte Staatschef Jair Bolsonaro in einer am Montag in Glasgow gezeigten Videobotschaft. Demnach sollen sich die Treibhausgasemissionen des Landes bis 2030 im Vergleich zu 2005 halbieren. Bisher war eine Reduktion um 43 Prozent vorgesehen.
Nach Angaben von Brasiliens Umweltminister Joaquim Leite will das Land bis 2050 Kohlenstoffneutralität erreichen. Diese Zusagen werde er nächste Woche bei seiner Teilnahme an der COP26 formalisieren. Außerdem kündigte er an, dass bis 2028 – und somit zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen – illegale Abholzungen im Amazonasgebiet vollständig unterbunden werden sollen.
Emissionen in Brasilien nahmen massiv zu
Ein Bericht von Klimaschützern hatte erst vergangene Woche beklagt, dass die Treibhausgasemissionen Brasiliens im Jahr 2020 um 9,5 Prozent gestiegen seien. Weltweit gingen die Emissionen im Jahr 2020 demnach um sieben Prozent zurück. Brasilien stieß jedoch mehr Treibhausgase in die Luft als in allen Jahren seit 2006, vorwiegend wegen der zunehmenden Abholzung im Amazonasgebiet.
Die Regierung Bolsonaro wird für ihre Umweltpolitik international hart kritisiert. Dem rechtsradikalen Präsidenten wird vorgeworfen, systematisch Personal und Mittel von Umweltschutzbehörden zu kürzen und sich vor allem für die Interessen der im Amazonas aktiven Unternehmen einzusetzen. Seit Bolsonaros Amtsantritt im Jänner 2019 hat das brasilianische Amazonasgebiet jährlich rund 10.000 Quadratkilometer Baumbestand verloren. In den zehn Jahren zuvor waren es im Schnitt jährlich rund 6.500 Quadratkilometer. Schreibt DER STANDARD.
Die groteske Palaver-Konferenz von Glasgow findet den kleinsten gemeinsamen Nenner. Unverbindlich zwar. Aber tönt gut als «Absichtserklärung». Die reinste Farce.
Das Übereinkommen aus der Pariser Klimakonferenz 2015 lässt grüssen. Erinnern wir uns: Und plötzlich kommt da ein Donald daher, der das Pariser Klimaabkommen vor laufenden Kameras im Rosengarten des Weissen Hauses in Stücke zerreisst.
Bei Brasiliens Präsident Bolsonaro wird das «Glasgower Abkommen» vermutlich auf der Präsidententoilette als Klopapier landen. Wetten, dass?
Oder wie Johann Wolfgang von Goethe zu sagen pflegte: «Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.»
Mir auch.
-
1.11.2021 - Tag von allen Heiligen
THE WALKING DEAD
Wir können es drehen und wenden wie wir wollen. Hilft alles nichts. Irgendwann fallen wir wie die welken Herbstblätter eines Kastanienbaums am Luzerner Quai vom Stängali. Gaudeamus igitur! Vita nostra brevis est.
Oder wie Lohengrin in der gleichnamigen Oper von Richard Wagner singt: «Geboren wurden wir in einer Burg, die Monsalvat genannt, nur mit diesem einen Fluch, dass alle wir dem Ende zuzustreben haben.»
Was will uns Ritchie damit sagen? Genau! «Das Leben ist zu kurz, um langweilige M-Budget-Frisuren zu haben.»
-
31.10.2021 - Tag der arabischen Grossmäuler
Söldner statt Soldaten – Golfarabische Streitkräfte: dienstuntauglich
Kaufen statt selber kämpfen: Die Golf-Armeen sind trotz riesiger Rüstungsausgaben und Unmengen von Söldnern schwach.
Die Golfmonarchien sind Kleinstaaten, Saudi-Arabien bestenfalls eine Mittelmacht. Doch ihre Verteidigungsausgaben sind gewaltig. Allein die Saudis geben jährlich 60 Milliarden Dollar für ihre Streitkräfte aus, die Vereinigten Arabischen Emirate 20 Milliarden.
Schlappe im Jemen
Umso mehr erstaunt, zumindest auf den ersten Blick, dass sie gegen die Houthi-Rebellen im Jemen kläglich versagten. Die Vereinigten Arabischen Emirate brachen ihren Feldzug 2019 ab. Die Saudis hoffen, dass die Houthis in ein Abkommen einwilligen, um Riad einen gesichtswahrenden Abzug zu ermöglichen. Man stehe «entschlossen an der Seite des jemenitischen Brudervolks», beteuert Kronprinz Mohammed bin Salman.
Da die Houthis de facto als Sieger des siebenjährigen Bürgerkriegs im Jemen bereits feststehen, haben sie indes wenig Anlass, Zugeständnisse für ein Friedensabkommen zu machen.
Debakel auf der ganzen Linie
Ob schmählich oder nicht – für die Saudis wäre es das Beste, sich so rasch wie möglich ebenfalls aus dem Jemen zurückzuziehen, sagt Professor Zoltan Barany von der Universität Texas in Austin. Er ist einer der besten Kenner der golfarabischen Streitkräfte. Soeben ist sein neuestes Buch «Armies of Arabia» erschienen.
Barany wundert es nicht im Geringsten, dass die Golfaraber, obschon zahlenmässig und technologisch den schiitischen Rebellen hoch überlegen, ein Debakel einfahren: «Sie hatten nie eine klare Strategie gegen die Houthis. Ihre Luftwaffen, auf die sie hauptsächlich setzten, haben versagt. Und am Boden gelang es ihnen nicht, ihre Soldaten, zumeist Söldner, wirksam einzusetzen.»
Rüstungskäufe gegen Schutzversprechen
Trotz enormer Rüstungsausgaben seien die golfarabischen Streitkräfte schwach: «Sie sind ausserstande, die Ölmonarchien über mehr als ein paar Tage vor Feinden zu schützen. Dafür verlässt man sich bis heute auf die USA und in geringerem Mass auf Grossbritannien.»
Die gewaltigen Rüstungskäufe seien im Grunde nichts anderes als eine Versicherungsprämie dafür, dass Washington und London im Notfall die reichen Ölländer heraushauten. Nach dem Prinzip: Wir kaufen eure Waffen, dafür verteidigt ihr uns. So betrachtet ist das Geld sinnvoll investiert.
Eigene Soldaten kaum zu finden
Tatsächlich können die Golfstaaten ihre Hochtechnologiewaffen gar nicht selber unterhalten und einsetzen. Es fehlen ihnen auch motivierte eigene Soldaten. Welcher wohlhabende Golfaraber will schon Militärdienst leisten?
Stattdessen – und dies seit langem – setzen die Feudalherrscher auf Söldner: aus Pakistan, Indien, Bangladesch, aus sunnitischen arabischen Ländern wie Marokko oder Jordanien, im Fall des Jemen-Feldzugs auch zunehmend aus Kolumbien, aus dem Sudan, Somalia oder Uganda.
Söldner mit Bürgerrecht
«Wie stark sie abhängig sind von Söldnern, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Sie machen aber, je nach Golfstaat, um die 80 Prozent der Truppenbestände aus», sagt Barany. Selbst in den Offiziersrängen, offiziell Staatsbürgern vorbehalten, finden sich viele Ausländer. Man verleiht ihnen dafür einfach das Bürgerrecht.
Söldner machen je nach Golfstaat um die 80 Prozent der Truppenbestände aus.Zoltan Barany, Professor University of Texas, Autor «Armies of Arabia»
In den obersten Dienstgraden finden sich zwar Saudis, Emiratis, Qatarer oder Kuwaiter. Doch ausgewählt werden sie nicht nach Leistung, sondern nach Stammeszugehörigkeit und Loyalität gegenüber dem Herrscher.
Es erstaunt deshalb wenig, wie abrupt die Golfstaaten nach der Abwahl von US-Präsident Donald Trump die zuvor feindselige Tonalität gegenüber dem Regionalrivalen Iran abschwächten.
«Scheinriesen»
Zwar behauptet der saudische Kronprinz Mohammed gegenüber dem emiratischen Medienhaus «The National», auch mit Joe Biden stimme man zu 90 Prozent überein. Bloss: Ganz so bedingungslos steht Biden nicht mehr hinter den arabischen Potentaten. Also mässigen sie ihre Rhetorik.
Zumal klar ist: Trotz modernerer Waffen und weit höherer Rüstungsausgaben hätten die Golfstaaten in einem militärischen Konflikt mit dem Iran keinen Stich. «Niemand im Iran hat schlaflose Nächte wegen der Streitkräfte der Golfaraber», drückt es Professor Barany aus. Deren Armeen seien bloss Scheinriesen.
Niemand im Iran hat schlaflose Nächte wegen der Streitkräfte der Golfaraber.Zoltan Barany Professor University of Texas, Autor «Armies of Arabia»
Das ist aber wirklich ein ziemlich alter Zopf, den SRF zusammen mit Professor Zoltan Barany von der University of Texas und Autor von «Armies of Arabia» aus dem Hut zaubert. Die Erkenntnisse des Professors sind seit jeher bekannt. Dem Begriff «dienstuntauglich» könnte man einen weiteren hinzufügen: «Arbeitsuntauglich».
Ältere Semester werden sich an die israelisch-arabischen Waffengänge nach der Gründung des Staates Israel erinnern.
Angefangen beim «Palästinakrieg» (November 1947 bis Juli 1949), über die «Sueskrise» (auch bekannt als Sinai-Krieg, von Oktober 1956 - März 1957), den «Sechstagekrieg» (auch Junikrieg genannt, im Juni 1967, der mit der israelischen Besetzung des Gazastreifens, des Sinais, des Westjordanlands und der Golanhöhen endete), den «Abnutzungskrieg» (von Juli 1967 bis August 1970), den «Jom-Kippur-Krieg» (Oktoberkrieg, im Oktober 1973), die «Operation Litani» (März 1978, Einmarsch der israelischen Armee in den Libanon), den «Libanonkrieg» (Juni bis September 1982) bis hin zum «zweiten Libanonkrieg» (Juli bis August 2006).
Eine Tatsache aus all diesen Kriegen ist bis zum heutigen Tag in unseren Köpfen hängen geblieben: Das (damalige) Vier-Millionen-Volk der Israelis ging gegenüber den (damals) 100 Millionen Arabern stets als Sieger hervor. Daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Ausser den Bevölkerungszahlen.
Ein Bild aus dem Sechstagekrieg hat sich ebenfalls bis zum heutigen Tag in unseren Köpfen eingeprägt: Tausende von arabischen Soldaten liessen auf ihrer Flucht die Armee-Stiefel auf dem Sinai zurück, was damals in der westlichen Presse höhnisch als «Feigheit vor dem übermächtigen Gegner» bezeichnet wurde. Dem legendären israelischen Generalstabschef Mosche Dajan und dem ebenso gefürchteten israelischen Geheimdienst «Mossad» hatten die arabischen «Grossmäuler» – so wurden die arabischen Führer schon damals betitelt – nichts entgegenzusetzen.
Was dazu führte, dass eine US-Zeitung einen vor Hohn und Spott triefenden Artikel zum damaligen Versagen der US-Army in Vietnam schrieb: «Gebt uns Mosche Dajan und den Mossad – und der Vietnamkrieg ist in drei Monaten beendet!»
Die unseligen «Militärexperten», die schon im vergangenen Jahrhundert ihr Unwesen in der Presselandschaft trieben, führten die Überlegenheit der israelischen Armee auf die massive Waffenunterstützung des Westens zurück.
Dass die Israelis nicht mit Pfeil und Bogen gegen die Araber kämpften und mit modernsten Waffen aus dem Westen unterstützt wurden, ist zwar richtig. Allerdings wurden auch arabische Staaten, wie beispielsweise Ägypten im «Kalten Krieg» von der damaligen UdSSR (heute Russland) bis auf die Zähne hochgerüstet und ebenfalls mit modernsten Waffensystemen beliefert.
An der Grossmäuligkeit der Araber hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Dass sie auch ein gestörtes Verhältnis zum Arbeiten an den Tag legen, beweisen die Millionenheere von fleissigen Asiaten in den reichen Ölstaaten, die das Staatswesen am Leben erhalten.
So arbeiten rund zehn Millionen Ausländer – also ein Drittel der saudischen Bevölkerung – zum halben Preis einheimischer Arbeitskräfte in Saudi Arabien.
Und dies, obwohl die Arbeitslosigkeit in Saudi Arabien in den vergangenen Jahren explodiert ist; besonders gravierend bei Jugendlichen und Frauen. Etwa 31 Prozent der saudischen Jugendlichen sind arbeitslos. Selbst eine höhere Ausbildung schützt sie nicht vor der Arbeitslosigkeit.
Immerhin haben die saudischen Arbeitslosen genügend Zeit für das Freitagsgebet. Allahu akbar.
Bild: Der legendäre israelische Generalstabschef Mosche Dajan, dritter von Links (stehend) mit Augenklappe. Foto Abraham Vered, National photo collection, Israel

-
30.10.2021 - Tag des Füdlispalts
Corona spaltet die SVP
Die ganze SVP ist gegen das Covid-Gesetz? Nein. Sowohl unter den Parteiexponenten wie auch an der Basis tun sich einige schwer mit der Parole. Und andere finden, man begebe sich in schlechte Gesellschaft.
Die SVP stemmt sich als einzige Partei gegen das Covid-Zertifikat. Weil sie darin «Diskriminierung und Spaltung», den «staatlichen Zugriff auf unseren Körper» und «totale Überwachung» sieht.
Nur: Ganz so einig ist diese Front nicht. Im vermeintlichen Fels des Widerstands gegen «Machtanmassung und Willkür» zeigen sich erste Risse. Das wurde am Mittwochabend deutlich, als die Aargauer Kantonalpartei knapp zwar, aber doch Ja zum Covid-Gesetz sagte.
Achtungserfolg im Thurgau
Gleichentags fasste auch die Thurgauer SVP ihre Parole. Mit 90 Stimmen lehnte sie das Gesetz zwar deutlich ab. Doch angesichts der Tatsache, dass Kantonsrat Hermann Lei (48) sowohl die Nein- als auch – gemäss lokalen Medien eher komödiantisch – die Ja-Seite vertrat, sind die 47 Stimmen für das Gesetz ein Achtungserfolg.
Das hat auch damit zu tun, dass sich respektierte Parteigrössen eher zurückhaltend äussern. So plädierte Ständerat Jakob Stark (63) für Stimmfreigabe, und Nationalrätin Verena Herzog (65) macht keinen Hehl daraus, dass es am 28. November ein Ja braucht.
«Das ist für mich SVP!»
Sie wolle auch, dass wir schnell wieder zur Normalität zurückkehren, sagt Herzog zu Blick. Als Gesundheitspolitikerin sei ihr aber wichtig, dass dies sicher geschehe. «Und es schleckt eben keine Geiss weg, dass die Impfquote einfach zu tief ist, um alle Massnahmen aufzuheben. Das Zertifikat bietet die Chance, wieder ein einigermassen normales gesellschaftliches Leben zu führen.»
Ausserdem, fügt sie an, erlaube es Unternehmen und Veranstalter, wieder arbeiten zu können und ihr Einkommen nicht vom Staat zu beziehen. «Das ist für mich SVP!»
Herzog sagt, dass sie mit dieser Haltung einen Teil der SVP-Wählerschaft abdecke. Sie erhalte viele Mails, «in denen die Anti-Zertifikats-Politik der Partei sehr stark hinterfragt wird».
Mühe mit Rechtsextremen und Holocaust-Leugnern
Wie gespalten die Partei beim Thema Corona ist, ist auch Camille Lothe (27) aufgefallen. «Das Thema ist sehr emotional», sagt die Präsidentin der Jungen SVP Zürich. «Wie man stimmt, hängt davon ab, was man erlebt hat.» Ihre Jungpartei hat die Parole noch nicht gefasst. Eine Prognose mag sie nicht abgeben: «Wie man im Aargau gesehen hat, ist es unvorhersehbar.»
Dass die Junge SVP Schweiz dazu aufgerufen hatte, an der bewilligten Anti-Corona-Demo am vergangenen Samstag in Bern teilzunehmen, nimmt Lothe zur Kenntnis. Die Zürcher Sektion werde bis zur Parolenfassung auf solche Aufrufe verzichten. Unbewilligte Demos seien ohnehin tabu.
Wie ihre persönliche Haltung zum Covid-Gesetz ist, will Lothe nicht sagen – ihr bereitet aber der Verlauf des Abstimmungskampfs Bauchschmerzen, wie sie sagt: «Ich habe extrem Mühe, dass die Kampagne von Massnahmen-Gegnern bestimmt wird. An den Demos sind Rechtsextreme und Holocaust-Leugner dabei. Da sollte man sich gut überlegen, ob man mit denen in einen Topf geworfen werden will.» Schreibt Blick.
Spaltung bei Aluhüten, Weltverschwörungstheoretikern*innen, Esoterikern*innen und sonstigen Po-Pulisten ist ein ganz normaler Vorgang und liegt in der Natur der Sache: Bei Arschlöchern ist der letzte Halt nun mal der Füdlispalt.
-
29.10.2021 - Tag der Hundegagel
Neuer Name: Facebook-Konzern heisst künftig Meta
Der Facebook-Konzern gibt sich einen neuen Namen. Die Dachgesellschaft über Diensten wie Facebook oder Instagram soll künftig Meta heissen, wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Donnerstag bekannt gab. Es gehe darum, das nächste Kapitel des Unternehmens zu schreiben. Zuckerberg hat den US-Konzern 2004 gegründet und zum weltgrössten Internet-Netzwerk aufgebaut.
Mit dem neuen Namen will Zuckerberg den Fokus auf die neue virtuelle Umgebung «Metaverse» lenken, in der er die Zukunft der digitalen Kommunikation – und auch seines Unternehmens sieht.
Auch will er damit den Konzern stärker aus dem Schatten seiner ursprünglichen und bisher wichtigsten Plattform Facebook führen. Zur Firmengruppe gehören neben Instagram auch die Chat-Apps Whatsapp und Messenger. «Wir werden heute als Social-Media-Unternehmen gesehen, aber im Kern sind wir ein Unternehmen, das Menschen verbindet», sagte Zuckerberg. Der Name Facebook habe damit nicht mehr die ganze Angebotspalette des Konzerns widerspiegeln können.
Konzern setzt auf Virtual Reality
Im «Metaverse» sollen nach der Vorstellung des 37-jährigen Facebook-Gründers physische und digitale Welten zusammenkommen. Dabei setzt Zuckerberg zum einen auf die virtuelle Realität (VR), bei der die Nutzer mit Spezial-Brillen auf dem Kopf in digitale Welten eintauchen können. Zum Facebook-Konzern gehört auch die VR-Firma Oculus.
Als «Metaverse»-Baustein sieht der Facebook-Gründer aber auch die sogenannte erweiterte Realität (AR, Augmented Reality), bei der digitale Inhalte auf Displays oder mit Hilfe von Projektor-Brillen für den Betrachter in die reale Umgebung eingeblendet werden. «Wir glauben, dass das «Metaverse» der Nachfolger des mobilen Internets sein wird», betonte Zuckerberg.
Facebook baut seine virtuellen «Metaverse»-Welten unter dem Namen Horizon aus. Bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz Connect gab Zuckerberg die bisher ausführlichste Beschreibung seines «Metaverse»-Konzepts. Es werde eine virtuelle Welt sein, in die man noch tiefer eintauchen könne, bis hin zum Gesichtsausdruck der Menschen, die einen umgeben. «Statt auf einen Bildschirm zu schauen, werden sie mittendrin in diesen Erlebnissen sein.» Das Gefühl, vor Ort zu sein, sei das entscheidende Merkmal des «Metaverse», betonte er. «Wenn ich meinen Eltern ein Video meiner Kinder schicke, werden sie das Gefühl haben, dass sie mit uns zusammen sind.»
Negative Schlagzeilen
Unklar blieb zunächst, mit welchen technischen Mitteln über die VR-Headsets hinaus dieser Präsenz-Effekt umgesetzt werden soll. Der Facebook-Gründer kündigte mit «Horizon Home» ein neues, «sozialeres» Zuhause für Oculus-Nutzer an. Der Bereich sieht allerdings dem Startbereich, den die VR-Brillen-Anwender bereits heute vorfinden, sehr ähnlich. Neu ist, dass Nutzerinnen und Nutzer Räume und virtuelle Gegenstände über die Grenzen von einzelnen Spielen oder Events hinweg nutzen können. Physische Gegenstände werde man einscannen können, damit sie auch im «Metaverse» präsent sind, sagte der Facebook-Gründer.
Zugleich werde man sie als Hologramme überall in die reale Welt projizieren können. In den kommenden fünf bis zehn Jahren werde vieles davon zum Alltag gehören, betonte Zuckerberg.
Facebook geriet in den vergangenen Wochen stark unter Druck durch interne Unterlagen, die von einer ehemaligen Mitarbeiterin öffentlich gemacht wurden. Frances Haugen tritt als Whistleblowerin auf und wirft Facebook vor, Profite über das Wohl seiner Nutzer zu stellen. Schreibt SRF.
Namensänderungen unterliegen einem Naturgesetz. Selbst wenn man einen Hundegagel in «Häufchen» umbenennt: Scheisse bleibt Scheisse.
-
28.10.2021 - Tag des Aargauer SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Gallati
SVP Aargau schert aus und sagt Ja zum Covid-Gesetz - Gallati sei Dank
Die SVP Aargau fasst mit 48 zu 47 Stimmen äusserst knapp die Ja-Parole zum Covid-Gesetz. Das beschloss der Kantonalparteitag am Mittwochabend in Lupfig. Die Aargauer Kantonalpartei ist die erste, die sich bisher dem Widerstand der Mutterpartei gegen das Gesetz entgegenstellt.
Schon die Ausgangslage war speziell am Parteitag der SVP Aargau in Lupfig: Es kommt nicht häufig vor, dass zwei Exponenten derselben Partei gegeneinander antreten. Für das Gesetz sprachen sich unter anderen der kantonale SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Gallati sowie diverse Gemeindepolitiker aus. Für ein Nein traten SVP-Kantonalpräsident und Nationalrat Andreas Glarner, Nationalrätin Martina Bircher und weitere Exponenten ein.
Aussergewöhnlich war auch die Diskussion vor der Parolenfassung: Es gab zahlreiche Voten. Engagiert – teils auch mit heftigen Worten – wollten einzelne Parteimitglieder ihre Kolleginnen und Kollegen von ihrer Meinung überzeugen. Streitpunkt war vor allem die Frage, welcher Weg am schnellsten aus der Pandemie führe.
Dabei beriefen sich beide Seiten auf die «Freiheit». Bringt das Covid-Zertifikat endlich die Freiheit, sich wieder frei bewegen zu können? Oder ist das Zertifikat nicht eher eine unnötige Einschränkung der Freiheit aller Ungeimpften? Dieses brauchte es übrigens, um am Parteitag teilnehmen zu können – weshalb einige Parteimitglieder der Versammlung aus Protest fernblieben.
Niederlage für Andreas Glarner
Das Resultat fiel schliesslich sehr knapp aus: Mit 48 Ja zu 47 Nein fasst die Aargauer SVP die Ja-Parole für die Abstimmung vom 28. November. Ein Antrag auf Stimmfreigabe scheiterte.
Das Ja ist eine Niederlage für Präsident Andreas Glarner, doch er trug es mit Fassung. Gegenüber dem Regionaljournal AG/SO von SRF sagte er: «Ich bedauere es zwar, aber es ist demokratisch korrekt zustande gekommen – obwohl viele Ungeimpfte nicht im Saal waren. Aber das müssen wir akzeptieren. Das ist Demokratie.»
Mutterpartei dagegen
Die Delegierten der Mutterpartei hatten das Nein zum Covid-Gesetz, über das am 28. November abgestimmt wird, bereits im August in Granges-Paccot FR beschlossen. Die SVP unterstützt als einzige Bundesratspartei das Referendum gegen das Covid-Gesetz.
Die SVP bekämpft bei dem Gesetz vor allem die Zertifikatspflicht. In ihrer Plakat-Kampagne setzt die sonst für kontroverse Sujets bekannte Partei auf blosse Text-Plakate wie «Gesellschaft spalten? Nicht mit uns!».
Sie begründete ihre Bedenken damit, dass sich Familien und Leute mit tiefen Einkommen Covid-Tests nicht leisten könnten. Mit einem Test erlangen Menschen – neben der Impfung oder einer durchgemachten Krankheit – ebenfalls vorübergehend ein Zertifikat. Schreibt SRF.
SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Gallati: Endlich einmal ein junger Politiker, der sein politisches Amt zum gesundheitlichen Wohl der gesamten Bevölkerung ausübt. Ohne Rücksicht auf krude Corona-Parolen seiner eigenen Partei.
Pierre Gallati hat bei der Bewältigung der Corona-Krise zusammen mit der Aargauer Kantonsregierung einen hervorragenden Job geleistet.
Das wird ihm von allen Seiten respektvoll attestiert. Ausser von den Aluhüten rund um den «Dummschätzer»* und SVP-Kantonalpräsidenten Andreas Glarner. Sowie den Impfgegner-Apologeten der Mutterpartei rund um die Partei-Granden Blocher und Maurer, denen nichts Besseres einfällt, als die «Freiheitstrychler» für ein paar Wählerstimmen zu missbrauchen.
Was allerdings bei den nächsten National- und Ständeratswahlen durchaus auch in die Hosen gehen könnte. Polizisten und Polizistinnen könnten beispielsweise bis dahin nicht vergessen haben, wie viel Arbeit ihnen durch die Trychler-Demonstrationen aufgebürdet wurde. Vor allem an Wochenenden.
Junge Politiker wie Pierre Gallati stellen die Leuchttürme bei der Wachtablösung der älteren Politsemester durch die Kader der jungen Generation dar. Sie sind dem Allgemeinwohl und nicht dem Parteibuch verpflichtet. Auch nicht der persönlichen Bereicherung und unappetitlichen Pöstchenjägerei**.
Was aber nicht heisst, dass diese hoffnungsvolle Generation junger Politiker*innen sinnvolle Parteibeschlüsse, die ja auch bei der SVP zu finden sind, nicht in den öffentlichen Diskurs einbringen würde. Im Gegenteil: Sie packen sie aus, erklären sie aber schlicht und einfach nicht zum Dogma und suchen den gesellschaftlichen Konsens.
Das ist mehr als nur ein Hoffnungsschimmer für die in letzter Zeit durch Populisten und Weltverschwörungstheoretiker*innen arg gebeutelte Demokratie.
Macht Lust auf mehr. Mehr Gallatis und weniger Aluhüte und Parteibuchgeschädigte.
* https://www.pulverturm-zofingen.ch/news/news-aus-presse/aargauer-svp-nationalrat-andreas-glarner-darf-_dummschwaetzer_-genannt-werden.html
** https://www.blick.ch/politik/damian-mueller-sichert-sich-lobby-mandate-freisinniger-poestchen-jaeger-id15717324.html
-
27.10.2021 - Tag der arbeitslosen Juristen
Neuer Bundestag in Deutschland: Viele Juristen, weniger Unternehmer
Die Zusammensetzung des Bundestags hat sich verändert: Viele Berufsgruppen sind kaum vertreten.
Juristischer Sachverstand ist für die Gesetzgebung von Nutzen. Das immerhin können die mehr als Hundert Rechtsanwälte für sich in Anspruch nehmen, die künftig den Bundestag bevölkern, selbst wenn sie schon seit sieben Jahren keine Akten mehr gewälzt haben. So witzelte ein Standesvertreter von den Grünen am Dienstag auf den Fluren des Reichstages. Aber Rechtsanwälte sind seit jeher gut im Parlament vertreten, auch im neuen Bundestag, der seine konstituierende Sitzung – trotz Wahlrechtsreform – mit der Rekordzahl von 735 Abgeordnete beging.
Jedem noch so unbedarften Beobachter würden wahrscheinlich sogleich einige namhafte Vertreter einfallen: Allen voran SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, Renate Künast von den Grünen oder CDU-Mitglied Friedrich Merz, um nur einige zugelassene Rechtsanwälte zu nennen. Diese Dominanz in Wirkung und Zahl bietet immer wieder Anlass für Kritik. Würde dieses Verfassungsorgan das Volk nicht nur in der Vielfalt seiner politischen Haltungen sondern auch in seiner konkreten Berufswahl repräsentieren, hätte die Bundesrechtsanwaltskammer mehr als 11 Millionen Anwälte unter ihren Fittichen und die deutschen Gerichte wahrscheinlich jede Menge zu tun.
Unternehmerschwund in der Union
Eine Kanzlei, so scheint es, kann für die Dauer einer Legislaturperiode einfacher unbeaufsichtigt bleiben als ein mittelständisches Unternehmen. Firmenlenker ebenso wie Landwirte nehmen immer seltener auf den blauen Stühlen unter der Reichstagskuppel Platz. Jedenfalls hat die Stiftung Familienunternehmer für diese Wahlperiode die Zahl von 51 Unternehmern ermittelt, die sich Zeit für die Politik nehmen. Im alten Bundestag waren immerhin 76 von ihnen vertreten, bei einer Gesamtzahl von 709 Abgeordneten.
Die meisten davon sind diesmal bei der FDP, dicht gefolgt von der AfD. Die Union hatte dagegen einen regelrechten Schwund an Unternehmern zu beklagen: Statt wie in der vergangenen Legislaturperiode 30, schickt sie nur noch 10 von ihnen in die parlamentarische Arbeit.
Das schwindende Engagement der Unternehmer sieht die Stiftung Familienunternehmen naturgemäß mit Sorge, hält sie doch das gegenseitige Verständnis von Wirtschaft und Politik für essenziell für die soziale Marktwirtschaft. Noch besorgter dürften dagegen Erzieher, Theologen oder Naturwissenschaftler sein, die jeweils nur mit einer Handvoll Menschen im Plenum vertreten sind. Ganz zu schweigen von Künstlern, die nicht einmal in der Statistik auftauchen, jedenfalls wenn man Kinderbuchautoren nicht in diese Kategorie fasst und damit den Grünen-Chef Robert Habeck notgedrungen ignoriert.
Das verrät auch, wie wenig repräsentativ die Volksvertreter mit Blick auf das Bildungsniveau sind. Ohne Universitätsstudium schafft es kaum einer den Bundestag, mehr als 88 Prozent der Abgeordneten sind Akademiker. Allerdings ist der neue Bundestag auch wesentlich weiblicher als der alte, der Frauenanteil ist um 4 Prozentpunkte auf 35 Prozent gestiegen. Schreibt die FAZ.
Irgendwo müssen die arbeitslosen Juristen und Juristinnen beschäftigt werden. Wo, wenn nicht in der Politik?
Taxifahrer*in in Berlin ist ja nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, obschon immer mehr Berliner Taxifahrer ein Studium der Jurisprudenz abgeschlossen haben sollen, wie die Bild-Zeitung berichtete.
Ob es sich dabei um Jura-Zertifikate von türkischen oder syrischen Universitäten handelt, wurde nicht erwähnt.
-
26.10.2021 - Tag der No Go-Areas
Wie Frankreichs jüdische Bevölkerung aus den Banlieues vertrieben wird
Heute wohnt Stella Bensignor in einem anonymen Wohnblock eines anonymen Pariser Vororts. Dessen Namen will die jüdische Französin lieber nicht in der Zeitung sehen: "Man weiß ja nie, was diesen Leuten noch alles in den Sinn kommt."
Es war an einem kalten Märztag, als "diese Leute" Stella Bensignor das erste Mal heimsuchten. Sie brachen in ihr Einfamilienhaus in Romainville östlich von Paris ein, stahlen Kreditkarten, Schmuck, Playstation und einen Scooter. Zum Glück wachten weder Stella noch ihr Mann noch ihre drei Kinder auf. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. "Als ich darauf eines Morgens zur Arbeit fahren wollte, hatte jemand in riesigen Lettern 'Jude' und 'Israel' in die Türen meines Autos gekratzt", erzählt Stella, und es kostet sie sichtlich Überwindung. "Ich bekam weiche Knie, begann zu zittern. Und als ich den Wagen danach zum Spengler brachte, stellte er fest, dass die Muttern an den Rädern meines Opel Mokka gelöst worden waren."
Ein guter Rat
Das war zu viel für Stella Bensignor. Sie, die in Romainville auf die Welt gekommen und aufgewachsen war, ist mit ihrer Familie in einen weniger gefährlichen Ort umgezogen. Ihr Entschluss stand fest, als ihr ein Polizist sagte, er gebe ihr einen guten Rat – und zwar als Vater, nicht als Gendarm: "Ziehen Sie weg."
Die Bensignors, die bis heute auf die Festnahme der Einbrecher warten, verließen Romainville so schnell wie möglich. "Wir zogen nicht um, wir traten die Flucht an", betont die 52-jährige Französin, die heute in einem Pariser Schönheitssalon arbeitet. Ihre Wohnung befindet sich in einem siebzehnstöckigen, wenig erbaulichen Block. "Das ist uns egal, wichtig ist: Wir wollen möglichst viele Nachbarn haben", sagt Frau Bensignor, die im Café öfters um sich schaut. Gleich nebenan wohne ein Nordafrikaner, schräg gegenüber eine afrikanische Familie. "Wir verstehen uns bestens, nehmen auch Postsendungen entgegen, wenn die anderen nicht da sind."
Und die Angst vor antisemitischen Attacken? "Ich hoffe, dass das nicht hierher kommt", sagt die energische, in Schwarz gekleidete Französin. "In unserem Viertel, wo das einfache Volk lebt, redet niemand von Religion. Ob der Metzger halal ist oder der Bäcker koscher, spielt hier zum Glück noch keine Rolle."
Keine Juden mehr
Anderswo schon. In einzelnen Orten oder Vierteln der endlosen Pariser Banlieues leben heute keine Jüdinnen und Juden mehr. 20.000 von ihnen seien in den letzten Jahren um- oder weggezogen, schätzt die BNVCA, die Anlaufstelle für antisemitische Gewaltakte. Der Demoskop Jérôme Fourquet listete in einem Buch ein paar Beispiele des lokalen Aderlasses in den sogenannten "schwierigen" Banlieue-Orten auf: In Aulnay-sous-Bois sank die Zahl der jüdischen Familien in den letzten fünfzehn Jahren von 600 auf 100, in Blanc-Mesnil von 300 auf 100, in Clichy-sous-Bois von 400 auf 80.
Die meisten sind innerhalb Frankreichs umgezogen, etwa in den kleinbürgerlichen 17. Pariser Bezirk, der in wenigen Jahren zu einem Magnet für Juden aus den Banlieues geworden ist. Andere haben gleich die "Alya" vollzogen, den Auszug nach Israel. Und jene jüdische Eltern, die in Frankreich bleiben, schreiben ihre Sprösslinge in die boomenden jüdischen Privatschulen ein. Wie auch Stella Bensignor: "Wir hatten keine Wahl, obwohl meine Kinder keinerlei Kippa trugen."
Schwierige Statistik
Genaue Zahlen über den jüdischen Exodus kennt niemand, denn Frankreich führt aus Prinzip keine ethnischen oder religiösen Statistiken. Unbestreitbar ist: Seit der Dreyfus-Affäre vor gut einem Jahrhundert und seit den Judenverfolgungen unter dem Vichy-Regime des Zweiten Weltkriegs fühlen sich die französischen Juden – welche die größte jüdische Gemeinschaft Europas bilden – erstmals wieder bedroht. Existenzbedroht.
Am Dienstag beginnt in Paris der Prozess gegen den Mörder von Mireille Knoll, einer jüdischen Pariserin, die der KZ-Deportation in Paris 1942 knapp entronnen war. Sie war 2018 von einem Bekannten zu "Allahu akbar"-Rufen erstochen worden, wobei laut einem Komplizen Geldneid ein Motiv abgegeben habe.
Laut der Staatsanwaltschaft spielte Antisemitismus auch bei einem Fall von Homejacking in Livry-Gargan mit. In dem verarmten Vorort im Nordosten von Paris brachen fünf Täter bei jüdischen Rentnern ein. Sie fesselten sie und pressten ihnen mit Schlägen die Kreditkartencodes ab – "weil die Juden Geld haben", wie sie nach ihrer Festnahme aussagten.
"Bagatellisiert"
Umstrittener ist der Tod von Sarah Halimi. Die jüdische Rentnerin war von ihrem Nachbar 2017 über den Balkon in den Tod gestürzt worden. Der junge Malier erklärte der Polizei, er habe den "Sheitan" (Teufel) austreiben wollen. Trotz heftiger Proteste der jüdischen Gemeinschaft wurde er für unzurechnungsfähig erklärt und psychiatrisch interniert. Frau Bensignor ärgert sich: "Bei jedem Gewaltakt wird der Antisemitismus zuerst in Abrede gestellt, dann bagatellisiert."
Soeben hat sie Neuigkeiten aus ihrem Herkunftsort Romainville erhalten. In 50 Briefkästen fanden sie Mitte Oktober Kopien alter "Juderei"-Karikaturen, auf die Dinge geschmiert waren wie "jüdische Bankergauner" oder "Alles Juden, alles Sozis". Der Täter, laut einer Überwachungskamera ein älterer Mann, klingt eher nach Rechtsextremist als nach Salafist; gefasst ist er noch nicht.
Stella Bensignor seufzt und sagt, sie sei wirklich froh, aus Romainville weggezogen zu sein. "Geflohen", korrigiert sie sich selber. Schreibt DER STANDARD.
Wer immer aus den Banlieues «vertrieben» wird, kann aufatmen. Es handelt sich hier ja nicht um eine «Vertreibung» aus dem Paradies, sondern wohl eher um eine gezielte Flucht aus der Hölle.
Frankreich erlebt schon seit längerer Zeit die Folgen des Algerien-Kriegs aus den Jahren 1954 bis 1962. Als Früchte der aus diesem Krieg resultierenden Massenimmigration aus Algerien und weiteren ehemaligen Kolonialgebieten Frankreichs auf dem afrikanischen Kontinent wuchsen die sogenannten Banlieues aus dem Boden. Satellitenstädte mit unzähligen Hochhausbauten, die sich spätestens mit dem Aufwachsen der zweiten Generation der Migranten zu Armuts- und Elendsquartieren entwickelten.
Inzwischen sind die «No Go-Areas» von extremen Muslimgruppen okkupiert worden. Dass die Banlieues kein Hort friedlichen Zusammenlebens zwischen Muslimen und Juden sein können, ist nur logisch. Wie sollte etwas in Frankreich gelingen, was nicht einmal zwischen Israel und den Palästinensern funktioniert?
-
25.10.2021 - Tag der arbeitslosen Eritreer
«Firmen wollen nur möglichst billige Fahrer finden» – Schweizer Chauffeuren lupfts den Deckel
Schweizer Lastwagenfahrer sind unzufrieden mit ihren Mindestlöhnen. Der Verband Les Routiers Suisses will nun die Sozialpartnerschaft mit dem Nutzfahrzeugverband Astag beenden.
In Grossbritannien sind noch immer viele Supermarktregale leer, weil rund 100'000 Lastwagenfahrer fehlen. In Deutschland warnen Experten, in zwei, drei Jahren drohe ein ähnlicher Versorgungskollaps.
Für die Schweiz gab Rolf Galliker (56), Chef der Galliker Transport AG, vergangene Woche im Interview mit SonntagsBlick Entwarnung: «Die Situation ist deutlich besser als im Rest Europas.»
Laut Galliker besteht hierzulande keine Gefahr von Versorgungsengpässen. Die Schweizer Transporteure hätten früh erkannt, dass sie in die Ausbildung des Personals investieren müssen. «So haben sie es geschafft, den Chauffeurberuf attraktiv zu halten.»
Die Transportfirmen anderer westeuropäischer Staaten hätten die Ausbildung im eigenen Land komplett vernachlässigt und jahrelang fast ausschliesslich günstige Fahrer aus Osteuropa eingestellt. Galliker: «Natürlich werden teilweise auch hierzulande Fahrer aus Osteuropa eingestellt. Den Grossteil rekrutieren wir allerdings in der Schweiz.»
Suche nach noch billigeren Arbeitskräften im Ausland
David Piras (54), Generalsekretär von Les Routiers Suisses, dem Berufsverband der Chauffeure, will diese Aussagen nicht unkommentiert lassen. «Für die Firma Galliker mag das stimmen, die haben tatsächlich eine nachhaltige Strategie und genügend Chauffeure, die in der Schweiz leben. Leider gibt es aber auch sehr viele Schweizer Transporteure, die nur darauf aus sind, möglichst günstiges Personal im Ausland zu rekrutieren.»
Geärgert hat Piras insbesondere ein aktueller Beitrag in der «Tagesschau». Darin beklagte sich Daniel Schöni, Inhaber der gleichnamigen Transportfirma, über den Mangel an LKW-Fahrern in der Schweiz. Er machte deshalb vor der Kamera einen brisanten Vorschlag: «Vielleicht müssen wir schulisch zurückfahren und praktisch hochfahren: Asylanten, Leute, die vielleicht am Rand sind, zweiter Arbeitsmarkt.»
Unterstützung erhält Schöni vom Nutzfahrzeugverband Astag. «Irgendeinmal kann man den Bedarf mit Fachleuten aus Europa nicht mehr abdecken», so Vizedirektor Gallus Bürgisser in der «Tagesschau». Stattdessen könne man aber vielleicht auf Leute von noch weiter weg zurückgreifen. Im Klartext: auf Fahrer aus Afrika.
Verbandschef Piras empören diese Aussagen: «Anstatt dafür zu sorgen, dass Lastwagenfahrer in der Schweiz anständige Arbeitsbedingungen erhalten, denken die Transportfirmen nur darüber nach, wie sie irgendwo auf der Welt noch billigere Arbeitskräfte finden können.»
«Es muss jetzt etwas geschehen.»
Das sei aus Sicht der Schweizer Chauffeure absolut inakzeptabel – zumal sich Les Routiers Suisses in den Verhandlungen mit der Astag seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen einsetzten, insbesondere für höhere und allgemeinverbindliche Mindestlöhne. Piras: «Wir haben aber bereits Mühe, bei den Mindestlöhnen auf 20 Franken pro Stunde zu kommen, in gewissen Regionen liegen wir gar darunter.»
Da die Astag nicht verhandeln wolle und versuche, die Angelegenheit schönzureden, sehe man in der Zusammenarbeit keinen Sinn mehr. Piras: «Wir werden deshalb in Kürze über die Weiterführung der Sozialpartnerschaft entscheiden. Aktuell sieht es nach Kündigung aus.»
Die Astag zeigt kein Verständnis für diese Kritik. «Unsere Branche zahlt anständige Löhne», sagt Vizedirektor André Kirchhofer (41). Der Bund habe der Branche jüngst wieder ein gutes Zeugnis ausgestellt. Demnach lägen «keine gesamtschweizerischen Probleme» vor.
Die langjährige Sozialpartnerschaft mit Les Routiers Suisses werde von der Astag geschätzt. «Die Zusammenarbeit mit den Sektionen und der Basis verläuft sehr gut», so Kirchhofer. Zur Prüfung der aktuellen Forderungen habe man zudem eine Arbeitsgruppe eingesetzt.
David Piras von Les Routiers Suisses ist das Warten jedoch leid. «Es muss jetzt etwas geschehen, sonst gehen wir in Zukunft andere Wege.»
Es klingt wie eine Drohung. Schreibt Blick
«Irgendeinmal kann man den Bedarf mit Fachleuten aus Europa nicht mehr abdecken.» Stattdessen könne man aber vielleicht auf Leute von noch weiter weg zurückgreifen. Im Klartext: auf Fahrer aus Afrika. Sagt der Knorrli und Vizedirektor Gallus Bürgisser von Astag.
Hat der Gallus wirklich noch alle Tassen im Schrank? Wieso Lastwagenfahrer aus Afrika holen? Die sind ja schon längst da.
Ende September 2021 lebten in der Schweiz rund 29'100 anerkannte Flüchtlinge aus Eritrea, ein Grossteil davon arbeitslos und als Sozialhilfebezüger*innen. Damit war Eritrea das Herkunftsland mit den meisten anerkannten Flüchtlingen.
-
24.10.2021 - Tag der Ode von Blocher an die Hode
Christoph Blocher und die Freiheits-Trychler
Am 11. Oktober habe ich mir aus Anlass meines Geburtstages einen freien Tag bewilligt. Da herrliches Herbstwetter herrschte, unternahm ich mit meiner Frau einen Ausflug auf den Bachtel im Zürcher Oberland. Wieder zuhause erreichte mich überraschend die Botschaft, dass mir die Freiheits-Trychler ein Geburtstagsständchen bringen möchten.
Sie hatten sich extra aus der Urschweiz auf den Weg gemacht und überreichten mir eine Trychler-Chutte mit der Aufschrift: «Für Christoph Blocher – aus Dank für das EWR-Nein».
Tatsächlich sind die Trychler allgemein zuverlässige Stützen der schweizerischen Freiheit und Selbstbestimmung. Die Trychler – die Freiheits-Trychler gab es damals noch nicht – haben 1992 gegen den Widerstand der gesamten Classe politique mitgekämpft, dass Volk und Stände den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), und damit zur EU verwarfen. Sie haben geholfen, einen staatspolitischen Unsinn zu verhindern. Sie standen nicht auf der Seite der massgebenden Politiker, Parteien, Verbände, Medien und Kulturschaffenden.
Nein, sie standen auf der richtigen Seite. Die Trychler sind keine Gelehrten, Intellektuellen und Theoretiker. Sondern sie stehen im wirklichen Leben und stellen ihren Mann wie ihre Frau – als Handwerker, Landwirte, Verkäuferinnen und Haufrauen. Ich habe grossen Respekt vor dem, was sie tun, und vor dem, wie sie denken.
Zuoberst steht für sie die persönliche Freiheit. Einem der anwesenden Trychler wurden bei einem Umzug in Bern zwei Zähne ausgeschlagen, und zwar durch einen «Linksautonomen», der sich wie ein blindwütiges Kind benommen habe. Ich selber bin gegen Covid geimpft und besitze das Zertifikat. Aber ich wehre mich dagegen, jene zu verteufeln und zu verachten, die eine andere Meinung vertreten. Seien es nun Freiheits-Trychler oder einzelne Bundesräte. Schreibt Christoph Blocher in seiner wöchentlichen Kolumne.
Eine Ode an die Hode – mit der Schachtel auf den Bachtel
Der Herausgeber von einigen Gratiszeitungen, die nun wirklich niemand braucht und kaum jemand liest, feierte seinen 81. Geburtstag auf dem Bachtel mit einer Schachtel Basler-Läckerli aus dem «Läckerli Huus», das seiner Tocher Miriam Baumann-Blocher gehört.
Zu seinem Wiegenfest wünschen wir nachträglich dem alt-Bundesrat und SVP-Gründer alles Gute, weiterhin viel Glück und Gesundheit.
Dass die Trychler keine Gelehrten sind, also nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte, hätte der grosse Zampano vom Herrliberg in seiner Kolumne nicht erwähnen müssen. Das war schon seit jeher bekannt.
Besonders putzig ist sein Hinweis, dass ein «Linksautonomer» einem Trychler in Bern anlässlich der Demonstration – bei Blocher «Umzug» genannt – angeblich zwei Zähne ausgeschlagen hat.
Weisheitszähne können es bei einem«nicht Gelehrten» wohl kaum gewesen sein. Da scheint der Trychler-Ikone des EWR-Neins aus dem letzten Jahrhundert ein Naturgesetz nicht mehr präsent zu sein, das älter ist als er selbst: «Wo gehobelt wird, fallen Zähne».
Bei diesem wehleidigen Gesäusel um zwei vernachlässigbare Trychler-Zähne erstaunt, dass die Trychler neuerdings ausgerechnet mit den «Linksautonomen» der Antifa gemeinsam gegen die Coronamassnahmen des Bundes in Bern demonstrieren.
Im letzten Satz seiner «Verlegerkolumne» lässt der Gesalbte vom Herrliberg allerdings aufhorchen: Mit einer Solidarität sondergleichen, die man normalerweise nur vom Papst kennt, zeigt er Verständnis für die «schwarzen Schafe» der Ungeimpften. Seien es seine Trychler oder «einzelne Bundesräte», wie der Herr aller seltsamen Dinge schreibt.
Hoppala! So lancieren Populisten ihre Verschwörungstheorien. Ob da wohl mit «einzelne Bundesräte» sein ehemaliger SVP-Parteipräsident und Trychler-Versteher Ueli Maurer gemeint ist?
-
23.10.2021 - Tag des portugiesischen Exodus
Saudade? Warum viele Portugiesen Luzern den Rücken kehren
Jeder zehnte Ausländer im Kanton Luzern ist ein Portugiese. Doch wie lange noch? Seit Jahren wächst die Zahl der Portugiesinnen, die der Schweiz den Rücken kehren. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Einwanderungen. Was passiert in der portugiesischen Gemeinde? zentralplus ging auf Spurensuche.
In den Kanton Luzern wird fleissig eingewandert. Rund 4’800 Personen zogen 2020 aus dem Ausland in den Kanton Luzern, um hier ihren Wohnsitz anzumelden. Dies zeigen Zahlen des Luzerner Statistikportals Lustat. Gleichzeitig verliessen rund 4’100 Personen den Kanton Luzern in Richtung Ausland. Unter dem Strich bleibt somit ein positiver Wanderungssaldo.
Die Zahlen von Lustat zeigen aber auch auf, dass sich dieser Trend nicht über alle Nationalitäten hinwegzieht. Denn bei Personen mit portugiesischer Herkunft verhält es sich genau umgekehrt. Deutlich mehr Portugiesen haben 2020 den Kanton in Richtung Ausland verlassen als im gleichen Zeitraum nach Luzern eingewandert sind. Keine andere Nationalität weist einen negativeren Wanderungssaldo auf.
Haben die Portugiesinnen Heimweh? «Saudade», wie dieses nostalgische, wehmütige Gefühl auf Portugiesisch ausgedrückt wird, für das es auf Deutsch keine exakte Übersetzung gibt?
Ebenso wenig gibt es für diese Frage eine exakte Antwort. Denn die Gründe für den Portugiesen-Exodus sind kompliziert – und hinterlassen manche Betroffenen in einer verzweifelten Situation.
Keine genügend hohe Rente
Das erklärt Monica Dantas (31), Sekretärin bei der portugiesischen Mission Luzern. Durch ihre Arbeit bei der Mission steht sie im direkten Austausch mit anderen Portugiesinnen und kennt die Sorgen der portugiesischen Gemeinde daher aus erster Hand: «Viele Portugiesen haben in den vergangenen Jahren das Rentenalter erreicht. Doch wir haben erlebt, dass bei vielen die finanziellen Mittel nicht genügend gross sind, um einen angenehmen Ruhestand in der Schweiz geniessen zu können.»
Dantas spricht damit die Portugiesinnen an, die in den 80er-Jahren aufgrund der wirtschaftlichen Perspektiven in die Schweiz eingewandert sind. Viele dieser Personen, die während 40 Jahren auf dem Bau, in der Gastronomie oder als Reinigungskräfte gearbeitet haben, kommen nun ins Rentenalter. Und geraten damit in eine Situation, die die 31-Jährige als Zwiespalt beschreibt: «Wollen sie in der Schweiz bleiben und jeden Rappen zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Oder nach 40 Jahren der Schweiz den Rücken kehren und in Portugal einen vergleichsweise komfortablen Ruhestand geniessen?»
Dantas zieht hierzu Beispiele von Betroffenen aus der portugiesischen Mission Luzern heran: Ein älteres Ehepaar musste rund 600 Franken für die Krankenkassenprämien zahlen. Diese Prämien alleine entsprechen in Portugal bereits dem Mindestlohn. Hinzu kommen in der Schweiz Ausgaben für die Miete und Steuern. Das Paar habe die Schweiz letztlich aus finanziellen Gründen verlassen. «Es ist klar, dass die finanziellen Möglichkeiten in der Schweiz und in Portugal in keinem Vergleich zueinander stehen», erklärt die in Emmenbrücke wohnhafte Dantas.
Sie erwähnt ein anderes Paar, das zwar noch nicht pensioniert, aber seit der Corona-Pandemie arbeitslos ist. Beide haben in einem Hotel gearbeitet, er als Portier, sie in der Hauswirtschaft. Ihnen wurde während der Pandemie gekündigt. Beide sind schon über 50. «Sie mögen sich nicht mehr mit RAV-Angelegenheiten auseinandersetzen. Sie können nicht gut Deutsch und wissen nicht, wie man eine Bewerbung per Mail verschickt. Darum gehen sie jetzt nach Portugal zurück und arbeiten dort etwas anderes, bis ihnen die Rente aus der Schweiz ausbezahlt wird», erzählt Dantas.
Herz gegen Kopf
Also ist die Rückkehr nach Portugal offenbar ein einfacher Entscheid, zumindest wirtschaftlich betrachtet. Doch auf emotionaler Ebene ist es eine herzzerreissende Entscheidung. Denn viele dieser Portugiesen bezeichnen die Schweiz längst als ihr Zuhause, haben Kinder und Enkel hier, die selbst Fuss gefasst haben in der Schweiz.
Gleichzeitig hat sich auch Portugal verändert in dieser Zeit. «Es ist wie eine zweite Auswanderung für die Älteren. Sie lassen ihre Familie in der Schweiz zurück und haben in Portugal mittlerweile fast keine Familie oder Freunde mehr», beschreibt Dantas diesen zweiten Zwiespalt, vor dem die ältere Generation steht.
Die Sekretärin der portugiesischen Mission weiss das aus eigener Erfahrung. Ihr Vater ist seit einiger Zeit pensioniert, ihre Mutter wird es in wenigen Jahren auch sein. Monica Dantas hat selber Kinder. Auch ihre Eltern stehen bald vor der Frage, wo sie ihren Ruhestand verbringen wollen. «Als Tochter will ich diesen Entscheid nicht beeinflussen. Ich will nicht, dass sie nur unseretwegen in der Schweiz bleiben und dafür auf einen komfortablen Ruhestand verzichten müssen.»
Letztlich sei es die altbekannte Frage, auf was die Eltern von Monica Dantas hören sollen: Auf das Herz, das für einen Verbleib in der Schweiz spricht? Oder auf den Verstand, der eine Rückkehr nach Portugal wegen der finanziellen Situation sinnvoll erscheinen lässt.
Leicht fällt diese Entscheidung niemandem. Und auch Dantas selbst ist hin- und hergerissen: «Es tut natürlich weh, wenn sie gehen. Doch es tut auch weh, wenn ich sehe, dass sie hier leiden. Nach 40 Jahren harter Arbeit sollen sie ihren Ruhestand geniessen dürfen.» Ein schwierig zu beschreibender Gefühlszustand. Saudade eben. Schreibt ZentralPlus.
Was der Artikel von ZentralPlus bis auf einen Hinweis (Ehepaar, das in einem Hotel arbeitet) verschweigt:
Die Portugiesen stellen laut Statistik vom September 2021 nach dem Balkan (Kroatien, Türkei, Serbien, Bosnien Herzegowina, Mazedonien, Kosovo, Albanien: 11'754 Personen) und Italien (7'229 Personen) mit 5'901 Personen die grösste Gruppe ausländischer Arbeitnehmer*innen bei der Schweizer Arbeitslosigkeit. Gefolgt von Deutschland (5'869 Personen) und Afrika (4'020 Personen). Tausende von Ausgesteuerten, die inzwischen in der Sozialhilfe gelandet sind, nicht eingerechnet.
Durch die Folgen von 2015/2016 herrscht auf dem Schweizer Niedriglohnsektor ein mörderischer Kampf um die Jobs. Das zwingt wohl viele Portugiesen, der Schweiz den Rücken zu kehren, um anderswo ihr Glück zu suchen.
Dass die mit Billiglöhnen erzielbaren Renten im Hochpreisland Schweiz zum Sterben zu viel, zum Leben jedoch zuwenig hergeben, ist eine altbekannte Tatsache. Eine Rückkehr portugiesischer Pensionäre*innen ins wesentlich günstigere Portugal ist demzufolge nur logisch.
-
22.10.2021 - Tag der Impfmuffel*innen
Es geht weiter mit den dezentralen Impfstandorten im Kanton Luzern!
Diese Woche am Freitag und Samstag im Hotel Sonne, Reiden und in der Mall of Switzerland. Öffnungszeiten und weitere Infos unter lu.ch/covid_impfung. Schreibt der Kanton Luzern in seiner Medienmitteilung.
Liebe Liebende, Nichtgeimpfte und Trychler-Hömmli-Träger*innen
Gehet einfach hin und zeigt für einmal ein klein wenig Solidarität mit der Gesellschaft. Für Euch ist es nur ein schmerzloser Pieks, für die Schweizer Bevölkerung hingegen ein weiterer Schritt zur Normalisierung.
Lasset Euch nicht länger von üblen Partei-Interessen, Esoterikern*innen und abstruser Weltverschwörungs-Kakophonie beeinflussen und missbrauchen.
Ja, es sterben Menschen trotz Covid-Impfung. Ich wage allerdings zu behaupten, dass die überwiegende Mehrheit davon nicht an Corona stirbt, sondern mit Corona. Ist nämlich das Immunsystem erst einmal ruiniert, lebt es sich in der Tat nicht mehr ungeniert. Da hilft auch eine Impfung kaum mehr weiter. War schon immer so, auch in ganz normalen Grippezeiten, und wird auch immer so bleiben.
Oder habt Ihr noch vor zwei Jahren je eine Statistik bejammert, die im Winter die Grippetoten aus der Altersgruppe der Ü70-Jährigen aufgelistet hat? Nein! Es gab auch keine Live-Ticker-Berichterstattung zu diesem Thema. Warum? Weil der Tod von älteren Menschen zur Normalität gehört.
Ich weiss wovon ich als Mitglied der vulnerablen Gruppe der Ü30-Jährigen spreche. Sollte ich, der ich mit Moderna geimpft bin, irgendwann in der BAG-Statistik der geimpften Corona-Toten auftauchen, betrauert mich nicht. Denn mit Corona hätte das nichts zu tun. Dafür aber mit meinem Immunsystem, das ich mit dem Rauchen von Zigaretten über Jahrzehnte hinweg bis zum heutigen Tag mit grosser Wahrscheinlichkeit etwas ruiniert habe und demzufolge auch dereinst rauchend aus dem Kamin des Krematoriums ins Nirvana entschwinden werde.
«Der Tod eines alten Menschen birgt keine Tragik. Vergeben wir ihm also seine Fehler und danken wir ihm für seine Liebe» schrieb Polo Hofer in seinem Abschiedsbrief kurz vor dem Tod.
Dass das Schicksal auch bei mir als «Hochheiliger» irgendwann den Hobel ansetzt, ist ein Naturgesetz. Oder wie Ludwig Hirsch singt: «Komm, grosser schwarzer Vogel. Komm.»
Frei von jeglichem Zynismus: So viel Wahrheit muss sein!
-
21.10.2011 - Tag des Versagens von Bundesrätin Keller-Sutter
Tatverdächtiger Algerier nach Diebstählen aus parkierten Fahrzeugen dank Polizeihund Capo in Willisau festgenommen
Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, kurz vor 03:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Willisau ein Mann beobachtet werde, welcher sich an parkierten, unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen mache. Im Rahmen der Fahndung nach dem unbekannten Mann konnte der Polizeihund Capo eine Fährte aufnehmen. Nach mehreren hundert Metern konnte der gesuchte Mann im Gebiet «I der Sänti» gestellt und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Algerier. Er trug bei der Festnahme mutmassliches Deliktsgut auf sich. Zurzeit laufen die entsprechenden Ermittlungen und Abklärungen.
Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.
Unverschlossene Fahrzeuge bilden eine einfache Gelegenheit für potenzielle Diebe, um an Bargeld oder kleinere Gegenstände zu gelangen.
Die Luzerner Polizei weist deshalb auf folgendes hin:
• Schliessen Sie Ihr Auto stets ab, auch wenn Sie es nur für kurze Zeit verlassen.
• Verwahren Sie den Autoschlüssel so, dass er nicht in falsche Hände geraten kann.
• Nutzen Sie für Ihr Auto wenn möglich gut beleuchtete und übersichtliche Parkplätze.
• Lassen Sie keinerlei Wertsachen im Auto zurück, weder sichtbar noch im Kofferraum.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer gestrigen Medienmitteilung
Und täglich grüsst das Murmeltier, pardon der Algerier. Würde Bundesrätin Karin Keller-Sutter ihren Worten Taten folgen lassen und ihre Pflicht erfüllen, hätte der wunderschöne und kluge Polizeihund Capo etwas mehr Freizeit.
Warum die mehr als 600 abgewiesenen Asylbewerber aus Algerien noch immer in der Schweiz ihr Unwesen treiben, grenzt an Politikversagen, gnädige Frau Bundesrätin. Den Göttern sei Dank, dass uns die Luzerner Polizei und der wunderbare Capo vor diesen Kriminellen beschützen, nachdem Sie dazu nicht in der Lage sind.
Zwischen Schein und Sein Ihrer Pressekonferenzen, die eher ein Hochamt der Selbstbeweihräucherung darstellen, klafft eine grosse Lücke Frau Bundesrätin. Aber das sind wir uns inzwischen von FDP-Politikern*innen ja längst gewohnt.
-
20.10.2021 - Tag der Datenkracke MIGROS
Die MIGROS wandelt auf Mark Zuckerbergs Spuren
Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Als MIGROS-Kunde*in haben Sie vor Jahren irgendwann im Überschwang Ihrer Gefühle für den orangen Riesen den wöchentlichen Newsletter über die Wochenhits bestellt. Eigentlich bis anhin eine gute Entscheidung. Erhielt man doch von der MIGROS dadurch wertvolle Informationen über Produkte und Aktionen, die gerade aktuell sind. Möglicherweise sogar zu reduzierten Preisen. Produkte, die man beim Schnelldurchlauf beim Einkauf öfters nicht auf dem Radar hat.
Doch seit einigen Wochen nervt die MIGROS im zweiwöchigen Rhythmus mit einem E-Mail. Wer sich nicht mit einem «registrierten Migros-Account» bei Gottlieb Duttweilers Nachkommen angemeldet hat, soll dies bitte sehr nachholen. Wer sich dem schamlosen Erpressungsversuch nicht beugt, erhält in Zukunft keinen Newsletter mehr.
Man darf sich fragen, was die öfters übers Ziel hinausschiessende Marketingabteilung der MIGROS – man denke nur mal an die völlig missglückte Dubler-Mohrenkopf-«Affäre» – mit dieser Nötigung ihrer Kunden bezweckt. Die Antwort ist relativ einfach. Mehr persönliche Daten! Als ob die MIGROS über die Cumulus-Karte nicht schon genug davon hätte.
Nachdem sie exakt weiss, welches Gemüse und Fleisch ich bevorzuge, ob ich nach dem Rasieren ein After Shave oder Parfüm verwende (es ist ein After Shave, gällid)und dass ich ausschliesslich XXL-Size-Kondome (mit Noppen) einkaufe, will die Datenkracke MIGROS noch mehr. Vermutlich von Telefonnummer über Schuhgrösse bis hin zum bevorzugten Pornokanal und Haarfarbe so ziemlich alles. Mark Zuckerberg und Facebook lassen grüssen.
Nachdem ich laut der Luzerner Staatsanwaltschaft einen Doktortitel führen darf, wurde mir von einem Facebook-User sogar der Titel «Hochheiliger» verliehen. So verzichte ich denn in «Gottes Namen» künftig auf den MIGROS-Newsletter. Sollten Sie eigentlich auch machen, wenn Sie der MIGROS nicht noch mehr persönliche Daten liefern wollen. Zuckerberg, Google und Microsoft wissen schon genug über Sie. Vermutlich mehr als Ihnen lieb ist.
Wie sagt eine alte Marketingweisheit so schön wie zutreffend: «Never change a running system!» Das müssen die Marketingtanten der MIGROS mit ihren etwas unglücklichen Händchen noch lernen, bevor irgendwann der Datenschützer eingreift.
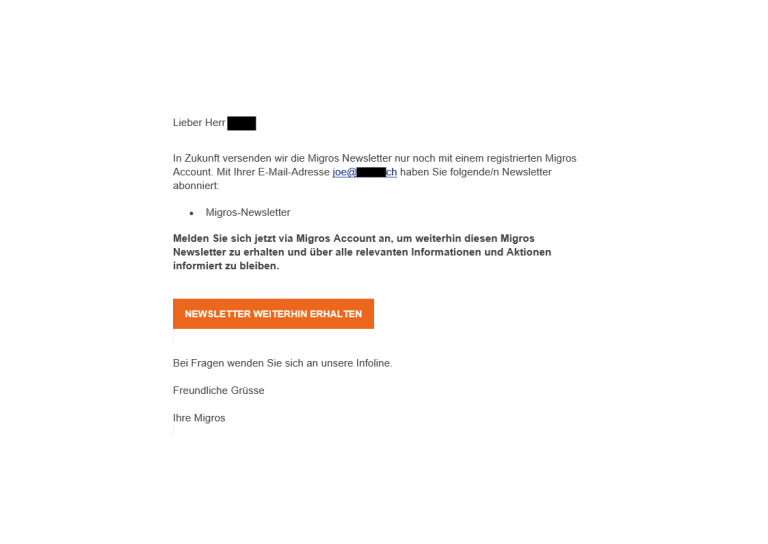
-
17.10.2021 - Tag der Coronaimpfung in der Moschee
Bund setzt auf Moscheen, Fussballclubs und Turn- und Schützenvereine: Letzte Hoffnung für die Impfoffensive
Eine Million Menschen will der Bundesrat mit seiner Anti-Covid-Offensive zur Impfung bewegen. Die Umsetzung liegt jedoch bei den Kantonen. Und die sind alles andere als begeistert.
Wenn es beim Impfen nicht vorwärtsgeht, drohen der Schweiz weitere Corona-Tote. Gemäss Modellrechnungen des Europäischen Zentrums für Seuchenprävention und Kontrolle sind bei einer Durchimpfung von lediglich 60 Prozent – der Quote, um die sich die Schweiz derzeit bewegt – Hospitalisationen in einer Höhe zu erwarten, die den Rekordstand vom Winter 2020/21 überschreiten.
Um ein solches Fiasko abzuwenden, wechselte der Bundesrat diese Woche in den Alarmmodus. Die angekündigte Impfoffensive, so eine Person aus dem Umfeld der Landesregierung, «ist der letzte Schuss – und der muss sitzen».
Tausende Tote vor einem Jahr
Zur Erinnerung: Bei der zweiten Infektionswelle, die vor rund einem Jahr durch die Schweiz rollte, starben fast 8000 Menschen am Coronavirus. Die Spitäler waren am Limit, in den Krematorien stapelten sich die Särge. Erst durch drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelang es ab Mitte Dezember, die Infektionsraten wieder sinken zu lassen.
Heute sind mehr als 90 Prozent der hospitalisierten Corona-Patienten ungeimpft, dennoch verwandelte sich der Impfschnellzug nach den Sommerferien zur Bummelbahn.
Nun soll es die viel diskutierte Impfoffensive richten – und die Schweiz vor dem Schlimmsten bewahren. An Geld wird es nicht fehlen: Der Bundesrat hat am Mittwoch ein Budget in Höhe von 100 Millionen Franken dafür gesprochen. Auch das Ziel ist hochgegriffen: Damit die immer noch geltenden Schutzmassnahmen aufgehoben werden können, soll die Impfrate bei den über 65-Jährigen auf etwa 93 Prozent und bei den 18- bis 65-Jährigen auf 80 Prozent zunehmen.
Eine Million zusätzlich Geimpfte nötig
Die ambitionierte Vorgabe lässt sich konkret beziffern: In den kommenden Wochen müssen fast eine Million Menschen dazu gebracht werden, sich impfen zu lassen. Erst dann ist für den Bundesrat eine Rückkehr zur Normalität denkbar.
Eigentliches Kernstück der Offensive ist eine Impfwoche, die zwischen dem 8. und 14. November dezentral in der ganzen Schweiz anberaumt werden soll. Der Bundesrat erhofft sich davon eine Grossmobilisierung der Landbevölkerung. Für die konkreten Projekte indes sind die einzelnen Kantone verantwortlich. Bis Dienstag haben sie Zeit, dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) Projekte zu präsentieren. Tags darauf sollen in einem Workshop Nägel mit Köpfen gemacht werden – bis Mittwochabend soll ein erstes Konzept für die nationale Spritz-Tour stehen.
Vereine im Vordergrund
Recherchen von SonntagsBlick ergaben: Im Zentrum der Impfwoche sollen ländliche Vereine stehen. Die Impfbotschaft soll über Fussball- und Hockeyklubs, Turn- und Schützenvereine zu den Menschen gebracht werden. Denkbar ist, dass eine Fachperson vor dem Training einen Vortrag hält – im Idealfall kann aber auch ein Trainer seinen Schützlingen die Vakzination ans Herz legen.
Ebenfalls im Vordergrund stehen Kulturvereine und Moscheen. Denn wie bei den jungen Erwachsenen liegt die Impfquote auch bei Migranten bedenklich tief. Deshalb sollen sie noch gezielter angesprochen werden als bisher. Der Kanton Aargau legte dem BAG am Freitag erste Skizzen dazu vor, wie Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati auf Anfrage mitteilt. Ziel wäre es, über die Moscheen im Aargau sowie einzelne Würdenträger einen Draht zur muslimischen Bevölkerung zu finden. Dabei könnte das Geld aus Bern beispielsweise für Übersetzungen verwendet werden. Das Vorbild für den Aargau ist Schaffhausen: Dort konnten sich die Gläubigen in einer Moschee bereits direkt nach dem Freitagsgebet für eine Impfung entscheiden.
Kantone kritisch
Festzuhalten bleibt aber: Der Funken aus Bern ist bislang nicht auf die Kantone übergesprungen. Das zeigt eine Umfrage von SonntagsBlick bei allen 26 Ständen. Das Impfziel des Bundesrates sei nicht realistisch, tönt es beispielsweise aus der Westschweiz. Auch in den bevölkerungsstärksten Kantonen Bern und Zürich runzeln die politisch Verantwortlichen derzeit noch die Stirn.
Unklar ist überdies in vielen Kantonen, wie und von wem das medizinische Personal für die geforderte Impfberatung rekrutiert werden soll. Der eigene Personaletat sei ausgeschöpft, heisst es allerorten.
Bund zahlt, Kantone organisieren
Der Bund sagt: «Wir zahlen, ihr organisiert.» Offen ist allerdings, wann die versprochenen Millionen für den letzten Schuss an die Kantone überwiesen werden. Geht es nach dem Bund, ist damit erst im nächsten Jahr zu rechnen. Geht es nach den Kantonen, soll der Aufwand für die Offensive noch im laufenden Jahr vergütet werden.
Die Eidgenossenschaft improvisiert in einem bislang unbekannten Ausmass. Vieles, was im Augenblick verfügt wird oder geschieht, wirkt wie eine Verzweiflungstat. Nichts tun als Alternative klingt jedoch ungleich schlimmer: endlose Einschränkungen im Alltag, überfüllte Spitäler und noch viele zusätzliche Tote. Das kann erst recht niemand wollen. Schreibt der SonntagsBlick.
Impfen in der Moschee: Letzter Halt Füdlispalt?

-
16.10.2021 - Tag der billigen Arbeitskräfte aus dem Ausland
45 Minuten aufs Essen warten? Bergbeizen warnen vor Personalmangel
Diese Saison müsssen sich Touristen in den Skigebieten wohl gedulden. Der Fachkräftemangel sei durch die Pandemie noch verstärkt worden, sagt die Gastrobranche.
Diese Saison sollen Wartezeiten von bis zu 45 Minuten in manchen Bergrestaurants aufgrund des Personalmangels nichts Aussergewöhnliches sein, schreibt der «Blick». Vor allem dort, wo viel Tourismus herrscht, arbeitet im Winter oftmals viermal so viel Personal wie im Sommer. Am Flumserberg im Kanton St. Gallen seien es so im Winter 120 Mitarbeitende. Doch «bei den Fachkräften ist der Markt ausgetrocknet, und bei den Hilfskräften sind grosse Anstrengungen nötig, um die Stellen zu besetzen», sagt Geschäftsführer Mario Bislin der Zeitung.
Fachkräftemangel durch Pandemie noch verstärkt
Fachkräftemangel herrscht grundsätzlich nicht erst seit gestern, doch hat die Pandemie die Lage noch verschlechtert. So werden Hilfskräfte in Polen und Portugal rekrutiert. Tiefe Löhne, unangenehme Arbeitszeiten und lange Schichten bieten wenig Anreiz, viele Angestellte hätten sich zudem während des Lockdowns umschulen lassen. Dem «Blick» seien ausserdem Fälle bekannt, in denen Gastro-Personal im Edelhotel Cervo in Zermatt VS von einem Tag auf den anderen vor die Tür gesetzt wurden. Das Hotel selber äussert sich auf Anfrage von Blick nicht zu den Vorwürfen.
Der Personalmangel soll auch wegen Mangels an Weiterbildungsmöglichkeiten ein Branchenproblem sein. Und bei ausländischen Mitarbeitenden kommt hinzu: die erschwerten Reisebedingungen aufgrund der Pandemie. Bei 30 verschiedenen Nationen käme so einiges zusammen und koste die Restaurantbetreiber einen riesigen Aufwand.
Kommt es wegen des Personalmangels zu längeren Wartezeiten?
Durch die Pandemie erhielten die Betreiber aber auch Anfragen aus dem Ausland: «Schweizer, die in Südostasien, in der Karibik oder auf Kreuzfahrtschiffen keine Beschäftigung mehr finden», schreibt die Zeitung weiter. Im Unterland mussten wegen des Personalmangels über die Sommermonate Betriebe zwischenzeitlich schliessen, dies solle aber nicht auf die Bergbeizen zutreffen. Es könne es aber zu längeren Wartezeiten kommen. Schreibt 20Minuten unter Berufung auf einen Blick-Artikel.
Warum Boulevard-Medien wie Blick und 20Minuten immer und immer wieder diese alarmistischen Artikel über «drohenden Personalmangel» in vorauseilendem Gehorsam für die Think Tanks der Wirtschaft – vor allem aus der Gastronomie – veröffentlichen, wurde schon öfters thematisiert.
Das Bullshit-Gejammer der Gastrobranche ist wirklich langsam unerträglich. Stetiges Widerholen von immergleichen Worthülsen macht die Behauptungen auch nicht wahrer.
Offiziell sind in der Schweiz noch immer mehr als 100'000 Arbeitslose registriert. Inoffiziell sollen es einige Zehntausend mehr sein, würden Ausgesteuerte und Personen in Weiterbildungskursen etc. hinzugezählt. So flüstern es jedenfalls einige Nationalräte – selbst von der SVP! – hinter vorgehaltener Hand.
Laut einer Medienmitteilung des Kantons Luzern im Sommer dieses Jahres sollen allein um die Tausend reguläre Asylanten aus den Jahren 2015/2016 in die kantonale Sozialhilfe gefallen sein, deren schulische Ausbildung im Sommer 2021 ohne künftigen Lehrstellen- oder Arbeitsvertrag endete. Geschätzte Kosten für den Kanton um 30 Millionen Franken. Pro Jahr.
Man darf sich schon langsam fragen, welche Anforderungen im Berufsprofil an die Serviertöchter, Kellner, Rezeptionisten, Köche und das Reinigungspersonal von der Gastrobranche gestellt werden. Matura und Universitätsausbildung werden es wohl kaum sein.
Machen wir uns doch für einmal ehrlich: Es geht in dieser Branche nicht selten einzig und allein um die billigsten Arbeitskräfte aus dem Ausland, die man mit miesen Tricks wie Lohnabzug für Essen und Unterkunft zum Wohle der Gewinnmaximierung zusätzlich noch hereinlegen kann. Gesetzlich absolut legal, moralisch hingegen verwerflich.
Es ist jedenfalls nicht mehr vermittelbar, dass sich unter dem hunderttausendfachen Heer der Arbeitslosen, das notabene auf die ganze Schweiz verteilt ist, keine adäquaten Mitarbeiter*innen finden lassen.
-
15.10.2021 - Tag der Lendengegend
Junge Frauen in China sollen sich um ältere Single-Männer auf dem Land kümmern
Männer haben im 21. Jahrhundert einen schweren Stand. Sie sind schlechter in der Schule, sterben aufgrund ihres risikoaffinen Verhaltens früher, und der jahrtausendealte Vorteil gegenüber Frauen, Körperkraft, zählt im Informationszeitalter nicht mehr viel. In China ist das nicht anders. Besonders hart trifft es die Untergruppe "alleinstehende Männer in ländlichen Gebieten".
Das Problem ist so groß, dass lokale Parteikader in der Provinz Hunan es für nötig erachten, sich dessen anzunehmen. "Das Thema alternder unverheirateter Männer ist langsam kein individuelles Problem mehr, sondern wird zu einem gesellschaftlichen." Man wolle deswegen "darauf hinarbeiten, dass mehr junge Frauen in ihren Heimatdörfern bleiben".
"Nur Bettwärmer und Babymaschinen?"
So weit, so gut. Daraus machte dann eine Lokalzeitung einen Artikel mit der Überschrift "Es ist notwendig, die Betten älterer alleinstehender Männer zu wärmen". Und da platzte dann auch vielen Frauen im sonst gründlich zensierten chinesischen Internet der Kragen. "Frauen sind also nur Bettwärmerinnen und Babymaschinen?", fragte eine erboste Userin.
Die Aufregung steht für vieles, was (abgesehen von einem implodierenden Immobiliensektor und einer Hightech-Diktatur mit Arbeitslagern, in denen eine Million Uiguren inhaftiert werden) gerade nicht so gut läuft in China. Es gibt zu wenige Frauen. Und zwar ungefähr 30 Millionen. Dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern ist eine Folge der Ein-Kind-Politik.
Mädchen gehen leer aus
Da Haus und Hof in China traditionell nur an einen männlichen Nachkommen vererbt werden konnten, griffen viele Bauern auf die Methode pränataler Diagnostik zurück und ließen weibliche Föten abtreiben. In der Folge kamen in den 1980er-Jahren wesentlich mehr Buben als Mädchen zur Welt, und die gehen heute leer aus.
Und noch etwas kommt hinzu: Auch in China ist die gesellschaftliche Aufwärtsmobilität junger Frauen stärker als bei Männern. Zwar gibt es auch im Sozialismus so etwas wie traditionelle Rollenbilder. Vielen jungen Frauen besonders in den boomenden Metropolen an der chinesischen Ostküste aber ist es gelungen, Karriere zu machen.
Keine Lust auf Heirat
Dementsprechend wenig Lust haben sie, das Bett alternder Männer auf dem Land zu wärmen. Laut einer Umfrage der Kommunistischen Jugendliga Chinas hat fast die Hälfte der chinesischen Frauen gar kein oder nur wenig Interesse daran, überhaupt zu heiraten. Nur ein Viertel der Männer hat ähnliche Ansichten.
Dass Frauen in China am längeren Hebel sitzen, zeigt sich auch auf dem Heiratsmarkt. Da romantische Liebe als Konzept in der Volksrepublik eher neu ist und sich erst langsam als Grund für eine Heirat etabliert, zählt nach wie vor Handfestes: Eine Eigentumswohnung (besser zwei), ein Auto und ein sechsstelliges Jahresgehalt sollte ein Bewerber schon mitbringen, um auch das Okay der Schwiegereltern in spe zu bekommen.
Noch mehr frieren als sonst
Viele Männer leiden unter diesem Druck. Und zu guter Letzt dürfte der Winter für sie besonders unangenehm werden: Nachdem die Kohlepreise in den vergangenen Wochen rasant gestiegen sind, wurde zuletzt der Strom reduziert. China bezieht nach wie vor mehr als 60 Prozent seiner Energie aus Kohle. Die Kraftwerke können nicht ohne massive Verluste weiterheizen. Die Verbraucher sind jetzt dazu angehalten, Strom zu sparen. Wer diesen Winter alleine ist, könnte also nachts richtig frieren. Schreibt DER STANDARD.
Da werden jetzt wohl einige ältere Herren zwischen Beckenried und der Luzerner Darmstrasse mit etwas Neid in Bauch und Lende auf die Opas aus dem Lande von Konfuzius wehmütig seufzen: «Ist halt doch nicht alles schlecht, was die kommunistische Partei in China zum Wohl der Senioren unternimmt. Wer will denn schon in kalten Winternächten allein im Bett frieren?» Sie etwa?
Laut einigen Büchern aus der Luzerner Stadtbibliothek über Mao Tse Tung soll auch der Gründer der KP Chinas im hohen Alter kein Verächter von «jungem Fleisch» gewesen sein.
Soll noch einer sagen, China hätte keine Menschenrechte. Ni Hao!
-
14.10.2021 - Tag der weiblichen Schluckspechtinnen
Lenzburg: Rotlicht von stark alkoholisierter Automobilistin missachtet
Weil sie das Rotlicht missachtete, verursachte eine Automobilistin heute Morgen auf einer Kreuzung in Lenzburg einen Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Der Schaden ist beträchtlich.
Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 6.15 Uhr auf der Neuhofkreuzung in Lenzburg. Vom Zentrum kommend wartete die Lenkerin eines VW Caddy an der roten Ampel, um nach links in Richtung Autobahn abzubiegen. Dabei achtete sie sich versehentlich auf die falsche Ampel und fuhr vermeintlich bei grün los. In der Folge kam es zur Kollision mit einem von Wohlen kommenden Mazda, der tatsächlich bei grün gefahren war.
Die 41-jährige Unfallverursacherin, ihre drei Mitfahrer sowie der Fahrer des Mazda blieben allesamt unverletzt. An beiden Autos entstand jedoch beträchtlicher Schaden.
Spreitenbach/A1: Betrunkene Automobilistin verunfallt
Stark alkoholisiert prallte eine Automobilistin gestern auf der A1 gegen die Leitplanke. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter. Die Polizei traf sie später an und nahm ihr den Führerausweis ab.
Der BMW war am späten Dienstagabend, 12. Oktober 2021, auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Augenzeugen fiel zunächst die unsichere Fahrweise des BMW auf. Sie sahen dann, wie dieser nach rechts schwenkte und gegen die Randleitplanke prallte. Ohne anzuhalten fuhr der Wagen weiter und verliess die Autobahn bei Spreitenbach.
Eine Patrouille fand den beschädigten BMW wenig später an einer Adresse in Spreitenbach. Auch trafen die Polizisten auf die 30-jährige Lenkerin. Zwar unverletzt war sie stark alkoholisiert. Die Atemluftmessung ergab umgerechnet rund 1.7 Promille. Die Kantonspolizei Aargau nahm der Unfallverursacherin den Führerausweis ab. Sie muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.
Schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihren gestrigen Medienmitteilungen.
Zwei Polizeimeldungen über alkoholisierte Frauen am Steuer im Kanton Aargau an einem Tag: Liebe Ladies vom Kanton Aargau, die Ihr in letzter Zeit öfters mal einen zu viel über den Durst trinkt und die Männer damit an Torheit zu übertreffen versucht: Andreas Glarner, Präsident der Aargauer SVP und Dummschwätzer* vom Dienst ist not amused und könnte Euch mit der Scharia drohen. Und das wollen wir doch nicht, oder?
By the way: Betuselt und zugedröhnt vom Spiritus alkoholi in der Weltgeschichte herumzubrausen gehört nicht zu den Frauenrechten, für die Eure Grossmütter jahrzehntelang gekämpft haben.
Wohin der berühmte Schluck zu viel führen kann, zeigt Euch der Skandal um die ehemalige Grüne Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin – von Christoph Mörgeli in einer TV-Sendung als «Luder» bezeichnet – in aller Deutlichkeit.
Hoffentlich klagt die Jolanda jetzt nicht gegen mich... Die Mörgeli-Aussage habe ich sicherheitshalber sowieso abgespeichert. Da wären dann Zürcher Richter zuständig und nicht die Luzerner.
-
13.10.2021 - Tag der Zalando-Kostüme für die «Ehe für alle»
«Ehe für alle»: Umwandlung eingetragener Partnerschaften in Baden
Am 26.09.2021 hat sich das Schweizerische Stimmvolk für die Ehe für alle ausgesprochen. Nach einer Äusserung der Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird die Gesetzesänderung voraussichtlich am 01.07.2022 in Kraft treten.
Ab Inkrafttreten der Gesetzesänderung wird es in der Schweiz nicht mehr möglich sein, neue eingetragene Partnerschaften einzugehen, von da an steht den jeweiligen Paaren einzig die Ehe offen. Paare, die unter altem Recht eine eingetragene Partnerschaft eingegangen sind, können diese in eine Ehe umwandeln, indem beide Partnerinnen oder Partner eine Erklärung vor einer Zivilstandsbeamtin oder einem Zivilstandsbeamten ihrer Wahl abgeben.
Auf Antrag kann die Umwandlungserklärung im Trauungslokal in Anwesenheit von Zeuginnen oder Zeugen in einer der Eheschliessung ähnlichen Zeremonie entgegengenommen werden.
Der Bund ist zur Zeit an der Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen ect. Schreibt die Stadt Baden in ihrer Medienmitteilung.
Liebe Aargauerinnen und Aargauer, liebe Liebende: Weisse Socken war einmal. Mit diesem furchtbaren Relikt aus vergangenen Zeiten geht kein Mensch heutzutage in ein Umwandlungslokal, um die «Umwandlungserklärung» abzugeben. Ganz in Weiss «ischt over», wie Wolfgang Schäuble in gepflegtem Denglisch zu sagen pflegt.
Was wäre die «Schöne neue Welt» von Aldous Huxley ohne die pfiffigen Marketing-Tanten von Zalando? Ein weisser Fleck im Universum!
Zalando wäre nicht Zalando, hätte der/die/das Online-Kleidergigant nicht blitzschnell modische Outfits in Pink für den Gang zum Umwandlungsamt in Zeiten von «Ehe für alle» auf den Markt geworfen. The new world is pink. C'est le ton qui fait la musique.
Dass die Brautkleider früheren «Unisex»-Modetrends aus den 1980er-Jahren ähneln... Geschenkt. In Sachen Mode gibt es nichts, was nicht schon einmal trendy gewesen wäre.
Es sollte deshalb auch niemand stutzig werden, sollte die derzeit hoffnungslos veraltete «Ehe für Heten» in die Gesellschaft zurückkehren. Mit einem 50-Franken-Gutschein lässt sich auch dieses epidemische Problem lösen.
Der Bundesrat plant ja nicht umsonst, die aussterbenden Wesen der Heterosexuellen nebst 50-Franken-Gutschein unter Artenschutz zu stellen. Unbestätigten Gerüchten zufolge kreiert der WWF bereits die erste Kampagne. Und Zalando wird ein entsprechendes «old fashioned» Modeset auf den Markt bringen.

-
12.10.2021 - Tag der Schweizer Drogenhotspots
Beschimpfungen und Bedrohungen der Luzerner Polizei in der Stadt Luzern
Am frühen Sonntagmorgen waren wir am Inseliquai im Einsatz. Eine Gruppe junger Männer verhielt sich vor Ort aggressiv und warf Verkehrsschilder und Werbetafeln um. Ein vernünftiges Gespräch konnte mit den Randalierern leider nicht geführt werden. Unsere Polizisten wurden beschimpft. Ein 20-jähriger drohte, dass er alle Polzisten zusammenschlagen werde. Der Mann wurde festgenommen. Dabei kickte er mit den Beinen mehrfach gegen die Kollegen.
Auch an der Frankenstrasse (Anm. beim Luzerner Junkiepark «Vögeligärtli») wurden wir während unserem Dienst beleidigt und bedroht. Nachdem ein 26-jähriger vom Sicherheitsdienst aus einem Lokal verwiesen wurde, verhielt sich dieser äusserst unkooperativ, sodass wir uns ihm annahmen. Dabei betitelte er uns als Hurensöhne und wehrte sich gegen die Kontrolle. Auch er versuchte uns mit Fusstritten zu verletzen.
Beide Männer werden wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden angezeigt.
Schreibt die Luzerner Polizei auf Facebook.
Tja. Wo Drogen laut Doktrin der Luzerner Polizei «zu einer Stadt gehören» und der Müll ohne Busse, wie sie das Littering-Gesetz eigentlich vorschreiben würde, auf der Strasse statt im Abfalleimer landen darf, ist der Polizist trotzdem immer noch der natürliche Feind eines jeden Drogenkonsumenten / Drogendealers und Umweltverschmutzers.
Erinnert an die Beziehung zwischen Fuchs und Huhn. Nur mit dem Unterschied, dass das Huhn dem Fuchs wenigstens Respekt zollt.
Auch wenn die Polizei die Nationalität der Beschuldigten verschweigt, lässt allein das Wort «Hurensöhne» eine gewisse Klima- und Kulturzone vom Balkan bis Maghreb erahnen. Inklusive Bildungsstand.
Machen wir uns doch für einmal nichts vor: Das Beschimpfen der Polizei ist inzwischen bei jeder Polizeikontrolle dank der Laissez-faire-Politik von Stadtregierungen zu einem grün/rot angehauchten «Menschenrecht» mutiert und wird mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen.
Oder hat sich in den letzten zehn Jahren je ein verantwortlicher Politiker*in dazu geäussert? Ausser leeren Worthülsen und Selbstbeweihräucherung ist da bis hinauf ins Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement von Frau Keller-Sutter nichts zu vernehmen. Auch die Führungspersonen der Schweizer Polizeikorps, die nicht selten nach ihrem Parteibuch ausgewählt werden, schweigen darüber beharrlich.
Ist halt nicht so sexy, über das eigene Versagen Pressekonferenzen abzuhalten. Mann/Frau will ja schliesslich wieder gewählt werden.
Dass Inseliquai und Frankenstrasse mit dem Junkiepark «Vögeligärtli» in Luzern inzwischen ab Einbruch der Dunkelheit für einigermassen normal tickende Menschen längst zur No-go-Area verkommen sind, wird als Kollateralschaden dieser Politik in Kauf genommen. Ein Hauch von Banlieue weht über den Drogenhotspots einiger Schweizer Städte.
Oder um Goethes «Zauberlehrling» zu zitieren: «Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los». Alles hängt mit allem zusammen.
-
11.10.2021 - Tag des Rufs vom Muezzin: «Allahu Akbar»
Der Ruf des Muezzins «Allahu Akbar»
Ist der Ruf des Muezzins durch Lautsprecher ein Ausdruck der Glaubensfreiheit? Ist er der Ausdruck gelebter Vielfalt? Nein, der Gebetsruf durch Lautsprecher hat weder mit Glauben noch mit Vielfalt zu tun, schließlich gab es zur Zeiten von Mohammed keine Lautsprecher, außerdem kann jeder Muslim heute ein Alarm zu den Gebetszeiten in seinem Handy aufstellen.
Aber da wo die Integration am meisten gescheitert ist, da wo der radikale Islam am stärksten ist, und da wo Erdogan seine Hochburg in Deutschland hat, braucht die Stadt eine symbolische Aktion, um dieses Scheitern zu vertuschen. Und Erdogans Anhänger brauchen eine Machtdemonstration, um zu zeigen, dass sie noch da sind. Seine Anhänger werden die Gebetsrufe in Köln nicht als Sieg der Vielfalt und Gleichberechtigung, sondern als Sieg des Islam und als einen persönlichen Sieg Erdogans interpretieren.
Der Gebetsruf beginnt mit "Allahu Akbar", welcher auch der Schlachtruf der Muslime ist. Er bedeutet Allah ist größer. Größer als die Feinde, größer als die Menschen, größer als das Leben, größer als Deutschland, größer als alles. Da er größer ist als Demokratie und Vielfalt, gilt am Ende nur sein Gesetz, die Scharia. Und selbst wenn die säkulare demokratische Gesellschaft den Gebetsruf genehmigt, wird sie von vielen Muslimen, die auf den Gebetsruf beharren, nicht anerkannt, denn Allah ist größer als sie und am Ende gilt nur seine Ordnung, und der Gebetsruf ist ein erster Schritt, um diese Ordnung herzustellen.
Außerdem muss kein säkularer Passant auf der Straße erinnert werden, dass Muslime gerade beten. Das gilt übrigens auch für die Kirchenglocken. Oder findet ihr es angemessen, wenn Atheisten mit Lautsprechern vor den Moscheen und Kirchen stünden und die Verbrechen beider Religionen laut aufzählten während die Gläubigen drin beten? Ich finde man sollte die Kirche und die Moschee im Dorf lassen, aber ohne Läuten und Schreien! Wenn Du wirklich an etwas glaubst, musst du es nicht der ganzen Nachbarschaft gleich mitteilen!
Meine Haltung ist: Der laute Gebetsruf wird nicht die Integration und die Toleranz in Deutschland begünstigen, sondern einen Triumphalismus und Chauvinismus unter den Gläubigen befördern, die wiederum Wut und Chauvinismus unter den Rechtsradikalen provozieren werden!
Politiker sollten die tatsächlichen Probleme des Zusammenlebens ehrlich ansprechen und nach Lösungen suchen, statt immer wieder diese nutzlose bis schädliche Aktionen zu starten! Deutsche Bürgermeister, Ministerpräsidenten und Kanzler sollten endlich begreifen, dass das Heilige Römische Reich längst nicht mehr existiert, wo die Landesfürsten auch für das Seelenheil ihrer Untertanen zuständig waren! Schreibt Hamed Abdel-Samad auf Facebook. *
«Allahu Akbar» – Die Stadt Köln startet Modellprojekt zum Muezzinruf.
Eine Anleitung zur Förderung von Parallelgesellschaften und in Zeiten der Digitalisierung ein Rückfall ins tiefste Mittelalter durch die von «Bündnis 90 / Die Grünen» in einem Bündnis mit CDU und VOLT dominierte Kölner Stadtregierung.
Die Stadt Köln kündigte ein zunächst auf zwei Jahre befristetes Modellprojekt an. Der islamische Gebetsruf dürfe nur von 12 bis 15 Uhr und maximal fünf Minuten lang erfolgen. Die Lautstärke werde abhängig von der Lage der Moschee mit einer Höchstgrenze festgelegt. Die umliegende Nachbarschaft der Gemeinde sei im Vorfeld über den Gebetsruf zu informieren.
Oberbürgermeisterin Reker begrüsste das Modellprojekt. Dies sei ein Zeichen der gegenseitigen Akzeptanz der Religion und ein Bekenntnis zur grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit, sagte sie.
Allahu Akbar. Doch die amerikanischen Flugzeugträger sind grösser, sollte es eines Tages hart auf hart kommen.
* Hamed Abdel-Samad ist ein ägyptisch-deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Der Öffentlichkeit ist er vor allem als Autor islamkritischer Werke bekannt wie «Der islamische Faschismus: Eine Analyse».
-
10.10.2021 - Tag der ÖVP-Familie
Rücktritt von Sebastian Kurz: Der Anfang vom Ende einer politischen Karriere
Noch tags zuvor hatte Sebastian Kurz keinen Zweifel daran gelassen, dass ein Rücktritt für ihn kein Thema sei. Am Samstag kam die 180-Grad-Wende. Am Abend um 19.40 Uhr erklärte er seinen Rücktritt. Er übernimmt den Posten des Fraktionschefs seiner Volkspartei, bis die Vorwürfe gegen ihn vom Tisch seien. Doch die Chancen, dass er als Kanzler zurückkommt, sinken von Tag zu Tag.
Kehrtwende innert 24 Stunden
Kurz war aufgrund der Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft zunehmend unter Druck geraten. Gestern hatte seine Koalitionspartnerin, die Grüne Partei, erklärt, er sei nicht mehr amtsfähig und hatte gefordert, dass Kurz als Kanzler ersetzt werde. Das hatte die Volkspartei abgelehnt. Doch warum diese Kehrtwende nur 24 Stunden später?
Wäre der Kanzler stur geblieben, hätte er seine Abwahl am Dienstag provoziert und seine gesamte Regierung mit in den Abgrund gerissen. Offenbar haben die Granden der Volkspartei – die ihm gestern noch den Rücken stärkten – Kurz hinter den Kulissen zum Einlenken bewogen. Denn dieser brachte die Partei in die Zwickmühle.
Angesichts der ständig neuen Enthüllungen über ihn und seine Vertrauten hätte er kaum einen erfolgreichen Wahlkampf führen können. Und sogar im Falle eines Sieges in (nun abgewendeten) Neuwahlen hätte Kurz wahrscheinlich kaum mehr Koalitionspartner gefunden. Die Partei hätte sich in eine Sackgasse manövriert.
Kurz als «Schattenkanzler»?
Damit kann die konservativ-grüne Regierung wohl nach der Sondersitzung des Parlamentes am Dienstag weiterregieren. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler hat bereits grünes Licht gegeben, mit dem neuen Kanzler Alexander Schallenberg weiterarbeiten zu wollen.
Die Opposition murrt zwar, das «System Kurz» bleibe im Amt. Kurz könne als «Schattenkanzler» weiterhin die Fäden ziehen. Tatsächlich bleibt seine ÖVP die mächtigste Partei Österreichs. Doch ob Kurz als Kanzler jemals ein Comeback geben wird, ist höchst ungewiss.
Kurz hat zwar in seiner Erklärung einmal mehr seine Unschuld beteuert. Doch wer die Anordnung der Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA für die Hausdurchsuchungen im Kanzleramt, im Finanzministerium und in der Parteizentrale der ÖVP liest, bekommt Zweifel. Das 104 Seiten dicke Papier strotz vor Beweisen gegen Kurz und seine Vertrauten.
Wunschdenken gegen Realität
Dort stehen Hunderte von SMS-Nachrichten, gefunden auf den beschlagnahmten Handys der Verdächtigten. Schwarz auf Weiss, und auch durch die besten Verteidiger kaum zu entkräften. Kurz hatte am Mittwoch noch erklärt, keines dieser SMS beweise etwas gegen ihn. Doch wer die SMS liest, merkt bald, dass das eher Wunschdenken als Realität ist.
Der heutige Rücktritt markiert wohl den Anfang vom Ende der politischen Karriere von Sebastian Kurz. Von einem der talentiertesten Politiker der Gegenwart. Ein Ausnahmepolitiker, der letztlich über seinen unbändigen Ehrgeiz und seinen Machthunger stolperte. Schreibt SRF.
Was ist denn das für ein schwachsinniges Fazit in der Titelzeile vom «SRF-Experten» und Korrespondenten Peter Balzli?
Mit Qualitätsjournalismus und seriöser Expertise hat diese Einschätzung jedenfalls rein gar nichts zu tun. Wäre die Kommentarfunktion zu diesem Artikel freigegeben, hätte wohl jeder Erstklässler dem wunderbar sonderbaren Experten mitgeteilt, wo der Sebastian den Most holt.
Kurz ist zwar vom Amt des österreichischen Bundeskanzlers zurückgetreten, bleibt jedoch dank seinem Schwenk ins österreichische Parlament als Klubobmann im Machtgefüge der österreichischen Regierung de jure zweitmächtigster Politiker. Ohne Zustimmung des Parlaments (Nationalrat) geht kein von der Regierung beschlossenes Gesetz durch. ÖVP-Parteichef bleibt er ohnehin. Damit ist er auch de facto der mächtigste Politiker Österreichs, der alle Fäden in der Hand hält.
Kein Wort davon, dass Kurz als Klubobmann der ÖVP im Nationalrat Immunität geniesst. Als Bundeskanzler hat er die nicht. Das bedeutet schlicht und einfach, dass Kurz als Klubobmann von der Justiz nicht mehr belangt werden kann. Die Untersuchungen ruhen. Ihm die Immunität zu entziehen, ist ein schwieriges Unterfangen. Die ÖVP ist immerhin die wählerstärkste Partei im Parlament.
Somit kann der Klubobmann Kurz nur warten, bis etwas Gras über die Korruptionsaffäre gewachsen ist. Ist die Bevölkerung aber erst einmal eingelullt durch Verschwörungstheorien und beruhigt durch Unschuldsbekenntnisse am laufenden Band, kann er mit seiner ÖVP die Regierung auflösen und in denn folgenden Neuwahlen triumphierend als Kanzler zurückkehren. Wie man eine gewählte Regierung auflöst und die anschliessenden Neuwahlen gewinnt, hat «Shorty», wie er in der «Familie» genannt wird, bereits zweimal sehr erfolgreich vorgeführt.
Mit Rücktritten und Regierungsauflösungen hat Kurz grosse Erfahrung, die ihm leider in anderen Fächern jenseits von seinem abartigen Neoliberalismus, die für das Volk aber wichtig sind, fehlt. Nur hat das Volk dies scheinbar noch nicht begriffen.
Wählerinnen und Wähler vergessen schnell – siehe österreichische Bundeswahlen nach dem Ibiza-Skandal – und werden die ÖVP ein weiteres Mal als stärkste Partei bestätigen, die nun mal den Kanzler stellt.
Wie man Umfragen zu seinen eigenen Gunsten und auf Kosten der Steuerzahler*innen frisiert und willfährige Medien mit Inseraten schmiert, müsste ja inzwischen zu den Kernkompetenzen von Kurz gehören.
Der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg ist nichts anderes als ein Befehlsempfänger von Kurz und Kurz somit tatsächlich der tonangebende «Schattenkanzler». Schallenberg ist ein enger Freund von seinem Förderer und Gönner Sebastian Kurz und gehört zur sogenannten «Familie» der ÖVP, wie der Machtapparat der österreichischen Kanzlerpartei heisst. Viele nennen dieses unappetitliche Machtgefüge inzwischen auch «Korruptionsfamilie».
Kurz ist zwar als Kanzler weg, doch das «System Kurz» bleibt. Der treibende Kopf hinter diesem System, Sebastian Kurz, ist mit seiner cleveren Taktik nun sogar dank Immunität mächtiger als noch ein paar Tage zuvor.
Wer hier «vom Ende einer politischen Karriere» spricht, hat sie nicht mehr alle. Das Gegenteil ist der Fall: Jetzt fängt es erst richtig an für den machtgeilen ex-Jungkanzler.
Dass die Grüne Partei als Koalitionspartner diesen Fake mitträgt, ist verständlich und nicht dem ab und zu mal etwas angeheiterten Vizekanzler Kogler zuzuschreiben. Es sind die Futtertröge, an denen sich die Grünen Österreichs erstmals seit 40 Jahren laben. Die will man nicht verlieren. Politik as usual. Dass die Grünen damit vermutlich den letzten Funken Glaubwürdigkeit verlieren... Geschenkt.
Welche österreichische Partei ausser der NEOS, die erst im Oktober 2015 gegründet wurde und bisher noch keine Regierungsverantwortung innehatte, ist denn frei von diesen unseligen Korruptionsskandalen, die die (Zweite) österreichische Republik seit ihrer Gründung am laufenden Band durchziehen wie ein roter Faden?
Wer sich als Experte in der Causa WKStA (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft) vs. (ex-) Kanzler Sebastian Kurz berufen fühlt, seinen Senf abzugeben, sollte vorher zumindest ein paar von den haarsträubenden, auf mehr als 140 Seiten aufgelisteten Beschuldigungen inklusive der infantilen Chats zwischen den Mitgliedern der «Familie» lesen.
-
9.10.2021 - Tag der neuen Game-Heroes
Kiffen und gamen – aber kaum Sozialkontakte: Wegen Corona? Immer mehr junge Luzerner haben einen Beistand
Wer mit seinem Leben alleine nicht (mehr) klar kommt, bekommt von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) teils einen Beistand an die Seite gestellt. In der Stadt Luzern ist dies bei immer mehr Jungen der Fall.
«Es ist ein stetiger Anstieg, aber kein massiver, der für uns ein Grund zur Besorgnis wäre», sagt Angela Marfurt, Präsidentin der Kesb Stadt Luzern. Seit 2015 steigt die Zahl der Stadtluzerner zwischen 18 und 25 Jahren, die einen Beistand haben. Woran liegt das?
«Es handelt sich um eine Altersgruppe, die im Moment zu kämpfen hat. Das zunehmende Abdriften der Lebenswelt ins Digitale und der soziale Rückzug durch die Corona-Pandemie ist für diese Generation eine Herausforderung», erklärt Marfurt. Die Betroffenen flüchten in eine Scheinwelt.
Exzessives Gamen und Kiffen
«Die jungen Erwachsenen, die wir begleiten, kiffen und gamen teilweise exzessiv. Teils kommt es dadurch zu einer Tag-Nacht-Umkehr. Das heisst, sie finden den Rhythmus nicht, machen keine Lehre, sitzen den grössten Teil des Tages an Computern und ihre sozialen Kontakte finden online statt», erzählt die Kesb-Präsidentin.
Die Eltern seien damit überfordert. «Die Diskrepanz zwischen digitaler und realer Welt wird immer grösser. Hinzu kommt eine Überforderung durch die vielen Aus- und Weiterbildungsangebote. Mit einem Klick können sie in der digitalen Welt etwas bewegen – in der realen Welt ist das anstrengender. Deshalb ziehen sie sich immer mehr zurück», so Marfurt.
Wenn die Jugendlichen volljährig sind, braucht es Erwachsenenschutzmassnahmen – von einem Begleitbeistand vergleichbar mit einer Art Coach bis hin zu einem Vertretungsbeistand, der sich beispielsweise um die finanziellen Angelegenheiten kümmert. Wichtig ist aber: Das gelingt nur, wenn die jungen Erwachsenen bereit sind, mit ihrem Beistand zusammenzuarbeiten. «Gegen den Willen bei einem urteilsfähigen Menschen eine Beistandschaft anzuordnen, ist schwierig und nicht wirklich zielführend», ist Marfurt überzeugt.
Manchmal brauche es auch den Druck durch die Eltern, damit sich etwas bewegt. «Vereinzelt kann es nötig sein, dass sie ihre volljährigen Kinder aus der Wohnung weisen oder ihnen zum Beispiel den Strom abstellen, weil die Betroffenen nur dann lernen, auf eigenen Füssen zu stehen», so Marfurt. «Unser Ziel ist ganz klar, dass diese jungen Erwachsenen im Leben Fuss fassen, eine Ausbildung absolvieren und für sich selber sorgen können.»
Stadtrat will eine Aufstockung des Personals prüfen
Nicht immer gelingt es, die jungen Erwachsenen vom Nutzen der Unterstützung zu überzeugen. Wer wegen einer Massnahme im Kindes- und Erwachsenenschutz in Konflikt mit den Behörden steht, kann sich an die Fachstelle Kescha wenden. 40 Prozent der 1'324 gemeldeten Fälle im letzten Jahr betrafen Klagen über Beistände, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Oft würden sich Personen zu wenig unterstützt fühlen.
Das wundert nicht. Die nationale Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) empfiehlt, dass eine Vollzeit arbeitende Beiständin rund 60 bis 70 Mandate betreut. In der Stadt Luzern waren es bis vor zwei Jahren rund ein Drittel mehr. Aktuell liegt die Fallbelastung im Erwachsenenschutz bei 86 Fällen pro Person, wie aus der Antwort des Stadtrates auf einen Vorstoss der SP hervorgeht. Der Stadtrat will nun prüfen, das Personal in diesem Bereich aufzustocken. Schreibt ZentralPlus.
Um es gleich vorwegzunehmen: Kiffen und Gamen haben rein gar nichts mit Corona zu tun. Es gibt hingegen Gründe, weshalb Kiffen und Gamen zusammengehören wie Pech und Schwefel. Aber das ist eine andere Geschichte, die sehr viel mit dem Bildungsstand zu tun hat.
Auch die Behauptung, die jungen Erwachsenen hätten kaum Sozialkontakte, trifft nicht zu. Sie haben vermutlich sogar mehr Sozialkontakte als nichtkiffende / gamende junge Erwachsene.
Allerdings handelt es sich bei diesen Sozialkontakten um Beziehungen aus ihren ureigensten Milieus. Gleich und gleich gesellt sich nun mal gern. Wer daran zweifelt, soll sich einmal auf dem Luzerner Inseli oder der Aufschütti die vielen unterschiedlichen Gruppen der Drogenkonsumenten zu Gemüt führen.
Ausserdem haben sich die sozialen Kontakte bei vielen jungen Erwachsenen – auch ohne behördlichen Beistand – längst auf die social Media-Schiene verlagert.
Vielleicht liegt die kommunistische Partei Chinas gar nicht so daneben, wenn sie Jugendlichen das Gamen «Par ordre du mufti» auf ein gewisses Zeitmass reduziert. Wer im Land des Lächelns als Jugendliche*r diesen «Befehl» missachtet, muss damit rechnen, dass der Computer schlicht und einfach wie von Geisterhand ausgeschaltet wird.
Und was macht der Westen? Verherrlicht in den Medien Gewinner*innen von Game-Events wie ausserirdische Rockstars und feiert jedes neue Gamespiel mit seitenlangen Artikeln als Sensation, während Rezensionen über neue Bücher nur noch mit der Lupe zu finden sind.
Gewisse Staaten inklusive der Schweiz fördern Game-Entwickler sogar mit staatlichen Geldern. Da braucht man sich doch nicht zu wundern, wenn man die Geister, die man rief, nicht mehr los wird.
-
8.10.2021 - Tag der Nebelkerzen
Sieben Prozent der Corona-Toten waren geimpft
In der Schweiz sind 119 Menschen trotz doppelter Impfung im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das entspricht 7 Prozent aller Todesfälle. Experten beruhigen: Die Impfdurchbrüche liegen im Rahmen des Erwartbaren, weil die Impfung nicht zu 100 Prozent schützt.
Neue Zahlen des Bundes zeigen das Ausmass von tödlichen Impfdurchbrüchen in der Schweiz. Seit Ende Januar sind in der Schweiz 1681 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Davon waren 119 Personen vollständig geimpft. Will heissen: Sieben Prozent der Corona-Toten waren geimpft. Das geht aus neuen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.
Das BAG stellt allerdings klar: Die Mehrheit der doppelt geimpften Corona-Toten war über 80 Jahre alt. Bei Menschen in dieser Altersgruppe schlägt die Impfung teils schlechter an. Das Immunsystem bildet trotz doppelter Impfung nicht ausreichend Antikörper.
Impfung schützt sehr gut – aber nicht zu 100 Prozent
Eines der Todesopfer hat unlängst für Schlagzeilen gesorgt: Der alt Nationalrat Andreas Herczog (†74) ist im September an einer Corona-Infektion gestorben – trotz doppelter Impfung.
Weiter listet das BAG, dass seit Ende Januar 600 Menschen trotz doppelter Impfung im Spital gelandet sind. Das entspricht 5,6 Prozent der 10'716 Hospitalisierten. Zwei Drittel der betroffenen Geimpften waren über 70 Jahre alt.
Das BAG zeigt sich über die Impfdurchbrüche weder erstaunt noch beunruhigt: Die in der Schweiz eingesetzten mRNA-Impfstoffe haben zwar eine sehr hohe Wirksamkeit. Diese liegt allerdings nicht bei 100 Prozent.
Booster-Impfung stehen zur Diskussion
Die Daten zum Impfstatus der Corona-Patienten werden seit Ende Januar 2021 erhoben. Sie basieren auf Informationen von Ärztinnen und Ärzte sowie der Spitäler im Rahmen der Meldepflicht.
Im Ausland werden aufgrund von Impfdurchbrüchen zum Teil bereits Auffrischimpfungen verabreicht. Es zeigt sich nämlich, dass die Wirksamkeit der Impfung mit der Zeit abnimmt, besonders bei älteren Geimpften. In Israel etwa erhält die Bevölkerung bereits eine dritte Impfung. In der Schweiz hingegen ist eine solche Auffrischimpfung bisher nicht zugelassen. Schreibt Blick.
Das sind genau die Nebelkerzen, die bei den Verschwörungstheorien rund um die Corona-Impfung gezündet werden: Tod durch Corona-Impfung.
Dass es sich bei den Toten überwiegend um Personen handelt, die über 80 Jahre alt sind, wird verschwiegen oder nur beiläufig erwähnt. Selbst angeblich «seriöse» Schweizer Medien wie SRF weisen in ihren Liveticker-Shortmessages kaum oder nur im Kleingedruckten auf diese Tatsache hin. Das ist weder redlich noch «Qualitätsjournalismus» und ist einzig und allein dem Clickbaiting geschuldet. «Tote bringen Quote» war schon immer im Lehrbuch medialer Marketingweisheiten verankert.
Alte Menschen sterben seit jeher auch an einer ganz normalen Grippe, wenn es das Immunsystem so will. Trotz Grippe-Impfung. Oder sie sterben mitten im Sommer an einem Hitzschlag, wie im Hitzesommer 2003 in Frankreich geschehen, als fast 11.500 Menschen an Hitze gestorben sind.
Die Sonne würde sich auch durch Lockdowns nicht beeindrucken lassen. Alle alten Menschen in einem Hitzesommer in den Kühlschrank zu sperren, funktioniert auch nicht. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als Tatsachen zu akzeptieren. Mögen sie noch so schmerzlich sein.
Der Tod ist ein natürlicher Vorgang und – wenn man so will – die einzige Gerechtigkeit allen Lebens. Für Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit dem Tod sorgt ab und zu das Schicksal, das den Hobel ansetzt, wann immer es ihm beliebt und das keine Altersgrenzen kennt. Zur falschen Zeit am falschen Ort ist nur einer dieser Schicksalsschläge.
Fazit: Ab einem gewissen Alter stirbt man selbst in einer durchgeimpften Gesellschaft nicht wegen Corona, sondern mit Corona.
Je eher wir das verinnerlichen, umso schnell kehren wir in die «Normalität» zurück.
-
7.10.2021 - Tag der Erpresserbriefe
Fake-Erpresserbriefe auf dem Postweg in der Zentralschweiz
Seit Dienstag, 5. Oktober 2021, gehen bei den Zentralschweizer Polizeikorps Meldungen über Erpresserbriefe ein, die den Betroffenen per Post zugestellt werden. Unter Todesandrohung wird die Überweisung von Bitcoins gefordert. Es handelt sich hierbei um Fake-Erpresserbriefe. Die Zentralschweizer Polizeikorps raten dringend, keine Zahlungen zu tätigen und die Polizei beizuziehen.
Eine unbekannte Täterschaft hat Briefe an Privathaushalte verschickt, in denen behauptet wird, dass sie die privaten Gepflogenheiten der Adressaten kennt. Die Erpresser drohen auch indirekt mit dem Tod, falls keine Überweisung von 0.5 Bitcoin erfolgt oder die Polizei beigezogen wird. Die Zentralschweizer Polizeikorps weisen darauf hin, dass aufgrund dieser Schreiben, keine konkrete Bedrohung für die Betroffenen besteht und keine Zahlungen geleistet werden sollen. Betroffene werden gebeten, umgehend bei der Polizei Anzeige zu erstatten.
Spurenschutz beachten!
Um mögliche Spuren nicht zu vernichten, sollte der Brief möglichst wenig berührt und in einer Klarsichtmappe verpackt der Polizei übergeben werden.
Weitere Informationen finden Sie beim Kompetenzzentrum für Cyberkriminalität:
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer gestrigen Medienmitteilung.
Ziemlich krass! Solche Drohbriefe per Post erhalte ich ab und zu von den Zeugen Jehovas, wenn ich wieder mal eines ihrer Mitglieder*innen mit Schimpf und Schande von meinem Penthouse vertrieben habe und auch vom Gebrauch eines Kübels Wasser nicht zurückschreckte.
Die etwas skurrilen Gottesanbeter der Zeugen Jehovas drohen mir schriftlich allerdings nicht mit dem Tod, sondern mit der Hölle, wo ich dereinst landen und für ewige Zeiten schmoren werde. Was eigentlich in meinem Fall nicht mehr als angebracht wäre, so es denn eine Hölle geben würde.
Eines muss man den Erpressern mit der Todesbrief-Drohung allerdings lassen: Sie beherrschen zumindest die Rechtschreibung und die deutsche Sprache.
Was sagt uns dies? Für einmal ist der Balkan definitiv nicht involviert. Die Balkanesen schicken auch keine Briefe, sondern kommen gleich in Bataillons-Stärke samt ihren Nah-Ost-Freunden an der Tankstelle vorbei und schaffen Fakten.
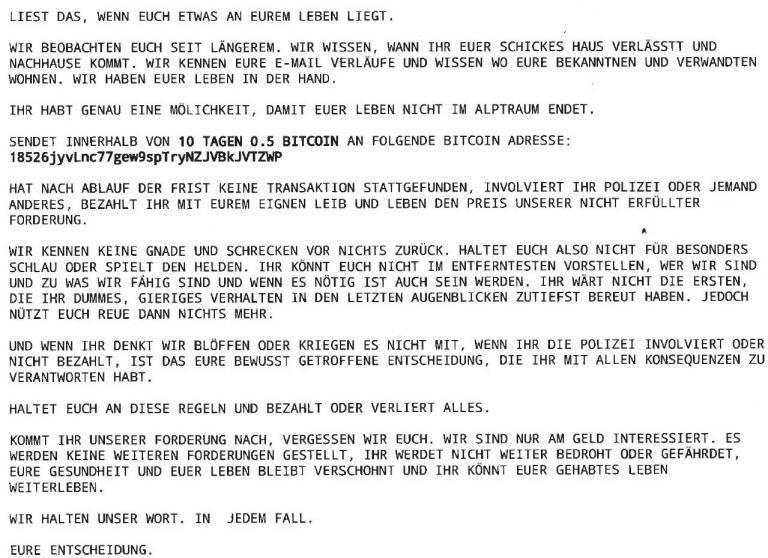
-
6.10.2021 - Tag der britischen Lastwagenfahrer
Briten suchen 5.000 Lkw-Fahrer aus dem Ausland, 127 aus der EU meldeten sich
Großbritannien hat große Probleme, dringend benötigte Tanklasterfahrer aus der EU anzuwerben. Wie Premierminister Boris Johnson der BBC am Dienstag am Rande des Parteitags der Konservativen in Manchester sagte, hat die Regierung bisher nur 127 Anträge auf ein Sonderkontingent an Arbeitserlaubnissen erhalten. Das ist weniger als die Hälfte der geplanten 300 Sondervisa.
Die Regierung hatte als Notfallmaßnahme gegen den akuten Mangel 5.000 Kurzzeitvisa für ausländische Fahrer bereitgestellt, davon 300 für Fahrer von Tanklastern. Die Visa sind allerdings zeitlich befristet und sollen nur bis Februar gelten.
Johnson widersprach aber der britischen Zeitung "The Times", die von nur 27 Anträgen berichtet hatte. Das Transportministerium hatte vor einigen Tagen die Ausstellung von 5.000 bis Februar befristeten Arbeitsvisa als nötig erachtet.
Die geringe Zahl der Anträge sei eine "fantastische Illustration des Problems", das der Treibstoffkrise in Großbritannien zugrunde liege, sagte Johnson weiter. Die Regierung habe den Spediteuren gesagt: "Gebt uns die Namen der Fahrer, die Ihr herbringen wollt, und wir kümmern uns um die Visa." Diese hätten aber nicht genügend Kandidaten genannt, um das Kontingent zu füllen.
Armee soll aushelfen
Seit Montag ist in London und Südengland die Armee im Einsatz, um die Nachschubprobleme an den Tankstellen zu lindern. Seit gut zwei Wochen bilden sich im ganzen Land an den Zapfsäulen lange Schlangen, weil das Benzin nicht schnell genug von den Raffinerien zu den Abgabestellen kommt. Grund dafür ist der Mangel an Lkw-Fahrern. Deshalb bleiben auch in zahlreichen Supermärkten Regale leer.
Hunderte Schweine gekeult
Weil ein eklatanter Mangel an Schlachtern in Großbritannien zu übervollen Schweineställen geführt hat, haben die ersten Bauern nun mit Keulungen begonnen. Etwa 600 gesunde Tiere, die man nicht habe zum Schlachthof bringen können, seien getötet worden, teilte der Schweinebauernverband National Pig Association am Dienstag mit.
Zwar gebe es noch keine Massenkeulungen, aber die Maßnahme zeige, dass die Krise Folgen habe. Der Verband hatte gewarnt, dass bis zu 120.000 Schweine gekeult werden müssten, falls nicht bald mehr Personal eingestellt werde.
Schlachthöfe überlastet
Für viele Bauern sei es äußerst belastend, die Schweine grundlos zu töten, sagte der Sprecher. Viele holten sich Hilfe von außerhalb.
In Großbritannien fehlen in vielen Branchen Fachkräfte, auch in der Fleischverarbeitung. Das liegt auch an den Folgen des Brexits, da viele Arbeiter vor allem aus Osteuropa während der Corona-Pandemie das Land verlassen haben, neue strenge Immigrationsregeln nun aber die Einreise für Arbeitssuchende erschweren. Schlachthöfe können wegen der fehlenden Spezialisten den Schweinebauern nicht mehr genug Tiere abnehmen – deshalb wird auf den Farmen der Platz knapp. Schreibt DER STANDARD.
Im Juli 2021 waren in Grossbritannien saisonbereinigt rund 1,6 Millionen Personen arbeitslos.
Noch Fragen?
-
5.10.2021 - Tag der Pandemien
Ausfall von Facebook, WhatsApp, Instagram: Gestörte Welt
Über Stunden waren drei der wichtigsten Kommunikationsdienste weltweit lahmgelegt. Dahinter steckte offenbar ein Konfigurationsfehler. Der Vorfall zeigt, wie viel Macht Facebook hat und wie brüchig sie ist.
Wäre unsere Welt ohne Facebook eine bessere? Eine friedlichere, eine weniger polarisierte? Solche Fragen machten am Montag weltweit die Runde, in Zeitungen, auf Nachrichtensendern und Websites. Eine US-Whistleblowerin, die Firmeninterna an das »Wall Street Journal« gegeben hatte, hatte sich am Sonntagabend (Ortszeit) im US-Fernsehen zu erkennen ergeben – mit Vorwürfen wie dem, dass »die heutige Version« von Facebook Gesellschaften zerreiße und rund um den Globus zu »ethnischer Gewalt« führe.
Darüber, was die ehemalige Produktmanagerin namens Frances Haugen sagte, bekamen die mehreren Milliarden Nutzerinnen und Nutzer der Facebook-Produkte schon am nächsten Tag Zeit, nachzudenken. Denn alle Ablenkung aus dem Hause Facebook fiel für mehrere Stunden weg, wenn auch unbeabsichtigt. Sowohl Facebook und der Facebook Messenger als auch die Schwesterplattformen Instagram und WhatsApp waren gegen 17.30 Uhr deutscher Zeit plötzlich nicht mehr erreichbar, ohne Vorwarnung.
Störungen und Ausfälle der Angebote gibt es zwar immer wieder. Aber dass gleich drei der wichtigsten Social-Media-Dienste überhaupt gleichzeitig und auch noch weltweit ausfielen, hatte für viele Nutzerinnen und Nutzer eine neue Dimension – zumal zunächst nicht absehbar war, wie lange die Probleme dauern würden.
Der Familienchat verstummt
Kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook mehr – das bedeutet für viele Menschen von einer Minute auf die andere: keine Familienchats mehr, keine Sprachnachrichten mehr, keine Kurzvideos ihrer Lieblingsstars mehr. Auch manche Besitzerinnen und Besitzer von Virtual-Reality-Headsets von Oculus wurden zurück in die Realität gerissen, in der ihre Wundermaschine ebenfalls zu Facebooks Firmenimperium gehört.
Und das alles sind in Relation Luxusprobleme: In einigen Ländern wie Indien ist WhatsApp für viele Menschen der wichtigste Kanal sowohl für persönliche Kommunikation, also auch für den Empfang von Nachrichten über das Geschehen in ihrer Region: Hier fiel nicht nur Unterhaltung und Eskapismus weg, sondern mitunter der digitale Hauptkanal zur Außenwelt. Ebenso gibt es weltweit viele Firmen und Einzelunternehmer, die Facebook, WhatsApp oder Instagram für ihre täglichen Geschäfte nutzen. Für sie bedeutet jede Minute Ausfall dieser Dienste einen potenziellen Einnahmeverlust.
Ausweichorte wie Twitter, TikTok, Twitch oder Telegram (welche Messenger es jenseits von WhatsApp und dem Facebook Messenger noch gibt, erfahren Sie übrigens hier. (Anm. Erfordert allerdings ein bezahltes PLUS-Abo; ein Schelm wer das Naheliegendste denkt).
Auf Twitter jedenfalls war am Montagabend gefühlt so viel los wie seit Langem nicht mehr: Der Hauptaccount des Dienstes @twitter begrüßte neue und zurückgekehrte Nutzerinnen und Nutzer mit der Botschaft »Hallo an buchstäblich alle«.
Zugleich führte der Ausfall vielen Menschen aber wohl auch noch einmal Augen, wie mächtig Facebook ist: Wenn das Unternehmen technisch ins Wanken gerät, warum auch immer, trifft das schon lange nicht mehr nur ein soziales Netzwerk, das manchen vielleicht ohnehin nicht mehr so wichtig ist wie früher. Nein, es kann auch die Lebenswelten jüngerer Menschen auf Instagram treffen oder die Unterhaltungen Älterer bei WhatsApp, der noch immer populärsten Chat-App der Deutschen. Oder gar Virtual-Reality-Welten. Facebook hat sich diese Macht über die Jahre selbst aufgebaut, immer wieder aber auch zugekauft.
So erklärt Facebook das Problem
Sechs Stunden dauerten die Störungen der Facebook-Angebote letztlich. Gegen Mitternacht deutscher Zeit konnten viele Nutzerinnen und Nutzer wieder wie gewohnt WhatsApp-Nachrichten verschicken oder sich mit ihrem Instagram-Feed in oder um den Schlaf scrollen. Das Unternehmen erklärte im Laufe der Nacht in einem Blogpost, dass vermutlich eine fehlerhafte Einstellung zu den Problemen führte, und trat so zumindest indirekt Gerüchten entgegen, die Firma könnte gehackt oder im Kontext der Whistleblowerin Haugen sabotiert worden sein.
Analysen von Facebooks Technikteams zufolge war die Konfiguration sogenannter Backbone-Router geändert worden, die den Datenverkehr zwischen Facebooks Datenzentren des Unternehmens regeln, fasste Facebook den Vorfall zusammen. Diese Unterbrechung des Netzwerkverkehrs habe durch einen »kaskadenartigen Effekt« die eigenen Dienste zum Stillstand gebracht. Man bitte »bei allen Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt, die sich auf uns verlassen«, für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.
In seinem Statement bestätigte Facebook, dass der Ausfall auch viele interne Werkzeuge und Systeme des Unternehmens lahmgelegt hatte. US-Medien hatten zuvor beispielsweise berichtet, dass Facebook-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter während des Ausfalls keine Mails von außen mehr empfangen konnten oder dass sie keinen Zugang zu elektronisch gesicherten Konferenzräumen mehr gehabt hätten.
Whistleblowerin Frances Haugen wird am heutigen Dienstag ab 16 Uhr deutscher Zeit im US-Senat angehört, ihre Befragung wird hier live übertragen. In ihrem Fernsehinterview hatte sie am Sonntag unter anderem gesagt, sie habe in ihrer Zeit als Produktmanagerin immer wieder Interessenkonflikte beobachten können, »zwischen dem, was gut für die Allgemeinheit ist, und dem, was gut für Facebook ist«: »Und Facebook hat sich immer wieder dafür entschieden, seine eigenen Interessen zu optimieren, um mehr Geld zu verdienen.«
Im Fall des aktuellen Ausfalls finden die Interessen von Facebook und der Allgemeinheit aber wohl schnell zusammen: So etwas soll bloß nicht wieder passieren. Aus Nutzersicht, weil es verunsichert, wenn plötzlich die liebgewonnenen Kommunikationskanäle wegbrechen. Und aus Facebook-Sicht allein schon, weil es das Unternehmen nicht nur Vertrauen kosten kann, sondern auch Geld: An der Börse jedenfalls ging es für das Unternehmen am Montag weiter bergab als ohnehin schon. Schreibt DER SPIEGEL.
Ein ziemlich kranker Artikel von Markus Böhm über eine ziemlich kranke Welt.
-
4.10.2021 - Tag der Balkan-DNA
Protz-Slowakin verhaftet – Instagram-Star soll Drogen-Baronin sein
Zuzana Strausz-Plackova (30) hat über 800’000 Fans auf Instagram. Diesen zeigt sie immer wieder, wie reich sie ist. Die Polizei aber ist sicher: Die slowakische Influencerin ist eine Drogen-Baronin. Vor wenigen Tagen wurde Strausz-Plackova verhaftet.
Zuzana Strausz-Plackova (30) ist eine Protz-Influencerin. Auf Instagram folgen der Slowakin über 800’000 Menschen. Seit sie 2012 an einer Reality-Show teilnahm, ist die 30-Jährige in ihrer Heimat ein Star. Ihren Fans präsentiert sie sich vor teuren Autos, an wunderschönen Stränden oder auf roten Teppichen. Sie nennt sich «Queen Plackova».
Nun ist die Königin vom Thron gepurzelt. Vergangene Woche wurde die ehemalige Softporno-Darstellerin gemeinsam mit ihrem Mann René Strausz in Handschellen abgeführt. Die Polizei ist überzeugt: Zuzana Strausz-Plackova ist eine Drogen-Baronin. Seit Jahren soll sie von der Hauptstadt Bratislava aus gemeinsam mit ihrem Mann und einem Dutzend weiterer Personen kriminelle Geschäfte in grossem Stil geführt haben. Bei Razzien an mehreren Orten beschlagnahmten die Behörden rund neun Kilogramm Crystal Meth, knapp 80’000 Franken Bargeld, eine unbekannte Anzahl Zigaretten – möglicherweise Schmuggelware – sowie Waffen und Munition. 15 Personen wurden festgenommen und verhört.
Über eine Million mit Instagram pro Jahr?
Die Polizei spricht von langjährigen Ermittlungen, bei denen Telefonate abgehört worden seien. Nach drei Tagen Haft kamen Zuzana und ihr Mann auf freien Fuss – vorläufig.
Das Ehepaar sagte nach der Verhaftung, dass sie weder Drogen konsumierten oder Dealer seien. Zusana legte ihre Finanzen offen. Sie gibt an, vergangenes Jahr über eine Million Franken mit Instagram eingenommen zu haben, bei einem Nettogewinn von mehr als einer halben Million Franken. Sie verdiene ihr Geld nebst ihren Auftritten in sozialen Medien mit einem E-Shop, auf dem sie von Kleidung bis zu Lotionen alles Mögliche verkaufe, verteidigte sie sich in einem Video.
«Ich spare viel»
«Es tut mir leid, dass ich mir erlaubt habe, so viel zu verdienen und nicht zu Hause auf meinem Hinterteil gesessen, sondern gearbeitet habe», klagte sie weiter. In früheren Interviews behauptete sie über ihren Reichtum: «Die Wahrheit ist, dass ich viel spare». Ihre Instagram-Beiträge sagen allerdings etwas anderes. Demnach besitzt oder besass sie mehrere sehr teure Mercedes, derzeit einen Brabus 900, der rund 350'000 Franken kostet und nur zehnmal gebaut wurde.
Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihre Freilassung Berufung eingelegt. Am 7. Oktober entscheidet sich, ob Zuzana Strausz-Plackova und ihr Mann erneut in den Knast müssen. Schreibt Blick.
Protzen und Drogen sind siamesische Zwillinge, die scheinbar in der DNA von unsäglich vielen Menschen aus dem Balkan tief verankert sind.
-
3.10.2021 - Tag der Fake-News von Human Rights Watch
«Wir werden uns rächen» – Taliban laden ehemalige Ortskräfte vor Gericht
„Wenn es uns nicht gelingt Sie zu fassen, werden wir das mit Ihren Angehörigen regeln“: Die Machthaber in Afghanistan sollen Ex-Ortskräften der internationalen Allianz Schreiben mit einer Vorladung vor Gericht zugestellt haben. Das berichtet ein niederländischer TV-Sender.
Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan haben ehemaligen Ortskräften der internationalen Truppen laut einem niederländischen Medienbericht Vorladungen vor Gericht zugestellt.
Wie der Fernsehsender NOS am Freitagabend berichtete, erhielten die Familien von im Versteck lebenden ehemaligen Dolmetschern Vorladungen. Darin wird den Angehörigen mit schweren Strafen gedroht, wenn die Ortskräfte nicht selbst vor einem Tribunal erschienen. Ziel sei es, anderen „Verrätern eine Lektion zu erteilen“.
NOS zeigte eines der Schreiben. Dieses war an einen ehemaligen einheimischen Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol in Afghanistan gerichtet. Dem Mann wird darin vorgeworfen, als Übersetzer für Ausländer gearbeitet und deren „entehrendes und verbotenes Geld“ angenommen zu haben.
„Wir werden uns rächen“
In einem anderen Brief an einen ehemaligen Dolmetscher heißt es: „Wir werden uns rächen. Wenn es uns nicht gelingt Sie zu fassen, werden wir das mit Ihren Angehörigen regeln.“ Laut NOS deutet alles auf eine Authentizität der Schreiben hin, die mit offiziellen Stempeln versehen sind.
NOS hat nach eigenen Angaben Kontakt zu rund einem Dutzend ehemaliger Ortskräfte der Niederlande. Ihre Lage in dem Land nach der Machtübernahme durch die Taliban Mitte August werde immer dramatischer.
Auch Druck auf Journalisten
Seit ihrer Machtübernahme in Afghanistan Mitte August haben die Taliban nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mindestens 32 Journalisten vorübergehend festgenommen.
Die meisten von ihnen seien freigelassen worden, nachdem die Taliban sie wegen ihrer Berichterstattung abgemahnt hätten, teilte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Freitag in New York mit. Einige Medienschaffende seien geschlagen worden.
Am 19. September hatten Taliban-Vertreter den afghanischen Medien elf Regeln mitgeteilt, nach denen unter anderen die „Beleidigung nationaler Persönlichkeiten“, „Inhalte im Widerspruch zum Islam“ und die „Verletzung der Privatsphäre“ untersagt sind.
Die Vorschriften seien „so weit gefasst und vage, dass sie praktisch jede kritische Berichterstattung über die Taliban verbieten“, kritisierte HRW. Zudem seien sie so weitreichend, dass Journalisten sich selbst zensierten und befürchteten, im Gefängnis zu landen, sagte die stellvertretende Asien-Chefin von HRW, Patricia Gossman. Schreibt DIE WELT.
Schon beim ersten Blick auf die Headline hatte ich gewisse Zweifel an der Authentizität der Taliban-Post. Selbst in Dubai oder Katar geläuterte Taliban laden niemanden ein, vor Gericht zu erscheinen. Die neuen (und alten) Herrscher vom Hindukusch schaffen Fakten und werfen nicht mit Wattebäuschchen um sich.
Dass es sich bei diesem «Einladungsschreiben» einmal mehr um eine Fake-Botschaft an den Westen von Afghanen (with a little Help from the NGO) handelt, die das Land legal verlassen wollen, war eigentlich sofort klar.
Die NGO «Human Rights Watch» tut das, was ein riesiger Apparat wie HRW tun muss, um die Spendengelder in Millionenhöhe zu rechtfertigen. Dass «Nicht Gewählte Organisationen» (NGO) in ihren Methoden nicht zimperlich sind, beweisen sie beinahe täglich.
Manchmal sind Lesermeinungen klüger als ein fürs Clickbaiting aufgepeppter Agentur- und Gefälligkeitsartikel. WELT-Leser Holger K. schreibt einen fundierten Kommentar, der es verdient, auch hier eins zu eins wiedergegeben zu werden und dem nichts hinzuzufügen ist:
Es gibt an den Handlungen der Taliban nichts zu relativieren und die Lage dort ist sicherlich prekär. Aber ich fasse mal in Bezug auf diesen speziellen Bericht zusammen:
1. In Afghanistan, einem Land mit knapp 60 Prozent Analphabeten (Anm. Internationale Institutionen gehen von 80 Prozent aus), werden keine «amtlichen Schreiben» verschickt. Da kommt der lokale Machthaber, Dorfchef oder Friedensrichter in Begleitung von ein paar Bewaffneten vorbei und verkündet den Willen der Mächtigen.
2. Geld anzunehmen, auch von Gegnern und Feinden, ist in diesem Kulturkreis weder entehrend noch verboten. Das ist eine fast ausschliesslich westliche Sichtweise. Die explizite Nutzung dieser Formulierung in den Schreiben deutet darauf hin, dass der Verfasser sie speziell für westliche Augen geschrieben hat.
3. Die Nutzung von Datum, Stempel, Unterschrift ist auch eine eher westliche Angewohnheit. Das haben die Afghanen so auch erst durch die westlichen Truppen und NGOs kennengelernt. Die «Verschönerung» der Schreiben mit solchen Stempeln lässt ebenfalls darauf schliessen, dass sie für westliche Augen gemacht wurden, um ihre «Echtheit» zu verstärken.
Mein Fazit: Die Schreiben sind nicht von den Taliban verfasst worden, sondern von Afghanen (von mir aus auch Ortskräften), die damit ihren Anspruch auf westliche Hilfe verstärken wollen.
-
2.10.2021 - Tag der vulgären Fakälsprache
Berner John L. fuhr nur wegen Darmproblemen 43 km/h zu schnell: Die beschissenste Ausrede der Welt
Mit 43 km/h zu schnell wurde ein Berner in Deutschland geblitzt: Der Wiederholungstäter macht geltend, er habe damals starke Darmprobleme gehabt. Die Ausrede von John L. (32) liess das Bundesgericht aber nicht gelten.
Die Plane klebt bereits an seinem Mercedes Cabriolet, als John L.* (32) es abdecken will – so lange darf der gelernte Kaufmann aus dem Kanton Bern schon nicht mehr fahren. Beim Anblick seines geliebten Autos meint er: «Zwei Jahre Ausweisentzug sind viel zu lang. Drei Monate hätten gereicht!»
Die kuriose Geschichte nahm ihren Lauf im April 2019 in Deutschland. «Ich war auf dem Heimweg von einem Pokerturnier», erinnert er sich. «Ich habe einen Zwischenstopp eingelegt und bei Kentucky Fried Chicken etwas Scharfes zu Essen bestellt.»
«Dann hat es geblitzt»
Auf der Bundesautobahn 7 bei Giengen (D) sei ihm die fettige Mahlzeit kurze Zeit später zum Verhängnis geworden, berichtet er: «Ich musste ganz dringend auf die Toilette. Es fühlte sich an, als müsste ich ein Kind gebären.» Zunächst habe es auf besagter Strecke keine Tempolimite gegeben, was ihm gerade recht gewesen sei. Im Bereich einer Baustelle jedoch sei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit kontinuierlich gesenkt worden, bis schliesslich nur noch 80 km/h erlaubt waren.
«Ich war in Panik und habe darum die Tafel nicht gesehen. Ich dachte, es seien 100 km/h erlaubt, und habe mich entschieden, wegen meiner Darmbeschwerden weiterhin 120 km/h zu fahren und das Risiko einer Busse einzugehen», schildert der begeisterte Poker-Spieler die Situation weiter. «Dann hat es geblitzt.»
John L. hatte es schon immer eilig
Die Folgen: 160 Euro Busse und ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland. In der Schweiz sollte der 32-Jährige den Fahrausweis aber frühestens nach zwei Jahren und einem positiven verkehrspsychologischen Gutachten wieder erhalten. Dies, weil John L. bereits einiges auf dem Kerbholz hat und sich noch in der Probezeit befand.
«Ich habe 2019 nicht einfach so ein bisschen Gas gegeben, sondern litt wirklich unter schlimmen Darmbeschwerden. Ich musste sogar zum Arzt und in die Physiotherapie deswegen», erklärt er.
Jobverlust wegen Führerschein-Entzug
«Ich hatte früher wirklich ein Problem, vermutlich eine Adrenalin-Störung», gibt er zu. «Im Aargau hat es mich 2014 mit fast 190 km/h geblitzt, und eine Woche später wurde ich ohne Ausweis erwischt.» Unterdessen habe er sich wirklich gebessert, versichert er.
Doch das Bundesgericht liess ihn abblitzen: Er habe zuvor schon ähnliche Ausreden benutzt, heisst es unter anderem im Urteil. Unverständlich für John L., der im Aussendienst gearbeitet hat: «Weil ich den Führerausweis länger als drei Monate abgeben musste, habe ich sogar meinen Job verloren. Ich gebe zu, dass ich zu schnell gefahren bin – aber ich hatte keine andere Option. Wenn ich mitten auf der Autobahn angehalten hätte, hätte dies tödlich enden können!» * Name geändertSchreibt Blick.
Die Psychoanalyse von Doktor Luzart –SATIRE
«Ich musste ganz dringend auf die Toilette. Es fühlte sich an, als müsste ich ein Kind gebären.» Sagt John L.
Lieber John L.: Auch wenn nun die «Ehe für alle» nach der Wahl des Schweizer «Volchs» (O-Ton Christophorus «The Saint» Blocher) vom vergangenen Sonntag in die Schweizer Verfassung aufgenommen wird, können Männer bis auf weiteres kein Kind gebären. Auch wenn es immer wieder auf die analoge Plugin-Art versucht wird. Da hilft nicht mal die Schweizer Verfassung weiter.
Du Dummerchen hast doch nicht etwa geglaubt....? John, uns Männern fehlen nicht nur die Gebärmutter, sondern auch die Eierstöcke. Selbst wenn das, was dem sogenannt «starken Geschlecht» zwischen den Beinen mal mehr, mal etwas weniger herunterbaumelt, im «Volchsmund» (Copyright siehe oben) «Eier» genannt wird. Für alle Blöden: Das sind die Höden und nicht die œufs!
Oder wie schon William Shakespeare in «Romeo und Julia», der wie Adolf Hitler unter Darmblähung gelitten haben soll und in seinem Gärtchen Hanf anbaute, weshalb er viel von diebischen Vögeln verstand, die sich an seinen Hanfstauden verlustierten, für alle Zeiten festhielt: «Es war die Nachtigall und nicht die Lerche!»
Womit endlich die Bedeutung dieses epochenprägenden Zitats wissenschaftlich geklärt ist. Shakespeare konnte auch in berauschtem Zustand den Flügelschlag einer zugedröhnten Nachtigall von dem einer grazil durch die Lüfte schwebenden Lerche unterscheiden. Was dem Luzerner LSD-Papst und Calida-Erben Vanja Palmers im spirituellen Flugmodus bis zum heutigen Tag noch nie gelungen ist.
Dafür nannte mich Vanja vor Jahren einmal auf dem Bahnhofplatz in Luzern, wo er mit seinem «Schweinemobil» in veganer Mission unterwegs war, ein Arschloch. Was mich allerdings nicht sonderlich beeindruckte. Im Gegenteil: Ich finde es sogar belustigend, wenn ein Esel den andern Esel als Langohr betitelt.
Solltest Du, abgrundgutester John, wieder mal bei rasender Fahrt in Deinem Mercedes-Cabriolet ein Kind gebären wollen, kacke schlicht und einfach in Deine modisch nicht wirklich berauschenden, aber farblich immerhin zu Deinem Taliban-Bart und der Karl Lagerfeld-Sonnenbrille passenden Röhrlihosen, die in Wirklichkeit keine Röhrlihosen sind. Damit erst machst Du sie geschmackvoll.
Aber tue dies nicht ohne die wirklich wunderbare, harmonisch auf die Farbe Deines Mercedes abgestimmte, Honiggelbe Bolero-Jacke im hinteren Bereich etwas über Deine Taille anzuheben. Wir wollen doch keine bräunlichen Flecken auf diesem durchgestylten Accessoire, das aus einem Mann erst einen richtigen Kerl macht. Das bist Du doch, oder etwa nicht?
Wenn Du diese gutgemeinten Ratschläge in Zukunft befolgst und den Gasfus noch etwas lupfst, ersparst Du Dir nicht nur viel Ärger, sondern auch eine Menge Money, womit sich ein paar Leasingraten fürs Cabriolet bezahlen lassen.
Allerdings hast Du dann als Kollateralschaden keine Blick-Story mehr inklusive beeindruckender Bildergalerie über Dein Mercedes-Cabriolet und Deinen wirklich modischen Dress-Style. Das willst Du, der Du ja alles andere als mediengeil bist, doch auch? Oder könnte es sein, dass wir uns da irren?
Um allfälligen Klagen vorzubeugen, ist dieser Beitrag als Satire gekennzeichnet. So habe ich es bei der letzten Anzeige gegen mich von der Luzerner Staatsanwaltschaft gelernt, die nicht nur die Anzeige mit einer zweiseitigen Begründung über die «gesellschaftliche Wichtigkeit» der Satire niederschmetterte und den/die/das Kläger (bei diesem Kläger ist gendergerechte Schreibweise wirklich angesagt) zur Bezahlung der entstandenen Kosten verdonnerte, sondern nebenbei auch noch meinen Doktortitel legalisierte. Liebe Grüsse an Damian.
-
1.10.2021 - Tag der Hochzeiten im weissen Tutu
109 Hochzeiten weniger als im Vorjahr: 2020 war dank Corona kein gutes Jahr für die Liebe
1’866 Paare gaben sich im Jahr 2020 das Ja-Wort. Damit sinkt die Zahl der Trauungen auf Tiefen wie vor 14 Jahren. Gleichzeitig ist auch die Anzahl Scheidungen gestiegen. Im Jahr 2020 liessen sich 723 Paare scheiden.
Die Corona-Pandemie ist nicht unbedingt für die Förderung sozialer Beziehungen bekannt. Besonders zu Lockdown-Zeiten fühlten sich viele Personen einsam. Anscheinend schlug Corona sich auch auf die Stimmung in bestehenden Beziehungen nieder: 2020 heirateten so wenige Luzerner Paare wie zuletzt 2006, wie Auswertungen der Statistik Luzern (Lustat) zeigen.
1’866 Trauungen führte das Luzerner Standesamt im letzten Jahr durch. Das sind 109 weniger als noch im Vorjahr. 19 Paare liessen sich währenddessen ihre Partnerschaft eintragen. Gerade während der Hochsaison im Frühling und Sommer haben Paare viel weniger oft geheiratet als in früheren Jahren, so Lustat.
Auf der anderen Seite hingegen nahmen Scheidungen abermals zu: 723 Ehepaare liessen sich 2020 scheiden, was 7,7 Prozent mehr als noch im Vorjahr sind. Zusätzlich wurden 11 eingetragene Partnerschaften wieder aufgelöst. Zudem verschiebt sich der Zeitpunkt der Scheidungen nach hinten. «Scheidungen nach nur wenigen Ehejahren sind in den letzten zwei Jahrzehnten anteilsmässig seltener geworden», schreibt das Lustat in ihrer Mitteilung. Die durchschnittliche Ehedauer bei einer Scheidung liegt damit neu bei 16,1 Jahren.
Weiter hat sich gemäss Lustat das Heiratsverhalten der Luzernerinnen in den letzten Jahren verändert: Nebst weniger Hochzeiten und mehr Scheidungen verändert sich auch der Zeitpunkt der Eheschliessung. Luzerner heiraten inzwischen generell später. Frauen sind bei der Eheschliessung im Schnitt 30,2 Jahre alt und Männer 32,5 Jahre alt. Bei der Partnerschaft sind Luzerner gar noch älter: Frauen sind durchschnittlich 35,9 und Männer 37,9 Jahre alt.
Zudem nimmt auch die Zahl der Wiederverheiratung zu: Inzwischen ist bei jeder fünften Luzerner Hochzeit mindestens eine Person nicht mehr ledig. Am häufigsten heiraten geschiedene Männer ledige Frauen (39 Prozent), umgekehrt ist dies bei 26 Prozent der Wiederverheiratungen der Fall. Schreibt ZentralPlus.
Müsste es in der Headline nicht heissen «wegen» statt «dank» Corona? Freut man sich gar über diese Entwicklung beim Luzerner Online-Portal für Qualitäts-Journalismus?
Sei's drum. Kein Grund zur Sorge wegen dieser niederschmetternden Nachricht! Frei nach Hölderlin «Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch!»
Was die aussterbene Art der «Heten» (Anm. Heterosexuelle) nicht mehr zu leisten vermag, übernimmt nun die LGBT-Community (Anm. eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender; Wikipedia).
Denn gestern schrieb ZentralPlus: «Ehe für alle»: Standesamt Luzern wappnet sich für Ansturm.
Sie sehen: Einmal mehr bestätigt sich die Aussage von König Artus, der seinen «Rittern der Tafelrunde» offenbart haben soll (Konjunktiv; die Forschung ist sich nicht sicher, ob König Artus überhaupt je existierte):
«Nichts bleibt wie es ist!»
Ob der Luzerner FDP-Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller, der im Vorfeld der Abstimmung zur «Ehe für alle» mit seinem Facebook-Aufruf um ein «grosses JA für die Ehe für alle; Love is liberal», also FDP, gebeten hat, seinen Worten nun Taten folgen lässt und im weissen Tütü (Ballettkostüm in Form eines Rocks aus mehreren Schichten Tüll; Wikipedia) samt Lebensabschnittspartner*in das Luzerner Standesamt stürmt, bleibt das Geheimnis des Luzerner Polit-Superstars und Staatsmannes. Ab und zu auch «Freisinniger Pöstchenjäger» genannt.
Huch.

-
30.9.2021 - Tag von «China first»
Olympia 2022: Winterspiele in Peking nur mit Zuschauern aus China
Internationalen Fans bleibt der Zugang zu den Winterspielen in Peking verwehrt. Ungeimpfte Athletinnen und Athleten dürfen zwar teilnehmen, müssen sich aber auf eine kompliziertere Einreise einstellen.
Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, die vom 4. bis 20. Februar stattfinden werden, sollen vor gefüllten Rängen stattfinden – Zuschauer aus dem Ausland werden allerdings dort nicht zugelassen. Entsprechende Pläne gab das Organisationskomitee am Mittwoch im Anschluss an einer Sitzung mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) bekannt. Demzufolge sollen nur Fans aus dem Gastgeberland China Zutritt zu den Wettkampfstätten erhalten. Voraussetzung dafür sind noch nicht näher bekannte Corona-Auflagen.
Zudem müssen sich ungeimpfte Athletinnen und Athleten gegenüber Geimpften auf eine kompliziertere Einreise einstellen. Während sich geimpfte Sportler unmittelbar nach der Einreise innerhalb einer Blase bewegen dürfen, müssen sich ungeimpfte Sportler in eine dreiwöchige Quarantäne begeben. Die sogenannte »Bubble« für alle Teilnehmer wird ab dem 23. Januar aufgezogen und darf die gesamten Spiele nicht verlassen werden.
Tägliche Coronatests für alle
Das IOC und auch das Internationale Paralympische Komitee (IPC), das ebenfalls an der Sitzung teilnahm, erklärten ihre Unterstützung für die Pläne. Diese sehen unter anderem auch tägliche Coronatests aller bei den Spielen involvierten Personen vor. Ähnlich war bereits bei den in den vergangenen Sommer verlegten Sommerspielen 2020 in Tokio verfahren worden. Im ersten sogenannten Playbook sollen die Sicherheitsmaßnahmen detailliert aufgeführt werden. Die Veröffentlichung ist für Ende Oktober geplant.
Bei den Olympischen und Paralympischen Spielen im vergangenen Sommer in Tokio waren Zuschauer weitgehend ausgeschlossen, da in der japanischen Hauptstadt und den benachbarten Präfekturen aufgrund der Pandemie der Ausnahmezustand verhängt worden war. Schreibt DER SPIEGEL.
Chinas «Zero Covid»-Strategie wagen nicht einmal die ansonsten unantastbaren Götter mit dem berühmten «Dollar-Blick» vom IOC zu widersprechen. Die Olympia-Stadien werden auch so gefüllt sein. Dafür sorgen allein schon die fast 22 Millionen Einwohner*innen Pekings sowie die KP (kommunistische Partei) der Volksrepublik.
Die wohl rigoroseste Pandemiebekämpung der Welt mit der Botschaft «das Virus kommt von aussen» zeigt Wirkung im Land der aufgehenden Sonne. Im Umkehrschluss aber auch hierzulande, wo die chinesischen Touristenhorden vergangener Jahre schmerzlich vermisst werden.
Dass in China inzwischen etliche Touristikunternehmen pleite sind, die sich über Jahre hinweg einzig und allein auf das boomende Massengeschäft mit ihren Landsleuten fixiert hatten, nimmt die KP China als Kollateralschaden in Kauf.
Statt dem Rest der Welt werden nun innerchinesische Touristenziele wie die Chinesische Mauer geflutet. Was für das chinesische BIP (Bruttoinlandprodukt) immerhin als positiver Nebeneffekt verbucht werden kann. Bleiben doch die Yuan (chinesische Währung) im eigenen Land.
«China first» at its best.
So äussert sich der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur in Krisenzeiten wie diesen. Diktatoren brauchen sich nicht um oppositionelle «Trychler»-Gruppen zu kümmern.
Was die «Trychler» nicht unbedingt sympathischer macht, aber mit dem chinesischen Regierungssystem möchten wohl trotzdem nur ein paar verwirrte Hitzköpfe und Anhänger der Uiguren-Camps tauschen.
Gefestigte Demokratien werden langfristig auch diese Herausforderung überstehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Denn nach jedem Regen scheint auch irgendwann wieder die Sonne.
Amen.
-
29.9.2021 - Tag der gefrorenen Herzen
Infiziert und ausgemustert: Pflegefachpersonen verlieren wegen Long Covid ihre Arbeit
Pflegefachkräfte, die von Corona-Langzeitfolgen betroffen sind, werden von der Arbeitgeberin im Stich gelassen.
Wegen Corona ist das Spitalpersonal seit Monaten am Anschlag. Wie viele von den Pflegefachkräften bisher selbst an Corona erkrankt sind, erfasst der Bund nicht.
Einen ersten Hinweis geben neue Zahlen der Suva, auch wenn hier nur ein kleiner Teil der Betriebe des Schweizer Gesundheitswesens versichert ist: In den vergangenen zehn Jahren erhielt die Versicherung im Schnitt 300 Meldungen über Berufskrankeitsfälle im Jahr. 2020 stiegen sie auf über 1300 an – eine Steigerung um mehr als das Vierfache. Die Suva geht davon aus, dass diese massive Steigerung auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist.
Ebenfalls nicht bekannt: Wie viele infizierte Pflegefachpersonen an Long Covid leiden. «Kassensturz» liegen mehrere Fälle vor, die zeigen: Manche Betroffene sind monatelang schwer krank. Erschwerend kommt hinzu, dass sie in dieser Situation vom Arbeitgeber nicht selten im Stich gelassen werden.
Mangelhafte Schutzmassnahmen
Ein Beispiel: Die erfahrene Pflegefachfrau M.L. arbeitete im Spital Interlaken auf der stationären Psychiatrie. Laut M.L. wurden während dieser Zeit weder Personal noch Patienten auf Corona getestet, es gab keine FFP2-Masken, sondern nur eine Hygienemaske pro Tag. Impfungen standen noch nicht zur Verfügung. Der Geschäftsbericht des Spitals legt offen, dass das Virus auch vor dem Personal nicht Halt machte:«Allein vom 31. Oktober bis zum 7. Dezember 2020 musste die krankheitsbedingte Abwesenheit von 67 Mitarbeitenden kompensiert werden.» Laut dem Spital wegen Corona, Krankheit und Erschöpfung.
Letzten Dezember traf es auch M.L. In ihrem Privatleben isolierte sie sich so gut wie möglich, die Vermutung liegt nahe, dass sie sich bei der Arbeit ansteckte. Covid-19 griff ihre Hirnnerven an. Und es wurde immer schlimmer – typisch für Long Covid. «Ich hatte unaushaltbare Schmerzen und bettelte nur noch, man solle mich betäuben», erinnert sich die Pflegefachfrau.
Gekündigt, damit Stelle neu besetzt werden kann
Ein halbes Jahr später – nach zwei Gesprächen mit den Vorgesetzten – folgte die Kündigung. Das Spital Interlaken schrieb ihr, man müsse ihre Stelle neu besetzen, um die Personalplanung dauerhaft sicherstellen zu können. Für M.L. ein Schlag ins Gesicht: «In einer solchen Situation bräuchte man Unterstützung; nicht die Kündigung.»
Das Spital Interlaken will vor der Kamera keine Stellung beziehen. Es schreibt «Kassensturz», Frau L. sei als «Mitarbeiterin und Mensch sehr geschätzt» worden. Und: «Mit der Vertragsauflösung konnte die Stelle nun neu besetzt werden; diese Entlastung der Teammitglieder war Frau L. wichtig; die Vertragsauflösung hat Frau L. von diesem selbst auferlegten Druck befreit.» Zudem habe man einen Wiedereinstieg angeboten.
M.L. sagt: «Ich weiss nicht, wie viele im Betrieb an Long Covid erkrankt sind. Vielleicht sind es Einzelne. Sollte man denen nicht speziellen Schutz zukommen lassen und sagen: Gerade jene, die sich vermutlich im Betrieb angesteckt haben, unterstützen wir?»
Heute geht es der Pflegefachfrau deutlich besser, und sie möchte für ihre Kolleginnen einstehen. Denn Kündigungen nach Krankheit gebe es gerade im Pflegeberuf viel zu oft. «Ich wünsche mir, dass die Arbeitgeber zu ihrem Personal stehen und ihnen Zeit geben, sich zu erholen. Und dass die Stellenpläne in dieser Situation mal beiseitegelegt werden.» Schreibt SRF.
Auch wenn mir (subjektiv, wie immer) der SRF-Artikel über den Kassensturz-Beitrag etwas aufgebauscht erscheint, da es sich um überschaubare Einzelfälle handelt, ist dennoch jeder einzelne Fall einer zu viel!
Zwischen Klatschen auf Schweizer Balkonen für das Pflegepersonal in der Hochphase der Coronapandemie, marketinggerechten Dankesfloskeln grosser Detailhändler und den etwas peinlichen «Jerusalema»-Tanzvideos einiger Schweizer Polizeikorps klafft eine grosse Lücke zu echter, gelebter Solidarität.
Das war aber schon immer so.
«Gefrorene Herzen» ziehen sich seit jeher durch die Geschichte der Menschheit.
Der gleichnamige Film vom Schweizer Oscar-Preisträger Xavier Koller nach Meinrad Inglins «Begräbnis eines Schirmflickers» liefert dafür ein treffendes Beispiel aus dem letzten Jahrhundert; die demonstrierenden «Trychler»-Horden eines aus der Gegenwart.
-
28.9.2021 - Tag des Buchstabensalats in Österreich
Abgestraft: Wenn der Politik in Österreich nicht mehr vertraut wird
MFGFRANKMA(R)TINPIRATKPÖ - was das für ein Buchstabensalat ist? Es sind Parteinamen auf Stimmzetteln. Aus dem Nichts kommende Wahllisten wie MFG ziehen in Volksvertretungen ein. Zugleich wissen wir seit Sonntag, dass die altbekannte KPÖ in einer Wahl Erster werden kann. Warum nur, warum?
1. In Oberösterreich hat es die Liste „Menschen Freiheit Grundrechte“ in den Landtag geschafft. Das gelang auch Frank Stronach bei den Nationalratswahlen 2013. Genauso wie davor MATIN mit dem EU-Parlamentarier Hans-Peter Martin. Die Piraten schafften immerhin ein paar Gemeinderäte von Innsbruck bis Graz. Ebenda werden die Kommunisten nun wahrscheinlich die Bürgermeisterin stellen.
2. All diese so unterschiedlichen Parteien haben eine Gemeinsamkeit. Gerne wird übersehen, dass die Motive von Wählern der Liste MFG natürlich Ablehnung der Corona-Maßnahmen und Impfskepsis beinhalteten. Aber nicht nur. Fast gleichauf war als Wahlmotiv der Protest gegen traditionelle Parteien und etablierte Parteimenschen und Politiker. Das gibt Typen und Gruppen gute Chancen, die als irgendwie anders gelten.
3. Klassische Parteipolitik hat ein derartiges Negativimage, dass das Anderssein bereits eine wichtige Voraussetzung für Wahlerfolge sein kann. Höchstens ein Drittel der Österreicher vertrauen den etablierten Parteien. Sowohl der Regierung als auch der Opposition wird mehrheitlich misstraut. Alle Parlamentsparteien haben also ein gewaltiges Imageproblem. Ganz egal, welche Parteifarbe sie haben.
4. Muss man also wie Stronach nur zu viel Zeit und Geld haben, um die Schwächen „alter“ Parteien auszunützen? Genügt es, nach dem Vorbild der MFG eine Krise als Chance für die Ansprache von Stimmungslagen für Proteststimmen auszunützen? Stürzen sich massenhaft Spinner und sensationslüsterne Medien auf jede Form der Andersartigkeit?
5. Nicht unbedingt. Klar, neue Parteien erhalten oft Zuspruch von verhaltensauffälligen Chaoten und bestenfalls halbdemokratischen Extremisten. Doch ihr typischer Wähler ist nicht zwangsläufig ein radikaler Protestierer, sondern oft schlicht von der Politik sehr enttäuscht. Den größten Anteil der MFG-Wählerschaft stellen berufstätige Männer aus der Privatwirtschaft, 30 bis 59 Jahre alt, und deren Familien.
6. Einmalerfolge können allerdings zu vorübergehenden Sternschnuppen werden. Zum Beispiel wünschen sich ja hoffentlich Abgeordnete der MFG gleich dem Rest des Landes, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist. Bleibt man monothematisch auf das Virus fixiert, so würde man dadurch die politische Existenzberechtigung verlieren. Das Gegenbeispiel ist der Grazer Wahlsieg der KPÖ, die ja keineswegs neu ist und in der steirischen Landeshauptstadt seit Jahrzehnten gute Ergebnisse einfährt.
7. Das kommunistische Geheimnis des Langzeiterfolges ist es, schon zur Jahrtausendwende ein Thema zu besetzen, das ÖVPSPÖFPÖGRÜNE in der Stadt sträflich vernachlässigten: leistbares Wohnen! Die Kommunisten ideologisierten dabei nicht herum, sondern kümmerten sich konkret vor Ort, die Wohnverhältnisse zu verbessern.
8. Dabei lebt Elke Kahr als kommende Bürgermeisterin von Graz glaubhaft ihr sozialpolitisches Denken, indem sie zwei Drittel ihres Gehalts spendet und mit anderen Parteien weder Kompromisse noch einem Kuhhandel ähnliche Abtauschgeschäfte eingeht. Ihre Gretchenfrage wird sein, ob das an der Stadtspitze funktioniert, wenn sie für ihre Regierungszeit Partnerparteien braucht.
9. Kahr geht jedenfalls unbestritten ihren Weg als überzeugte Kommunistin mit praktischem Themenbezug. Das ist besser als populistische Eintagsfliegen, die Fantasielösungen für alles vorgaukeln. Sonst könnte ja jeder Kasperl morgen eine Partei namens Winnetous Apatschen gründen - und mit inhaltsleeren Sprüchen wie „Wir sind die echten Roten!“ oder „Besser rot als jeden Tag blau!“ zu punkten versuchen. Das große Potenzial der von altbekannten Parteien enttäuschten Wähler würde freilich sogar das möglich machen. Schreibt DIE KRONE.
Ich werde den Eindruck nicht los, dass die Demokratie für länger andauernde Krisenzeiten nicht gewappnet ist. Und dies nicht erst seit heute. Schon oft in der Geschichte der Menschheit spülte sie in schleichenden Prozessen Gruppierungen, Parteien und Diktatoren an die Macht, die nichts anderes im Sinne hatten, als den sogenannten «Parlamentarismus» zu zerstören.
Als exemplarisches Beispiel der jüngeren Geschichte darf Adolf Hitler genannt werden, der sich – nach einem missglückten Versuch – nicht an die Macht putschte, sondern mit dem demokratischen Mittel der Wahlen und dank einem senilen Reichspräsidenten (Hindenburg) legal gewählter deutscher Reichskanzler wurde.
Der schleichende Zerfall der Demokratie, wie wir ihn derzeit live und wahrhaftig in vielen westlichen Demokratien erleben, hat viele Gründe. Allen voran sind die Parteien und deren führende Köpfe zu nennen. Denn letztendlich sind es nur die Parteien, die im Auftrag des Staates die Demokratie durch die ruhigen wie auch stürmischen Zeiten führen müssen. Doch genau daran hapert es.
Nach vielen Jahren des wirtschaftlichen Sonnenscheins und der stetigen Zunahme vom Bruttoinlandprodukt (BIP) geht die Schere zwischen Arm und Reich, Unzufriedenen und Zufriedenen, immer weiter auf. Die eine Seite kauft sich die Politik so wie sie sie haben will, die andere wartet auf den Erlöser. Das war schon immer so und ist weder dem viel zitierten Zeitgeist noch der Digitalisierung geschuldet. Benito Mussolini, Adolf Hitler und Donald Trump sind nicht vom Himmel gefallen.
Dass Menschen der Politik nicht mehr vertrauen, ist kein österreichisches Phänomen. Die saturierten Politiker*innen geben ja wirklich überall ihr Bestes, um dieses Vertrauen zu zerstören.
Es ist ja nun beileibe nicht so, dass die misstrauischen Menschen den Politikern*innen nichts zutrauen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Man traut ihnen so wirklich alles zu.
Machterhalt um jeden Preis, Klientelpolitik und persönliche Bereicherung bis hin zur Korruption ergeben eine Melange, die langfristig jedes Vertrauen erschüttert. Und damit die Demokratie schwächt und ihr unendlichen Schaden zufügt.
Wenn die Wähler*innen von Graz – immerhin die zweitgrösste Stadt Österreichs – ausgerechnet die kommunistische Elke Kahr zur Bürgermeisterin wählen, hat das nichts mit Ideologie oder Politikverdrossenheit zu tun. Politikverdrossene gehen in der Regel gar nicht mehr an die Wahlurne. Wählen somit zur Not auch keinen Besenstiel, wie öfters kolportiert wird.
Die gute Frau Kahr hat schlicht und einfach das richtige Thema mit der Grazer Wohnungsmisere angesprochen, die vielen betroffenen Menschen unter den Fingernägeln brennt.
Ob sie es lösen kann, sei dahingestellt. Das werden die etablierten Parteien Österreichs durchs Band weg zu verhindern wissen. Dass sie aber das Problem des bezahlbaren Wohnraums damit nur auf die lange Bank schieben, ist ihnen ziemlich egal. Gilt es doch für ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und Grüne einzig und allein darum, ihre Klientel und Gross-Spender der Immobilienbranche vor unliebsamen Überraschungen zu schützen. Wer bezahlt befiehlt. Steht vermutlich inzwischen unter dem Kleingedruckten in allen Parteibüchern.
Ach wie gut, dass wir in der Schweiz solche Probleme wie bezahlbaren Wohnraum, korrupte Politiker*innen (Pöstchenjäger) und Klientelpolitik der Parteien nicht kennen. Dafür aber den Zynismus.
Jedenfalls ich. Zynismus hilft manchmal bei unlösbaren Problemen. Sagte mir jedenfalls mal das Orakel und wandelnde Lexikon vom Riedtal in Zofingen.
-
27.9.2021 - Tag danach nach der Ehe für alle
Nach dem Ja zur «Ehe für alle»: Fordert die queere Community nun Eizellenspenden und Leihmütter?
Das Ja führt nicht dazu, dass Lesben und Schwule neue fortpflanzungsmedizinische Möglichkeiten einfordern. Wenn es aber neue gibt, sollen sie für alle gelten.
Vor einem «Kind auf Bestellung» haben die Gegnerinnen und Gegner der «Ehe für alle» gewarnt und jetzt mit dem Ja befürchten sie, es werde Realität. Für die SVP-Nationalrätin Verena Herzog ist klar: «Mit der Annahme der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare werden jetzt weitere Forderungen der Homosexuellen folgen.»
Die Parlamentarierin aus dem Kanton Thurgau sagt weiter: «Diese Forderungen liegen ja schon auf dem Tisch. Die Eizellenspende ist bereits im Parlament deponiert. Das Nächste wird die Leihmutterschaft sein.»
Was hat es mit der Eizellenspende auf sich?
Eine Eizellenspende ist, wenn eine Frau einem Paar, bei denen die Partnerin unfruchtbar ist, eine Eizelle spendet. Diese Eizelle wird mit dem Sperma des Partners befruchtet und der Partnerin eingesetzt.
Die grünliberale Nationalrätin Katja Christ hat in einer parlamentarischen Initiative analog zur erlaubten Samenspende die Legalisierung der Eizellenspende gefordert.
Die Nationalrätin für Basel sagt: «Es braucht die Legalisierung, weil es eine Ungleichbehandlung darstellt. Es gibt juristisch keinen Unterschied. Es ist eine Drittperson, die einem Paar, das ungewollt kinderlos ist, eine Keimzelle zur Verfügung stellt.»
Profitieren würden Heterosexuelle
Von dieser Legalisierung würden hauptsächlich kinderlose heterosexuelle Paare profitieren. Für ein schwules Paar mit Kinderwunsch würde die Eizellenspende nichts bringen.
Bei einem lesbischen Paar wird in den allermeisten Fällen mindestens eine der Partnerinnen zukünftig dank der nun legalen Samenspende ein Kind bekommen können.
Stichwort Leihmutterschaft
Für ein schwules Paar wäre eine Leihmutter neben der Adoption effektiv eine Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Roman Heggli aber winkt ab. Der Vertreter der Schwulenorganisation Pink Cross sagt, eine solche Forderung würden sie nicht aktiv vorantreiben.
Heggli sagt: «Ich denke nicht, dass wir uns dagegen stellen werden. Wir werden aber nicht die Vorreiterinnen oder die Vorkämpfer sein. Ich glaube wirklich, es ist hauptsächlich ein Thema, das heterosexuelle Paare betrifft.»
Leihmutterschaft zurzeit eh chancenlos
Alle Bundesratsparteien haben gesagt, sie seien gegen die Leihmutterschaft. Das Ja zur «Ehe für alle» führt also nicht dazu, dass Lesben und Schwule die neuen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin für sich einfordern.
Seit gestern ist ebenso klar: Wenn die Politik neue Techniken diskutiert und für Paare zulässt, dann wird sie das für alle Paare tun – unabhängig ob homo- oder heterosexuell. Schreibt SRF.
Alea iacta est, wie wir Lateiner*innen zu sagen pflegen. Der/Die/Das Würfel zur «Ehe für alle» ist gefallen.
Homosexualität soll übrigens laut einigen Hysterikern und Historikern*innen in der Gesellschaft des Römischen Reichs weit verbreitet gewesen sein.
Selbst die griechischen Philosophen frönten der erotischen Liebe zwischen Mann und Knabe, wie der Schweizer Modist und Tuchhändler Heinrich Hössli in der ersten, fundierten Verteidigung der Homosexualität mit seinen Büchern «Eros. Die Männerliebe der Griechen» (1. Band 1836, 2. Band 1838) geschrieben hat.
Nun denn, das Volk hat an der Wahlurne demokratisch entschieden und ist dem Wunsch nach einem «GROSSEN JA ZUR EHE FÜR ALLE» des Luzerner Ständerats Damian «ich bin nicht schwul» Müller entgegengekommen. Schwulsein ist schliesslich liberal. Also FDP-Blau. Sagt jedenfalls Müllers Flyer aus. Ob er nun demnächst ganz in Weiss mit einem Adrian oder einem Besenstiel vor dem Stadesamt auftaucht, lässt der grosse Staatsmann allerdings offen.
Nach diesem wirklich überwältigend grossen JA zur «Ehe für alle» kommt's nun wirklich nicht mehr drauf an, ob da noch die Reproduktionsmedizin wie die Leihmutterschaft oder eine künstliche Gebärmutter als Implantat für Männer hinzu kommt. Wer A sagt muss auch B sagen.
So ist das nun mal im Leben. Den letzten Zwick an der Geissel, die kirchliche Trauung von Homosexuellen, wird die Scharia der römisch-katholischen Kirche auch nicht auf ewig verhindern können. Mit Irgendwelchen Leuten müssen ja die katholischen Kirchen noch gefüllt werden. Warum nicht mit einer Pride?
Eine Forderung aber bleibt nach dem grossen JA: Das Plakat am Neptunbrunnen auf dem Mühlenplatz in Luzern mit dem Verbotshinweis «Das Besteigen des Brunnens ist untersagt» muss nach dem gestrigen Wahltag augenblicklich entfernt werden!
Wenn wir das grosse JA zur «Ehe für alle» wirklich ernst nehmen, muss es auch erlaubt sein, diesen altehrwürdigen Brunnen «besteigen» zu dürfen. Könnte ja durchaus sein, dass eine liebestolle Giesskanne diesen Brunnen heiraten und ein Kind von oder mit ihm haben will. «Ehe für alle» bedeutet nun mal nichts anderes als «Ehe für alle».
Oder wie der grossartige Wiener Poet und Liedermacher André Heller in seinem Lied «Denn ich will» singt: «Und wenn ein Hirte sein Lamm liebt, soll er es lieben, wenn er es liebt. Denn ich will, dass es das alles gibt, was es gibt.»
So viel Toleranz muss in einer durchgenderisierten Gesellschaft sein! Auch Giesskannen haben ihre Rechte.

-
26.92021 - Tag Ehe für alle: Ständerrat Damian «ich bin nicht schwul» Müller fordert ein GROSSES JA
Im Juni nahmen 59,7 % der Stimmbeteiligten* an den Abstimmungen teil. Das müssen wir am Sonntag wieder hinbekommen!
Wer's noch nicht gemacht hat: Heute noch das Couvert ausfüllen und auf die Post. Allerspätestens am Mittwoch mit A-Post, sonst kommt's nicht rechtzeitig an!
Dabei bitte ein grosses JA für die Ehe für alle. Der Staat hat im Privatleben der Bürger nichts zu suchen.
Schreibt der Luzerner Ständerrat Damian Müller auf einem seiner Social Media Accounts.
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Er/Sie/Es hat sich doch noch zur «Ehe für alle» geäussert: Unser aller Luzerner Ständerrat Damian «ich bin nicht schwul» Müller.
LOVE IS LIBERAL! Ich gebe es zu: Ich habe geweint, als ich diese Headline samt den süssen** und aufmunternden Worten mit regenbogenfarbiger Umrandung und FDP-blauem Herzchen von unserem Liebling aller Schwiegermütter gelesen habe. Dieser Tränen schäme ich mich überhaupt nicht.
Aber wenn doch zum Beispiel Schwulsein liberal ist, sei die Frage erlaubt, warum denn unser aller «freisinniger Pöstchenjäger» mit seinem neu gestylten Pride-Frisürchen** (süss, das muss man neidlos zugeben**) in jedem Interview bei den Wahlen 2019 ungefragt betont hat, dass er denn absolut und gar nicht etwa schwul sei, wie es rund um ein paar Miststöcke im Entlebuch behauptet wurde. Das war ja im Umkehrschluss alles andere als ein liberales Bekenntnis des liberalen Ständerrats-Kandidaten zur «Ehe für alle».
Nun denn, sei's drum. Endlich wissen wir, dass ein bisschen Tuck Tuck in alle Richtungen liberal ist. Also zur DNA der FDP gehört. Ein grosser Fortschritt. Besser spät als nie. Gratulation. Das war vor den Wahlen 2019 bei unserem Luzerner «next-top-model» aus dem Ständerrat noch nicht so. Von einem «GROSSEN JA ZUR EHE FÜR ALLE» war damals noch keine Rede. Nicht mal von einem kleinen. Aber eben: Da gings halt um die Wählerstimmen rund um die Miststöcke im Entlebuch.
* Finde den Fehler: Es nahmen 59,7 % der «Stimmbeteiligten» an der Abstimmung teil. Dieser Satz ergibt keinen Sinn. Da verwechselt einer «Wahlberechtigte» mit «Stimmbeteiligten». Dürfte eigentlich einem in der Politik tätigen Menschen nicht passieren. Und so ein Blender mit orthografischen Schwächen eines Analphabeten, die sich auch durch die persönlich verfassten Beiträge auf seiner Website wie ein roter Faden durch sein Gesülze ziehen, wird nicht nur Ständerrat, sondern von der NZZ auch noch als «eloquent» bezeichnet. Eine Lachnummer sondergleichen und ein Hohn für alle wirklich Eloquenten.
** Um allfälligen Klagen vorzubeugen: Das sind selbstverständlich subjektive, rein persönliche Auslegungen gewisser Modetrends, die nicht unbedingt richtig sein müssen.

-
25.9.2021 - Tag der viereckigen Köpfe
Ab Montag: Einreiseverbot für ungeimpfte Albaner und Serben!
Das Staatssekretariat für Migration hat die Liste der Risikoländer aktualisiert. Neu finden sich darauf auch Albanien und Serbien. Ungeimpfte Touristen von dort dürfen ab Montag nicht mehr einreisen.
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat – wie die anderen Schengen-Staaten – die Liste der Corona-Risikoländer aktualisiert. Ab dem kommenden Montag, 27. September, finden sich darauf neu: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Brunei, Japan und Serbien. Uruguay wurde von der Liste gestrichen.
Das heisst: Ungeimpfte Touristen aus diesen sechs Staaten dürfen ab dem kommenden Montag nicht mehr in die Schweiz einreisen. Ausser, sie können eine «äusserste Notwendigkeit» geltend machen. Darunter fallen gemäss SEM Todesfälle von Verwandten, gerichtliche Vorladungen oder dringende Behördengänge.
Geimpfte sind nicht betroffen
Für jene, die geimpft sind, ändert sich nichts. Sie können mit Visum ganz normal einreisen. Allerdings müssen sie mit einem der anerkannten Impfstoffe geimpft sein. Ebenfalls nichts zu befürchten haben Albaner und Serben, die eine Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz haben. Sie dürfen weiterhin einreisen, auch wenn sie nicht geimpft sind.
Erst kürzlich hatte die Schweiz auch die Schraube für Kosovaren und Mazedonier angezogen. Diesen ist die Einreise ebenfalls nur dann gestattet, wenn sie geimpft sind.
Der Grund für die Verschärfung liegt in der angespannten epidemiologischen Lage in diesen Ländern. Serbien etwa verzeichnet in der letzten Zeit täglich über 6500 Neuinfektionen – bei knapp sieben Millionen Einwohnern ein sehr hoher Wert. So dramatisch ist die Lage in Albanien nicht, aber auch dort wütet die vierte Corona-Welle.
Einfacher an ein Zertifikat
Erleichterungen soll es für Touristen aus anderen Ländern geben. Konkret will der Bundesrat es ihnen einfacher machen, ein Schweizer Covid-Zertifikat zu bekommen. Er will dazu eine zentrale elektronische Anmeldestelle für Touristen aufbauen. Diese soll es den im Ausland geimpften oder genesenen Personen ermöglichen, die für die Zertifikatsausstellung notwendigen Informationen und Unterlagen hochzuladen.
Die Anmeldestelle wird voraussichtlich ab dem 11. Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Der Bundesrat will ausserdem die Übergangsfrist verlängern, während der Personen aus dem Ausland auch mit dem gelben WHO-Impfbüchlein oder einem ausländischen Impfnachweis Zugang zum Beispiel zu Restaurants erhalten. Erst am 24. Oktober ist ein Schweizer Zertifikat Pflicht. So haben alle in die Schweiz Einreisenden genügend Zeit, den Schweizer Corona-Pass zu organisieren. Schreibt Blick.
Einfacher an ein Zertifikat
Erleichterungen soll es für Touristen aus anderen Ländern geben. Konkret will der Bundesrat es ihnen einfacher machen, ein Schweizer Covid-Zertifikat zu bekommen. Er will dazu eine zentrale elektronische Anmeldestelle für Touristen aufbauen. Diese soll es den im Ausland geimpften oder genesenen Personen ermöglichen, die für die Zertifikatsausstellung notwendigen Informationen und Unterlagen hochzuladen.
Die Anmeldestelle wird voraussichtlich ab dem 11. Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Der Bundesrat will ausserdem die Übergangsfrist verlängern, während der Personen aus dem Ausland auch mit dem gelben WHO-Impfbüchlein oder einem ausländischen Impfnachweis Zugang zum Beispiel zu Restaurants erhalten. Erst am 24. Oktober ist ein Schweizer Zertifikat Pflicht. So haben alle in die Schweiz Einreisenden genügend Zeit, den Schweizer Corona-Pass zu organisieren. Schreibt SRF.
Ginge es nach mir, würden unabhängig von Corona generell keine Menschen aus Albanien, Serbien und den weiteren Balkan-Ländern in die Schweiz einreisen dürfen.
Den durchgeknallten Schweizer Drogenkonsumenten*innen würde dies allerdings nicht unbedingt gefallen, da möglicherweise ihr Nachschub an Produkten auf der unendlichen «Suche zur Spiritualität» (Copyright by Calida-Erbe und LSD-Papst Vanja Palmers) ins Stocken käme.
Dafür würde sich die Schweizer Kriminalstatistik etwas erholen und die Polizeikorps der Schweiz wären sicherlich auch nicht unglücklich über eine kurze Atempause, haben sie doch mit den hier lebenden Mitbürgern und Mitbürgerinnen aus dem Balkan bereits genug zu tun.
«Der Balkan ist mir nicht die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers wert.» Sagte schon Otto Fürst von Bismarck. Ein kluger Mann. Kein Rassist. Er fühlte sich als Kanzler des Deutschen Reichs lediglich für das Wohl seines Volkes verantwortlich.
-
24.9.2021 - Tag der Willisauer-Gringli
Unbewilligte Kundgebung der Corona-Massnahmen-Gegner in Willisau verhindert
Mehrere Dutzend Gegner der Corona-Massnahmen wollten sich gestern Abend in Willisau zu einer nicht bewilligten Kundgebung treffen. Die Luzerner Polizei konnte einen Aufmarsch verhindern. Rund 60 Personen wurden kontrolliert und weggewiesen.
Über soziale Medien wurde für Donnerstag, 23. September 2021, von Corona-Massnahmengegnern zu einer Kundgebung in Willisau aufgerufen. Bei der Stadt Willisau war im Vorfeld kein Gesuch für eine Kundgebung eingereicht worden. Der Stadtrat hatte deshalb vorab angekündigt, dass eine Demonstration nicht toleriert würde.
Die Luzerner Polizei hat am Abend in Willisau rund 60 Personenkontrollen durchgeführt und ebenso viele Wegweisungen ausgesprochen. Eine kleine Gruppe von Trychlern wurde beim Untertor aufgehalten, kontrolliert und ebenfalls weggewiesen.
Im Umfeld der Kundgebung wurden von der Luzerner Polizei diverse Personenkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden rund 60 Wegweisungen ausgesprochen. Dank der Präsenz der Polizei kam es zu keiner Kundgebung. Es mussten keine Zwangsmittel eingesetzt werden.
Die Luzerner Polizei wird in den nächsten Tagen abklären, ob allenfalls Personen zusätzlich verzeigt werden.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung.
So schnell kann's in Zeiten von Corona gehen: Ein leckeres Willisauer Ringli mutiert zum einfältigen «Trychler»-Gringli.
-
23.9.2021 - Tag der SVP-Brandstifter
Die SVP und die Coronaskeptiker: Ein Tanz auf Messers Schneide?
Die SVP wird momentan immer mehr zur Heimat vieler Corona-Skeptiker und Massnahmen-Gegner. SRF-Recherchen zeigen, dass es dadurch viele Partei-Neueintritte, aber auch zahlreiche Austritte gibt. Kann die SVP nachhaltig ihre Wählerbasis erweitern oder ist dies nur eine kurzzeitige Stimmungsschwankung? Und wie beeinflussen die Neumitglieder das Profil der grössten Schweizer Partei? Politologie-Professor Andreas Ladner gibt Auskunft.
SRF News: Handelt es sich beim vermehrten Zulauf von Massnahmen-Gegnern in der SVP um das Ergebnis einer gezielten Strategie?
Andreas Ladner: Es handelt sich wahrscheinlich eher weniger um eine bewusste Strategie. Es ist schwierig für eine Partei bei solchen Ereignissen strategisch gezielt vorzugehen, um so Wähler zu gewinnen. Sicher ist aber, dass die SVP natürlich auch eine Chance sieht, Leuten, die ein anderes Verhältnis zu Corona haben als der Mainstream, eine Stimme zu geben, um dann davon zu profitieren.
Kann die SVP unter diesen Leuten eine neue Basis schaffen? Eventuell auch bei Leuten, die vorher nicht SVP gewählt haben?
Da muss man unterscheiden. Sie kann sich kurzfristig als Partei darstellen, die offener gegenüber Impfgegnern ist. Hierbei muss man aber sagen, dass die Elite der Partei nicht zu den Impfgegnern gehört, sich jedoch so präsentiert und sagt, «wir sind weniger intolerant als andere Parteien».
Längerfristig Leute an sich zu binden, ist für eine Partei immer eine Herausforderung. Das dürfte bedeutend schwieriger werden, da ja ein Thema im Vordergrund steht und nicht ein Parteiprogramm. Ich zweifle stark daran, dass es der SVP gelingen wird, Leute aus einem anderen politischen Lager – etwa linksalternative Impfgegner – für sich zu gewinnen.
Kann die SVP die Neuanhänger auch in Zukunft und bei anderen Themen als Wähler halten?
Ich glaube nicht. Es macht für die SVP auch keinen Sinn, eine allzu grosse Heterogenität in ihrer Wählerschaft zu halten. Die SVP hat ihre politische Linie und wird versuchen, dieser treu zu bleiben. Von Linksalternativen beispielsweise ist sie in allen anderen Themen schlicht zu weit entfernt. In der Corona-Frage hat sie eine Position gefunden, die es ihr erlaubt, auch viele ihrer gewerblich orientierten Wähler anzusprechen, die stark unter den harten Massnahmen leiden. Ihnen will sie vor allem eine politische Heimat bieten.
Wie verändert die aktuelle Entwicklung das Profil der Partei?
Es kommt natürlich darauf an, wie die SVP mit diesem Zulauf umgeht. Im Moment sieht man noch keinen Wandel des politischen Profils. Die SVP ist hier nicht komplett militant, sondern lediglich offen für Kreise, die nicht so stark auf der Linie des Bundesrates sind. Das sind doch auch Positionierungen, die sich aus der politischen Heimat der Partei ableiten lassen. Ich sehe hier kein Bruch mit der Vergangenheit und keine Neuorientierung der Partei.
Kann die SVP von der jetzigen Situation profitieren?
Ich glaube, dass für die Partei durchaus eine Chance besteht, sich wieder ins Gespräch zu bringen. Jedoch kann die Partei nur profitieren, wenn es sich so entwickelt wie es im Moment aussieht. Also mit sinkenden Fallzahlen und einer tragbaren Spitalauslastung.
Sollte sich die Situation verschlimmern und man zum Schluss kommen, dass man vehementer gegen die Corona-Pandemie hätte vorgehen müssen, würde es der SVP schwierig fallen, hier Gewinn zu machen. Im Moment sieht es eher danach aus, dass die SVP profitiert. Wie die Situation abschliessend aussehen wird, können wir im Moment jedoch noch nicht sagen.
Das Gespräch führte Leonardo Siviglia.
Schreibt SRF.
SRF bemüht den Politologie-Professor Andreas Ladner, um Aufklärung über Vor- und Nachteile der Brandstifter aus der SVP rund um die Wirrköpfe der kruden Impfgegener*innen aus der mehr als suspekten «Trychler»-Vereinigung zu beantworten.
Einen Psychiater statt einen Politologen zu befragen, wäre vermutlich die bessere Wahl gewesen.
Wohin letztendlich psychopathisches Gedankengut dank der Legalisierung durch politische Parteien führen kann, zeigt der Tankstellen-Mord in Deutschland, bei dem ein 20-jähriger Tankstellen-Kassierer von einem Corona-Masken-Gegner erschossen wurde. Oder der Sturm aus Kapitol in Washington.
Eines haben alle diese Tragödien, von denen es nicht nur die zwei vorerwähnten gibt, gemeinsam: Die geistigen Brandstifter aus den radikalen Parteien waschen sich danach stets ihre schmutzigen Hände in Unschuld.
-
22.9.2021 - Tag des inszenierten UNO-Palavers
Taliban fordern Redezeit bei Uno-Generaldebatte
Vor fünf Wochen übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan – nun verlangen sie Sprechzeit bei den Vereinten Nationen. Ein entsprechendes Schreiben wird derzeit von der Uno geprüft.
Die radikalislamischen Taliban verlangen kurz nach dem Machtwechsel in Afghanistan das Recht auf einen Auftritt auf höchster diplomatischer Ebene – bei der Generaldebatte der Uno-Vollversammlung in New York. Wie ein Uno-Sprecher am Dienstag mitteilte, ging ein entsprechendes Schreiben von Taliban-Außenminister Amir Khan Muttaki mit der Forderung nach Redezeit bei den Vereinten Nationen ein.
Darin heißt es demnach, der afghanische Präsident Aschraf Ghani sei am 15. August abgesetzt worden und werde im Ausland nicht mehr als Staatschef des Landes anerkannt. Auch die Mission des bisherigen afghanischen Botschafters bei den Vereinten Nationen sei beendet. Als neuer Botschafter sei Mohammad Suhail Schaheen nominiert worden.
Das Uno-Sekretariat leitete das Schreiben an einen zuständigen Ausschuss zur Prüfung weiter. Wer bei der Generaldebatte die Rede für Afghanistan halten wird, ist bislang unklar. Die Islamisten hatten Mitte August inmitten des US-Truppenabzugs aus Afghanistan die Macht in dem Land wieder an sich gerissen. Sie bildeten in der Folge eine Übergangsregierung.
Die Generaldebatte der Uno-Vollversammlung hatte am Dienstag begonnen. An dem einwöchigen diplomatischen Spitzentreffen nehmen rund hundert Staats- und Regierungschefs und zahlreiche Außenminister teil.
Klare Belege für Menschenrechtsverletzungen
Mit Sorge blicken Beobachter derweil auf die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan. So beklagte Amnesty International gezielte Menschenrechtsverletzungen. Seit ihrer Machtergreifung seien die Taliban dabei, die Errungenschaften der vergangenen zwanzig Jahre im Bereich der Menschenrechte zu demontieren, erklärte die Organisation am Dienstag.
Gemeinsam mit der Internationalen Föderation für Menschenrechte und der Weltorganisation gegen Folter habe Amnesty International viele Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, darunter gezielte Tötungen von Zivilistinnen und Zivilisten und sich ergebenden Soldaten. Auch die Rechte von Frauen, die Meinungsfreiheit und die Zivilgesellschaft seien erneut eingeschränkt worden.
Die Bundesregierung müsse alles in ihrer Macht Stehende tun, um gefährdeten Menschen Schutz in Deutschland zu ermöglichen, sagte die Stellvertreterin des Generalsekretärs von Amnesty International in Deutschland, Julia Duchrow. »Sie muss die Betroffenen jetzt schnell über die vergangene Woche beschlossenen 2600 Aufnahmezusagen informieren, sie bei der Ausreise aus Afghanistan unterstützen und sicherstellen, dass die Botschaften der Nachbarländer mit Hochdruck Visaverfahren durchführen und die Menschen von dort evakuiert werden können«, so Duchrow. Schreibt DER SPIEGEL.
Lasst die Gotteskrieger vom Hindukusch an der UN-Vollversammlung reden. Ein radikal-islamistischer Phrasendrescher mehr oder weniger spielt bei diesem jährlich inszenierten Palaver am Hauptsitz der UNO in New York nun wirklich keine Rolle.
-
21.9.2021 - Tag des alternativlosen Elektroautos
Jean Pütz: «Ende von Verbrennungsmotoren zu fordern, ist populistisch»
Die Zukunft gehört elektrisch angetriebenen Fahrzeuge. Davon ist auch der Ingenieur und Journalist Jean Pütz überzeugt. Allerdings hält er Autos mit großen, schweren Batterien für einen Irrweg. Im Interview erklärt er warum.
Der Wissenschaftsjournalist Jean Pütz hat bereits 1969 in seiner TV-Serie „Energie, die treibende Kraft“ auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Anstieg der globalen Temperatur durch effiziente Nutzung von Energie zu begrenzen. Mit den aktuell diskutierten Klimaschutzmaßnahmen ist der studierte Elektroingenieur, der am 21. September 2021 seinen 85. Geburtstag feiert, allerdings nicht glücklich.
WELT: Der Klimawandel war noch in keinem Bundestagswahlkampf ein so großes Thema wie derzeit. Freut Sie das?
Jean Pütz: Ganz und gar nicht. Wir erleben da eine unsägliche Fokussierung auf die Elektromobilität. Nicht nur die Grünen fordern den vollständigen Umstieg auf Elektrofahrzeuge und ein Verbot des Verbrennungsmotors. Zunächst einmal lenkt es von den eigentlichen Herausforderungen ab. Hierzulande werden rund 40 Prozent der CO2-Emissionen durch das Heizen und Kühlen von Gebäuden verursacht. Dort müsste man in erster Linie auf klimafreundliche Alternativen setzen. Die Verbrennungsmotoren der privaten Pkws tragen hingegen nur mit maximal sechs Prozent zu den CO2-Emissionen bei. Das Ende von Verbrennungsmotoren zu fordern, ist stümperhaft und populistisch. Es führt in eine Sackgasse.
WELT: Warum das? Man kann doch sowohl das eine tun und das andere nicht lassen. Was wäre falsch daran, diese immerhin sechs Prozent CO2-Emissionen zu vermeiden?
Pütz: Verbrennungsmotoren können uns sogar helfen, die Klimaziele zu erreichen. Denn mit ihrer Hilfe lässt sich der Energieverbrauch von Häusern deutlich reduzieren.
WELT: Das müssen Sie genauer erklären!
Pütz: Wenn man im Keller mit einem kleinen Verbrennungsmotor elektrische Energie erzeugt und dabei die Abwärme zum Heizen und zur Warmwassererzeugung nutzt, dann spart man sehr viel Energie und CO2 ein. Mit dieser Technik könnten zahllose Öl- und Gasheizungen ersetzt werden, die CO2-Schleudern sind. Schließlich kann man ja nicht alle Häuser in Deutschland mit Strom heizen oder mit einer Wärmepumpe ausstatten. Die benötigt ebenfalls Strom oder man nutzt eine Gas-Wärme-Pumpe, die dann wiederum auf einem Verbrennungsmotor basiert. Beide Technologien nutze ich schon lange in meinem Haus. Mein mit Erdgas angetriebenes Kleinheiz-Kraftwerk erzeugt neben Wärme zum Heizen auch 5,5 Kilowatt Strom. Auf dem Dach habe ich außerdem Solarzellen und Systeme zur solaren Warmwassererzeugung. Eine gute Isolierung des Hauses trägt dazu bei, dass ich extrem wenig Energie zum Heizen benötige.
Je schwerer ein Auto, umso größer der Reifenabrieb
WELT: Auch wenn man Verbrennungsmotoren für diese Zwecke nutzt, wäre das für sich noch kein Argument, nicht auf Elektroautos zu setzen.
Pütz: Dem Elektroauto gehört in der Tat die Zukunft, aber nicht dem Elektroauto, wie es heute von Tesla und anderen konzipiert wird. In diesen Fahrzeugen stecken sehr schwere Batterien. Das ist so, als würde man noch sechs weitere Fahrgäste in seinem Auto mitnehmen. Das ist nicht nur energetisch ein Problem. Je schwerer ein Auto ist, umso größer ist auch der Abrieb der Reifen. Da gibt es einen linearen Zusammenhang – also doppeltes Gewicht gleich doppelter Abrieb. In den Reifen steckt aber nicht nur Gummi, sondern auch Plastik. Mit dem Abrieb gelangt Feinstaub in die Umwelt und damit Mikroplastik. Dieser Aspekt wird von den Grünen gerne ignoriert. Ein großer SUV mit schweren Batterien an Bord ist eine Unverschämtheit. Das entscheidende Argument gegen eine flächendeckende Einführung von Elektroautos ist aber, dass man in Deutschland niemals so viel elektrische Energie erzeugen kann, um damit alle Kraftfahrzeuge zu betreiben – und nachhaltig schon gar nicht. Wir importieren heute rund 80 Prozent unserer Primärenergie. Ein von Energieimporten unabhängiges Deutschland ist eine Illusion. Wenn man nur die Hälfte der heutigen Elektroautos gleichzeitig ans Stromnetz hängen würde, bräche es zusammen. Mein Eindruck ist, dass Annalena Baerbock den Unterschied zwischen Primärenergie und elektrischer Energie nicht kennt. Wunschdenken allein reicht nicht.
WELT: Haben Sie eben nicht selbst gesagt, dass dem Elektroauto die Zukunft gehört?
Pütz: Ja, aber es müssen Elektroautos ohne große Batterien sein. Nichts spricht dagegen, Autos mit Elektromotoren auszustatten. Die haben einen sehr großen Wirkungsgrad. Doch der Strom für diese Motoren sollte an Bord mit Verbrennungsmotoren aus synthetischen Treibstoffen erzeugt werden. Das wäre CO2-neutral, die Autos wären viel leichter und insbesondere viel preiswerter. Der im Moment eingeschlagene Weg zur Elektromobilität ist nicht nur für einkommensschwache Menschen ein Problem. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren würde hierzulande auch hunderttausende Arbeitsplätze gefährden.
WELT: Was sind synthetische Treibstoffe und warum sind sie CO2-neutral?
Pütz: Synthetische Treibstoffe werden aus nachhaltig gewonnenem Strom, grüner Wasserstoff und Kohlendioxid hergestellt. Das später bei der Verbrennung im Auto freigesetzte CO2 wurde also anfangs der Umwelt entzogen und in das Treibstoff-Molekül eingebaut. Das ist also ein klimaneutraler CO2-Kreislauf. Und weil wir in Deutschland die benötigten Mengen an synthetischen Kraftstoffen nicht selbst produzieren können – so viele Windräder und Solaranlagen lassen sich hierzulande gar nicht aufstellen – müssten diese aus Ländern mit sehr viel Sonne und freien Flächen importiert werden. Denkbar sind verschiedene synthetische Kraftstoffe. Ich persönlich setzte da auf Methanol.
Mit einer Tankfüllung 1500 Kilometer fahren
WELT: Warum Methanol?
Pütz: Weil es da schon den Proof of Principle gibt. Eine innovative österreichische Firma hat ein Hyper-Hybrid-Auto entwickelt – kein Plug-in-Hybrid – das mit einem Zwei-Zylinder-Motor einen Wirkungsgrad von 56 Prozent erreicht. Der Verbrauch liegt bei zwei Liter Treibstoff auf 100 Kilometer. Mit einer Tankfüllung von 30 Litern kann man also 1500 Kilometer weit fahren. Und wenn der Tank leer ist, ermöglicht die kleine Batterie weitere 100 Kilometer. Ich habe die Hyper-Hybrid-Technik bereits vor 15 Jahren empfohlen und empfinde es als wunderbar, dass das inzwischen umgesetzt wird. Ein besonders effizienter Verbrennungsmotor in Kombination mit synthetischen Treibstoffen ist die Lösung. Auch, weil diese Autos nicht teurer sind als die bisherigen Verbrenner-Fahrzeuge.
WELT: Was genau ist der Unterschied zwischen einem Hyper-Hybrid-Auto und einem Plug-in-Hybrid?
Pütz: Beim Plug-in-Hybrid gibt es noch parallel einen mechanischen und elektrischen Antrieb. Das halte ich für idiotisch. Das Hyper-Hybrid-Auto ist hingegen ein rein elektrisch angetriebenes Autos, das ganz ohne Mechanik und Getriebe auskommt.
WELT: Was wünschen sie sich von der neuen Bundesregierung?
Pütz: Ich wünsche allen Politikern die Erkenntnis, dass es fundamentale Gesetze der Physik und Chemie gibt, die sich durch keine Ideologie umgehen lassen. Das gilt sowohl für den menschengemachten Klimawandel als auch die technischen Ansätze zum Erreichen von CO2-Neutralität. Ich wünsche mir, dass es keine milliardenschweren staatlichen Subventionen für das Batterie-schwere Elektroauto herkömmlicher Bauart mit schlechter Ökobilanz gibt. Mein großer Traum ist, dass unsere freiheitliche Demokratie noch in der Lage ist, fundamentale Probleme zu lösen ohne Populismus und ohne Zwangswirtschaft. Schreibt DIE WELT.
Die älteren Herr- und Frauschaften unter uns werden sich vermutlich noch gut an die WDR-Sendung «Hobbythek» von Jean Pütz erinnern. Dafür sorgt allein schon sein beeindruckender Schnauzbart, wie ihn heute Horst Lichter in seiner Trödelshow «Bares für Rares» zur Schau trägt.
Ob der inzwischen 85-jährige Ingenieur Pütz, der Physik und Mathematik studierte, mit seinen Erkenntnissen über die fundamentalen Gesetze der Physik und Chemie bezüglich Elektromotoren wissenschaftlich noch immer richtig liegt, kann ich nicht beurteilen.
Wissenschaft an sich ist ein stetes Ringen um die neuesten Resultate und Theorien weltweiter Forschungsanstalten und deren Koryphäen auf ihren ureigenen Spezialgebieten. Diskrepanzen innerhalb bedeutender Wissenschaftler*innen gehören zur Tagesordnung.
Forscher*innen machen Fehler, einige davon sogar eine ganze Menge. Aber nur wenige geben sie so offen zu wie Albert Einstein, der in der Endphase der Entwicklung der Relativitätstheorie jede Woche korrigierte, was er eine Woche vorher gesagt hatte. Seine Theorie vom «statischen Universum» stellt sich heute sogar als eine seiner grössten Fehleinschätzungen dar.
Trotz meinen Vorbehalten finde ich die Ansätze von Pütz diskussionswert. Ich werde meine Befürchtung nämlich nicht los, dass die vom Thema «Klimawandel» getriebenen Politiker*innen in ihrer permanenten Alarmstimmung und ihrem natürlichen Streben nach dem Machterhalt Entscheidungen treffen und Weichen stellen, die sich im Nachhinein ebenfalls als Fehleinschätzungen herausstellen könnten. Der alternativlose Entscheid für das Elektroauto könnte einer davon sein. Die langfristigen Kosten bezahlen dann allerdings die kommenden Generationen.
Wer als Politiker*in sein Tun und Handeln auf lautstarke und bestens vernetzte Teenager ausrichtet, sollte stets bedenken, dass es die Generation ebendieser Teenager sein wird, die die Kosten dafür zu tragen haben. So wie sie auch die Kosten fürs Nichtstun bezahlen werden.
Bei diesem Spagat um politischen Machterhalt, Klimarettung und die dafür geeigneten Mittel darf ruhig auch ein Fossil aus der Vergangenheit wie Jean Pütz zu Wort kommen. Jean Pütz hat jedenfalls mehr Tage pro Woche zum Nachdenken zur Verfügung als nur den Freitag. Was nicht heissen soll, dass er mit seinen Thesen nicht daneben liegt. Wie so viele andere Forscher*innen auch. Einstein lässt grüssen!
Vielleicht kann ja unser wandelndes Lexikon Res, ebenfalls ein Fossil, die Frage nach falsch oder richtig der Pütz'schen These beantworten.
Zur Person Jean Pütz
Jean Pütz wurde am 21. September 1936 in Köln geboren. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Elektromechaniker arbeitete er ein Jahr als Betriebselektriker in einem Luxemburger Eisenhüttenwerk. 1955 wechselte er nach einer abgeschlossenen Aufnahmeprüfung für Sonderbegabte auf die damalige staatliche Nikolaus Otto Ingenieurschule (heute TH Köln), an der er 1959 das Studium als Ingenieur der Nachrichtentechnik abschloss. Danach holte er im zweiten Bildungsweg das Abitur nach und studierte Physik und Mathematik für das Lehramt der Sekundarstufe II, welches er 1964 mit dem I. Staatsexamen abschloss. Parallel zur zweijährigen Referendarzeit studierte Pütz noch Soziologie und Volkswirtschaft. Von 1970 bis 2001 war Jean Pütz Redakteur beim WDR, wo er schon bald die Redaktion Naturwissenschaft und Technik leitete. Bekannt wurde er insbesondere mit der Sendereihe „Hobbythek“, die „Wissenschaftsshow“ und den Umweltmagazinen „Dschungel“ und „Globus“. Pütz ist Gründungsmitglied der Wissenschafts-Pressekonferenz (WPK) und war von 1990 bis 2003 Vorsitzender des WPK-Vorstandes.
-
20.9.2021 - Tag der afghanischen Wackelvideos
Brutale Scharia-Justiz in Afghanistan: Taliban peitschen Frauen und einen Mann öffentlich aus
Vor Weltmedien geben sich die Taliban moderat. Ihr neues Afghanistan sieht anders aus. Menschen werden auf offener Strasse ausgepeitscht. Drakonische Scharia-Körperstrafen versetzen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Videos belegen die Gräuel.
Genauer Ort und Zeitpunkt der Vorfälle sind nicht bestätigt. Doch sicher ist: Die brutalen Szenen haben sich unter dem Regime der Taliban ereignet, die seit der Machtübernahme Mitte August in Afghanistan wieder zu ihrer mittelalterlichen Scharia-Rechtssprechung greifen - dies am helllichten Tag, mitten auf der Strasse, vor den Augen aller. Dabei strafen die neuen alten Machthaber auch wehrlose Frauen öffentlich. Dies nach Beteuerungen, fairer und gerechter als früher zu regieren.
Im arabischen und islamischen Raum sind ähnliche barbarische Szenen bekannt, so im Iran und in Saudi Arabien, wo Menschen teils sogar öffentlich hingerichtet werden. Auch unter dem ersten Regime der Taliban von 1996 bis 2001 wurden Scharia-Brecher öffentlich exekutiert, darunter im Fussballstadion von Kabul.
Öffentliche Hinrichtungen sind seit der Rückeroberung Afghanistans durch die Radikalislamisten noch keine dokumentiert. Doch in diesen Tagen sind gleich mehrere Menschen auf offener Strasse von Taliban-Schergen ausgepeitscht worden. Darunter zwei Frauen und ein Mann.
«Leben unter der Peitsche der Taliban»
Der afghanische Journalist Akram Gizabi postet auf Twitter ein Video, wie eine Demonstrantin in Kabul von einem Taliban gepeitscht wird. Dazu sein Kommentar: «Das ist das neue Afghanistan, ein Leben unter der Peitsche der Taliban. Vor 25 Jahren erlebten die Menschen die gleiche Behandlung mit Fleisch und Knochen. Dank des Missgeschicks der USA und der Nato sehen sie sich dem gleichen Schrecken gegenüber.»
Ahmad Shah Mohibi, ein früherer Berater der US-Besatzer, zeigt auf Twitter Szenen, wie eine Frau vor umstehenden Taliban ausgepeitscht wird. Dazu seine Worte: «Afghanische Frau schreit vor Taliban, die sie in der Öffentlichkeit auspeitschen.» Die ganze Welt könne das wahre Gesicht der Taliban und ihre Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen sehen.
Mohibi teilt auf Twitter eine weitere Strassenszene in Kabul. Der für die «New York Times», BBC und andere westliche Medien berichtende Journalist Sulaiman Hakemy hat sie gefilmt. Ein Mann ist mit einer Eisenstange an ein Verkehrsschild gekettet.
Brutale Vergeltungsjustiz
Der Mann schreit und windet sich unter den Schlägen seiner Peiniger. Er will sich losreissen, bricht zusammen. Und wird wieder hochgezerrt. Und ausgepeitscht. Auch Umstehende treten ihn und schlagen auf ihn ein. In der Menge ist Gelächter zu hören. Jemand muss das Verkehrsschild festhalten. Ein Taliban mit Turban hält die Eisenstange, damit der Peiniger das Opfer besser peitschen kann.
Bei dem öffentlich Gefolterten soll es sich um einen Dieb handeln. Er habe ein Handy gestohlen. Die islamische Scharia sieht für Vergehen eine Vergeltungsjustiz mit drakonischen Körperstrafen vor: Auspeitschen, aber auch Amputationen und Steinigungen.
Das öffentliche Vollziehen der Strafen soll das Opfer nicht nur strafen und demütigen. Solche Szenen gelten im streng-islamischen Raum auch als Unterhaltung - und dienen der Abschreckung. Schreibt BLICK.
Wozu brauchen wir noch Bruce Willis und die Action-Filme von Netflix, wenn uns die Medien im Stundenrhythmus nicht verifizierbare Videos aus Afghanistan präsentieren, die unseren sadistischen Voyeurismus vollumfänglich befriedigen?
Den NGO rund um die Flüchtlingsindustrie im Westen sind die Barbarenvideos höchst willkommen. Die Wackelaufnahmen erscheinen ja nicht umsonst auf deren Websites. Kein Schelm ist, wer hier das Naheliegendste denkt.
Ein törichter Mensch ist allerdings, wer von einem islamischen Regime, das den mehrdeutigen Koran nach seinen eigenen Vorgaben und zum eigenen Machterhalt stringent definiert, etwas anderes erwartet. Das gilt nicht nur für das «Islamische Emirat Afghanistan», sondern auch für einige geschätzte islamische Scharia-Staaten, die der Westen zu seinen Freunden und Verbündeten zählt. Business rules!
Im saudischen Konsulat in Istanbul werden eben keine Wackelvideos gedreht, wenn der ermordete Kritiker des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, Jamal Khashoggi, mit einer Kettensäge in seine Einzelteile zerlegt wird, damit die Leichenteile im standesgemässen Louis-Vuitton-Koffer entsorgt werden können.
-
19.9.2021 - Tag der Mücke, die zum Elefanten gemacht wird
Grösste jemals in Berlin und Brandenburg sichergestellte Menge Crystal Meth
Der Zollfahndung ist in Berlin ein großer Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Im Visier: eine deutsch-vietnamesische Tätergruppe, die laut der Behörde „höchst konspirativ vorgegangen“ ist.
Die Berliner Zollfahndung hat einen großen Berliner Drogenring zerschlagen. Dabei wurde die größte je in Berlin und Brandenburg gefundene Menge an Crystal Meth sichergestellt. Insgesamt beschlagnahmte die Zollfahndung 29,6 Kilogramm Kokain, 47 Kilogramm Ecstasy, 18 Kilogramm Crystal Meth, zwei Kilogramm Marihuana und Bargeld in Höhe von 30.000 Euro.
Der Straßenverkaufswert der Ware soll mehr als vier Millionen Euro betragen. Bei dem Zugriff am Dienstag wurden drei Tatverdächtige, zwei Deutsche und ein Vietnamese, festgenommen. 100 Beamte der Zollfahndung und Spezialeinheiten hatten private Wohnungen, Depot-Wohnungen und Autos der Drogen-Großhändlern durchsucht.
Die Bande soll die Drogen nach Berlin geschmuggelt haben, um sie an Zwischen- und Kleinhändler zu verkaufen, die sie wiederum im ganzen Stadtgebiet anbieten sollen. Für die Lagerung soll der Vietnamese auch extra gemietete Hotelzimmer genutzt haben.
Das Zollfahndungsamt Berlin teilte mit: „Nach mehreren erfolgreich geführten Rauschgiftverfahren gegen die vietnamesisch geprägte Drogenszene in Berlin gelang den Ermittlern des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg in den Mittagsstunden des 14. September 2021 ein empfindlicher Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel.“
Die Verdächtigen sollen „höchst konspirativ vorgegangen“ sein und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Bei ihnen handelt es sich um zwei 51 und 61 Jahre alte Deutsche und einen 40-jährigen Vietnamesen.
Der Leiter des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg, Oliver Pampel-Jabrane, sagte: „Besonders an diesem Fund ist die Menge, und dass es und gelungen ist, das Vertriebsnetz dahinter zu zerschlagen.“
Bei dem 61 Jahre alten Deutschen soll es sich um den Organisator gehandelt haben. Der Mann ist einschlägig vorbestraft und geht keiner geregelten Arbeit nach. Die Drogen soll er aus den Niederlanden und Polen nach Deutschland geholt haben, um sie auf dem Berliner Markt zu vertreiben.
Auf die Gruppe aufmerksam wurden die Ermittler durch ein anderes Verfahren. Der Zugriff erfolgte am Dienstag in dieser Woche, als die beiden Deutschen mit einer Sporttasche voller Drogen eine Bunkerwohnung in Charlottenburg verließen, die sie zuvor unter falschem Namen angemietet haben sollen. „Wir hatten Erkenntnisse, dass die Haupttäter sich darauf vorbereiteten, die Drogen zu verteilen“, sagte der Leitende Zollfahnder Henner Grote.
Oberstaatsanwaltes Günter Sohnrey sagte, dass vor allem die Mengen an sichergestelltem Crystal Meth in Berlin in den vergangenen Jahren stetig gestiegen seien. Schreibt DIE WELT.
29,6 Kilogramm Kokain, 47 Kilogramm Ecstasy, 18 Kilogramm Crystal Meth, zwei Kilogramm Marihuana und Bargeld in Höhe von 30.000 Euro beschlagnahmt: Tönt gut, ist aber im Verhältnis zu den täglich konsumierten Drogen in der Millionenstadt Berlin konsumierten Drogen nichts anderes als die berühmte Mücke, die zum Elefanten aufgebauscht wird.
Zwei Kilo Marihuana entspricht in etwa dem Konsumbedarf einer Stunde in einem der berüchtigten Berliner Parks.
Wo immer ein paar Drogendealer verhaftet werden, stehen genügend Nachfolger bereit, um den vakanten Job zu übernehmen. Nicht nur in Deutschland. Weltweit.
-
18.9.2021 - Tag des Zauberlehrlings Ueli Maurer
Polizei: «Schutz des Bundeshauses konnte gewährleistet werden»
An einer Kundgebung gegen die Corona-Schutzmassnahmen in Bern hat die Polizei am Donnerstagabend vor dem Bundeshaus Wasserwerfer, Reizstoff und Gummischrot eingesetzt. Der Einsatz war laut Polizei nötig, weil einzelne Demonstranten versucht hatten, eine Absperrung aus ihrer Verankerung zu lösen. Weiter hätten einzelne Protestierende die Polizei mit Holzscheiten und Flaschen angegriffen sowie Feuerwerkskörper abgefeuert. Gegen 22 Uhr wurde die Demonstration polizeilich aufgelöst.
Schätzungsweise 3000 bis 4000 Menschen haben sich laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr beim Bahnhofplatz zu einer unbewilligten Demonstration versammelt. Danach sind diese durch die Innenstadt zum Bundeshaus gezogen.
Nach einem Aufruf, mit dem Rütteln am Zaun vor dem Bundeshaus aufzuhören, kam es auch zum Einsatz von Wasserwerfern und Gummischrot. Zudem versprühte die Berner Kantonspolizei Reizstoff. Dies aber in geringen Mengen, wie Reto Nause, Sicherheitsdirektor der Stadt Bern, nach Schluss der unbewilligten Kundgebung sagte.
Zweimal während des Umzugs stellte sich eine Gruppe von mutmasslichen Mitgliedern von Berns links-alternativer Szene dem Umzug in die Quere. Es kam zu Gerangel. Mit gelben Westen ausgestattete Demonstrationsteilnehmer entfernten am Rand des Bundesplatzes die quer über die Strasse gestellten Absperrgitter.
Die Teilnehmenden demonstrierten gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht und den «Impfzwang». Die Polizei war präsent und beobachtete die Lage.
Auf Transparenten waren Parolen zu lesen wie «Nein zur Zerti-Diktatur» und «Nein zum Impfterror». Wiederholt wurde in Sprechchören «liberté, liberté» gerufen, Pfeifkonzerte waren zu hören.
Im Verlauf der Demonstration kam es dann laut Gnägi zu mehreren Provokationen, teils auch zu Handgemengen zwischen Personengruppen. «In diesem Zusammenhang wurde auf dem Bundesplatz auch ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt.»
Weitere Ermittlungen zu den Vorfällen sowie Abklärungen zu allfälligen Sachschäden würden derzeit laufen, sagte Christoph Gnägi, Sprecher der Polizei. Deren Einsatz habe einen möglichen Sturm aufs Bundeshaus verhindert, twitterte derweil Sicherheitsdirektor Reto Nause.
Nach Ankunft des Umzugs auf dem Bundesplatz drängten Teilnehmende gegen die Sperre vor dem Bundeshaus. «Dann wurden unzählige Gegenstände, Flaschen, Holzscheite gegen das Bundeshaus, die Einsatzkräfte und Diensthunde geworfen und letztlich auch die Einsatzkräfte mit Feuerwerk und Knallpetarden angegriffen.»
Deshalb habe die Polizei dann den Wasserwerfer, Reizstoff und Gummischrot eingesetzt und die Kundgebung polizeilich aufgelöst. «Wir haben den Schutz des Bundeshauses gewährleisten können, indem wir diese Mittel eingesetzt und so die Demonstration aufgelöst haben.»
Demonstration auch in Biel
Viele der Demonstrierenden schwangen Schweizer- und Kantonsfahnen. Aufgerufen worden war zu der Kundgebung auf den sozialen Medien. Aus Sicherheitsgründen hätten wegen des Umzugs mehrere Strassen gesperrt werden müssen, schrieb die Kantonspolizei Bern auf Twitter.
Auch in Biel wurde am Abend unbewilligt demonstriert. Nach Angaben eines Reporters waren unter rund 1000 Anwesenden Leute aller Altersgruppen. Sie skandierten «liberté, liberté», verurteilten das Impfen von Kindern, sie hatten Transparente dabei und schwenkten Fahnen. Schreibt SRF.
Der Sturm aufs Bundeshaus und Goethes Zauberlehrling
Eigentlich ist mir Ueli Maurer nicht unsympathisch. Jedenfalls seit er Bundesrat ist und meiner (subjektiven) Meinung nach keinen schlechten Job in seinem Amt als Schweizer Finanzminister macht. Vor allem in der Corona-Krise hat sich sein kluges, beherztes und rasches Handeln für die Schweizer Bevölkerung bewährt.
Bisher.
Doch seine umstrittene Aktion mit dem offensiven Tragen eines «Freiheitstrychler»-Shirts der Corona-Massnahmengegner*innen erinnert wieder an seine Attitüden längst vergangener Zeiten. Als Parteipräsident der SVP konnte er sich mehr als nur grenzwertige Aussetzer noch leisten. So rissen sich seine Fans seinerzeit beinahe die Kleider vom Leib, als er im Hohen Haus von und zu Bern vor versammeltem Parlament ins Bundesmikrofon krächzte: «Be üs en Bärn seit mer zome ne Schwarze emmer no Neger». Oder so ähnlich. Das N-Wort fiel definitv. Lange Zeit existierte auf YouTube ein Video dieser Szene. Doch einen Tag nach seiner Wahl zum Bundesrat war es verschwunden.
Dass das Internet niemanden vergisst, ist auch nicht mehr als eine Floskel. Jedenfalls für diejenigen auf den etwas höheren Rängen. Auch ein etwas anrüchiges Bild von Jens Spahn zusammen mit seinem Ehemann verschwand auf Google wie von Geisterhand, als der Eierlikör-Liebhaber und bekennende Homosexuelle zum deutschen Gesundheitsminister gewählt worden war. Und dies genau einen Tag nach der Wahl. Kein Schelm, wer hier das Naheliegendste denkt.
Zurück zu Bundesrat Maurer.
Seine provokativ zur Schau getragene Verbundeheit mit der Gruppe der «Freiheitstrychler», die am letzten Samstag mit geschätzten 1'500 Teilnehmern*innen in Luzern für Freiheit und gegen «Impfzwang» demonstrierten und die Stadt teilweise lahmlegten, hat gewaltiges Spaltpotenzial. Maurer legitimiert damit beinahe die kruden Argumente der Verschwörungstheoretiker und Alu-Hüte. Auch wenn der bundesrätliche Ausrutscher an einem SVP-Treffen im zürcherischen Wald vermutlich wahltaktische Gründe für kommende Abstimmungen hat, bundesrätlich ist er deswegen noch lange nicht. Denn im Schweizer Bundesrat herrscht das «Kollegialitätsprinzip. Ganz abgesehen davon, dass Maurer gewählt wurde, um die Interessen des gesamten Schweizer Volks wahrzunehmen und nicht nur diejenigen der SVP-Mitglieder*innen.
Was im allerschlimmsten Fall bei der Spaltung einer Gesellschaft passieren kann, hat uns dieses Jahr der «Sturm aufs Kapitol» in Washington gezeigt. Trumps Reden an seine Anhänger zeigten verheerende Wirkung. Ueli Maurer sollte sich als intelligenter Mensch bewusst sein, dass Bilder noch viel mehr als nur tausend Worte sagen können. Vor allem in Social Media-Zeiten.
«Der Sturm aufs Berner Bundeshaus» sollte Bundesrat Maurer eine Warnung sein!
Deshalb sei ihm die Ballade «Der Zauberlehrling» von Johann Wolfgang von Goethe empfohlen. Der Zauberlehrling probiert einen Zauberspruch seines Meisters aus und verwandelt einen Besen in einen Knecht, der Wasser schleppen muss. Zuerst ist der Zauberlehrling stolz auf sein Können, doch bald merkt er, dass die Situation buchstäblich aus dem Ruder läuft:
Herr, die Not ist gross! Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los.
....................................................................................
Hat der alte Hexenmeister
sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister
auch nach meinem Willen leben.
Seine Wort und Werke
merkt ich und den Brauch,
und mit Geistesstärke
tu ich Wunder auch.
Walle! walle
Manche Strecke,
dass, zum Zwecke,
Wasser fliesse
und mit reichem, vollem Schwalle
zu dem Bade sich ergiesse.
Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhüllen;
bist schon lange Knecht gewesen:
nun erfülle meinen Willen!
Auf zwei Beinen stehe,
oben sei ein Kopf,
eile nun und gehe
mit dem Wassertopf!
Seht, er läuft zum Ufer nieder,
Wahrlich! ist schon an dem Flusse,
und mit Blitzesschnelle wieder
ist er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweiten Male!
Wie das Becken schwillt!
Wie sich jede Schale
voll mit Wasser füllt!
Stehe! stehe!
denn wir haben
deiner Gaben
vollgemessen! –
Ach, ich merk es! Wehe! wehe!
Hab ich doch das Wort vergessen!
Ach, das Wort, worauf am Ende
er das wird, was er gewesen.
Ach, er läuft und bringt behende!
Wärst du doch der alte Besen!
Immer neue Güsse
bringt er schnell herein,
Ach! und hundert Flüsse
stürzen auf mich ein.
Nein, nicht länger
kann ichs lassen;
will ihn fassen.
Das ist Tücke!
Ach! nun wird mir immer bänger!
Welche Miene! welche Blicke!
O du Ausgeburt der Hölle!
Soll das ganze Haus ersaufen?
Seh ich über jede Schwelle
doch schon Wasserströme laufen.
Ein verruchter Besen,
der nicht hören will!
Stock, der du gewesen,
steh doch wieder still!
Willst am Ende
gar nicht lassen?
Will dich fassen,
will dich halten
und das alte Holz behende
mit dem scharfen Beile spalten.
Seht da kommt er schleppend wieder!
Wie ich mich nur auf dich werfe,
gleich, o Kobold, liegst du nieder;
krachend trifft die glatte Schärfe.
Wahrlich, brav getroffen!
Seht, er ist entzwei!
Und nun kann ich hoffen,
und ich atme frei!
Wehe! wehe!
Beide Teile
stehn in Eile
schon als Knechte
völlig fertig in die Höhe!
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!
Und sie laufen! Nass und nässer
wirds im Saal und auf den Stufen.
Welch entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister! hör mich rufen! –
Ach, da kommt der Meister!
Herr, die Not ist gross!
Die ich rief, die Geister
werd ich nun nicht los.
«In die Ecke,
Besen, Besen!
Seids gewesen.
Denn als Geister
ruft euch nur zu seinem Zwecke,
erst hervor der alte Meister.»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.9.2021 - Tag der Hühner und Eier
Mitfahrgemeinschaften: Verkehrsdepartement will eigene Fahrspuren fürs «Carpooling»
Das Verkehrsdepartement möchte spezielle Fahrspuren einführen. Auf diesen sollen nur Autos mit Fahrgemeinschaften verkehren dürfen.
Fahrspuren speziell für Mitfahrgemeinschaften kennt man bislang vor allem aus den USA. Wenn sich mehrere Personen ein Auto teilen, könne das Verkehrsüberlastungen und Umweltbelastung verringern. Das schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) im Verkehrsdepartement auf Anfrage.
Das Bundesamt bestätigt, dass man solche Fahrgemeinschaften hierzulande stärken wolle: «Um sie zu fördern, soll für die lokal zuständigen Behörden die Möglichkeit geschaffen werden, Fahrgemeinschaften besondere Rechte einzuräumen.» Dazu zählten etwa das Befahren von Busstreifen oder separate Fahrstreifen.
Eigene neue Signalisation für Fahrgemeinschaften
Das Bundesamt denkt darüber nach, eine eigene Signalisation für Fahrgemeinschaften einzuführen. Dazu soll ein neues Symbol unter dem Titel «Mitfahrgemeinschaften» in die Signalisationsverordnung zum Strassenverkehrsgesetz aufgenommen werden.
Das Symbol bestünde laut Astra aus einem Auto, in dem mehrere Personen sitzen. Allerdings sei noch unklar, ab wie vielen Insassen man als Fahrgemeinschaft gelten könne, räumt das Departement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga ein.
Busspuren neu auch fürs Carpooling
Das neue Symbol soll als Markierung auf Strassen aufgemalt werden können, um einzelne Fahrspuren für das sogenannte «Carpooling» freizuhalten. Es könnte aber auch als Verkehrsschild am Strassenrand montiert werden, um zum Beispiel bestehende Busspuren für Fahrgemeinschaften zu öffnen.
In Versuchen an stark befahrenen Grenzübergängen in der Region Genf und im Kanton Tessin habe man mit speziellen Fahrspuren für Fahrgemeinschaften gute Erfahrungen gemacht, schreibt das Astra. Die Signalisation sei von den Verkehrsteilnehmenden verstanden worden.
Laut dem Plan des Verkehrsdepartements soll der Bundesrat die Vorlage für eine Teilrevision der Signalisationsverordnung bald verabschieden und in die Vernehmlassung schicken. Idealerweise soll dies noch vor Ende Jahr geschehen. So will man austesten, wie gut die Idee ankommt. Schreibt SRF.
Haben die grossartigen Experten vom Bundesamt für Strassen (Astra) im Verkehrsdepartement wirklich noch alle Tassen im Schrank?
Wo um alles in der Welt ausser irgendwo in der Pampa sollen denn die zusätzlichen Fahrspuren gebaut werden? Nennen Sie eine Schweizer Stadt plus Agglomeration, wo das möglich wäre und Sie gewinnen den Preis für das «Schweizer Superhirn des Jahrhunderts».
Wer ist eigentlich zuständig für diesen Think Tank im Schweizer Verkehrsdepartement?
Aha, Frau Simonetta Sommaruga, die sich Gedanken darüber macht, ab wie vielen Insassen ein Fahrzeug als «Fahrgemeinschaft» gelten könne und nicht etwa um die Quizfrage über die Unvereinbarkeit von zusätzlichen Fahrspuren und vorhandenem Platzangebot.
Unsere Chefpianistin vom Bundeshaus ist sich wieder einmal nicht sicher, was zuerst da war: Huhn oder Ei?
Alles klar?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.9.2021 - Tag des islamischen Monsters der Gewalt
Islamismus - Das Monster der Gewalt
9/11 war ein Weckruf, der weder von Muslimen noch vom Westen gehört wurde. Muslime hätten erkennen müssen, dass sie über Jahrhunderte in ihrer Mitte ein Monster der Gewalt großgezogen und gefüttert haben. Der Westen hätte gegen den Islamismus wie damals gegen die Nazis kämpfen müssen: Erst militärisch vernichten, dann gegen Ideologie vorgehen.
Doch von Reflexion bei Muslimen war zunächst keine Spur. Und im Westen kam es nicht zu Entislamisierung, sondern zum Kuscheln mit dem Islamismus. Muslime verfielen nach den Anschlägen in Selbstmitleid und Apologetik. Ihnen war das Bild des Islam wichtiger als die Zukunft ihrer Länder und ihrer Kinder und das Leben der vielen Opfer. Und der Westen war zu naiv zu glauben, es gäbe einen moderaten Islamismus, den man dem radikalen Islamismus entgegensetzen könnte.
Also, statt die Strukturen des Islamismus im Westen mit aller Vehemenz zu zerschlagen, schuf man neue Strukturen und neue islamistische Vereine, die nun sogar Partner der westlichen Staaten sind in Sachen Kampf gegen Islamismus und Rassismus. Politiker, die diesen Schritt gegangen sind, erinnerten mich an jene naive westliche Politiker von damals, die an einem moderaten Flügel im Hitlers Regime glaubten und auf Dialog setzten, bis Hitler die Tschechoslowakei verschlungen und Polen angegriffen hatte.
Das Ergebnis des Schweigens und der Apologetik der Muslime war, dass nach Al-Qaida und der Taliban nun der IS, Boko Haram, Abu Sayyaf, Jama'a Islamiyya, Dchihad Islami, Chabab Miliz, Hamas, Muslimbruderschaft, Al-Huthi und hunderte andere islamistische Gruppierungen nun die Geschicke in der islamischen Welt bestimmt und die Länder in Elend und Bürgerkriege gestürzt haben.
Auch der Westen wurde mit einer beispiellosen Welle des Terrors überzogen. Das Sicherheitsgefühl der Bürger hat sich massiv verändert.
Weihnachtsmärkte schauen aus wie Militärkaserne. Und die moderaten Islamisten, die man unterstützt hat, um die Integration von Muslimen zu fördern, sind Integrationsverhinderer und Radikalisierungsbeschleuniger geworden. Mit dem Geld, das sie vom Staat erhielten, schufen sie einen Erdogan-Kult und eine antiwestliche Haltung unter ihren Anhängern.
20 Jahre nach 9/11 sind die Taliban und der IS nach mehreren militärischen Niederlagen wieder da, weil man ihre Soldaten und ihre Waffenlager angriff, aber nicht die theologische Quelle des Hasses, die sie großmachte. Man sitzt sogar im ihren Brüder im Geiste an einem Tisch und hofiert sie als Partner des Staates immer noch. Man will sogar die Taliban mit Geld unterstützen, damit sie gegen den IS in Afghanistan vorgehen kann. Nun sind die Taliban die Moderaten, morgen vielleicht der IS selbst!
20 Jahre nach dem 11. September ist der Islamismus stärker denn je und die Integration gescheiterter denn je. Aber weder das Thema Islamismus noch das Thema Integration stehen auf dem Agenda der etablierten Parteien beim Wahlkampf. Islamsiten sitzen in westlichen Parlamenten, beraten Politiker und gelten als Kämpfer gegen Rassismus, während Islamkritik aus der Politik und zunehmend aus den Medien verschwindet. Salafisten laufen frei herum und predigen im Namen der Religionsfreiheit, während ihre Kritiker nur unter Polizeischutz auftreten können.
Das woke Europa schläft weiter und diskutiert lieber über Gender*Sternchen und neue Namen für Schnitzel-Saucen. Man glaubt, das Krokodil, den man füttert, würde einen nicht auffressen!
Ich habe lange vor dieser Entwicklung gewarnt, aber nur Wenige haben zugehört. Die meisten sind lieber woke als wachsam, und sie werden dafür irgendwann einen hohen Preis zahlen, denn die Krankheiten einer Gesellschaft werden nicht von alleine geheilt und die Dummheit verjährt nicht!
Schreibt Hamed Abdel-Samad auf seiner Facebook-Seite.
Mir wird öfters vorgeworfen, ich hätte eine Phobie gegen den Islam.
Falsch! Als bekennender Atheist habe ich keine Phobie gegen den Islam, sondern gegen alle Religionen. Speziell gegen die monotheistischen.
Spätestens nach der Ära des Dritten Reichs müsste eigentlich jedem aufgeklärten Menschen bewusst sein, wie nahe sich die unter dem Monotheismus und Faschismus verbreiteten Ideologien sind. Bei beiden wurden und werden noch immer die "Ungläubigen" mit dem Tode bestraft.
Wobei ich Wert auf die Feststellung lege, dass Vergleichen nicht Gleichsetzen heisst!
Aber bevor ich mich weiter an diesem Thema abarbeite, lassen wir Hamed Abdel-Samad*, einen aufgeklärten Muslim, zu Wort kommen.
Hamed Abdel-Samad Islamophobie vorzuwerfen, wäre an Absurdität wohl kaum zu überbieten.
* Der Deutsch-Ägypter Hamed Abdel-Samad ist für seine skeptischen Bücher über den Islam bekannt. Sie haben ihm Morddrohungen und Polizeischutz eingebracht. Mehr zum muslimischen Islamkritiker Hamed Abdel-Samad finden Sie unter Wikipedia.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.9.2021 - Tag der psychopathischen Walliser «Stieregrindä»
Widerstand gegen die neuen Zutrittsregeln für Restaurants: «Freie Zone. Kein Covid-Zertifikat» – Vier Walliser Beizer proben den Aufstand
«Jetzt reicht's», sagt Manfred Theler. Auf der Eingangstüre seines Restaurants in Brig prangt ein grüner Kleber mit der Aufschrift: «Freie Zone. Kein Covid-Zertifikat».
Seit Montag gilt in der ganzen Schweiz in Innenräumen von Restaurants die Zertifikatspflicht. Doch nicht alle Wirte halten sich daran. Der «Walliser Bote» berichtet in seiner heutigen Ausgabe über vier Restaurant-Besitzer im Oberwallis, die den «Widerstand gegen die Behörden wagen».
Einer von ihnen ist der Briger Wirt Manfred Theler. Er sagt, dass er nicht mehr an den Bundesrat glaube, dass die Politik in dieser Pandemie längst versagt habe und dass es immer und immer wieder die Wirte seien, die das Ganze ausbaden müssten.
«Dabei ist es doch nicht meine Aufgabe, die Gäste zu kontrollieren. Ich habe nicht Polizist gelernt. Ich bin Wirt und bei mir ist jeder willkommen. Wir sind hier nicht rassistisch», erklärt Theler.
Branchenverband geht auf Distanz
Der Walliser Branchenverband Gastrovalais distanziert sich von den aufmüpfigen Wirten. Vizepräsident Henry Lauwiner sagt: «Wir haben unseren Mitgliedern ganz klar empfohlen, dass sie sich an die Vorschriften halten sollen. Und die grosse Mehrheit der Walliser Wirte macht das auch.»
Doch so ganz wohl ist es auch Lauwiner nicht angesichts der aktuellen Entwicklung. «Ich beobachte eine Spaltung der Gesellschaft und das in einer Zeit, wo es für so manchen Betrieb um die Existenz geht. Jene fünfzig Prozent der Menschen, die noch nicht geimpft sind, werden den Betrieben in den nächsten Wochen fehlen», sagt Lauwiner.
Es droht eine saftige Busse
Aktuell profitieren die Gastrobetriebe noch von spätsommerlichen Temperaturen. Konsumiert wird vorwiegend draussen und da braucht es kein Zertifikat. Doch das Wetter kann launischer sein als jedes Virus und spätestens, wenn die Gäste wieder drinnen konsumieren, wird
Restaurateur Manfred Theler damit rechnen müssen, dass er Besuch von der Polizei erhalten wird.
«Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mich kontrollieren werden, aber das ist mir jetzt auch egal», sagt Theler. Er stehe zu seinem Entscheid, die Zertifikatspflicht zu missachten und er fühle sich darin sogar bestärkt durch die positiven Reaktionen, die er von seinen Gästen erhalten habe. Viele würden ihm gratulieren.
An einer allfälligen Busse werden sich die Gratulanten dann aber wohl kaum beteiligen – und diese könnte für den Wirt saftig ausfallen. Wer die Zertifikatspflicht missachtet, riskiert eine Busse von bis zu 10'000 Franken. Schreibt SRF.
Ob sich dieser Walliser «Stierägrind» Gedanken darüber macht, was passiert, wenn ein weiterer Lockdown über die ganze Schweiz verhängt werden muss? Ist sich dieser Querulant bewusst, wie viele seiner Berufskollegen*innen dann mit grösster Wahrscheinlichkeit Konkurs anmelden müssen?
Wohl kaum! Solidarität und Vernunft sind Begriffe, die im Lexikon der psychopathischen* «Freiheitstrychler», mit denen SVP-Bundesrat Ueli Maurer sympathisiert, nicht vorhanden sind.
* Psychopathie bezeichnet heute eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bei den Betroffenen mit dem weitgehenden oder völligen Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht. Psychopathen sind auf den ersten Blick mitunter charmant, sie verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Dabei können sie sehr manipulativ sein, um ihre Ziele zu erreichen. Schreibt Wikipedia
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.9.2021 - Tag des obersten Aluhutes der Schweiz: Ueli Maurer
Umstrittenes T-Shirt an Anlass: Verstösst Bundesrat Ueli Maurer gegen das Kollegialitätsprinzip?
Am Sonntag ist Bundesrat Ueli Maurer mit einem T-Shirt der «Freiheitstrychler», einer massnahmenkritischen Gruppe, an einem SVP-Anlass aufgetreten. Ein Bild davon machte die Runde – in den sozialen Medien schlug Maurer viel Kritik entgegen.
Bereits früher fiel Ueli Maurer durch Provokationen auf – unter anderem sein «Kä Luscht» auf eine Frage nach einem Interview sorgte für einigen Wirbel, in der Pandemie haderte er mit der SwissCovid-App und kokettierte mit seiner Impfung. Politologe Michael Hermann erklärt im Interview Motiv und Wirkung von Maurers symbolischen Aktionen.
SRF News: Was bezweckt Ueli Maurer mit solchen Provokationen?
Michael Hermann: Er will zeigen, dass er Sympathien mit dieser Bewegung hat und der offiziellen Corona-Politik des Bundes kritisch gegenüber steht. Er ist geübt darin zu provozieren und weiss, wie man Aufmerksamkeit erregt und eine Botschaft vermittelt. Das beherrschte er schon als Parteipräsident.
Sorgt er damit nicht für eine Spaltung der Gesellschaft?
Die Spaltung ist ja bereits vorhanden – sie wird nicht grösser, weil Maurer das macht. Doch er wäre eigentlich eine Person, die helfen könnte, die Spaltung zu verringern. Er hätte diese Fähigkeit, weil er bei Menschen, die sich von der Politik des Bundesrats nicht abgeholt fühlen, eine hohe Glaubwürdigkeit hat.
Ueli Maurer fiel ja auch durch eine gewisse Impfskepsis auf?
Gerade bei der Impffrage haben sich viele SVP-Exponenten klar für das Impfen ausgesprochen – das untergräbt Ueli Maurer mit seiner Impfskepsis. Es ist schon speziell, wenn ein Bundesrat in einer grundlegenden Frage eine extremere Position vertritt als seine eigene Partei. In dieser Hinsicht unterscheidet er sich auch von seinem Partei- und Bundesratskollegen Guy Parmelin, der Impfen als eine Chance sieht – und sich sehr früh gegen Gratis-Tests ausgesprochen hat. Anhand dieser beiden Bundesräte sieht man auch das breite Spektrum innerhalb der SVP.
Wird ihn der Auftritt im T-Shirt der Freiheitstrychler Sympathien kosten – oder bringt er ihm gar Applaus?
Es hat ihm bereits Applaus eingebracht bei jenen, die dieselbe Einstellung haben. Viele, die anders denken, empören sich natürlich darüber. Schaden wird ihm das aber kaum. Maurer hat mit seinen Provokationen schon oft Kritik geerntet. Dann kommt ein Auftritt als Staatsmann und er kriegt wieder Beifall aus breiten Kreisen – und die letzte Provokation ist vergessen.
Maurer tanzt immer wieder aus der Reihe. Torpediert er damit nicht das Kollegialitätsprinzip im Bundesrat?
Trotz Kollegialitätsprinzip ist es nicht verboten, als Bundesrat eigene Werte und Haltungen zu vertreten. Deshalb finde ich nicht, dass man als Bundesrat nicht mehr individuell politisch sein oder seine Kritik sowie Sympathien nicht mehr zeigen darf. Auch wenn nicht alle das so provokativ machen wie Maurer, tun es alle.
Was nicht geht, ist, wenn der Bundesrat einen gemeinsamen Entscheid fällt und ein Bundesrat sich danach dagegen positioniert. Maurers Provokationen helfen zwar nicht, aber es sind keine direkten Angriffe auf das Kollegialitätsprinzip, solange sie auf der allgemeinen Ebene bleiben. Problematischer erachtete ich es übrigens, als er sagte, dass für ihn eine Impfdosis genüge. Damit hatte er direkt zur tiefen Schweizer Impfquote beigetragen und indirekt auch der Wirtschaft geschadet.
Können solche Auftritte nicht negativ auf den gesamten Bundesrat zurückfallen?
Klar wäre es positiver, wenn man spüren würde, dass der gesamte Bundesrat am selben Strick zieht. Trotz einzelner Geschichten wie jener von Ueli Maurer ist der Bundesrat gegenwärtig konsequent. Für die Wahrnehmung des Bundesrates ist es schlussendlich viel wichtiger, dass das Handeln des Bundesrates verständlich und klar formuliert ist – und nicht, welches T-Shirt Ueli Maurer trägt.
Als Kommunikationsberater: Würden Sie Maurer nun zu seiner Aktion beglückwünschen oder es als Kommunikationspanne bezeichnen?
Eine Panne ist es garantiert nicht – das war schon immer Ueli Maurers Handschrift als Parteipräsident und in abgewandelter Form als Bundesrat. Seine Aktionen haben dazu geführt, dass er zwar kritisiert wird, aber an Glaubwürdigkeit bei seiner Parteibasis gewinnt. Dieses Ziel hat er erreicht. Ob das jedoch wirklich das Ziel der Kommunikation eines Regierungsmitglieds in Krisenzeiten sein soll, ist eine andere Frage.
Das Gespräch führte Saya Bausch.
Wer auf allen Hochzeiten tanzt, wird irgendwann nicht mehr ernstgenommen. Oder abgewählt.
Das musste selbst der Gesalbte vom Herrliberg zur Kenntnis nehmen, der als Bundesrat genüsslich sowohl Opposition wie auch Regierung im gleichen Atemzug zelebrierte und zu seinem Markenzeichen machte.
Wurde denn auch prompt nach einer Legislatur 2007 abgewählt. Was Artillerie-Oberst Christoph Napoleon bis heute nicht verkraftet hat.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
13.9.2021 - Tag der amerikanischen Hurensöhne auf dem Präsidentensessel
China zerschlägt AliPay und erzwingt separate Kredit-App
China zieht die Daumenschrauben gegenüber seiner Tech-Industrie weiter an. Die Regierung in Peking wolle die hochprofitable Zahlungs-App AliPay des Fintech-Konzerns Ant Group zerschlagen und eine getrennte Plattform für das Kreditgeschäft des Unternehmens schaffen, schrieb die Zeitung "Financial Times" am Sonntag. Der Plan sehe zudem vor, dass Ant die seinen Kreditentscheidungen zugrunde liegenden Nutzerdaten an ein neues Joint-Venture zur Kreditwürdigkeitsprüfung übergeben muss. Dieses sei teilweise in Staatsbesitz, berichtete die Zeitung unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Der Schritt reiht sich ein in eine ganze Serie von Maßnahmen, durch die die chinesischen Behörden ihre Aufsicht über viele Branchen verschärfen – von der Technologie bis zur Bildung. Damit soll nach Jahren des rasanten Wachstums die Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft gestärkt werden.
Bereits im Herbst vergangenen Jahres geriet Ant ins Visier der Regulierer: Chinas Behörden vereitelten den geplanten Börsengang des Unternehmens und belasteten damit auch den Mutterkonzern Alibaba. Nur zwei Tage vor dem geplanten Debüt an den Börsen in Shanghai und Hongkong bemängelte die Finanzaufsicht bei Alibaba-Gründer Jack Ma, dass wegen veränderter Regularien die Offenlegungspflichten wohl nicht erfüllt würden. Kurz vor der Ziellinie platzte damit der mit mehr als 37 Milliarden Dollar weltgrößte Börsengang von Chinas Branchenführer beim mobilen Zahlungsverkehr. Schreibt DER STANDARD.
Machen wir uns nichts vor: Monopolistische Konzerne zu zerschlagen gehört zum Geschäft einer Weltmacht. US-Präsident Theodore Roosevelt zerschlug in seiner zweiten Amtszeit von 1905 bis 1909 grosse US-Konzerne und Industriekonglomerate wie die «Standard Oil Company» des Ölmagnaten und damals reichsten Amerikaners John D. Rockefeller.
Stahlbaron Henry Clay Frick, der Roosevelt im Wahlkampf finanziell massiv unterstützt hatte, äusserte sich nach den präsidialen Massnahmen, die auch seinen Konzern betrafen, über den Präsidenten wie folgt: «Wir haben den Hurensohn gekauft, aber er blieb nicht gekauft.»
Tja, dumm gelaufen, beziehungsweise aufs falsche Pferd gesetzt. Allerdings auch etwas naiv, der Glaubwürdigkeit eines Politikers zu vertrauen.
Das passiert den heutigen Monopolisten der amerikanischen Tech-Giganten nicht mehr: Apple, Microsoft, Google, Facebook & Co. haben von Henry Clay Frick gelernt, dass man nicht nur ein einzelnes Pferd schmieren darf, sondern die ganze Herde füttern muss. So wie es auch die Schweizer Gesundheitsindustrie äusserst erfolgreich praktiziert.
Die kommunistische Partei Chinas exekutiert nun als gelehriger Schüler des gepflegten Neoliberalismus die Gesetze der «US-Antitrust Division» des amerikanischen Justizdepartements am chinesischen Fintech-Konzern «Ant Group», einer Tochtergesellschaft der chinesischen Alibaba Group.
Der legendäre Alibaba-Gründer Jack Ma verschwand schon letztes Jahr plötzlich von der Bildfläche. Vermutlich in einem der chinesischen «Umerziehungs»-Camps.
2021 ist Jack Ma beim Golfen erstmals wieder in Hainan gesichtet worden, wie nicht näher bezeichnete Quellen gegenüber der Nachrichtenagentur «Bloomberg» erklärten. Er habe auf einem abgelegenen 27-Loch-Platz im Sun Valley Golf Resort gespielt. Hainan ist eine Insel am südlichsten Punkt des chinesischen Festlandes. Immerhin lebt er scheinbar noch. So viel Glück haben nicht alle Bewohner des Uiguren-Camps.
Wer sich jetzt darüber aufregt, dass Ant «die seinen Kreditentscheidungen zugrunde liegenden Nutzerdaten an ein neues Joint-Venture zur Kreditwürdigkeitsprüfung übergeben muss, das teilweise in Staatsbesitz ist», kann sich die Empörung sparen. Auch der amerikanische Staat hat mit dem «Cloud-Act» seit 2001 (!) ungehinderten Zugriff auf sämtliche Daten der US-Dienstleister. Und dies weit über die USA hinaus.
Doch wofür Amerika «Nine Eleven» brauchte, um die entsprechenden Gesetze zu installieren, genügt in China ein Fingerzeig oder ein Augenrollen im Sinne von «not amused» des Präsidenten der kommunistischen Partei. Besser bekannt unter dem Namen Xi Jinping, der zugleich Präsident auf Lebenszeit der Volksrepublik China ist.
Im Kopieren war China schon immer weltmeisterlich, sprich die absolute Nummer Eins. Da wird auch vor den Gesetzbüchern des «demokratischen» Konkurrenten um die Weltmacht nicht Halt gemacht.
Ni Hao statt Good Day! Allerdings serviert mit diesem charmanten, fernöstlichen Lächeln im Gesicht, bei dem man nie ganz sicher ist, ob man angelacht oder ausgelacht wird.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.9.2021 - Tag der Unverbesserlichen
Unbewilligte Kundgebung in Luzern am Samstag, 11.9.2021 – rund 60 Wegweisungen ausgesprochen
In sozialen Medien wurde für Samstag-Nachmittag zu einer nicht bewilligten Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen in der Stadt Luzern aufgerufen. Es nahmen rund 1500 Personen teil. Die Luzerner Polizei hat im Rahmen dieser Kundgebung rund 60 Wegweisungen ausgesprochen.
Am Samstag, 11. September 2021, fand in der Stadt Luzern eine nicht bewilligte Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen statt. An der Kundgebung nahmen rund 1500 Personen teil. Der Kundgebungszug führte vom Mühlenplatz durch die Altstadt, über die Seebrücke und den Pilatusplatz zum Kasernenplatz und erneut durch die Altstadt bis zum Inseli, wo sich die Kundgebung allmählich auflöste. Zeitweise kam es dadurch zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.
Im Umfeld der Kundgebung wurden von der Luzerner Polizei diverse Personenkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden rund 60 Wegweisungen ausgesprochen.
Die Luzerner Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Im Bereich Kasernenplatz kam es zu einer Konfrontation der Corona-Massnahmengegner mit anderen Gruppierungen. Zur Trennung der beiden Lager setzte die Polizei kurzzeitig Zwangsmittel (Reizstoff) ein. Verletzt wurde beim Einsatz niemand.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer gestrigen Medienmitteilung.
Das nackte Grauen unter strahlend blauen Himmel am Samstag, 11.9.2021: Durchgeknallte Aluhüte, soweit das Auge blickt!
Ganz in der Nähe der lautstark brüllenden Meute der Impf- und Coronamassnahmen-Gegner*innen, die mich mit ihren Fahnen und ihrem gekrächzten, heiseren Gebrüll an die Auftritte der NSDAP-Fans vor der Machtergreifung Hitlers erinnerten, sprach mich eine gut aussehende und gepflegte Frau mittleren Alters an der Ladenkasse eines Spezialitätengeschäfts an der Pfistergasse, wo ich mich gerade mit dem Inhaber über die unsägliche Demonstration unterhielt, in ziemlich perfektem Hochdeutsch an:
«Ich stamme aus einem Land, in dem sich Millionen Menschen gegen Corona impfen lassen möchten. Doch eine Impfung bleibt für sie nur ein unerfüllbarer Traum. Es gibt kaum Impfdosen und es sterben täglich massenhaft Menschen an Corona in diesem Land. Unbemerkt von der Weltöffentlichkeit.»
Auf die Frage, aus welchem Land sie denn komme, antwortet sie: «Afghanistan.»
Es war gestern beileibe nicht das erste Mal, dass ich mich für einen Teil meiner Landsleute schämte.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
11.9.2021 - Tag der afganischen Frauenrechte
Frauen in Afghanistan: Taliban installieren ein «Sittenministerium»
Die wiederbelebte Moralpolizei der Taliban lässt keine Zweifel offen: Afghaninnen gehen düsteren Zeiten entgegen.
In der englischsprachigen Medienmitteilung über die neuen Kabinettsposten der Taliban-Regierung war ein Ministerium nicht übersetzt: Das Ministerium «zur Verbreitung von Tugend und Verhinderung von Laster» – Dawat-wal-Irshad, wie es im Text auf Arabisch stand.
Das sei kein neues Ministerium, sondern die Wiedereinführung einer Moralpolizei, welche die Taliban schon während ihrer ersten Herrschaft führten, sagt Heather Barr von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Es diene dazu, das Moralverständnis der Taliban durchzusetzen.
Während ihrer alten Herrschaft war es dieses Ministerium, welches das Hören von Musik verbot oder Frauen verpflichtete, eine Burka zu tragen. Wird dies nun automatisch wieder der Fall sein?
Zwiespältige Signale
Heather Barr, welche speziell auf die Rechte der Frauen schaut, wägt ab: «Wir sind immer noch daran, herauszufinden, inwiefern sich die heutigen Taliban von ihrer ersten Herrschaft vor 20 Jahren unterschieden.»
Unterschiede gebe es: So stehe die Grundschule auch nach der erneuten Machtübernahme Jungen wie Mädchen offen. Das sei zwischen 1996 und 2001 nicht der Fall gewesen.
Zugleich seien weiterführende Schulen für Mädchen noch nicht wieder geöffnet worden oder man sehe Fotos von Seminarräumen mit durch einen Vorhang getrennten Studentinnen und Studenten.
Barr macht sich keine Illusionen: Bei den Frauenrechten werde es Rückschritte geben, das sei nicht die Frage. Die Frage sei vielmehr, wie gross diese Rückschritte seien.
Sie richtet ihr Augenmerk speziell auf die Gesetze aus den letzten zwanzig Jahren: Das bis anhin geltende Strafrecht etwa, das im Vergleich zu den Taliban moderat ist. Oder das 2009 erlassene Gesetz zum Schutz der Frauen vor Gewalt. Ob die Taliban diese Vorschriften in Kraft lassen oder ihre alten drakonischen Gesetze ausgraben, müsse sich zeigen.
Ministerium für Frauenangelegenheiten
Doch allzu optimistisch ist Barr nicht. Das Ministerium für Frauenangelegenheiten zum Beispiel wurde offenbar abgeschafft – oder zumindest nicht neu besetzt. Es war laut Barr auch unter der Präsidentschaft von Ashraf Ghani kein mächtiges Ministerium und hatte praktisch kaum eigene Mittel.
«Es wäre für die Taliban ein Leichtes gewesen, das Ministerium für Frauenangelegenheiten symbolisch weiterzuführen», sagt Barr. Dass sie es nicht taten, zeige, dass sie aus eigenem Antrieb kaum Zugeständnisse machten.
Zugeständnisse müssten den Taliban abgerungen werden. Frauen protestieren derzeit auf den Strassen von Kabul für ihre Rechte, obwohl sie damit rechnen müssen, von Taliban-Kämpfern geschlagen zu werden.
Internationale Gemeinschaft soll Bedingungen stellen
Doch auch die internationale Gemeinschaft habe eine Rolle zu spielen, sagt Barr: «Die Taliban wollen humanitäre Hilfe, sie brauchen Gelder, um ihre Behörden am Laufen zu halten und sie wollen in den internationalen Bankenverkehr eingegliedert und als Regierung anerkannt werden.»
Das seien alles Punkte, bei denen die internationale Gemeinschaft Druck ausüben und ein Entgegenkommen an Bedingungen knüpfen könne.
Eine erste Gelegenheit dafür böte sich bereits kommende Woche, wenn der UNO-Sicherheitsrat darüber entscheidet, seine Unterstützungsmission für Afghanistan weiterzuführen. Schreibt SRF.
Den Namen der islamisch-fundamentalistischen Bewegung der «Taliban»* mit «Saudi Arabien» zu ersetzen, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen, ist bei diesem Artikel von SRF nicht zulässig. Saudi Arabien hat nämlich längst ein «Sittenministerium», wie alle muslimischen Staaten. Von der Türkei, den Golfstaaten, Iran, den Maghreb-Ländern bis hin zu einzelnen Bundesstaaten Indonesiens.
Diese «Sittenpolizei», ein Relikt aus der Steinzeit der monotheistischen Religionen inklusive Christentum, wird durch den Koran legitimiert. Je nach Auslegung der örtlichen Mullahs, Ajatollahs und sonstigen Pfaffen des Islams rund um den Erdball mal in einer strikten, mal in einer etwas gemässigteren Version.
Für aufgeklärte Menschen aus dem Westen jenseits einer totalitären, faschistoiden** Religion wie dem Islam eine unzumutbare Rückständigkeit in Bezug auf die Menschenrechte des 21. Jahrhunderts, egal um welche Sittenpolizei-Version es sich handelt.
Bezeichnend und nicht frei von einer gewissen Verkommenheit der westlichen «Wertegemeinschaft» ist allerdings die Heuchlerei, mit der nun Afghanistans «Sittenministerium» mit einer Empörung sondergleichen in Grund und Boden verurteilt und gegeisselt wird. Die «Werte» der Taliban stehen seit jeher auf ihrer Fahne geschrieben, welche jetzt in Afghanistan über jedem Mohnblumenfeld weht. Von Frauenrechten ist da nichts zu lesen, von Allahu akbar hingegen sehr viel.
Die gelehrigen Schüler bzw. Suchenden (Taliban*) führen nur zu Ende, woraus sie nie ein Geheimnis gemacht haben und das bei unseren geschätzten Geschäftspartnern aus den muslimischen Ländern längst in Stein gemeisselt und vom Westen stillschweigend akzeptiert ist.
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: «Wenn zwei das Gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe». Jedenfalls wenn es um religiösen oder politischen Totalitarismus und Business geht. So viel Wahrheit muss sein!
Würden wir unsere Schnappatmungen bezüglich Scharia und Menschenrechten tatsächlich ernst nehmen, dürften wir weder mit islamischen Ländern noch mit China oder Russland Handel betreiben. Die wären nämlich längst mit Sanktionen überzogen worden. Wie es derzeit der Iran erlebt.
Das wissen inzwischen auch die Taliban. Die «Schüler» hatten 20 Jahre lang genügend Zeit, die Doppelzüngigkeit der hehren westlichen Wertegemeinschaft zu studieren. Mit ihrer smarten, zuckersüssen und salafistischen Kommunikationsstrategie, die alles verspricht, aber ausser dem Tod nichts hält und deshalb wie Hohn in unseren Ohren klingt, setzen sie nun um, was sie gelernt haben.
Die Gotteskrieger vom Hindukusch können sich sogar sicher sein, dass die westlichen Hilfsgelder wie eh und je fliessen werden. Die Schweiz hat in dieser Woche in einem Anflug von vorauseilendem Gehorsam bereits 33 Millionen Schweizer Franken als humanitäre Hilfe zwecks Versorgung der afghanischen Bevölkerung mit Lebensmitteln spendiert. Und das ist gut so. Irgend jemand muss letztendlich das Überleben dieser seit Jahrzehnten geschundenen Bevölkerung sichern.
Die unermesslich reichen, salafistischen Golfstaaten sowie Saudi Arabien sind schliesslich in einer geschickten Aufgabenteilung zwischen Westen und Osten für das spirituelle Wohl zuständig und nicht für das tägliche Überleben ihrer Glaubensbrüder- und Schwestern. Flüchtlinge nehmen die Nahost-Länder mit Ausnahme der Türkei, Jordanien und dem Libanon quasi keine. Dafür spenden sie Milliarden von Dollar, um Afghanistan mit neuen Moscheen bis ins letzte afghanische Dörfchen zu überziehen.
Was die salafistischen «Hilfsorganisationen» aus dem Nahen Osten bisher – in einer ebenfalls erfolgreichen Aufgabenteilung – auch in ganz Europa praktiziert haben: Der Westen ist zuständig für die Flüchtlinge und deren Wohlergehen, Saudi Arabien und die Golfstaaten wie Katar, wo demnächst die Fussballweltmeisterschaft stattfindet, für die Finanzierung von Moscheen.
Die Salafisten-Moschee in Menziken lässt grüssen. Die bis dato in die Schweiz geflossenen Millionen aus den Golf-Ländern für den Bau von Moscheen wären möglicherweise für Weiterbildungsprogramme der derzeit laut Schweizer Arbeitslosenstatistik August 2021 mehr als 5'000 arbeitslosen Glaubensbrüder- und Glaubensschwestern aus dem Kosovo besser angelegt gewesen. Aber das steht vermutlich nicht im Koran.
Moral predigen und Moral leben sind letztendlich auch nicht mehr als zwei paar ungleiche Stiefel, die man je nach Situation wechseln kann, wann immer es einem beliebt.
*Der Name ist der Plural des arabischen Wortes Talib, das Schüler oder Suchender bedeutet.
** Der Islamwissenschaftler Bassam Tibi nennt den Islamfaschismus eine weitere totalitäre Ideologie, die sich nun ausbreitet, nachdem die Welt den Faschismus und Stalinismus überwunden hat.
Die Frauenrechtlerin Ayaan Hirsi Ali bezeichnete im Jahre 2007 während eines Interviews mit der britischen Zeitung London Evening Standard den Islam als «den neuen Faschismus» und «eine destruktive, nihilistische Sekte des Todes». In einem weiteren Interview im selben Jahr mit dem Independent begründete sie ihre Thesen mit der Kernbotschaft des Islams, die von einem Muslim die gleiche bedingungslose Unterwerfung und Aufopferung bis hin zum eigenen Tod einfordere, wie sie beispielsweise von Mohammed Atta, einem der Attentäter des 11. Septembers, der Welt vor Augen geführt worden war. Darüber hinaus sehe sie keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus, da der Prophet Mohammed selbst zur gewaltsamen Eroberung anderer Länder im Namen des Islam und zum Töten Andersgläubiger und Homosexueller aufgerufen hätte.
Der deutsch-ägyptische Politologe und prominente Islamkritiker Hamed Abdel-Samad unterstreicht die weltanschaulichen Gemeinsamkeiten faschistischer Parteien und Bewegungen in Europa und bestimmter islamischer Organisationen in Vorderasien und Nordafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Abdel-Samad weist aber ähnlich wie Ayaan Hirsi Ali auf faschistische Elemente im sogenannten «Ur-Islam» hin, insbesondere das bedingungslose Unterwerfungsprinzip im Islam, verschiedene antisemitische Passagen im Koran und die ethnischen Säuberungen, die unter der Führung Mohammeds von seinen Anhängern auf der Arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert vollzogen wurden. Quelle Wikipedia.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.9.2021 - Tag der schwulen Kinder von der SVP
Glarner gegen Portmann zur Ehe für alle: «Kinder von Homo-Paaren werden tendenziell schwul»
FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann streitet im «Blick Abstimmungs-Kampf» mit SVP-Hardliner Andreas Glarner über die Ehe für alle. Schreibt (bzw. zeigt in einem Video) unser aller Blick.
«Kinder von Homo-Paaren werden tendenziell schwul», sagt die Talibanane Andreas Glarner von der Aargauer SVP. Erinnert stark an die «verdrehten Hirnlappen» des SVP-Schreinermeisters und Nationalrats Toni Bortoluzzi.
Es gibt tatsächlich gute Gründe dafür, dass man den Aargauer SVP-Präsidenten Andreas Glarner ungestraft einen "DUMMSCHWÄTZER" nennen darf.
Und noch mehr, viel mehr:
Er sei ein «dummer Mensch», ein «infantiler Dummschwätzer» und ein «übler, verlogener Profiteur»: Mit diesen Worten hat ein Aargauer auf Facebook SVP-Nationalrat Andreas Glarner (57) angegriffen. Das Obergericht in Aarau hat entschieden: Das darf er. Glarner zog den Entscheid daraufhin an die nächste Instanz weiter – und verlor nun abermals, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Auch die Richter am Obergericht sind der Meinung, dass sich der SVPler die harschen Worte gefallen lassen muss.
Geschadet hat's dem SVP-Dumpfplauderer vom Dienst bisher nicht unbedingt: «Ist der Ruf erst uriniert, politisiert es sich ungeniert» sagt ein altes Sprichwort. Wie wahr!
Diese Volksweisheit bestätigt die Karriere des ehemaligen Berner SVP-Grossrats und Nationalrats Thomas Fuchs, der gerne über Schwule lästerte, bevor er von einem Journalisten vor versammelter Meute im Berner Parlament selbst als Homosexueller öffentlich geoutet wurde, was beinahe zu einer Schlägerei – mit Fäusten und nicht mit Wattebäuschchen – führte. Das entsprechende Video sollte eigentlich noch heute auf YouTube zu finden sein.
Die Skandalnudel mit hohem Peinlichkeitspotenzial Fuchs hat seine parlamentarischen Ämter inzwischen verloren, ist aber zum Kassier der GaySVP aufgestiegen. Das nennen wir doch mal einen Karrieresprung!
Nun gut: "Dumme Menschen", "infantile Dummschwätzer" und "üble, verlogene Profiteure" gibt es - vor allem in der Politik - nicht wenige. Dass aber so einer wie Glarner auch noch zum Präsidenten der Aargauer SVP gewählt wird, sagt viel über den moralisch-intellektuellen Zustand dieser "Volchs-Partei" aus, die notabene übrigens eine der ersten Schweizer Parteien war, die mit der "GaySVP" eine schwule Untergruppe mit eigener Website lancierte.
Was man bei Schweizer Parteien alles so tut, um auch die Wählerstimmen der Vögelchen aus den etwas wärmeren Nestchen einzufangen, erstaunt einen immer wieder.
Was soll's? Auch der geistig eher etwas unbedarfte, aber immerhin nicht gänzlich unsympathische "Secondo" Bortoluzzi wurde 2002 (erfolglos) sogar als Sprengkandidat der SVP bei der Nachfolge von Ruth Dreifuss als Bundesratskandidat aufgestellt.
Irgendwie scheint es, als ob sich die SVP bei der Auswahl ihrer Kader stets im Fasnachtsmodus dreht.
Ob da einer/eine/eines alle Tassen im Schrank hat, scheint dem Blocher-Verein nicht so wichtig zu sein. Hauptsache, er/sie/es beherrscht das Poltern im Sinne des Propheten Jesus Christophorus vom Herrliberg. Dass die gezielten Provokationen meistens an infantiler Lächerlichkeit nicht zu überbieten sind, spielt keine Rolle.
Dabei, und das ist die eigentliche Tragödie der SVP, gibt es durchaus respektable und wählbare SVP-Topshots jenseits der Dumpfbacken-Ideologie über schwarze Schafszüchterei, muslimische Kapuzen und anderen Schwachsinn.
Der Aargauer SVP-Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati beispielsweise leistet einen hervorragenden Job in einer von der Coronakrise gebeutelten Zeit. Niemals mit Blick auf die SVP-Aluhüte der Masken- und Impfverweigerer, sondern stets für das Wohl des Kantons und damit zum Wohl der Allgemeinheit. Parteiübergreifend. Und dies erst noch in einem Departement, das von seiner (SVP-)Vorgängerin ziemlich heruntergewirtschaftet worden war.
SVP-Politiker*innen vom Schlage Gallatis sind durchaus wählbar. Was auch auf den Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter zutrifft. SVP-Nationalrätin Martina Bircher bewährt sich ebenfalls hervorragend als Gemeinderätin von Aarburg.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
9.9.2021 - Tag mit Flip Flops getretenen Frauenrechte
Taliban verbieten Proteste in Afghanistan – Kritik des Westens an Regierung
Als Grund nennen die Taliban die Verletzung der "öffentlichen Ordnung" durch die Proteste der vergangenen Tage. Indes hagelte es Kritik an der neuen Taliban-Regierung.
Die militant-islamistischen Taliban haben am Mittwoch alle weiteren Proteste in Afghanistan untersagt. In der ersten offiziellen Erklärung des Innenministeriums nach der Regierungsbildung heißt es, niemand solle derzeit unter allen Umständen versuchen, Proteste zu organisieren. Bei Verstößen wird mit ernsthafter Strafverfolgung gedroht. Als Grund wurde angeführt, dass in den vergangenen Tagen einige Menschen die öffentliche Ordnung gestört und Menschen belästigt hätten.
Zugleich gaben die Islamisten die Bedingungen für Proteste in der Zukunft vor. Demnach müssen Organisatoren im Vorfeld eine Genehmigung des Justizministeriums einholen. Mindestens 24 Stunden vorher müssten der Grund der Demonstration, Ort, Zeit und Slogans Justiz und Sicherheitsbehörden mitgeteilt werden.
Die Taliban hatten in den vergangenen Tagen Demonstrationen mit Gewalt unterdrückt. Außerdem untersagten sie die Berichterstattung über die Proteste in den Medien. Frauen und Männer waren in der Hauptstadt Kabul und mehreren Provinzen unter anderem für Frauenrechte und Freiheit auf die Straße gegangen.
Kritik aus aller Welt
Auch wenn es eigentlich niemanden so wirklich zu überraschen vermochte, dass die radikalislamistischen Taliban die Chefposten in ihrer Übergangsregierung ausschließlich Männern und noch dazu weitgehend ihresgleichen überantworten, übten sich die westlichen Regierungen am Mittwoch in Kritik an den neuen Herren in Kabul.
Während Deutschland und die USA mit Sorge reagierten, will China die Kommunikation mit den radikal-islamischen Machthabern in Kabul aufrechterhalten. Die EU zeigte sich enttäuscht, sie setzt ihre Nothilfe für Afghanistan bis auf weiteres aber fort. In Österreich beschloss die Bundesregierung 18 Millionen Soforthilfe für Afghanistan.
Zehn Millionen Euro davon gehen an das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR), fünf Millionen an UN Women und drei Millionen an das Welternährungsprogramm. "Wir wollen in der Region helfen und weitere Fluchtbewegungen nach Europa verhindern," sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ergänzte: "Die Lage der Frauen und Mädchen und die Ernährungslage für ein Drittel der Bevölkerung sind alarmierend. Das macht die internationale humanitäre Hilfe so dringend notwendig."
Die neue Regierung stellt sich vor
Die Taliban hatten tags zuvor, gut drei Wochen nach ihrem Einmarsch in der Hauptstadt, ihre 33-köpfige Ministerriege vorgestellt – und dem verdutzten Westen rasch klargemacht, was sie unter einer "inklusiven Regierung" verstehen, die sie kurz nach ihrer Machtübernahme noch versprochen hatten.
Im Kabinett des designierten und zuvor vergleichsweise unbekannten Premierministers Mullah Hassan Akhund findet sich etwa Sirajuddin Haqqani, ein hochrangiger Taliban und Anführer des von den USA seit 2012 als Terrororganisation definierten Haqqani-Netzwerkes, das für viele Anschläge in Afghanistan verantwortlich gemacht wird. Die US-Bundespolizei FBI hat auf den neuen Innenminister daher seit Jahren ein siebenstelliges Kopfgeld ausgelobt.
Die Außenminister Deutschlands und der USA, Heiko Maas (SPD) und Antony Blinken, äußerten sich nach einem Treffen auf dem US-Stützpunkt in Ramstein besorgt über die Zusammensetzung der Regierung in Kabul. Wie Maas forderte auch Blinken, dass weitere Menschen aus Afghanistan ausreisen können. "Diese Charterflüge müssen fliegen können", sagte Blinken. Die weiteren Beziehungen hingen nun maßgeblich vom Verhalten der Taliban ab, sagten beide Außenminister. Maas betonte, dass die Weltgemeinschaft zwar humanitäre Hilfe leisten werde. Eine Isolation Afghanistans sei nicht im Interesse der Taliban.
Kritik aus Washington
Dennoch bereiten den USA die Verbindungen und die Vergangenheit einiger Personen der Übergangsregierung Sorge, sagte zuvor ein Sprecher des State Department, des US-Außenministeriums. Ebenso monierte dieser, dass auf der Liste der Kabinettsmitglieder "ausschließlich Personen stehen, die Mitglieder der Taliban oder ihrer enger Verbündeter sind und keine Frauen". Man habe zuvor "unsere Erwartung klar geäußert, dass das afghanische Volk eine inklusive Regierung verdient". Dass die Taliban weiblichem Personal keinen Platz am Kabinettstisch zugestehen, hatten die radikalen Islamisten freilich schon vor der offiziellen Verkündung angekündigt.
Auch die ethnische Zusammensetzung des Taliban-Kabinetts vermag bei näherer Betrachtung kaum den Vielvölkerstaat Afghanistan abzubilden. Bis auf drei der 33 Minister gehören alle der bei den Taliban dominierenden Ethnie der Paschtunen an, zwei sind Tadschiken, einer ist Usbeke. Auf ihr Versprechen angesprochen, in der neuen Regierung würden alle Teile der Gesellschaft vertreten sein, reagierten die Taliban dann beschwichtigend. Es handle sich lediglich um ein Übergangskabinett, in dem noch nicht alle Posten besetzt seien, wiegelte Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid bei einer Pressekonferenz ab.
Maas: "Signale stimmen nicht optimistisch"
Deutschlands Außenminister Heiko Maas, der zuletzt wegen einer offenbar ignorierten Warnung der deutschen Botschafterin in Washington vor einem schnellen Vormarsch der Taliban in die Kritik geraten war, gibt sich damit nicht zufrieden. "Die Verkündung einer Übergangsregierung ohne Beteiligung anderer Gruppen und die gestrige Gewalt gegen Demonstrantinnen und Journalisten in Kabul sind nicht die Signale, die optimistisch stimmen", sagte er am Mittwoch.
Diese hatten die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit gefordert. Seit Wochen warnt etwa das Uno-Büro für Nothilfe vor einer drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan. Pakistan, dem immer wieder die Billigung des neuen Regimes in Kabul nachgesagt wird, hat vorgeschlagen, zur Bewältigung der humanitären Notlage auch die Taliban zu Gesprächen einzuladen.
Die Europäische Union (EU) will jedenfalls ihre Nothilfe für Afghanistan fortsetzen – die neue Taliban-Regierung aber genau im Auge behalten. "Die Europäische Union ist bereit, weiter humanitäre Hilfe zu leisten", sagte der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič. Längerfristig hingen Gelder aber davon ab, ob die neuen Machthaber in Kabul Grundfreiheiten aufrechterhielten. Auch die EU äußerte sich enttäuscht über das von den Taliban eingesetzte Übergangskabinett.
Sorge auch in Asien
Doch nicht nur der Westen ist ob der Entwicklung in Afghanistan besorgt. Dass von dem Land zwanzig Jahre nach den 9/11-Anschlägen weiterhin Terrorgefahr ausgeht, konstatierten am Mittwoch die nationalen Sicherheitsberater der beiden Regionalmächte Russland und Indien, Nikolai Patruschew und Ajit Doval. Die Taliban müssten ihr Versprechen halten, wonach sie ausländischen Terrorgruppen keinen Unterschlupf bieten. Während Moskau am Mittwoch erklärte, vorerst keine direkten Kontakte zum Taliban-Regime unterhalten zu wollen, fühlt sich Indien von den radikalen Islamisten in seiner Nachbarschaft bedroht. Und auch China will seine Grenzen künftig stärker überwachen.
Appelle für einen Dialog mit den Taliban kamen am Mittwoch vom Roten Kreuz. "Es braucht einen breiteren Rahmen für politische und wirtschaftliche Kontakte mit den neuen Autoritäten", sagte der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, in Kandahar. Dies sei zur Bekämpfung der sozioökonomischen Krise in dem Land notwendig. Humanitäre Hilfslieferungen allein seien nicht genug.
Andere Staaten sollten jetzt darüber nachdenken, ob Sanktionen gegen die Taliban negative Auswirkungen auf die Bevölkerung in Afghanistan hätten, sagte Maurer. Außerdem solle die Weltbank nach Wegen suchen, ihre Unterstützung für das Gesundheitswesen wiederaufzunehmen. Maurer traf während seines viertägigen Besuches auch den neu ernannten Vizeregierungschef Mullah Abdul Ghani Baradar. Das IKRK sei bisher schon in Taliban-Gebieten tätig gewesen und wolle das auch weiter tun.
Plötzliche Entschuldigung
Während der Westen nun mit Sorge auf die neue Taliban-Regierung blickt, hat sich indes am Mittwoch der alte Präsident Ashraf Ghani zu Wort gemeldet. Gut drei Wochen nach seiner überstürzten Flucht aus Afghanistan hat sich dieser beim afghanischen Volk entschuldigt. "Es war nie meine Absicht, das Volk im Stich zu lassen", ließ Ghani auf Twitter wissen. Er habe mit seiner Flucht heftige Kämpfe wie während des Bürgerkrieges in den 1990er-Jahren in der Hauptstadt Kabul verhindern wollen.
Ghani, der sich aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhält, wies erneut Vorwürfe zurück, dass er bei seiner Flucht "Millionen Dollar, die dem afghanischen Volk gehören", mitgenommen habe. "Diese Beschuldigungen sind vollständig und kategorisch falsch." Er stelle sich jeder unabhängigen Untersuchung. Der afghanische Botschafter in Tadschikistan etwa hatte Ghani des Diebstahls von 169 Millionen Dollar, umgerechnet 144 Millionen Euro, an staatlichen Mitteln beschuldigt. Schreibt DER STANDARD.
Der Westen kritisiert die «militant-islamistischen» Taliban. Die Bartlis vom Hindukusch lassen die Maske fallen und kümmern sich nicht mehr um ihr Geschwätz von gestern, was bisher eigentlich eine Domäne westlicher Politiker*innen war. Demonstrationen werden verboten und Frauenrechte mit den Flip Flops getreten. Ganz zu schweigen von gendergerechten Formulierungen oder gar gendergerechten Toiletten.
Und nun, liebe Politiker und Politikerinnen, geschätzte Bürger und Bürgerinnen der hehren westlichen Wertegemeinschaft: Ersetzen Sie das Wort «Taliban» durch «Saudi Arabien» und Sie werden erstaunt feststellen, dass Ihre hehren Werte irgendwo im Nirwana eines skurrilen und verlogenen Parallel-Universums angesiedelt sind.
Wenn zwei das Gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe. Weil vielleicht der eine etwas geschickter handelt als der andere und missliebige Journalisten in einer Botschaft am Bosporus ermorden und die Leiche mit einer Kettensäge vierteilen lässt, damit sie möglichst unauffällig in einem Louis-Vuitton-Koffer entsorgt werden kann. Der saudische Kronprinz, der im Gegensatz zum Talibananen-Häuptling auf keiner FBI-Fahndungsliste steht, lässt grüssen.
Geschätzte Mitglieder und Mitgliederinnen der hehren westlichen Wertegemeinschaft: Können Sie eigentlich noch in den Spiegel schauen, ohne rot zu werden? Oder gar schämen ob Ihrer Doppelmoral?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.9.2021 - Tag der Mutter Theresa des Klimawandels
On geht an die Börse und macht Federer noch reicher
Der Zürcher Schuhhersteller will nun doch den Börsengang in New York wagen. Dieser soll in ein paar Tagen angekündigt werden. Der Schritt bringt den Eigentümern den Geldsegen.
Nun also doch: Die Zürcher Schuhfirma On geht demnächst in New York an die Börse. Schon länger gabs Gerüchte. Wie das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» nun aber aus mehreren Quellen erfahren haben will, ist der Börsengang schon bald Tatsache.
Laut dem Bericht soll es der grösste Börsengang einer Schweizer Firma sein, seit der Rohstoffhandelskonzern Glencore 2011 an der hiesigen Börse aufs Parkett ging. On soll eine Bewertung von sechs bis acht Milliarden Dollar anstreben.
Schweizer Banken mit kleiner Rolle
Bei den Banken, die den Börsengang begleiten, soll es sich um JP Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley handeln. Schweizer Banken sollen nur eine kleine Rolle dabei spielen, zitiert die Bilanz einen Insider. Laut diesem könnte sich die Ankündigung des Börsengang verzögern, sollten die Aktienmärkte einbrechen oder wenn On die Papiere noch nicht parat hat.
On selber gibt sich weiterhin verschwiegen. Auf Anfrage von 20 Minuten teilt eine Sprecherin mit: «Zu Gerüchten nehmen wir keine Stellung.»
Geldsegen für Mitarbeiter
Ein Börsengang würde die private Kasse von Roger Federer noch einmal kräftig füllen. Der Tennisstar ist an der Firma beteiligt (siehe Box). Auch die On-Mitarbeiter mit Anteilen an der Firma würde der Geldsegen ereilen. Einige könnten nun über Nacht zu Millionären werden
Auch in der Schweiz gibt es Beispiele, bei denen Mitarbeiter über Nacht zu Millionären wurden. So etwa beim Thurgauer Zugbauer Stadler Rail. Als die Firma im Frühling 2019 den Börsengang wagte, hielten die 170 Topkader der Firma Aktien im Wert von 250 Millionen Franken.
Das machte auch die damalige Stadler-Pressechefin Marina Winder reich. Der Wert ihrer 40’000 Aktien legte nach dem ersten Handelstag um rund 1,7 Millionen Franken zu.
Federer als Mitbesitzer von On
On ist ein Zürcher Sportschuhhersteller mit Sitz in Zürich, Portland, Berlin, Yokohama und Shanghai. Das Unternehmen wurde von ehemaligen Spitzensportlern und Ingenieuren gegründet. Seit 2019 ist Roger Federer Mitbesitzer von On. Wie viel Geld Federer in das Unternehmen gesteckt hat, ist nicht bekannt. Branchenkenner gehen von 50 bis 100 Millionen Franken aus. Leisten kann er es sich: Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» schätzt sein Vermögen auf 500 bis 600 Millionen Franken.
Schreibt 20Minuten.
Dass Federer durch den Börsengang von «ON» laut Headline noch reicher wird sei ihm gegönnt. Immerhin hat er nicht nur beim Tennisspiel ein gutes Händchen, sondern auch bei Kapitalanlagen. Ausserdem können bei den Hardcore-Fans von Federer sämtliche Befürchtungen ad acta gelegt werden, dass ihr Idol je beim Sozialamt landen wird.
Störend am Artikel ist allerdings etwas ganz anderes: «Der Zürcher Schuhhersteller will nun doch den Börsengang in New York wagen» schreibt 20Minuten. ON soll ein Schuhhersteller sein?
ON stellt rein gar nichts her ausser einer perfekten Werbung mit einem der prominentesten Sportler der Welt.
ON-Schuhe werden ausschliesslich in China und Vietnam von ebenso fleissigen wie billigen Asiaten*innen hergestellt, bevor sie mit Containerschiffen beispielsweise in der Schweiz eintreffen.
Laut Routenplaner beträgt die kürzeste Route zwischen der Schweiz und China 9'702,25 km. Das heisst, ein ON-Sneaker legt knapp 10'000 Kilometer zurück, bevor er im Zürcher Schuhgeschäft an der Bahnhofstrasse landet.
Was wohl Klimaschützer*innen wie Bundesrätin Sommaruga dazu sagen? Hehre Worte an den unzähligen Klimagipfeln unserer Mutter Theresa des Klimaschutzes vom Bundeshaus sind das eine, konsequente Taten, die das Klima wirklich schützen, das andere.
Dass ein läppischer «On The Roger Advantage Herren Sneaker» 199.90 Schweizer FränkLees kostet, erinnert an das iPhone, das in der US-Zollstatistik als «China-Import»* im Wert von 237.45 Dollar auftaucht und in den USA zum Preis von knapp 1'000 Dollar verkauft wird. Not bad! Das nennt man mal Gewinnmargen. Dürfte bei den ON-Sneakern prozentual etwa gleich sein.
Es sei jedem Konsumenten und jeder Konsumentin selbst überlassen, für welches Sneaker-Produkt er/sie/es sich letztendlich entscheidet. Mit Schuhen an den Füssen, die die halbe Welt auf klimaschädlichen CO2-Schleudern umrundet haben an Klimademos teilzunehmen, ist allerdings ein absolutes NO GO!
Womit eigentlich keine einzige Klimademo mehr stattfinden dürfte, denn mehr oder weniger stammen beinahe alle Schuhe inzwischen aus Asien.
Klimaschutz fängt aber zuallererst bei den eigenen Füssen an; merkt Euch das! Sonst kommt Doktor Luzart an der nächsten Klima-Demo in Luzern mit der Spraydose vorbei und markiert Eure modischen Sneakerchen als Klimaschädlinge.
Selbstverständlich nur mit gendergerechten Farben. Huch. Alles klar?
* Laut «Syracuse University» sowie der «University of California» gehen bloss 8,46 Dollar an chineische Hersteller. US-Betriebe stellen immer noch den grössten Teil eines Apple-Handys her (im Wert von 68,70 Dollar) – derweil europäische Partner lediglich Beiträge für 6,60 Dollar zuliefern. Die restlichen Zulieferer stammen aus Südkorea, Taiwan und Japan.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.9.2021 - Tag der Dauereinsätze der Luzerner Polizei
Luzerner Polizei im Dauer-Einsatz über das Wochenende
Die Luzerner Polizei musste am Wochenende wegen diversen Schlägereien in der Stadt Luzern ausrücken. Zudem wurde ein 22-jähriger Bolivianer festgenommen, welcher mit einer verbotenen Waffe unterwegs war. Daneben gab es mehrere Meldungen wegen Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und wegen häuslicher Gewalt.
22-jähriger Bolivianer mit verbotener Waffe unterwegs
Am späten Freitagabend (3. September 2021) alarmierte ein Passant, welcher im Gebiet Inseli in der Stadt Luzern unterwegs war, die Luzerner Polizei. Der Zeuge beobachtete, wie ein Unbekannter beim Inseli mit einer Waffe hantierte und diese einsteckte. Die Luzerner Polizei konnte den Verdächtigen umgehend vor Ort festnehmen und die "Waffe" sicherstellen. Es handelte sich dabei um eine Glock-Softair-Pistole, welche nicht von einer echten Faustfeuerwaffe unterschieden werden kann. Zuvor hatte er - gemäss eigenen Aussagen - mit der Waffe im Gebiet Kantonsschule auf Gegenstände geschossen. Zudem stellte die Polizei beim 22-jährigen Mann aus Bolivien einen Pfefferspray und ein gefährliches Messer (Klappmesser) sicher. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.
Information:
Eine Soft-Air-Pistole gilt als Waffe, wenn die Gefahr einer Verwechslung mit einer Feuerwaffe besteht. Weiterführende Informationen siehe Waffenbroschüre.
Mehrere Schlägereien und Körperverletzungen
Zu einer Schlägerei musste die Polizei am Freitagabend (3. September 2021) ausrücken. In einem Lokal an der Pilatusstrasse wurde ein Gast von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen und erheblich verletzt. Am frühen Samstagmorgen (4. September 2021) kam es zu einer weiteren Schlägerei an der Sempacherstrasse in der Stadt Luzern. Der Rettungsdienst 144 musste einen Mann betreuen, welcher diverse Kopfverletzungen hatte. Er wurde zuvor von einer unbekannten Person zusammengeschlagen. Eine weitere Person wurde am frühen Samstagmorgen bei einer Schlägerei an der Frankenstrasse verletzt. Auch dieser Mann musste vom Rettungsdienst 144 betreut werden. Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen.
Unbekannte beschädigen Rettungsgeräte an der Reuss
Über das Weekend haben Unbekannte aus Blödsinn ein Lebensrettungsgerät an der Reussinsel beschädigt. Sie haben die Wurfleine zerschnitten und den Wurfsack und Rettungsring weggeworfen. Die Polizei konnte organisieren, dass die Geräte, welche im Notfall Leben retten können, umgehend wieder ergänzt und in Stand gestellt werden konnten.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung vom 6.9.2021.
«Luzerner Polizei im Dauer-Einsatz über das Wochenende» schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung.
Das scheint ja inzwischen bei der Luzerner Polizei nicht die Ausnahme an den Wochenenden zu sein, sondern Dauerzustand. Denn diese Feststellung deckt sich mehr oder weniger mit der Medienmitteilung vom Wochenende zuvor.
Das hat Gründe. Wenn sich das Luzerner Bahnhof-Quartier inklusive Peripherie langsam aber sicher zu einer No-Go-Area entwickelt, sollte die Luzerner Polizei vielleicht einmal zusammen mit der Stadtregierung nach den Ursachen für diese verhängnisvolle Entwicklung forschen.
Laissez-faire-Einstellungen wie «Drogen gehören halt zu einer Stadt» ist vielleicht eine davon. Wenn ein Luzerner Polizist hinter vorgehaltener Hand vermutet, dass beim Luzerner Polizei-Korps wohl einige Beamte*innen selber Drogen konsumieren, macht das die Sache auch nicht besser. Den Teufel durch Beelzebub austreiben ging noch immer in die Hosen.
Der Skandal um einen ehemaligen Chef der Zofinger Polizei lässt grüssen!
Wie man sich bettet, so liegt man. Alles hängt mit allem zusammen: Wo die Drogen herrschen, ist die Kriminalität nicht weit! Das Luzerner Bahnhofquartier ist ja nicht umsonst einer der Drogenhotspots in der Leuchtenstadt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.9.2021 - Tag der Maskenpflicht an Luzerner Schulen
Ab heute heisst's wieder: Maske auf! So denken Luzerner Schüler über Revival der Maskenpflicht
Anders als die Zugerinnen tragen Luzerns Kantischüler ab Montag im Unterricht wieder Maske. Noch vertraut die Schülerschaft der Kantonsschulen Alpenquai, Menzingen und Zug gemäss Vertreterinnen auf die Beschlüsse von BAG, Kanton und Schulen – trotz Entbehrungen und Kritik.
Die Freude über den Wegfall der Maskenpflicht währte an den Kantonsschulen Luzerns nicht besonders lange. Den entsprechenden Entschluss hatte der Luzerner Regierungsrat im Zuge der bundesrätlichen Lockerungen vom 28. Juni verabschiedet. Mit den steigenden Fallzahlen nach den Sommerferien hat sich die Regierung erneut für einen Kurswechsel entschieden.
Für Salvina Knobel, die Präsidentin der Schülerinnenorganisation (SO) der Kantonsschule Alpenquai (KSA), kam dieser Entscheid mehr als unerwartet. Von knapp 1800 Schüler seien letzte Woche 5 positiv getestet und weitere 6 in Quarantäne geschickt worden, sagt sie. Wären es 100 Fälle gewesen, würde die Schülerschaft die neuerliche Verschärfung der Massnahmen nachvollziehen können. Möglicherweise würden die Schutzkonzepte an den Kantonsschulen besser greifen als an der Volksschule. «So verstehen viele den Entscheid nicht.»
Zuger Kantischülerinnen fühlen mit
Die Schülerschaftsvertreterinnen der Kantonsschulen Menzingen (KSM) und Zug (KSZ) können den Frust der Luzerner nachvollziehen. «Niemand wünscht sich die Masken zurück», sagt Ashley Taylor, die Co-Präsidentin der Schülerinnenorganisation der KSZ. Wirklich lästig seien die Masken aber nur an heissen Sommertagen gewesen. Ansonsten hätten sich die Schüler mit der Zeit ans Maskentragen gewöhnt und sich arrangiert, sagt sie.
Dieser Meinung ist auch Salvina Knobel. Es sei aber trotzdem schön gewesen, nach knapp einem Jahr endlich wieder mehr als eine Gesichtshälfte der im Unterricht Anwesenden zu sehen, «frei atmen» und vernünftig kommunizieren zu können. Gewisse Lehrpersonen hätten sie vor dem Wegfall der Maskenpflicht noch nie ohne Maske gesehen. «Wir wussten bis vor Kurzem nicht mal wirklich, wie sie aussehen», sagt die SO-Präsidentin der KSA.
Schülerschaft steht noch hinter den Beschlüssen
Ein Klacks dürften die erschwerten Unterrichtsbedingungen während der Pandemie für alle Kantischülerinnen nicht sein. Die befragten Schülerschaftsvertreterinnen vermuten allerdings, dass die meisten bis jetzt im Grossen und Ganzen mit den Entscheidungen von Politik und Schulleitung einverstanden gewesen sind. Diese Einschätzung entspricht in etwa den Ergebnissen einer vom BAG in Auftrag gegebenen Studie des Forschungsinstituts Sotomo vom Juli 2021. Laut Studienautoren würden die 15- bis 19-Jährigen die Pandemiestrategie des Bundesrats in Bezug auf die Pandemiebewältigung grösstenteils unterstützen.
Allerdings ist sich Salvina Knobel von der KSA in Luzern nicht sicher, ob der Rückhalt unter der Schülerschaft auch in Zukunft bestehen bleibe. Dass Eltern ihrem Ärger bei der Schulleitung Luft machen würden, wie dies direkt nach der Einführung der Maskenpflicht im letzten Jahr geschehen sei, glaubt sie aber nicht. Damals hätten sich einige Erwachsene darüber beschwert, dass die Kosten nicht vom Kanton übernommen wurden, ergänzt Co-Präsidentin Giulia Bucheli. Weitere seien der Meinung gewesen, das Maskentragen gefährde die Gesundheit ihrer Kinder.
Kritik und Unverständnis bleiben nicht aus
Dass an den Kantonsschulen der Kantone Luzern und Zug trotzdem nicht jeder Beschluss auf Bundes-, Kantons- und Schulebene unhinterfragt und unkommentiert hingenommen wird, zeigt sich etwa daran, dass sich die Schülerschaft aller drei Kantonsschulen im Frühling 2020, wenn auch vergeblich, gegen die Durchführung der schriftlichen Maturitätsprüfungen wehrte.
An der KSZ hätten die aus Sicht der Jugendlichen zu früh abgesagten Studienreisen oder die – trotz vorhandenen Schutzkonzepten – nicht durchgeführte Maturaparty zu einigem Unverständnis geführt, erinnert sich Ashley Taylor. Bei den betroffenen Kantischülerinnen sei dadurch durchaus das Gefühl aufgekommen, in ihrer Schulzeit etwas verpasst zu haben.
Am meisten Mühe dürften den meisten aber der letzte Winter und Frühling bereitet haben, sagt die Vertreterin der Schülerschaft der grössten Kantonsschule im Kanton Zug. Zu jener Zeit seien die sozialen Kontakte und die Sportmöglichkeiten für Jugendliche stark eingeschränkt gewesen, und sie hätten auf vieles verzichten müssen. Dennoch gehe sie davon aus, dass die Schülerschaft angesichts der erhöhten Zahlen Verständnis für die strengeren Massnahmen gehabt habe.
Allerdings dürften die Entbehrungen und Einschränkungen mit Blick auf die erwähnte BAG-Studie im Laufe des Frühlings auch bei vielen Kantischülern zu Coronamüdigkeit und Verdruss geführt haben. An der KSM etwa hätten viele mit der Zeit nicht mehr nachvollziehen können, warum von ihnen Vernunft eingefordert wurde, während sie das Verhalten der Erwachsenen als immer unvernünftiger und unvorsichtiger wahrgenommen hätten, so die Vertreterin der Schülerinnen der KSM.
Schüler setzen auch auf Mitverantwortung
Auch wenn vereinzelte Entscheidungen durchaus Kritik und Unverständnis bei der Schülerschaft hervorzurufen scheinen, scheint die Annahme, die Jugendlichen würden sich nur deswegen an die Corona-Regeln halten, weil sie müssen, ungerechtfertigt.
Giulia Bucheli von der KSA betont, dass sie gelernt hätten, selbst zu denken und sich im Internet, diversen Nachrichtenportalen und anderen Seiten zu informieren. Persönlich entscheide sie situativ darüber, ob es angebracht sei, sich straffere Verhaltensregeln aufzuerlegen, als von der Schule vorgegeben. Ihre Maske habe sie trotz vollständiger Impfung erst abgelegt, als nach dem ersten Corona-Test im neuen Schuljahr kaum jemand positiv getestet worden sei.
Dass auch andere Schülerinnen mitverantwortlich handeln und ihr Handeln während der Pandemie selbst in die Hand nehmen, zeigt sich laut Schülerschaftsvertreter an allen drei Kantonsschulen der beiden Kantone. Allerdings seien diejenigen, die die Maske auch ohne Pflicht zu tragen pflegen, deutlich in der Minderheit. Viele davon würden bei potenziellen Covid-Symptomen wie bei einem Schnupfen versuchen, die Mitschülerinnen und Lehrer zu schützen. Andere wiederum hätten Risikopatientinnen in der Familie, so die Befragten.
Pro Hygienemassnahmen und Massentests
Selbstverständlich spiele bei solchen Entscheidungen auch der Selbstschutz eine Rolle. Sorgen wegen der derzeit kursierenden Delta-Variante würden sich aber die wenigsten Schüler machen, sagen deren Vertreterinnen. Die Jugendlichen würden derzeit auf das Einhalten der Hygienemassnahmen, die PCR-Massentests und teilweise auch die Impfung vertrauen – an und für sich auch an der KSA in Luzern, wie Salvina Knobel betont.
Für die Kantischüler bedeuten die Regelungen unter anderem, dass die Schulzimmer auch im Winter regelmässig gelüftet werden. Mit einem Pullover oder einer Jacke sei das absolut zumutbar, sagen Giulia Bucheli und Salvina Knobel von der KSA. Anders als die anderen beiden Schülerschaftsvertreterinnen haben sie zu wiederholten CO2-Messungen und Luftreinigern eine klare Meinung und würden sie absolut befürworten. Manchmal erkenne man beim Betreten eines Zimmers schon am Geruch, dass nicht konsequent gelüftet worden sei.
Genauso wenig seien die PCR-Tests eine Tortur, sagen die vier Interviewten. An den Zuger Kantonsschulen wird zweimal, an den Luzerner Kantonsschulen einmal wöchentlich mit einer Salzwasserlösung in einen Becher gespuckt. Seit Februar. Die meisten Schülerinnen hätten sich schnell an das Prozedere gewöhnt, und die Testmoral sei an allen drei Kantonsschulen relativ hoch.
Zurückzuführen ist dieser Umstand möglicherweise darauf, dass Getestete bei Kontakt zu einem Corona-Positiven nicht in Quarantäne geschickt werden, sagt Ashley Taylor, die Co-Präsidentin der KSZ. Zudem würde die Testpraxis den Schülern nach der Abschaffung der Maskenpflicht eine gewisse Sicherheit geben. Laut ihrer Kollegin aus der KSM ist es zudem nicht auszuschliessen, dass viele, die kürzlich gewonnene Masken-lose Freiheit nicht leichtfertig wieder verspielen oder gar zum Homeschooling zurückkehren wollen.
Impfbereitschaft könnte grösser sein
Grösser hingegen könne die Impfbereitschaft sein, heisst es von Seiten der Schülerschaftsvertretungen. Ashley Taylor von der KSZ geht von 3–4 erst- oder zweitgeimpften Schülerinnen aus. Das würde in etwa der Impfquote der Jugendlichen in der Schweiz (27,38 Prozent, Stand 2. September) entsprechen. Die Vertreterinnen der KSA und der KSM dagegen sprechen von bis zu 10 Geimpften in oberen Klassen. Statistiken zur Impfquote der einzelnen Kantonsschulen gibt es nicht.
Folgt man den Ausführungen der beiden Schülerschaftsvertreterinnen aus Zug, so hätten sich die meisten Kantischüler geimpft, weil sie in den Sommerferien unbeschwerter reisen und geniessen wollten. Da dieser Grund jetzt nicht mehr unmittelbar gegeben sei, sei die Impfmoral gesunken, sagt Ashley Taylor von der KSZ. Ausserdem wisse sie von solchen, die annehmen würden, die Impfung nütze nichts gegen die Delta-Variante.
Alle Schülerschaftsvertreterinnen halten es aber für möglich, dass mit einem niederschwelligen Impfangebot mehr Kantischüler der Impfempfehlung des BAG folgen würden. «Man sieht an der HPV-Impfung, dass Impfmöglichkeiten im Schulhaus durchaus genutzt werden», sagt Salvina Knobel von der KSA. Zusammen mit ihrer Vize-Präsidentin Giulia Bucheli würde sie einen Impfbus, wie er am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug im Einsatz ist, ebenso begrüssen wie die Möglichkeit, sich direkt an der Kantonsschule impfen zu lassen. Schreibt ZentralPlus.
Mir liegt das Wohl der kleinen Scheisserchen der zukünftigen Luzerner Elite sehr am Herzen. Eine Maske während dem Unterricht zu tragen, ist eigentlich das kleinste aller Übel. Tut niemandem weh und kann möglicherweise Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindern.
Aber beim Kiffen oder der Nasenfütterung mit weissem Pulver ist eine Maske wirklich hinderlich. Laut einer Newsletter-Mitteilung der Gemeinde Ebikon, die mehr ein Hilferuf war, sollen ja nebst Cannabis auch etliche Pulversubstanzen zur Bewusstseinserweiterung (Copyright beim Luzerner LSD- und Veganer-Papst Vanja Palmers) von Minderjährigen unter 13 Jahren konsumiert werden. Von den etwas älteren Semestern ganz zu schweigen.
Um den Schülerinnen und Schülern der Luzerner Schulen seelische Qualen zu ersparen, sei darauf hingewiesen, dass die Maske beim Inhalieren und Sniffen verbotener Substanzen nicht getragen muss.
Denn wie die Polizei der Stadt Luzern sagt, «gehören Drogen halt zu einer Stadt». Ob dies allerdings auch für die Schulen ausserhalb der Stadt Luzern Gültigkeit hat, muss noch abgeklärt werden.
Damit auch die Schüler und Schülerinnen des Maihof-Schulhauses und der St. Karli-Schule in Luzern meinen aufmunternden Text verstehen, folgt hier eine Übersetzung auf Albanisch via Google-Translator. Allfällige Fehler sind bei der Verwendung dieses Übersetzungs-Tools vermutlich unvermeidlich. Ob das Wort «Papst» mit «kurva» von Google richtig übersetzt ist, kann ich nicht beurteilen.
.............................................
Mirëqenia e gjërave të vogla të elitës së ardhshme të Lucernit është shumë e rëndësishme për mua. Veshja e një maskë gjatë orës së mësimit është në fakt më e keqja nga të gjitha të këqijat. Nuk dëmton askënd dhe mund të jetë në gjendje të parandalojë infeksionin me koronavirus.
Por kur pini duhan ose ushqyer hundë me pluhur të bardhë, një maskë është me të vërtetë një pengesë. Sipas një gazete nga bashkia Ebikon, e cila ishte më shumë një thirrje për ndihmë, përveç kanabisit, disa substanca pluhur duhet të përdoren gjithashtu për të zgjeruar ndërgjegjësimin (e drejta e autorit nga Lucerne LSD dhe kurva vegan Vanja Palmers https: // www. zentralplus.ch/mit-lsd- zur-spiritualitaet-717437 /) nga të miturit nën 13 vjeç. Për të mos përmendur semestrat disi më të vjetër.
Për të kursyer nxënësit e shkollave të Lucernit nga agonia mendore, duhet të theksohet se maska nuk duhet të vishet kur thithni dhe nuhasni substanca të ndaluara.
Sepse siç thotë policia e qytetit të Lucernit, "droga i përket vetëm një qyteti". Sidoqoftë, nëse kjo vlen edhe për shkollat jashtë qytetit të Lucernit, ende nuk është sqaruar.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.9.2021 - Tag der regenbogenfarbigen Gebärmutter
Luzerner Regenbogenfamilie: Wie zwei Frauen Kinder kriegen
Bald stimmen wir über die «Ehe für alle» ab. Mit einem Ja würden verheiratete Frauenpaare Zugang zur Samenspende erhalten. Anders als früher, wie das Beispiel der Luzernerin Lisa Bachmann und ihrer damaligen Partnerin zeigt. Vor 21 Jahren wurden sie zum ersten Mal schwanger.
Lisa Bachmann ist keine Unbekannte. Vier Jahrzehnte hat sie an der Kantonsschule Musegg Theater unterrichtet und rund 60 Theaterstücke realisiert (zentralplus berichtete).
Auch als Lesbe ist sie keine Unbekannte in Luzern. 1999 hat sie sich öffentlich in der Sendung des Schweizer Fernsehens «Quer» zum Thema «lesbische Mütter» geäussert. Den Begriff der «Regenbogenfamilie» gab es damals noch nicht. Familien, in denen sich mindestens ein Elternteil als lesbisch, schwul, bisexuell oder trans versteht, existierten aber auch damals schon.
Wir treffen Lisa Bachmann (68) mit ihrer Tochter Malin (18) an einem sonnigen Septembertag im «Mardi Gras» in der Luzerner Kleinstadt. Malin streckt uns ihr Handy entgegen, auf dem Display sehen wir das Bild einer Familie. Einer glücklichen Familie. Mit «Mama Lisa», Mami Maya, ihrem Bruder Lou und ihrem Vater. «Man erkennt auf den ersten Blick, dass er der Vater ist», sagt Lisa Bachmann und lacht.
Von Anfang an war klar: Die Kinder sollen einen Vater haben
Sie wuchs in einer Zeit auf, in der Homosexualität noch völlig tabuisiert war. Als das Comingout der US-Tennisspielerin Martina Navratilova, die sich im Jahr 1981 zu ihrer Liebe zu Frauen bekannte, ein «Riesending» war. Schliesslich war sie die erste weltweit bekannte Sportlerin, die sich outete. «Wir haben damals wahnsinnig gefant», sagt Lisa Bachmann. «Endlich gab es mal jemand zu!»
Lisa Bachmann wünschte sich schon als junge Frau eine Familie. Weil sie sich nicht zu Männern hingezogen fühlte, habe sie diesen Wunsch aber schnell beerdigt. Im Kopf, nicht im Herzen. «Weh tat es trotzdem.» Das änderte sich, als sie ihre damalige Lebenspartnerin kennenlernte und sich verliebte. Denn Maya wünschte sich ein Kind – und zwar mit Lisa.
Ganz so einfach ist das für zwei lesbische Frauen in der Schweiz bekanntlich nicht. Das Paar diskutierte die Möglichkeiten, die ihnen blieben. «Für uns war schnell klar: Wir wollen keine Spiele spielen und uns irgendwo in den Ferien schwängern lassen. Uns war klar: Wir suchen einen Vater für das Kind. Und unser Kind wird seinen Vater kennenlernen.»
Viele Verträge – doch der Vater bleibt den Behörden geheim
Lisas damalige Partnerin – heute leben sie getrennt – kannte einen schwulen Mann, mit dem das Paar sich schliesslich getroffen hat. In einer Beiz beim Bahnhof Zürich. «Diese Szene würde ich heute noch gerne filmen», sagt Lisa Bachmann. Lustig sei es gewesen, wie sie da sassen und zwei Stunden lang über das «Projekt» Familie gesprochen haben. Der Mann – der zukünftige Vater – war nach reiflicher Überlegung damit einverstanden. Er – «leicht buddhistisch angehaucht» – stellte aber eine Bedingung: «Wenn wir wollen, dass die Seele kommt, machen wir das richtig.» Was er damit meinte? Sex haben. «Keine Bechermethode», sagt Tochter Malin und lacht.
Beim dritten Versuch klappte es, Lisas Partnerin wurde schwanger. 2000 kam Sohn Lou zur Welt, 2003 Tochter Malin. «Ich wurde oft gefragt, ob es für mich nicht unerträglich war, dass meine Partnerin mit einem Mann schläft», sagt Lisa Bachmann. «Für mich war von Anfang an klar: Es geht nicht um Sex. Es geht um Elternschaft.»
«Zwecks Feststellung der Partnerschaft» wurde Lisas Partnerin von der Vormundschaftsdirektion eingeladen. Zu dritt mit dem Kind kreuzten die beiden Mütter auf. Mit allen Papieren: Partnerschafts- und Unterhaltsvertrag, Todesfallrisikoversicherung, und so weiter und so fort. So viel sie auf dem Papier auch geregelt haben, der Name des Vaters steht darauf nirgends. «Wir haben mit ihm vereinbart, dass er den Behörden unbekannt bleibt. Er bezahlt keine Beiträge – darf aber als Vater regelmässig Kontakt zu seinem Kind haben.» Dafür brauchte es vor allem eines: gegenseitiges Vertrauen.
Wann hat Tochter Malin erfahren, wie sie und ihr Bruder entstanden sind? «Mega früh. Seit ich das überhaupt verstehen kann», sagt die 18-Jährige. Mit dem Vater, der wieder in Brasilien lebt, pflegt die ganze Familie ein enges und sehr herzliches Verhältnis. «Er wünschte sich immer eine Familie in der Schweiz», sagt Lisa Bachmann. «Und wir geben ihm hier ein bisschen Halt.» Der Vater ist zu Besuch, wenn seine Kinder Geburtstag feiern. Er war hier, als Malin und Lou ihren ersten Tag im Kindergarten oder den ersten Schultag hatten. «Da haben wir doch zusammen einen Schnitzelturm im Centro gegessen», sagt Lisa Bachmann zu ihrer Tochter. Auch davon gibt es noch Fotos.
Die Heirat hätte vieles vereinfacht
Das Paar hatte Glück, auf eine Beamtin zu treffen, die es gut mit ihnen meinte. Eine, die überzeugt davon war, dass vor ihr zwei Mütter stehen, die es gut mit ihrem Kind meinen. Denn eigentlich hatte die Beamtin den Auftrag, den Vater ausfindig zu machen. Sie setzte sich aber dafür ein, dass das Verfahren eingestellt wurde. Lisa Bachmann spricht von «Beamtenwillkür». Was, wenn die Behörden nicht so flexibel gewesen wären? Sie an Beamtinnen geraten wären, die ihnen das Leben schwer gemacht hätten? Wenn ihrer Partnerin etwas zugestossen wäre, was wäre mit den Kindern passiert?
Fragen, die sich bei einem Ja zur «Ehe für alle» nicht gestellt hätten. Der nationale Dachverband Regenbogenfamilien schätzt, dass bis zu 30’000 Kinder in sogenannten Regenbogenfamilien aufwachsen. Mit einem Ja zur «Ehe für alle» öffnet sich die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Auch bei der Familiengründung sollen homosexuelle Paare gleichgestellt werden. Gleichgeschlechtliche Paare würden damit gemeinsam ein Kind adoptieren können, verheiratete Frauenpaare den Zugang zur gesetzlich geregelten Samenspende erhalten.
«Kein gleichgeschlechtliches Paar wird aus dem Blauen heraus einfach so Eltern», sagt Bachmann. Es braucht diese Sorgfalt, die nötig ist, das «Projekt Familie» anzugehen. Dutzende Verträge. «Und darum glaube ich, Regenbogeneltern sind sehr gute Eltern. Sie setzen sich mit ihrer Elternschaft sehr intensiv auseinander, mindestens so sehr wie ‹normale› Eltern.»
Hätten sie damals heiraten können, wäre alles mit einer Unterschrift geregelt gewesen. Gerade vor ein paar Wochen wurde ihr das wieder bewusst. Als Malin nach einem Unfall im Spital landete und Bachmann sich nach dem Zustand ihrer Tochter erkundig wollte. Sie sei gefragt worden, ob sie denn Malins Mutter sei. Bachmann präzisierte: Ja, aber nicht die leibliche. Es gab ein Hin und Her, Malin, die ja volljährig ist, gab längst ihr Okay, bis es wiederum hiess, ob da nicht auch die leibliche Mutter noch was zu sagen hätte. «Ich hätte auf ihre Frage, ob ich Malins Mutter sei, schlicht und einfach mit Ja antworten können», sagt Bachmann. «Ich sage nicht in allen Situationen, dass sie meine Tochter ist. Auch wenn ich das schon immer so empfunden habe.» Auch davon sei sie noch nicht ganz davon gefeit. «Manchmal wollen wir es eben auch überrkorrekt machen», sagt Malin. Schreibt ZentralPlus.
Liebe Luzerner Männer und Männerinnen! Im Gegensatz zu Frauen können Männer definitiv keine Kinder bekommen. Auch wenn es immer wieder versucht wird.
Das ist erwiesen und wird von den Biologie- und Regenbogenexperten*innen nicht bestritten. Auch nicht von den Anthro-PO-sophen aus Dornach.
Laut dem chinesischen Forscher Huan Wong Li von der Universität für genmanipulierte Fledermäuse in Wuhan soll den Männern die Gebärmutter fehlen. Entsprechende Versuche an Fledermäusen, dies mittels Gentransplantation zu ändern, seien bisher erfolglos gewesen, meinte Huan Wong Li.Die Versuche hätten lediglich ein eigenartiges Virus bei den Flattermäusen erzeugt.
Hat sich eigentlich der Luzerner FDP-Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller zum Thema «Ehe für alle» schon geäussert und eine entsprechende Wahlempfehlung abgegeben?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.9.2021 - Tag der diskriminierten Albaner
Nach Festival-Absage: Die albanische Community fühlt sich diskriminiert
Es herrscht grosse Enttäuschung, weil die Zürcher Regierung dem Alba-Festival definitiv die Bewilligung entzogen hat.
Auf dem Festgelände auf dem Hardturm-Areal ist die Stimmung betrübt. Die Bühne und zahlreiche Stände waren schon aufgestellt. Bevor das Fest überhaupt angefangen hat, wird nun alles wieder abgebaut. Denn nur gerade einen Tag vor der Durchführung steht der Entscheid fest: Das Alba-Festival, das dieses Wochenende auf dem Zürcher Hardturm Areal stattgefunden hätte, ist definitiv abgesagt. Die rund 20'000 Besucherinnen und Besucher müssen zuhause bleiben.
Community fühlt sich diskriminiert
Der Medienansturm ist gross, als die Veranstalter über die kurzfristige und vor allem für sie überraschende Absage informieren: «Meine Enttäuschung ist natürlich extrem gross. Ich habe mich enorm auf das Wochenende gefreut. Umso grösser ist jetzt die Ernüchterung», so Veranstalter Adem Morina. Wie gross der finanzielle Schaden ausfällt, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Feststeht: «Der emotionale Schaden ist extrem gross».
Auch bei den Zürcher Politikern Përparim Avdili (FDP) und Reis Luzhnica (SP) stösst der kurzfristige Entzug der Bewilligung auf Unverständnis. Insbesondere, da andere Veranstaltungen an diesem Wochenende stattfinden dürfen – unter anderem die Pride oder das Openair am Greifensee. Die Politiker haben beide albanische Wurzeln und sehen in der Absage des Alba-Festivals eine klare Benachteiligung der Community. «Ich finde das sehr diskriminierend. Die 3G-Regel gilt für sämtliche Festivals und wäre auch hier am Alba-Festival einwandfrei eingehalten worden», sagt Gemeinderat Reis Luzhnica.
Regierungsrat verzichtet auf Interview
Der Zürcher Regierungsrat will sich am Freitag nicht mehr zur Absage des grössten albanischen Festivals Europas äussern. Man verweist auf die Medienmitteilung vom Donnerstag. Darin steht, dass das Contact Tracing sowie ein Blick in die Intensivstationen zeigen würden, dass sich überdurchschnittlich viele Ferienrückkehrer aus dem Balkan mit Covid-19 angesteckt hätten. «Daraus lässt sich schliessen, dass die Impfquote in dieser Bevölkerungsgruppe zu tief ist, um in der derzeitigen epidemiologischen Lage eine solche Grossveranstaltung verantworten zu können», heisst es in der Mitteilung.
Der Regierungsrat wolle mit dem Widerruf der Bewilligung verhindern, dass es am Festival zu einer Verbreitung des Coronavirus und folglich einer zusätzlichen Belastung der Spitäler komme. Die Regierung empfindet es als ihre Fürsorgepflicht, dem Ansteckungsrisiko in dieser Bevölkerungsgruppe entgegenzuwirken und diese zu schützen. Schreibt SRF.
Im Jammern sind unsere Schweizer Mitbürger*innen mit albanischem Migrationshintergrund Weltmeister; knapp 270'000 Personen inklusive Kosovo (200'000), Mazedonien und Montenegro, davon rund 100'000 jünger als 16 Jahre; Stand 2021.
Ihr grenzenloses Selbstmitleid steht aber mehrheitlich diametral zu ihrem gesellschaftlichen Verhalten. Geht es darum, mit einer Überheblichkeit sondergleichen und dämlichem Macho-Gehabe den «starken Mann» (früher nannte man diese Spezies auf Schweizerdeutsch «Blöffer») zu markieren, sind die Shqiptaren (Albaner) ebenfalls Weltklasse.
Bei Drogenkonsum und Drogenhandel, Autoposing, Raserei auf den Strassen, Schlägereien, Prostitution mit dem dazugehörenden Frauenhandel, Tötungsdelikten und etlichen anderen Straftaten führen sie die meisten Statistiken auf den oberen Rängen an.
Statt bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Opfer aufzutreten und die Keule der Diskriminierung zu schwingen, würde es vielen von den in der Schweiz lebenden Menschen vom Balkan nicht schlecht anstehen, ihr renitentes Verhalten gegenüber einer geordneten Gesellschaftsstruktur zu überdenken.
Dass die Zürcher Behörden ein Festival bei den derzeitigen Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus absagen, ist nicht nur das Normalste der Welt, sondern der eklatanten Situation rund um die Rückkehrer aus dem Corona-Hotspot Kosovo geschuldet.
Der Schutz der gesamten Schweizer Bevölkerung vor einem neuerlichen Lockdown steht über den lächerlichen Bedürfnissen einer kleinen Minderheit, die keine gesellschaftliche Verantwortung zu tragen gewillt ist.
Von nichts kommt nichts. Nicht einmal die angebliche Diskriminierung. Und schon gar nicht das verheerende Ranking einer kleinen Minderheit in der Schweiz bezüglich üblen Kriminalstatistiken.
Auch Vorurteile müssen letztendlich erarbeitet werden. Und dafür tut ein gewisser Teil der albanischen Community nicht wenig. Dass da simple Kalauer entstehen wie «Nicht jeder Albaner ist ein Drogenhändler; aber wird ein Drogenhändler verhaftet, ist es in der Regel ein Albaner» ist nur eine logische Konsequenz.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.9.2021 - Tag der geschminkten Gotteskrieger
Sie malen sich einen schwarzen Lidstrich und färben sich die Haare rot: Darum schminken sich die Taliban
Auch die Taliban brauchen einen Spiegel: Viele schminken sich regelmässig und färben sich die Haare. Damit wollen sie dem Propheten Mohammed nacheifern.
Man kennt ihre langen, ungepflegten Bärte, ihre grimmigen Blicke, wenn sie mit den erbeuteten Waffen für Fotos posieren. Aber die Taliban haben auch eine andere Seite: Sie schminken sich!
Auf vielen Fotos ist zu erkennen, dass vor allem junge Islamisten ihre Augen mit Kajal betonen. Kajal ist ein schwarzer Lidstrich, der ober- und vor allem unterhalb der Augen aufgetragen wird. Er lässt die Augen grösser erscheinen.
Kajal ist generell bei den Muslimen verbreitet, die es vor allem während des Ramadans als Zeichen der religiösen Ehrerbietung benutzen. Sie tun dies in erster Linie, weil laut der Sunna schon Prophet Mohammed (ca. 570–632) Kajal aufgetragen haben soll. Er empfahl es auch andern, weil er glaubte, dass es für die Augen und für das Sehen von Vorteil sei.
Haare und Bart gefärbt
Auch gebe es Taliban, die ihre Kopf- und Barthaare mit Henna färben, berichtet die «Bild», die mit einem Reporter in Afghanistan vor Ort ist. Auch damit eifern sie dem Propheten nach, der seine Haare gefärbt haben soll. Henna gibt es in Afghanistan günstig zu kaufen.
Taliban kleiden sich traditionell. Der Salwar Kamiz ist eine Kombination aus Hose und langem Überwurf-Hemd, das an den Seiten für grössere Bewegungsfreiheit eingeschnitten ist. Als Kopfbedeckung wird neben dem Turban häufig eine lokale Version der islamischen Gebetskappe (Takke) getragen. Ausserdem sind bei den Islamisten Flaggen und Wappen des «Islamischen Emirats Afghanistan» auf Stirnbändern, Caps oder als Aufnäher beliebt. Schreibt Blick.
Wer hätte das gedacht? Diese Talibananen! Jeden Tag eine neue Überraschung. Jetzt schminken sie sich auch noch. Von den Augenbrauen bis zum wallenden Bart wird alles mit «Kajal» übertüncht. Botox-Lippen werden wohl die nächste Überraschung der jungen Kalaschnikow-Boys sein, die uns BLICK morgen im Afghanistan-Liveticker mitteilen wird. Mit Aufmacher auf der Startseite.
Da ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis die «Ehe für alle» auch am Hindukusch Einzug hält. Eine entsprechende Sure lässt sich im Koran sicher finden.
Die benachbarte Weltmacht China geht einen etwas anderen Weg als die Gotteskrieger. Laut SRF werden allzu modische, sprich etwas zu weiblich gekleidete und auffällig geschminkte Fernsehmoderatoren entlassen. Vermutlich direkt ins «Camp» zu den Uiguren. Von einer «Ehe für alle» steht scheinbar nichts geschrieben in den Schriften von Konfuzius. Ni hao!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.9.2021 - Tag der «Mitte»-Scharia von Frau Humbel
Forderungen auf dem Prüfstand: Sollen Ungeimpfte ihre Spitalkosten selber tragen?
Kritik an den Ungeimpften: Die Präsidentin der Ethikkommission zu den polarisierenden Forderungen.
Wovor das BAG schon länger warnte, scheint Realität zu werden: Eine «Epidemie der Ungeimpften» zieht durchs Land. In den Spitälern sind derzeit 9 von 10 Covid-Patienten nicht geimpft. Die Kritik an Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und im Krankheitsfall das Gesundheitssystem belasten, wächst – auch vonseiten der Politik.
Andrea Büchler, Präsidentin der Nationalen Ethikkommission (NEK) nimmt Stellung zu drei brisanten Aussagen aus der Politik.
Der Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia wartete vor wenigen Tagen mit einem brisanten Vorschlag auf: Ungeimpfte sollen selbst für die Kosten aufkommen, wenn sie wegen einer Covid-Erkrankung ins Spital eingeliefert werden. «Solche Überlegungen lehnt die Nationale Ethikkommission deutlich ab», sagt Präsidentin Büchler. «Dass die Impfung eine persönliche Entscheidung ist, muss respektiert werden.»
Durch eine Überwälzung der Spitalkosten auf ungeimpfte Patientinnen und Patienten werde diese Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Bei den Corona-Massnahmen gebe es graduelle Unterschiede. Etwa, wenn für den Zugang zu gewissen Bereichen ein Covid-Zertifikat verlangt wird, um die Pandemie einzudämmen. Poggias Vorstoss gehe für die Nationale Ethikkommission aber zu weit.
Weil Covid-Patienten Intensivstationen belasten, verschieben erste Spitäler erneut Operationen. «Mitte»-Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel fordert: Ungeimpfte Covid-Patienten sollen sich hinten anstellen.
Die Präsidentin der Ethikkommission lehnt auch das ab: Aufgrund ihres Impfstatus dürfe man Menschen in den Spitälern nicht anders behandeln.
Denn unser Gesundheitssystem beruhe auf der Idee der Solidarität. «Es wäre höchst problematisch und hätte weitreichende Konsequenzen, wenn wir jetzt von diesem Grundsatz abweichen würden.» Denn, so fragt die Rechtsprofessorin rhetorisch: Sollen künftig auch Risikosportler oder Raucher hinten anstehen, wenn den Spitälern eine Überlastung droht?
Auch die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli macht derzeit Schlagzeilen: «Wer Impfgegner ist, der müsste eigentlich eine Patientenverfügung ausfüllen, worin er bestätigt, dass er im Fall einer Covid-Erkrankung keine Spital- und Intensivbehandlung will», sagte Rickli gegenüber den Tamedia-Zeitungen. «Das wäre echte Eigenverantwortung.»
Hier kommt die Schuldfrage ins Spiel: Wer sich nicht impft, ist selber schuld, wenn er auf der Intensivstation landet. So einfach sei es aber auch hier nicht, sagt NEK-Präsidentin Büchler: «Die Verschuldensfrage suggeriert, dass alles ganz einfach ist.» Hier die Menschen, die sich gegen eine Impfung entscheiden und die Konsequenzen tragen müssen. Dort die anderen, die sich impfen lassen und damit sich selbst und andere schützen.
Doch die Motive, sich (noch) nicht impfen zu lassen, seien sehr vielschichtig und komplex, sagt Büchler. Hier spielten individuelle und vielschichtige Faktoren hinein: «Das kann mit Ängsten, sozialen Bedingungen oder Ressourcen zu tun haben. Hier von Verschulden zu sprechen, erscheint mir eine unzulässige Verkürzung.» Die Motive des Einzelnen zu bewerten, sich nicht impfen zu lassen, und quasi den «Grad des Verschuldens» festzustellen, sei weder möglich noch angezeigt, schliesst Büchler. Schreibt SRF.
Jetzt wird's aber wirklich happig und gruselig! Und einmal mehr fällt eine Aargauer Politikerin auf: Die leicht zerknitterte «Mitte»-Nationalrätin und «Gesundheitspolitikerin» Ruth Humbel wird ihrem Ruf als Vertreterin des radikalen Neoliberalismus einmal mehr gerecht.
Nach den Gesetzen der «Mitte»-Scharia und dem Koran der Schweizer Gesundheitsindustrie fordert die Aargauer Talibanin des Schweizer Gesundheitswesens, "Ungeimpfte Covid-Patienten sollen sich hinten anstellen".
Ob sich die Lobbyistin Ruth Humbel, die über ein Dutzend Mandate im Gesundheitsbereich hat, auch hinten anstellt, wenn's um bezahlte Lobbytätigkeit für ebendiese Industrie geht, darf bezweifelt werden. Ebenso ihre groteske Aussage «Man verdient sich keine goldene Nase mit Mandaten im Gesundheitsbereich», geäussert im Wahlkampf 2019.
Wer wählt eigentlich solche Leute ausser den Angestellten von Krankenkassenversicherungen, Arztpraxen, Spitälern, Altersheimen und älteren Herren, denen jeglicher Sinn für Schönheit fehlt, in den Nationalrat? Asterix hätte auf diese Frage eine kesse Antwort. Aber die lassen wir jetzt mal lieber weg. Will ja nicht auf meine alten Tage noch von geldgierigen Schrumpfhauben* angezeigt werden.
* Um allen Eventualitäten vorzubeugen: Frau Humbel ist damit nicht gemeint. Weder ist sie geldgierig noch eine alternde Schrumpfhaube. Im Gegenteil: Sie ist eine bezaubernde Frau im besten Alter und verdient mit ihren Lobbymandaten keine goldene Nase. Höchstens eine silberne.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
01.9.2021 - Tag der liberalen Talibananen
Exklusiv-Interview mit Taliban-Führer: «Wir wollen Beziehungen zur Schweiz»
Als erstes europäisches Medium hatte SonntagsBlick die Möglichkeit, einen in Afghanistan ansässigen Taliban-Anführer zu interviewen. Abdul Qahar Balkhi erklärt, wie die Miliz mit Frauen und Gegnern umgehen will und wie sich die Taliban die Zukunft vorstellen.
Die Islamisten der Taliban sind wieder an der Macht. Und sie geben sich geläutert. Jahrelang setzten sie die Scharia mit Terror durch – nun beteuern sie plötzlich, freundlich und moderat regieren zu wollen.
Experten zweifeln. Haben sich die militanten Fundamentalisten wirklich geändert? Als erstes europäisches Medium seit der Machtergreifung der Taliban hat SonntagsBlick einen in Afghanistan ansässigen Kadermann der Miliz interviewt.
Abdul Qahar Balkhi meldet sich erst über den Kurznachrichtendienst Twitter bei unserem Reporter, dann über den Messenger-Dienst Whatsapp. Er will Antworten geben auf die brennenden Fragen, die die Welt beschäftigen. Einzige Bedingung: Die Kommunikation läuft schriftlich.
Balkhi gehört zu den ranghöchsten Funktionären der Taliban. Er ist Mitglied der Kulturkommission der Miliz und trat an der Pressekonferenz in Kabul vor knapp zwei Wochen zum ersten Mal in Erscheinung. Beobachter gehen davon aus, dass der Islamist, der fliessend Englisch spricht, eine zentrale Rolle in der künftigen Regierung einnehmen wird.
Blick: Am Flughafen von Kabul drängen sich Tausende Zivilisten. Sie alle wollen fliehen – vor den Taliban, vor Ihnen!
Abdul Qahar Balkhi: Die Menschen fliehen weder aus Angst noch aufgrund von Drohungen, die wir gegen sie ausgesprochen haben. Sie fliehen wegen falscher Hollywood-Versprechen und der wirtschaftlichen Prosperität, die der Westen vermeintlich bietet.
Diese Menschen haben Panik. Viele haben mit westlichen Ländern zusammengearbeitet und befürchten nun die Rache der Taliban.
Wir haben eine Generalamnestie für alle Oppositionellen angekündigt.
Die Leute haben also nichts zu befürchten?
Die Angst vor uns ist unbegründet. Wir garantieren für den Schutz des Lebens dieser Leute. Genauso wie wir für den Schutz ihres Eigentums und ihrer Ehre garantieren.
Das sind doch nichts als leere Versprechen! Ausserhalb Kabuls gab es gemäss Berichten bereits Übergriffe der Taliban. Sogar von Hinrichtungen ist die Rede.
Es hat keine Hinrichtungen oder aussergerichtliche Tötungen gegeben. Wir wollen Frieden und Sicherheit.
Und die Scharia, das islamische Rechtssystem: Werden bald wieder Menschen gesteinigt und Hände abgehackt?
Die Scharia beschränkt sich nicht nur auf Strafen, so wie es westliche Medien oft darstellen. Die Scharia ist eine ganzheitliche Lebensweise, die sehr vieles regelt und Frieden und Wohlstand bringen soll.
Und die Strafen?
Auch die sind Teil des islamischen Rechts, beschränken sich aber auf die extremsten Fälle von Kriminalität. Auch im Westen gibt es schliesslich die Todesstrafe zur Abschreckung vor schweren Verbrechen.
Augenzeugen vor Ort berichten, dass die Taliban mit Listen von Haus zu Haus gehen. Sie suchen Personen, die mit westlichen Staaten zusammengearbeitet haben.
Es gibt weder solche Listen, noch geht jemand von Haus zu Haus, um nach Menschen zu suchen. Diese Berichte sind Unsinn. Sie sind erfunden.
Informationen aus Afghanistan zeigen, dass die Antworten von Abdul Qahar Balkhi beschönigend und propagandistisch sind. Die Deutsche Welle berichtete vor einer Woche, dass ein Familienangehöriger eines Journalisten des Senders von Taliban erschossen wurde. Demnach gehen die Taliban im Westen des Landes von Haus zu Haus und suchen gezielt nach Reportern. Den Vereinten Nationen liegen zudem glaubhafte Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen der Taliban in Afghanistan vor. Die zuständige Uno-Hochkommissarin Michelle Bachelet sprach in Genf von willkürlichen Hinrichtungen von ehemaligen Angehörigen der Sicherheitskräfte des Landes.
Nochmal: Die Menschen fürchten sich vor Ihnen. Nicht nur Oppositionelle, auch Frauen.
Dazu gibt es keinen Grund. Wir haben bereits betont, dass die Rechte der Frauen im Rahmen des islamischen Rechts geschützt werden.
Dürfen die Frauen unter den Taliban arbeiten und zur Schule gehen?
Ja, auch das Recht auf Arbeit und Bildung gehört dazu – sofern sie in angemessener islamischer Kleidung arbeiten.
Frauen müssen also wieder Burka tragen?
Alle Frauen, die sich zum Islam bekennen, sind verpflichtet, ihren Körper zu bedecken. Sei dies mit einer Burka, einem Hidschab, einem Nikab oder sonst einem Kleidungsstück.
Wie geht es nun weiter?
Als Nächstes wollen wir eine Regierung verkünden, die alle Menschen dieses stolzen Landes widerspiegelt. Unser Ziel ist, unserem Heimatland, das in den letzten vier Jahrzehnten durch Kriege verwüstet wurde, Wohlstand zu bringen. Und wir wollen mit der Welt zusammenarbeiten.
Sie streben diplomatische Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft an?
Wir wollen wirtschaftliche und persönliche Beziehungen. Wir fordern die Länder der Welt auf – einschliesslich die Schweiz –, das Selbstbestimmungsrecht des afghanischen Volkes anzuerkennen und gute diplomatische, wirtschaftliche sowie zwischenmenschliche Beziehungen zu Afghanistan zu pflegen.
Hoffen Sie auch auf internationale Investitionen und auf humanitäre Hilfe?
Wir begrüssen jede humanitäre und entwicklungsorientierte Hilfe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist.
Eine Bedingung wird sein, dass die Taliban nicht wie in den Neunzigerjahren mit Terrororganisationen wie Al Kaida zusammenarbeiten. Damals haben sie Osama bin Laden und seinen Mitstreitern Unterschlupf in Afghanistan gewährt.
Wir haben bereits deutlich gemacht, dass wir weder Gruppen noch Einzelpersonen erlauben werden, den Boden Afghanistans zu nutzen, um die Sicherheit anderer Nationen zu bedrohen.
Die Terroristen sind bereits in ihrem Land. Am Donnerstag sprengte sich am Flughafen in Kabul ein IS-Attentäter in die Luft. Mindestens 170 Menschen starben.
Wir verurteilen den Angriff und sehen alle vorsätzlichen Angriffe gegen unschuldige Zivilisten als Terrorismus und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Offenbar haben Sie die Lage nicht im Griff.
Die Attacke geschah in einem Gebiet, das unter der Kontrolle der US-Armee steht. Die hat es versäumt, die Sicherheit zu gewährleisten. Das ist deren Schuld, nicht unsere.
Der IS-Anschlag richtete sich unter anderem gegen die US-Soldaten in Kabul. Diese wollen bis am Dienstag abziehen. Was, wenn sie darüber hinaus bleiben, um Menschen zu evakuieren?
Über den 31. August hinaus dürfen sich keine ausländischen Truppen in Afghanistan aufhalten. Sie müssen Kabul verlassen. Das ist unsere rote Linie. Bleiben sie, werden wir unsere Strategie ändern müssen.
Und was passiert mit all den Menschen, die ausreisen wollen, es bis dann aber nicht geschafft haben?
Wir hoffen, dass wir den Flughafen betriebsbereit halten können. Wir wollen allen mit ordnungsgemässen Dokumenten das Reisen ermöglichen.
Ein smartes Interview von Fabian Eberhard. Gratuliere!
Der Aussage des ebenso smarten Talibans "Auch im Westen gibt es schliesslich die Todesstrafe zur Abschreckung vor schweren Verbrechen" kann man schwerlich widersprechen. Selbst der Hegemon und Anführer der hehren westlichen Wertegemeinschaft, called USA, praktiziert die Todesstrafe.
Auch Abdul Qahar Balkhis Einwand "Sie (Anm. die Afghanen) fliehen wegen falscher Hollywood-Versprechen und der wirtschaftlichen Prosperität, die der Westen vermeintlich bietet" birgt nebst rhetorischer Schlagfertigkeit sehr viel Wahrheit in sich.
Eines ist definitiv gewiss: Die Taliban haben in den 20 Jahren Krieg gelernt, wie der Westen tickt und gleich auch noch seine Kommunikation inklusive allen rhetorischen Tricks übernommen. With a little Help from Saudi Arabien und den Golf-Staaten. Koranschule Pakistan war einmal. Jedenfalls für die Leader.
Was letztendlich von den zuckersüssen Versprechungen der "smarten Gotteskrieger" in ihren feschen Outfits und den modisch gepflegten Bärten zu halten ist, wird die Zukunft zeigen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
31.8.2021 - Tag der politischen Versager
Viel Arbeit für die Luzerner Polizei: betrunkener Rollerfahrer, Raubüberfall, Passanten von Algeriern mit abgebrochenem Flaschenhals und Messer bedroht und Ladendiebstahl
Die Luzerner Polizei hatte über das Wochenende viel Arbeit. Diverse Personen waren massiv alkoholisiert und standen unter Drogeneinfluss. Die Polizei hat allein in der Stadt Luzern mehrere Personen festgenommen, welche Passanten bedroht, überfallen und ausgeraubt haben. Die Untersuchungen führen die Jugendanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft Luzern.
Bewaffneter Ladendieb aus Algerien festgenommen
Am Samstagnachmittag (28. August 2021) hat ein bewaffneter Mann in Ebikon aus einem Geschäft an der Luzernerstrasse Waren im Wert von mehreren hundert Franken entwendet. Der Dieb konnte von der Luzerner Polizei festgenommen werden. Er wehrte sich massiv gegen die Festnahme. Der Mann ist 38 Jahre alt und stammt aus Algerien.
Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und wird gestoppt
Am Samstagabend (28. August 2021) hat die Luzerner Polizei kurz vor 23.00 Uhr einen 17-jährigen Rollerfahrer beim Tribschenmoosweg in der Stadt Luzern angehalten und festgenommen. Der Jugendliche war zuvor vor der Polizei geflüchtet, als diese ihn an der Werftestrasse kontrollieren wollte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0.73mg/l (1.46 Promille). Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis. Die Polizei hat dem 17-jährigen Schweizer den Führerausweis abgenommen und für weitere Massnahmen an das Strassenverkehrsamt weitergeleitet. Am frühen Sonntagmorgen musste die Polizei erneut wegen dem Jugendlichen ausrücken. An der Frankenstrasse provozierte und belästigte er andere Personen.
Algerier bedroht Passanten mit abgebrochenem Flaschenhals und wird festgenommen
Am frühen Sonntagmorgen (29. August 2021, ca. 02.30 Uhr) hat die Polizei am Bahnhof zusammen mit der Securitrans einen 30-jährigen Mann aus Algerien festgenommen. Der Mann hatte zuvor diverse Passanten mit einem abgebrochenen Flaschenhals bedroht. Verletzt wurde niemand. Der Algerier wehrte sich massiv gegen die Festnahme und bedrohte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0.83mg/l (1.66 Promille).
40-jähriger Algerier bedroht und beraubt Ehepaar am Bahnhof mit Messer
Am Sonntagabend (29. August 2021) wurde am Bahnhof Luzern ein 40-jähriger Algerier festgenommen. Im Einsatz stand auch ein Diensthund der Luzerner Polizei. Der Mann hat kurz vor Mitternacht ein Ehepaar mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Verletzt wurde niemand. Das Messer konnte in seinem Rucksack sichergestellt werden. Ein Atemlufttest ergab bei ihm einen Wert von 0.6mg/l (1.2 Promille). Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Opfer erlitten einen Schock und wurden betreut.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer gestrigen Medienmitteilung.
Die Luzerner Polizei hatte über das Wochenende viel Arbeit:
• Bewaffneter Ladendieb aus Algerien festgenommen
• Algerier bedroht Passanten mit abgebrochenem Flaschenhals und wird festgenommen
• 40-jähriger Algerier bedroht und beraubt Ehepaar am Bahnhof mit Messer
• 17-jähriger Schweizer Rollerfahrer, alkoholisiert und unter Canabis-Einfluss, flüchtet vor Polizei und wird gestoppt
Fällt Ihnen etwas auf? Drei Algerier verursachen der Luzerner Polizei viel Arbeit. Gegen die doch ziemlich dreisten Delikte der drei Wüstensöhne aus Algerien ist die Flucht des 17-jährigen, von Drogen im Doppelpack (Alkohol und Cannabis)zugedröhnten Schweizers fast schon Kleinmist. Gehören doch Drogen zu einer Stadt, wie die Luzerner Polizei ab und zu resignierend besorgten Bürgerinnen und Bürgern am Telefon erklärt, die einen Drogendealer melden wollen, der in ihrem Vorgarten gerade päckchenweise Kokain und Cristal Meth an minderjährige Kids zwischen 13 und 15 Jahren verkauft.
Dass die Stadt Luzern inzwischen Drogenhotspot Nummer Zwei der Schweiz ist, erstaunt niemanden mehr und wird von der Bevölkerung nonchalant zur Kenntnis genommen. «Ist halt so. Drogen gehören zu einer Stadt...» Dass auch der «Oscar» für die widerwärtigsten Abfallhalden aller Schweizer Städte an die Stadt Luzern gehen wird, gehört gemäss dieser «laissez faire-Haltung» ebenso zu einer so weltoffenen Stadt wie Luzern. «Ist halt so. Müllhalden im öffentlichen Bereich gehören zu einer Stadt...»
Dass sich nun aber die Peripherie rund um den Luzerner Bahnhof selbst an geheiligten Wochenenden je länger je mehr zur kriminellen «No go-Area» entwickelt, hat schon eine beängstigende Qualität. Solche Zustände, wie man sie aus Frankreichs Banlieu-Quartieren mit der riesigen Community aus Algerien kennt, dürften auch die bürgerlichsten aller wohlhabenden Stadtluzern*innen schockieren. Damit geht ein weiteres Stück Lebensqualität in der Stadt Luzern flöten und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese mit Messern ausgerüsteten arabischen Kriminellen auch in die vornehmeren Quartiere Luzerns vorstossen, wo es wesentlich mehr zu holen gibt als am Bahnhof.
Das Stadtluzerner Drogenranking und der Müllhalden-Oscar sind eindeutig dem Versagen der Luzerner Stadtregierung geschuldet. Wofür die ehrwürdigen Damen und Herren mit der Spreizwürde der Etablierten und einem Jahreseinkommen von mehr als 250'000 Franken an den nächsten Stadtratswahlen definitiv abgestraft werden sollten. Ein «Abwahl-Komitee» gründen! Könnte sich lohnen.
Die algerischen Messerstecher hingegen gehen auf das Konto des Bundes. 547 kriminelle Algerier, die meisten von ihnen Wiederholungstäter, warten seit zwei und mehr Jahren auf die Ausschaffung. Doch ausgeschafft wurde bis zum heutigen Tag kein einziger von ihnen. Im Gegenteil: Monat für Monat kommen zwischen 200 bis 300 neue «Flüchtlinge» aus Algerien zur Schweizer Flüchtlingsstatistik hinzu, obschon in Algerien meines Wissens derzeit kein Krieg stattfindet.
Dabei rühmte sich doch FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, nach ihrem Besuch im Frühjahr 2021 in Algerien, die Probleme um die Rücknahme straffälliger Asylanten aus Algerien gelöst zu haben. Hatte unsere Bundesrätin zu wenig «Schmiermittel» in ihrem Reisekoffer dabei oder lehnt Algerien die Rücknahme ihrer eigenen Staatsbürger aus nachvollziehbaren Gründen ab? Wohlwissend, dass es sich bei diesen Menschen um Kriminelle handelt?
Dass bei diesem Versagen des Bundes diejenigen Flüchtlinge leiden, die es verdient haben, in der Schweiz aufgenommen und nicht unter Generalverdacht gestellt zu werden, ist eine andere Geschichte. Die Politik wäre aber gut beraten, alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, damit die Stimmung im Volk nicht kippt. Denn darauf warten unsere Populisten nur.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.8.2021 - Tag des Zuger SVP-Nationalrats Thomas Aeschi
Dutzende Corona-Patienten heimgeholt: Rega im Dauereinsatz in den Kosovo
Schweizer Spitäler klagen über die vielen Corona-Hospitalisierungen. Zusätzlich belastet wird die Situation durch Rückholaktionen von schwer erkrankten Doppelbürgern im Ausland – insbesondere im Kosovo.
Seit dem Ende der Sommerferien spitzt sich die Lage in den Schweizer Spitälern bedrohlich zu. So muss etwa der Thurgau Schwerkranke in andere Kantone verlegen, weil die eigenen Intensivstationen aus allen Nähten.
Da es schweizweit an fachkundigem Personal fehlt, sind die Kapazitäten auf den Intensivstationen beschränkt. Aber: «Ein Hauptproblem sind für uns auch die Rückholflüge aus dem Ausland. Viele Patienten wurden schon und sollen noch eingeflogen werden», sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin (42) zu Blick. Dies verschärfe die Situation in den Spitälern zusätzlich.
Rega flog allein im August 21 Mal nach Pristina
Insbesondere auf dem Balkan erkrankten während der Sommerferien viele Menschen mit Wohnsitz in der Schweiz so schwer an Corona, dass eine selbständige Rückkehr bis heute unmöglich ist. Ambulanz-Jets stehen seither im Dauereinsatz, um die hierzulande versicherten Schwerkranken heimzufliegen.
Auf Anfrage will die Rega «aus Gründen des Patientenschutzes» keine Angaben zu ihren Rückholflügen machen. Blick konnte aber über das Tracking-Portal Flightradar24 die Flugaktivitäten der drei Rega-Ambulanz-Jets inoffiziell auswerten.
Das Resultat: Allein seit Monatsbeginn wurde die kosovarische Hauptstadt Pristina von der Rega 21 Mal angeflogen. Mit grossem Abstand folgen in der Spitaljet-Rangliste Skopje (Nordmazedonien, 9 Anflüge) sowie Belgrad (Serbien) und die beiden italienischen Städte Neapel und Brindisi mit jeweils vier Landungen.
Viele Rückholpatienten harren weiterhin im Kosovo aus
Die Rega-Auswertung deckt sich mit den Zahlen der Medicall AG. Sie organisiert im Auftrag von Schweizer Krankenkassen Rückholaktionen rund um den Erdball. In den Monaten Juli und August hat das Unternehmen insgesamt 55 Repatriierungen von Corona-Patienten durchgeführt.
18 Rückholaktionen mit Fliegern, Helis und Ambulanzen entfielen dabei auf den Kosovo und Nordmazedonien. Damit ist die Region bei Medicall trauriger Spitzenreiter.
Beunruhigend auch: Allein bei Medicall stehen weltweit derzeit noch 36 Corona-Rücktransporte auf der Warteliste. 20 der Patienten, also mehr als die Hälfte, liegen in Spitälern im Kosovo und in Nordmazedonien!
«Wir decken die Hälfte aller Krankenversicherten in der Schweiz ab. Dann gibt es noch weitere Patienten, die sich direkt bei der Rega melden. Sie können unsere Zahlen also um etwa den Faktor 2,5 hochrechnen», erklärt Martin Huser, Geschäftsführer von Medicall. Erfahrungsgemäss kämen etwa drei Viertel aller zurückzuholenden Corona-Patienten auf die Intensivstation.
Doppelbürger warten in Kosovo-Spitälern auf Hilfe
Wie die Lage vor Ort aussieht, ist schwierig abzuschätzen. Der gesamtkosovarische Spitaldirektor Valbon Krasniqi (49) bestätigt gegenüber Blick lediglich, dass derzeit Doppelbürger hospitalisiert seien. Wie viele es sind und ob es sich um Intensivpatienten handle, wisse er mangels Daten nicht.
Dass gerade der Kosovo als Hotspot heraussticht, kommt nicht überraschend. Die grosse Schweizer Diaspora nutzte den Sommer eifrig für Besuche in der Heimat. Zumeist in randvollen Fliegern und vollgepackten Bussen.
Der Kosovo kam auch als Balkan-Ballermann in die Schlagzeilen, weil dort besonders exzessiv und hemmungslos gefeiert wurde. Denn die Regierung hatte vor den Sommerferien praktisch sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben. Auch gefälschte PCR-Tests sollen im Umlauf sein.
Kosovo wird von Corona-Welle überrollt
Die Konsequenz: Wegen der grassierenden Delta-Variante explodierten insbesondere im August die Infektionszahlen. Das Hauptproblem ist aber, dass nur etwas mehr als elf Prozent aller Kosovaren doppelt gegen das Virus geimpft wurden. Auch in der Schweiz haben sich überdurchschnittlich viele Menschen aus dem Balkan nicht impfen lassen.
Bei 40 Prozent der hierzulande hospitalisierten Corona-Patienten konnte der Ansteckungsort klar bestimmt werden. Davon hatten ihrerseits 80 Prozent ihre Ferien in Südeuropa verbracht, wie Corona-Taskforce-Vize Urs Karrer vergangene Woche mitteilte. Schreibt Blick.
Für all diejenigen, die reflexartig die «Rassismuskeule» schwingen, sofern es jemand wagt, die regelmässig auffallenden, renitenten Mitglieder bestimmter Bevölkerungsgruppen vom Balkan, vor allem aus dem Kosovo und Albanien, zu kritisieren, sei hier ein Ausschnitt aus der Medienmitteilung des Kantons Aargau vom 30.8.2021 empfohlen:
«Weiter regt der Aargauer Regierungsrat verstärkte Präventionsbemühungen für bestimmte fremdsprachige Bevölkerungsgruppen an, wie zum Beispiel Menschen aus dem Balkan.»
Der Aargauer Regierungsrat wird ja wohl berechtigte Gründe haben, diese «bestimmte fremdsprachige Bevölkerungsgruppe» beim Namen zu nennen. Passende Medienartikel dazu gibt es derzeit en Masse:
Sündenbock-Diskussion um Reiserückkehrer: Luzerner Kosovaren fordern einfacheren Impfzugang
Die gebürtige Kosovarin und Luzerner Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj von der SP und der aus dem Kosovo stammende Luzerner «Rapper» Marash Pulaj sehen sich als Opfer; eine massgeschneiderte Rolle, die beide perfekt beherrschen.
Dutzende Schweizer warten auf Rettung aus Covid-Hölle Balkan
Da fällt einem unwillkürlich der Sommerausflug des Zuger SVP-Nationalrats Thomas Aeschi querbeet durch den ganzen Balkan (inklusive Kosovo und Albanien) ein, den der Politiker, um den es in letzter Zeit etwas still geworden ist, auf seiner Facebook-Seite in voller Länge in Wort und Bild online stellte. Eine Lobhudelei über die Balkanstaaten, wie man sie wirklich nur selten findet. Aeschi wurde nicht müde zu betonen, wie sicher der Balkan auch ohne Massnahmen gegen das Corona-Virus sei.
Ironie der Balkanreise des Zuger Politikers: Der gleiche Aeschi teilt nun fleissig Medienartikel über das Drama der Corona-Patienten von den Karpaten auf seiner FB-Seite. Das bringt wirklich nur ein Politiker fertig, der sich um sein Geschwätz von gestern wirklich keinen Deut kümmert. Und der war sogar tatsächlich mal Bundesratskandidat. Ach du meine Güte!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.8.2021 - Tag des Orakels von Delphi
Olaf Scholz vor der Bundestagswahl: Der kichernde Dritte
Olaf Scholz ist beliebter als Laschet und Baerbock. Profitiert er nur von deren Fehlern? Oder spricht doch mehr für die SPD, als viele dachten?
Olaf Scholz trägt eine gelbe Warnweste über dem blauen Anzug. Helm und Schutzbrille hat er wieder abgenommen und schaut auf Stelltafeln, die zeigen, wie Zement produziert wird. Ein beseelter Ingenieur der Cemex AG versucht, den komplexen Prozess in Schaubildern zu erklären. Es ist einer von zweihundert Wahlkampfauftritten, die der Mann, der Kanzler werden will, absolviert. „Das ist ein ganz, ganz wichtiger Termin“, sagt er. Das stimmt sogar.
Die Produktion von Zement sorgt global für acht Prozent der CO2-Emissionen, mehr als doppelt so viel wie der weltweite Flugverkehr. Ohne Zement kein Beton. Ohne CO2-freien Beton keine Klimawende. Das passt zu Scholz’ Botschaft: Die Rettung des Klimas brauche „keinen Verzicht“, sagt er, sondern Modernisierung. Bessere Industrie, nicht weniger. Das Zementwerk in Rüdersdorf im Osten Berlins ist dafür ein guter Ort, hier kann Scholz Klimaschutz mit Bauarbeiterlook verbinden.
Auch chemische Formeln spielen bei dem Ingenieursvortrag eine Rolle. Die mitgereiste Hauptstadtpresse gibt sich Mühe, geduldig zu folgen. Scholz, ironisch: „Das haben Sie sich jetzt bestimmt alle gemerkt.“
Das Besondere bei der Zementproduktion ist: Mehr als zwei Drittel der Emissionen sind auch mit Ökoenergie unvermeidbar. Sie entstehen bei der Zerkleinerung von Kalkstein. Rüdersdorf soll 2030 das erste Werk der Welt sein, das Zement ohne CO2-Emission herstellt. Das freiwerdende CO2 soll per Wasserstoffpipeline und Elektrolyse zu Flugzeugkraftstoffen synthetisiert werden. Der Umbau wird ein gigantisches Hightech-Projekt. „Die Bevölkerung muss sich daran gewöhnen, dass auf den Feldern statt Raps Solaranlagen stehen. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Politik“, sagt die Unternehmenssprecherin forsch. Und: „Wir erwarten von Olaf Scholz die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren.“
Scholz fusioniert die klassische Nähe der SPD-Rechten zu Managern und Firmenchefs mit der Macherattitüde in Sachen Klima. So will er gesehen werden. Dass die „chemische Industrie 2050 so viel Strom verbrauchen wird wie heute ganz Deutschland“ gehört zu seinen Standardsätzen. Dafür müssen Windfelder erschlossen, Stromtrassen gebaut und Solartechnik gefördert werden. Um das Historische der Herausforderung zu illustrieren, verweist Scholz gern auf das Ende des 19. Jahrhunderts, als Staat und Unternehmen gemeinsam die industrielle Infrastruktur schufen. Wir brauchen „eine Revolution in den Genehmigungsverfahren“ sagt Scholz. Er brüllt diesen Satz fast ins Mikro.
Wie diese Revolution konkret aussehen soll, bleibt offen. Ebenso, warum die SPD, die seit 1998 mit einer Unterbrechung von vier Jahren regiert, diese Revolution erst jetzt so dringlich findet. Die Botschaft der Partei ist: Das Großprojekt klimaneutraler Umbau kann nur einer managen – Olaf Scholz.
Voluminöse Staatsinvestitionen sind, glaubt man Scholz, für den kompletten Umbau der deutschen Industrie nicht nötig. Es gebe genug privates Kapital, das deutsche Infrastruktur für ein sicheres Investment hält. Cemex ist für diese These indes kein brauchbares Beispiel. Für den Umbau in Rüdersdorf mit Ökoenergie und Wasserstoffpipeline kalkuliert der Konzern mit knapp 200 Millionen Euro Fördergeldern.
Die SPD galt in Sachen Bundestagswahl lange als chancenlos. Noch Mitte Juli wollten laut Umfragen nur 15 Prozent der Deutschen SPD wählen – und fast doppelt so viele die Union. Jetzt liegen SPD und Union gleichauf. Und Olaf Scholz ist weit populärer als Armin Laschet und Annalena Baerbock. Alles ist möglich. Sogar das Kanzleramt.
Er wirkt verkrampft
Der Rundgang über das Zementwerk führt zu einer Halle, groß wie drei Kathedralen, in der lärmend Kalksteinschotter über ein Förderband transportiert wird. Ingenieur Stefan Schmorleiz hebt einen faustgroßen Schotterstein auf und sagt mit kräftiger Stimme: „Der besteht zu 44 Prozent aus CO2.“ Scholz, mit Helm und Weste, nickt verständig. Dann drückt Schmorleiz dem Kanzlerkandidaten den Kalksteinschotter in die Hand. Die Fotografen gehen in Position. Endlich ein sinnliches Motiv. Der Mann, der vielleicht bald Kanzler sein wird, vor recht eindrucksvoller Industriekulisse. Scholz lächelt. Und weiß nicht so recht, was er mit dem Schotterstein anfangen soll. Er dreht sich um und lässt ihn in der Halle fallen. Er wirkt verkrampft.
Das Lässige, den nebenher eingestreuten Scherz, der die Stimmung auflockert, hat Scholz selten im Repertoire. Auch das Joviale oder Onkelhafte sind nicht seins. Scholz ist spröde – keiner, der im Wahlkampf mit allen ins Plaudern kommt. Er wartet eher ab, was auf ihn zukommt. Später, auf dem Oberdeck eines Schiffs auf der Havel, winken Ruderer. Scholz erwidert den Gruß. Von sich aus würde er so etwas eher nicht machen.
Es gibt selten Anlässe, ihn sympathisch zu finden. Aber auch Joe Biden, wie Scholz seit langem im politischen Geschäft, ist nicht US-Präsident geworden, weil er so ein schillernder Charakter ist.
Wenige kennen Scholz so gut wie Wolfgang Schmidt, 50, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und seit 20 Jahren Scholz’ enger Berater. Schmidt ist locker, offen, diskussionsfreudig und immer der Meinung, dass sein Chef alles richtig macht. Und am Ende siegen wird.
Das Horrorszenario ist abgewendet
Mit Kritikern wie Fabio De Masi von der Linkspartei, der Scholz wegen seiner erstaunlichen Erinnerungslücken in der Cum-Ex-Warburg-Bank-Affäre angriff, lieferte sich Schmidt Twitter-Duelle. Krise der SPD? Wirecard? Monatelang desolate Umfragen, die Scholz’ Bekundungen, dass er Kanzler wird, zusehends trotzig wirken ließen? All das zählt für Schmidt nicht. „Scholz ist schon oft niedergeschrieben und politisch für tot erklärt worden. Er hat alles überstanden“, sagt er Mitte August in seinem Zimmer im Finanzministerium, dem unwirtlich wirkenden NS-Bau in der Berliner Wilhelmstraße.
„Wir waren immer grundentspannt“, sagt Schmidt. Er sei von Anfang an überzeugt gewesen, dass die Frage, wer Merkel nachfolgen soll, bei den meisten erst im August auf dem Radar auftauchen würde. Dass dann der Moment komme. „Wir haben immer gesagt, dass die SPD im August auf Augenhöhe mit den Grünen liegen wird. Und wurden dafür ausgelacht. Viele haben gedacht: Lass die mal reden.“
Das Horrorszenario für die SPD – Schwarz kämpft gegen Grün und keiner redet von Scholz – scheint vier Wochen vor der Wahl abgewendet. Vor dem Duell mit Laschet muss der SPD nicht bange sein. „Bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Union um Mindestlohn, Renten und Abschaffung des Soli für Reiche haben wir 80 Prozent der WählerInnen auf unserer Seite“, sagt Schmidt.
Er lag mit seinem Optimismus richtig. Auch wenn das nicht nur mit dem alles überstrahlenden Genie von Scholz zu tun hat. Denn die SPD hat fast unverschämtes Glück. Der gepimpte Lebenslauf von Annalena Baerbock hat vor allem ältere WählerInnen nachhaltig abgeschreckt. Armin Laschets Performance ist bislang eine Serie von Pannen. Scholz, berüchtigt für sein Kichern über eigene Witze, ist der kichernde Dritte.
Lieber Zahnschmerzen als Rot-Grün-Rot
Die SPD liegt laut Umfragen gleichauf mit der Union. Manches spricht dafür, dass dieser Trend stabil ist. Anders als 2017, als die SPD zuletzt vor der Union lag. Der Schulz-Hype verflog damals schnell. Nico Siegel, Chef des Umfrageinstituts infratest dimap, sieht zwischen Scholz 2021 und Schulz 2017 vor allem Unterschiede. Das Schulz-Hoch „war acht Monate vor der Wahl. Jetzt sind es noch vier Wochen. Und Scholz hat ein eindeutigeres Profil.“ Mit Schulz, dem Unbekannten, verbanden sich diffuse Hoffnungen. Scholz kennen alle, und große Hoffnungen, die enttäuscht werden könnten, hat sowieso keiner.
Diese Wahl wird nicht gegen die Älteren gewonnen. Knapp 22 Prozent der WählerInnen sind über 65, so viele wie noch nie. Für die Union war diese Gruppe, die verlässlicher als Junge zur Wahl geht, immer eine politische Lebensversicherung. Doch gerade Ältere wenden sich jetzt von der Union ab.
Deren Anti-links-Kampagne, die darauf zielt, Ältere zu verunsichern und laut Siegel „Wechselwähler in dieser Gruppe davon abzuhalten, ihr Kreuz bei der SPD zu machen“, wirkt hyperventiliert. Auch deshalb sind die Zahlen für Scholz (30 Prozent wollen ihn als Kanzler, nur 11 Prozent wollen Laschet) so gut.
Der Kanzlerkandidat macht weiter das, was er schon seit Monaten tut. Er gibt stoisch Sätze von sich, die sich kaum jemand merken kann. Rot-Grün-Rot schließt er formal nicht aus. Möglichkeiten zu streichen, auch unwahrscheinliche, wäre unklug für die Pokerrunden nach der Wahl. Aber man kann an seiner Minimalmimik ablesen, dass er lieber Zahnschmerzen hätte als eine Mitte-links-Regierung zu führen. In einem Bild-TV-Interview ließ er sich zu der Formulierung hinreißen, Deutschland könne nur regieren, wer die Nato „aus vollem Herzen“ bejahe. Offenbar würde ihm sogar ein Ja der Linkspartei zur Nato nicht reichen.
Scholz versucht den Angela-Merkel-Ähnlichkeitswettbewerb zu gewinnen. Er ist der Pragmatiker, der die Details kennt. Er fräst sich durch Akten – und regelt am Ende alles irgendwie. Er ist vorsichtig und kontrolliert. Er weiß fast alles. Aber, anders als Merkel, auch alles besser.
Kommt der Basta-Scholz zurück?
Scholz hat schon immer kundgetan, dass, wer bei ihm Führung bestellt, auch Führung bekommt. Kritik ließ er oft an sich abperlen. Den Spitznamen Scholzomat verdiente er sich, als er jede Kritik an der Agenda-Politik kleinredete. Beim G20-Desaster 2017, als er als Hamburger Bürgermeister die Gewalteskalation unterschätzte, war er beratungsresistent.
Mit Macht ist bei Scholz nicht wie bei Merkel Macht durch Moderation gemeint. Sondern die zackige Ansage von oben. Da ist Scholz ein Sozialdemokrat alten Schlages. Als der Parteilinke Kevin Kühnert und die Parteispitze Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken ihm aus eigenem Antrieb die Kanzlerkandidatur antrugen, war dies ihr größter Vorbehalt. Hält der Frieden mit Scholz auch, wenn die SPD Erfolg hat? Oder kommt dann der Basta-Scholz wieder zu Vorschein?
„Vielleicht haben ihn das G20-Debakel und die Niederlage bei der Wahl zum Parteichef wirklich etwas demütiger gemacht“, sagt Gesine Schwan, 78, die große Dame der Sozialdemokratie und eine der wenigen kreativen Intellektuellen in der Partei. Auf der Plusliste sieht sie, dass Scholz sich „von kompetenten, eher linken Ökonomen wie Sebastian Dullien und Gustav Horn beraten lässt und ein Ethos intellektueller Redlichkeit“ hat. Scholz liest viel. Zuletzt hat ihn der US-Philosoph und Gerechtigkeitstheoretiker Michael Sandel beeindruckt, der das Übermaß an Ungleichheit und die Arroganz der akademischen Eliten kritisiert. Viele rühmen die Auffassungsgabe und Intelligenz von Olaf Scholz.
Schwan, die ihn seit fast 20 Jahren kennt, zweifelt aber, ob der Erfolg dem selbstbewussten Hamburger nicht allzu schnell zu Kopf steigen wird. „Er setzt zu viel auf Disziplin und Kader“, sagt sie. „Und er hat Angst vor Debatten, die er nicht kontrollieren kann.“ Im Erfolg lauert die Hybris. „Wenn Scholz sogar die Union besiegt, ist die Gefahr da, dass er sagt: Ich hatte Recht, ihr folgt mir jetzt.“ Für Schwan ist das eine Schreckensvorstellung. „Eine SPD, die nicht öffentlich diskutiert, ist keine Sozialdemokratie.“
Die SPD wirkt mit sich selbst versöhnt
Eine Frage lautet nun: Profitiert die SPD nur von den Desastern der Konkurrenz – oder wird erst jetzt ihre verborgene Stärke sichtbar? Schwan, Chefin der SPD-Grundwertekommission, glaubt, dass beides der Fall ist. Die Leitmedien hätten die SPD vorschnell abgeschrieben und dabei übersehen, dass die Partei ihren „Mangel an geistiger Lebendigkeit und die Kapitulation vor dem Neoliberalismus“ überwunden hat.
Da ist etwas dran. Die SPD war in Merkels Schatten unterbewertet. Und sie wirkt derzeit mit sich selbst versöhnt. Nur deshalb kann sie von der Schwäche der anderen profitieren. Der Konsens hat viele Gründe.
In einem zähen Prozess hat die Partei nach 20 Jahren den Zoff um die Agenda-Politik überwunden: weniger Sanktionen bei Hartz IV, Grundrente für Geringverdiener und mehr Geld für Kinder in armen Familien – so das Konzept. Als Kitt wirkt auch die Angst, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, so wie die Schwesterpartei in den Niederlanden. Und: Corona hat viele alte Gräben zugeschüttet. Das Kurzarbeitergeld und Scholz’ Corona-Bazooka haben sogar manche No-Groko-AktivistInnen mit der SPD-Regierungsbeteiligung versöhnt.
Zudem hat der SPD-Rechte Scholz Positionen des linken Flügels übernommen: 12 Euro Mindestlohn, die Forderung nach sanften Steuererhöhungen für Reiche und die globale Mindestbesteuerung. Bei der Schwarzen Null, die Scholz 2019 noch verteidigte, als wären es die Kronjuwelen, hat der Kanzlerkandidat sich widerstrebend eines Besseren belehren lassen. Sogar konservative Ökonomen fanden es unsinnig, bei Nullzinsen die marode Infrastruktur weiter verfallen zu lassen.
Viele BürgerInnen sind veränderungsmüde
Der linke Flügel hingegen ist personell so blass und ausgezehrt, dass er kaum eine Gefahr für Scholz’ Machtansprüche darstellt. Die Juso-Chefin Jessica Rosenthal lobt Scholz in höchsten Tönen, dabei war er vor nicht allzu langer Zeit noch der Lieblingsgegner der Jusos. Die Zusammenarbeit mit ihm sei „sehr wertschätzend“ und „von gegenseitigem Respekt geprägt“, sagt sie. Inhaltlich sei man sich eigentlich völlig einig.
Man kann rechts und links in der SPD neuerdings durchaus mal verwechseln. Deshalb wird auch der Versuch der Union, Scholz als Marionette der SPD-Linken zu attackieren – wer Scholz wähle, bekomme Esken – ins Leere laufen.
Vor ein paar Monaten schien es viele gute Gründe zu geben, warum die SPD die Wahl nicht gewinnen kann. Die SPD regiert seit Langem, und Scholz steht wirklich nicht für das Neue, das ja bestimmt in der Post-Merkel-Zeit nachgefragt würde. Doch die Stimmung ist vier Wochen vor der Wahl anders: lieber keine Veränderung. Viele BürgerInnen sind nach mehreren Lockdowns, der Flut, angesichts des gigantischen Öko-Umbaus der Industrie in den nächsten Jahren und der Digitalisierung veränderungsmüde. Sie wollen keine schwungvolle Reform, keine neuen Gesichter, sondern Konstanz. Und unauffällige Kontinuität verkörpert – Scholz.
Eine Schwachstelle der SPD ist aber der Mangel an einer einleuchtenden Machtperspektive. Scholz will die Ampel mit Grünen und Liberalen. Christian Lindner will sie nicht. Kritischen Fragen in Sachen Ampel weicht Scholz aus. In seinem Umfeld gibt es die Hoffnung, dass die FDP in einer Regierung mit Rot-Grün den sichtbaren Wahrer von Sparwillen und Wirtschaftsliberalismus spielen könnte – auf der Kontrastfolie von Rot-Grün eine Heldenrolle. Die FDP wäre dann die erste Adresse für den Bundesverband der Deutschen Industrie, Unternehmerverbände und die üblichen Lobbyverbände.
Doch die FDP wird den Preis für diesen Lagerwechsel sehr hoch treiben. Scholz aber hat immer wieder versprochen, dass er als Kanzler schnell 12 Euro Mindestlohn einführen wird. Wie das mit der FDP gehen soll, ist, gelinde gesagt, unklar. Wenn die SPD, um das Kanzleramt zu erobern, der FDP bei Steuern und Löhnen freie Hand lässt, ruiniert sie ihre gerade wieder halbwegs reparierte Glaubwürdigkeit in Gerechtigkeitsfragen. Scholz kann als Merkel-Imitator zwar vielleicht Kanzler werden. Aber wie Merkel regieren kann er nicht.
Demut und das Warten auf den richtigen Titel
Trotzdem ist Scholz derzeit locker drauf. Es läuft ja. „Das Momentum ist aktuell auf der Seite der SPD“, so Wahlforscher Siegel. Seit einem Jahr erklärt Scholz unverdrossen trotz mieser Umfragen, dass die Stunde der SPD noch kommen wird. Viele hatten dafür nur Häme übrig. Und er lässt sich die Genugtuung, es jetzt allen Zweiflern und Nörglern zu zeigen, nicht anmerken. Das fällt ihm, dem Kontrollierten, leicht. Seit die Umfragen steigen, redet er oft von Demut. „Es freut mich, dass die Zustimmung wächst“, sagt er bei Bild-TV mit starrem Gesicht und ohne Anflug eines Lächelns. Bloß kein zu früher Jubel. Das politische Leben habe ihn Demut gelehrt.
Auf seiner Wahlkampftour schaut sich Scholz in einem Technologiezentrum im Süden Berlins ein Start-up an, das Notarzteinsätze mit digitaler Technik verbessert und beschleunigt. Der Firmenchef spricht den SPD-Mann mit „Herr Doktor Scholz“ an. Scholz kontert, er sei kein Doktor. Und scherzt: „Falsche Titel sind im Wahlkampf schwierig“. So schlagfertig ist er nicht immer.
Und er will einen anderen Titel. Schreibt die TAZ.
Die gleichen Medien, die 2016 noch einen Tag vor der Wahl Hillary Clinton als neue US-Präsidentin laut Umfragen hochjazzten, sehen nun ausgerechnet Olaf Scholz und seine dahinsiechende SPD in Front um das deutsche Kanzleramt. Was bei dieser Momentaufnahme eigentlich nur damit zusammenhängen kann, dass sich das Wahlvolk derzeit für das kleinste der drei Übel ausspricht, die zur Wahl stehen.
Dass Umfragen vier Wochen vor einer Wahl das Papier bzw. die Bytes nicht wert sind, auf dem oder mit denen sie veröffentlicht werden, müsste eigentlich hinlänglich bekannt sein.
Innerhalb von vier Wochen kann viel passieren, das aus den prognostizierten Winnern sehr schnell armselige Loser macht. Martin Schulz lässt grüssen! Ausserdem ist man nie so sicher, ob die befragten Menschen auch wirklich ihre wahren Wahlabsichten bekannt geben.
Viele nennen mit Absicht eine andere Partei als die, die sie letztendlich wählen. Einerseits um mit bewusst verfälschten Zahlen die Stammwähler*innen zu mobilisieren: Je höher die SPD in der Wählergunst steigt, umso mehr CDU/CSU-Symphatisanten und Nichtwähler*innen bewegen sich in die Wahlkabinen, um doch noch die CDU/CSU zu wählen.
Andererseits um auf keinen Fall zuzugeben, eine im öffentlichen Bewusstsein verfemte Partei – wie zum Beispiel die rechtsradikale deutsche AfD – nennen zu müssen, für deren Gedankengut man sich zwar schämt, es aber insgeheim eben doch akzeptiert.
Ein Phänomen, das auch Schweizer Umfrageinstitute im Zusammenhang mit heiklen Volksabstimmungen wie etwa der Minarett-Abstimmung der SVP kennen. Wer will denn schon am Telefon gestehen, dem Islam kritisch gegenüberzustehen?
Ein Phänomen, das beispielsweise bei den deutschen Bundestagswahlen 2017 dazu führte, dass die AfD wesentlich mehr Stimmen fangen konnte, als ihr in den Umfragen zugetraut wurde. Sie etablierte sich damit als stärkste Oppositionskraft im deutschen Bundestag und liess die Grünen, die in den Umfragen weit höher gehandelt wurden, ziemlich alt aussehen.
Der bevorstehende Exodus hunderttausender Afghanen*innen Richtung Europa könnte der AfD auch bei diesen Wahlen erneut in die Karten spielen. Es gibt naheliegende Gründe, weshalb die drei Kanzleramts-Kandidaten dieses Thema in der öffentlichen Diskussion scheuen wie der Teufel das Weihwasser.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
28.8.2021 - Tag von Mutter und Vater Theresa
Stadt Luzern will Flüchtlinge – der Bund blockt ab
Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zwingt tausende Zivilisten zur Flucht. Erneut positioniert sich eine Allianz, bestehend aus 16 grösseren und kleineren Städte der Schweiz. Auch die Stadt Luzern setzt sich für eine Direktaufnahme der Flüchtlinge in den Städten ein. Das Begehren stösst beim Bund auf taube Ohren.
Bereits 2020, als uns die Bilder aus dem überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos erreichten, haben sich die acht grössten Schweizer Städte zusammengetan. Gegenüber dem Bund und der Öffentlichkeit wurde die Forderung einer Direktaufnahme – das heisst, die Städte könnten die Geflüchteten unmittelbar nach ihrer Ankunft im Land zu sich holen – von Flüchtlingen postuliert und auch entsprechende Gespräche geführt.
Die klare Botschaft damals und heute ist: «Die Schweiz kann und muss mehr tun, um das Leid bedrohter und geflüchteter Frauen, Männer und Kinder in Konfliktregionen, auf der Flucht und an den Aussengrenzen Europas zu lindern», wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Hilfe vor Ort sei richtig und wichtig. Aber die humanitäre Tradition unseres Landes dürfe sich nicht in der materiellen Unterstützung vor Ort erschöpfen.
Nun macht sich die Stadt Luzern im Angesicht der aktuellen Afghanistan-Krise, die auch in der Zentralschweiz spürbar ist, stark, um Menschen in der Not zu helfen.
Städte seien «unverzichtbare Partner»
Die Schweizer Asylpolitik liegt grundsätzlich in der Kompetenz des Bundes, doch die Städte sind «unverzichtbare Partner bei der Unterbringung, vor allem aber bei der eigentlichen Integrationsarbeit», wie es weiter heisst. Die Städte hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage sind, auch eine grössere Zahl von Geflüchteten sehr kurzfristig und menschenwürdig unterzubringen und sie zu betreuen.
«Die Stadt Luzern ist auch jetzt bereit, bedrohten Menschen aus Afghanistan Schutz und Unterkunft zu bieten und ihnen eine Zukunft in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.» Eine fixe Zahl von Personen, die aufgenommen werden könnte, gibt die Stadt jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Das mache im Moment aus Sicht der «Allianz der Städte und Gemeinden für die Aufnahme von Flüchtlingen» keinen Sinn.
«Es muss pragmatische Wege und Möglichkeiten geben, diesen bedrohten Menschen möglichst rasch Schutz zu gewähren. Die Stadt Luzern und 15 weitere Städte der Schweiz sind bereit», sagt Martin Merki, Sozial- und Sicherheitsdirektor der Stadt Luzern.
Bund lehnt ab
Darum schlägt sie dem Bund vor, kurzfristige Einreiseerleichterungen einzuführen, wie das 2013 für syrische Flüchtlinge gemacht wurde. Nur: Die für das Dossier zuständige Justizministerin Karin Keller-Sutter lehnt die Forderungen der Städte bisher mangels rechtlicher Grundlage ab.
Merki und die anderen Mitglieder der Allianz bleiben jedoch optimistisch. «Die Allianz der Städte und Gemeinden ist überzeugt, dass sich ein gangbarer Weg finden lässt.» Zum einen, um die Not zu lindern, zum anderen aber auch, als «längerfristige Weiterentwicklung der humanitären Tradition unseres Landes», so Merki.
Ob das Begehren erfolgreich ist, wird sich zeigen müssen. Im vergangenen Jahr wurde die Städte-Allianz aufgrund des Föderalismus grösstenteils ausgebremst. Der Bund bestätigte zwar die Aufnahme von zwanzig jugendlichen Betroffenen aus dem Flüchtlingslager in Moria, legte den Fokus allerdings auf humanitäre Hilfe vor Ort. Schreibt ZentralPlus.
Immer wieder interessant zu beobachten, wer sich so alles in Luzern (und anderen Schweizer Städten) als Mutter oder Vater Theresa zu positionieren versucht. Es sind in der Regel Menschen mit höheren Ambitionen als nur zu den «Guten» zu gehören.
Man findet sie nicht selten als Kandidaten*innen auf Wahlzetteln, die über die komfortable Rundumversorgung an den kantonalen oder staatlichen Futtertrögen entscheiden.
Menschen, die in noblen Stadtquartieren ohne jeden häuslichen Kontakt mit Flüchtlingen wohnen und ihre eigenen Kinder vom Bramberg nicht etwa ins naheliegende St. Karli-Schulhaus mit den überwiegend von Migranten abstammenden Kindern schicken, sondern auf eine Privatschule.
Womit einmal mehr bewiesen ist, dass gezielt eingesetzte Heuchlerei auch zur Verkommenheit ausarten kann. Wie viele Elendsquartiere wie die «Baselstrasse» will sich die Stadt Luzern noch leisten?
Menschen, die sich auch keinen Deut um die gemachten Fehler aus den Jahren 2015/2016 kümmern. Auch nicht um die Mitteilung des Kantons Luzern, dass nach Beendigung des Schuljahres im Sommer 2021 knapp 1'000 (in Worten eintausend) Flüchtlinge von 2015/2016 mangels Jobs direkt in die Sozialhilfe fallen, was dem Kanton geschätzte 30 Millionen Kosten pro Jahr verursacht.
Wer die Welt retten will, sollte auch den notwendigen Marschallplan mitliefern, wie dies – auch und vor allem zum Wohle der Geretteten – verwirklicht werden kann. Rot-/Grüne Ideologien fern jeglicher Realität zu verbreiten ist das Eine. Skrupellose Negierung der damit verbunden finanziellen und gesellschaftlichen Probleme, die den Bürgerinnen und Bürgern und nicht zuletzt auch den Geflüchteten schamlos vor die Füsse gekippt werden, das Andere.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
27.8.2021 - Tag des LSD-Papstes Vanja Palmers
Wir beobachten eine Zunahme von Einschleichdiebstählen bei unverschlossenen Autos, die sich vor allem in der Stadt Luzern ereignen. Allein in diesem Monat wurden über 40 solcher Diebstähle verzeichnet.
Unverschlossene Fahrzeuge bilden eine einfache Gelegenheit für potenzielle Diebe, um an Bargeld oder kleinere Gegenstände zu gelangen, die sie verkaufen können.
Achten Sie auf folgendes um sich zu schützen:
• Schliessen Sie Ihr Auto stets ab, auch nur für kurze Zeit.
• Verwahren Sie den Autoschlüssel sicher.
• Nutzen Sie gut beleuchtete und übersichtliche Parkplätze.
• Lassen Sie keinerlei Wertsachen im Auto zurück.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung vom 27.8.2021.
Wenn Drogen zu einer Stadt gehören, wie die Stadtpolizei Luzern ab und zu besorgten Bürgerinnen und Bürgern am Telefon verkündet, gehören halt auch Autoeinbrüche und Diebstähle zu einer Stadt.
Denn, merke Dir: Wo die Drogen sind, ist die Beschaffungskriminalität für die spirituellen und «bewusstseinserweiternden» Substanzen (gemäss Luzerner LSD-Papst Vanja Palmers) nicht weit.
Nicht alle Drogensüchtigen sind so reich mit Bargeld gesegnet, wie Calida-Erbe, Multimillionär und oberster Schamane der veganen Spiritualität Vanja Palmers.
Oder wie die NZZ über Palmers schrieb: «Der gefährlichste Mann der Schweiz: Vanja Palmers will die Menschheit mit psychedelischen Drogen retten.» Ob Palmers wirklich der gefährlichste Mann der Schweiz ist, darf bezweifelt werden. Peinlichster Vollpfosten der Schweiz käme der Sache vermutlich näher.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
26.8.2021 - Tag der Staplerfahrer*innen
Arbeitsmarkt und Zuwanderung
Mit einer interessanten Aussage hat der Chef der deutschen Bundesagentur für Arbeit - quasi das Pendant zum Österreichischen AMS - aufhorchen lassen: Man brauche „400.000 Zuwanderer pro Jahr“, um den Bedarf an Arbeitskräften in Deutschland abdecken zu können. Sie fehlen im Pflegebereich. Techniker, Logistikexperten und sogar Akademiker sind gefragt.
Eine Ursache dafür sieht er in der demografischen Entwicklung, eine andere im starken Anstieg der Langzeitarbeitslosen, die mangels Qualifikation offenbar niemand haben will oder die selber nicht wollen.
Auf Österreich umgelegt würde das in etwa bedeuten, dass der Bedarf bei rund 40.000 Zuwanderern im Jahr liegt. Dass viele Jobs derzeit trotz hoher Arbeitslosenzahlen nicht besetzt werden können, hören wir täglich: Aus der Gastronomie, aus gewerblichen Fachbetrieben, erst kürzlich aus dem Handel.
Doch statt endlich Konzepte für eine gezielte Migration zu implementieren, verstrickt sich die heimische Politik seit Wochen in eine seltsame Diskussion über die mögliche oder unmögliche Abschiebung von Menschen in ein Land, in dem die Flughäfen geschlossen sind.
Niemand kann verhindern, dass in den nächsten Jahrzehnten Millionen Menschen aus den Armenhäusern dieser Welt nach Europa drängen werden. Man wird weder alle aufnehmen noch alle aussperren können. Doch weder die EU noch Österreich haben eine geeignete Strategie, um die Zuwanderung geschickt mit den Bedürfnissen am Arbeitsmarkt zu verknüpfen. Schreibt die Krone.
Starten wir mit ein paar Zahlen aus Deutschland – immerhin noch immer die viertgrösste Volkswirtschaft der Welt: Laut Pressemitteilung vom 29.7.2021 der deutschen Bundesagentur für Arbeit waren im Juli 2021 2'590'00 Menschen arbeitslos; Ausgesteuerte wie bei allen europäischen Arbeitslosenstatistiken nicht eingerechnet. Die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen wird von der Politik eben gerne verschwiegen. Übrigens auch in der Schweiz.
Hinzu kommt eine ebenso interessante wie auch schockierende Zahl: «Die Unterbeschäftigung lag im Juli 2021 bei 3.379.000 Personen». Um Missverständnissen vorzubeugen: Damit sind nicht etwa die von der Arbeitsagentur «geschätzten» 75'000 Personen gemeint, die wegen Corona noch in «Kurzarbeit» verweilen und in der Statistik separat aufgeführt werden.
Unterbeschäftigung kurz und prägnant erklärt: «Unterbeschäftigung» bedeutet nichts anderes als «zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel».
Jobs also, die vor allem von globalen Giganten wie Amazon & Co. sowie anderen Niedriglohnbranchen Deutschlands den Arbeitswilligen und Arbeitslosen zum Frass offeriert werden. Vorzugsweise über die Bundesagentur für Arbeit.
Dass sich die Bundesagentur für Arbeit bei diesen Horror-Zahlen dazu hergibt, alarmistisch mit dem seit Jahren immergleichen Hinweis auf die «Demografie» einen «Fachkräftemangel» von 400'000 Personen pro Jahr zu bejammern, ist nicht nur lächerlich und absurd, sondern auch Zynismus in Reinkultur. Mitarbeitende in den berühmt berüchtigten Warenlagern von Amazon & Co. als «Logistikexperten» zu bezeichnen, ist die neue Umschreibung für Staplerfahrer*innen und Gangos (Gang go hole).
Politik sowie Wirtschafts- und Industrieverbände Deutschlands werden allerdings die wohlfeile «Propaganda» der Bundesagentur für Arbeit gerade jetzt zu schätzen wissen.
Sind es doch die gleichen Akteure wie 2015, die schon damals nicht müde wurden, ihre Lobgesänge auf die Flüchtlingswelle aus Syrien mit hanebüchenem Unsinn zu rechtfertigen.
Der damalige Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz von der SPD, verstieg sich 2015 gar zur Aussage «Was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold».
SPD-Chef Schulz endete 2017 mit seiner Kanzlerkandidatur als bemitleidenswerte Lachnummer; von seinen «Goldstücken» aus dem Jahr 2015 sind laut CDU-Politiker Friedrich Merz inzwischen über eine Million in Hartz IV, also beim deutschen Sozialamt, gelandet.
Es kamen 2015 halt doch etwas mehr Analphabeten als Akademiker und Logistikexperten. Diese Tatsache musste inzwischen auch die Schweiz zur Kenntnis nehmen.
Da sowohl die Bundesagentur für Arbeit wie auch die deutsche Politik – inklusive der immer nach noch billigeren Arbeitskräften gierenden Wirtschaft und Industrie im Schlepptau – seit längerer Zeit ganz genau wissen, dass die nächste Flüchtlingsflut, diesmal aus Afghanistan, demnächst vor den deutschen Türen steht, muss man wirklich kein Schelm sein, um Böses zu denken.
Die Lippenbekenntnisse der deutschen Politiker*innen, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe, sind ausschliesslich dem derzeitigen Bundestagswahlkampf geschuldet.
Billige Floskeln wie «wir schaffen das» wird auch der/die/das kommende Kanzler*in nach der Bundestags-Wahl im Gepäck haben. Das ist so sicher wie die irgendwann kollabierenden Sozialsysteme, auch wenn darüber vorerst nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird.
Eigenartigerweise stört es im Gegensatz zu den Kosten des Klimawandels niemanden, dass die dereinst fälligen Zuschüsse in Milliardenhöhe für die überbordenden Sozialsysteme ebenfalls auf die Schultern kommender Generationen abgewälzt werden.
Man darf sich auch fragen, welche Altersrente das Millionenheer der «Unterbeschäftigten» bei ihrem Eintritt ins Pensionsalter erwartet. Doch auf diese Frage haben weder Politik noch Industrie und Wirtschaft ausser vorgestanztem Müll aus dem Rhetorik-Seminar eine Antwort.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.8.2021 - Tag der zweiten Balkan-Generation
Wildwest in Emmenbrücke LU eskaliert schon seit über einem Jahr: Die Geschichte hinter dem Prügel-Video
Das Video der brutalen Strassen-Prügelei in Emmenbrücke LU vom letzten Freitag schockierte. Jetzt zeigen Blick-Recherchen: Die Eskalation im Feierabendverkehr hat eine lange Vorgeschichte.
Es sind brutale Szenen, die sich am Freitag in Emmenbrücke LU abspielen: Mitten im Feierabendverkehr versuchen mehrere Schläger ihr Opfer, einen Serben (53), aus dem Auto zu zerren (Blick berichtete). Minutenlang prügeln sie immer wieder auf den Mann ein, ziehen ihn schliesslich aus seinem Fahrzeug. Als der Serbe auf der Strasse liegt, setzt es noch Tritte gegen den Kopf!
Die Aggressivität der Angreifer kommt nicht von ungefähr. Recherchen zeigen: Der Prügel-Angriff ist nur die jüngste Eskalation in einem blutigen Konflikt, der schon ein Jahr schwelt.
Im Zentrum stehen zwei Gruppierungen. Der 53-jährige Serbe, der am letzten Freitag verprügelt wurde, wohnt unweit des Tatortes. Und gehört einer Türsteher-Gruppe an, die immer wieder durch hohes Aggressionspotenzial auffällt, wie ein Informant berichtet. Bei den Angreifern vom Freitag handle es sich unter anderem um Bosnier, Vater und Sohn (33).
Schon die zweite Prügelei innert Jahresfrist
Die Vorgeschichte: Fast genau ein Jahr vor der Prügelei im Feierabendverkehr, am 25. August 2020, gab es schon einmal eine Schlägerei. «Damals lief es aber genau anders herum», so der Informant, der anonym bleiben will.
Der 33-jährige Bosnier, im aktuellen Wildwest-Video auf der Täterseite, sei damals allein in einem Lokal in Emmenbrücke gesessen – und von mehreren Männern aus der Serben-Gruppe, mit der es schon zuvor immer wieder Stress gegeben hatte, verprügelt worden. «Was man am letzten Freitag gesehen hat, war jetzt die Rache dafür», so der Informant. Und: «Die Aktion letzte Woche war nicht geplant, es war ein zufälliges Aufeinandertreffen auf der Strasse.»
Simon Kopp von der Luzerner Polizei bestätigt gegenüber Blick, dass es vor einem Jahr einen entsprechenden Polizeieinsatz gab. Und dass damals tatsächlich Involvierte der Prügelei vom letzten Freitag anwesend waren.
Der Informant berichtet weiter: Seither sei es immer wieder zu Provokationen und Sachbeschädigungen gekommen. «Darum ist hier auch niemand überrascht, dass es nun wieder geknallt hat.» Mehr noch: «Ich befürchte, dass nun wieder die serbischen Türsteher am Zug sind, um sich zu rächen. Ich hoffe, die Polizei hat da ein Auge drauf!»
Polizei musste am Freitag zwei Mal ausrücken
Zur Rache-Befürchtung passt: Am letzten Freitag musste die Polizei nach der Strassen-Schlägerei noch ein zweites Mal ausrücken. Im Lokal, wo es schon vor einem Jahr zur Schlägerei kam, marschierten plötzlich Leute aus dem Umfeld des Serben auf. Und stiessen Todesdrohungen gegen anwesende Personen aus.
Die Luzerner Polizei bestätigt einen Einsatz an der Lokalität wegen Verstosses gegen das Hausverbot.
Von den Involvierten selber wollte sich gegenüber Blick niemand zum Vorfall äussern. Schreibt Blick.
Es gibt manchmal im Leben eines Kolumnisten Situationen und Momente, in denen man nicht umhin kommt, sich zu wiederholen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn es sich um Situationen und Momente mit Beteiligten vom Balkan handelt.
Eine Ethnie die nichts, aber auch wirklich rein gar nichts unterlässt, ihren ohnehin schon seit Jahrhunderten ramponierten Ruf noch mehr zu beschädigen. Beziehungsweise immer wieder aufs Neue zu bestätigen.
Mit einer Aktivität sondergleichen werden diese Vorurteile – die längst keine Vorurteile mehr sind sondern alltägliche Realität – von der zweiten Generation gefördert, deren Vorfahren in Hunderttausender-Stärke von den Karpaten in die Schweiz zugewandert sind.
Wiederholung 1
Wo immer irgendwelche «Wildwest-Aktionen», Einbrüche in Luzerner Juwelierläden, Frauenhandel zwecks Prostitution, Zuhälterei, Auto-Posing, Schlägereien, Drogenhandel und nicht selten sogar Tötungsdelikte stattfinden, kann man inzwischen beinahe davon ausgehen, dass häufig ein Mitglied dieser Zuwanderungsgruppe involviert ist.
Wiederholung 2
Peter Scholl-Latour, leicht abgewandelt («Balkan» statt «Kalkutta»): «Wer den halben Balkan aufnimmt, hilft nicht etwa dem Balkan, sondern wird selbst zum Balkan!» Kabul, Damaskus und Kurdistan ist schon, könnte man als Zyniker hinzufügen. Wie gut, dass ich keiner bin.
Rechtlicher Hinweis
Für alle Menschen vom Balkan gilt die Unschuldsvermutung.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.8.2021 - Tag des SVP-Dummschwätzers
Ausgerechnet ein SVPler!: Glarner will Corona-Pfleger aus dem Ausland holen
SVP-Nationalrat Andreas Glarner schlägt vor, Pflegende in Nachbarländern zu rekrutieren. Parteikollege und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati hält das für keine gute Idee. Und auch sonst treibt Corona die beiden Weggefährten auseinander.
Der Aarauer Bahnhofplatz ist praktisch leer, als Jean-Pierre Gallati (54) und Andreas Glarner (58) um 9 Uhr aufeinandertreffen. Die beiden kennen sich seit Jahren, sind Weggefährten. Doch Corona treibt sie auseinander. Covid-Zertifikat, Impfung, Spitalbetten – einig sind sich der Aargauer Gesundheitsdirektor und der kantonale SVP-Präsident nie, wie sich im Streitgespräch zeigt.
Vorgeschlagen hatte dieses Gallati – weil er sich nicht zu jedem Corona-Angriff seines Parteikollegen in der Zeitung äussern wolle.
Herr Glarner, Sie haben Herrn Gallati als «Höseler»bezeichnet. Weshalb fallen Sie Ihrem eigenen Regierungsrat derart in den Rücken?
Andreas Glarner: Ich habe mit «Höseler» den Gesamtregierungsrat gemeint, sicher nicht meinen Freund Gallati. Wir haben einfach eine unterschiedliche Auffassung, was die Corona-Politik angeht.
Zwischen SVP-Regierungsräten und der Partei gibt es beim Covid-Gesetz einen Graben. Die SVP hat am Wochenende die Nein-Parole zum Gesetz – und damit auch zum Zertifikat – beschlossen. Sind Sie enttäuscht, Herr Gallati?
Jean-Pierre Gallati: Ich stelle einfach fest, dass die SVP unter der Bundeshauskuppel – im Ständerat und im Nationalrat – dem Gesetz und dem Zertifikat damals noch zugestimmt hat.
Sind Sie enttäuscht?
Gallati: Nein, ich bin einfach anderer Meinung. Und ich versuche, die Menschen mit Argumenten zu überzeugen. Den Aargauer Wirten würde ich sagen, es ist keine Hexerei, das Zertifikat anzuwenden. Und es hilft uns, Schliessungen zu verhindern.
Herr Glarner, Sie haben sich bei der Abstimmung im Parlament enthalten. Nun bekämpfen Sie das Zertifikat. Weshalb der Sinneswandel?
Glarner: Damals wussten wir noch nicht, wo das Zertifikat überall eingesetzt würde. Ich sehe nicht ein, weshalb wir in den Restaurants das gesellschaftliche Leben wieder herunterfahren sollten.
Was schlagen Sie denn vor?
Glarner: Wir sollten die Regeln bei den Beizen so lassen, wie sie sind. Aber sicher keine Grossveranstaltungen ...
Gallati: ... ich staune, dass du keine Grossveranstaltungen mehr willst.
Glarner: Moment. Wenn ein Veranstalter sagt, bei uns kommen nur Geimpfte, Genesene und Getestete rein, habe ich keine Mühe damit. Das muss jeder Veranstalter selber wissen.
Gallati: Aber genau das geht ohne Zertifikat nicht mehr!
Herr Glarner, Sie wehren sich – trotz zunehmenden Spitaleinweisungen – gegen neue Corona-Massnahmen. Nehmen Sie in Kauf, dass die Spitäler an den Anschlag kommen?
Glarner: Das Problem liegt bei den Spitalkapazitäten. Wir brauchen mehr Plätze! Vor gut einem Jahr hat Herr Gallati uns gesagt, wir hätten etwas mehr als 100 Intensivplätze. Wie viele Plätze verkaufst du uns heute?
Gallati: Wir haben im Aargau normalerweise 50 Intensivpflegeplätze. Wir haben letztes Jahr während der ersten Welle möglichst viele Beatmungsgeräte gekauft. So, dass wir am Schluss 96 Beatmungsplätze hatten. Im Verlauf der Pandemie haben wir allerdings gemerkt, dass ein Covid-19-Patient auf der Intensivpflegestation drei- bis fünfmal mehr Personal braucht. Unter anderem, weil das Personal teilweise krankheitsbedingt ausfiel, konnten wir die Plätze daher von 50 nur auf 60 aufstocken.
Glarner: Aber wie viele Leute habt ihr zusätzlich rekrutiert – im Ausland zum Beispiel? Man muss jetzt Personal rekrutieren. Und ausserdem muss man schauen, dass es nicht sechs Leute braucht, um einen Patienten zu kehren. Das ist ja eine Lachnummer!
Herr Gallati, ist es so schwierig, geeignetes Personal zu finden?
Gallati: Wir haben immer wieder besprochen, wie wir die Kapazität im Gesundheitswesen erhöhen können. Es geht schlicht nicht. Erstens handelt es sich um eine sehr spezialisierte Tätigkeit. Zweitens kann ich die Fachkräfte nicht – wie Herr Glarner immer wieder vorschlägt – in Polen rekrutieren. Es überrascht mich sowieso, dass Herr Glarner das vorschlägt.
Glarner: Man könnte Personal in Deutschland rekrutieren, ich habe nichts von Polen gesagt. Wenn ich ein Inserat schalte in der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und sage, ich brauche so und so viele Pflegekräfte für dieses Gehalt, dann läuft euch die Mailbox über.
Herr Gallati, haben Sie versucht, Pflegende im Ausland zu rekrutieren?
Glarner: Nein, natürlich nicht.
Gallati: Wir haben bereits heute sehr viele, die aus Deutschland in die Schweiz kommen, um hier zu arbeiten. Zum Glück. Aber es ist nicht so, dass jeder in die Schweiz springt, nur wenn man ein Inserat schaltet – erst recht nicht, wenn es um spezialisierte Intensivpflegeplätze geht.
Der Aargau will die Impfquote markant erhöhen und impft neuerdings auch an Schulen. Wie läuft das?
Gallati: Das Impfen an der Schule ist für die Schüler völlig freiwillig. Bei den Schülern unter 16 Jahren müssen die Eltern zustimmen.
Glarner: Eine tolle Freiheit ist das, wenn die Lehrerin in der Schule fragt, wer alles geimpft ist! Es entsteht ein unglaublicher Druck auf die Kinder.
Gallati: Herr Glarner und ich gingen in den 1970er Jahren zur Schule. Wir hatten damals zig Impfungen, und niemand hat von Zwang gesprochen. Die Covid-Impfung hat eine extrem positive Wirkung: 99-Prozent der Patienten auf den Intensivstationen sind nicht geimpft.
Herr Glarner, was haben Sie gegen die Impfung?
Glarner: Ich möchte nicht derjenige sein, der dem Volk sagt, lasst euch impfen. Ich kenne weder die Nebenwirkungen, noch weiss ich, was in zwei Jahren ist. Im Moment laufen ja noch Menschenversuche mit dieser Sauce, die wir uns da reinjagen.
Sind Sie denn geimpft?
Glarner: Ja, ich bin geimpft.
Gallati: Ich verstehe Herrn Glarner wirklich nicht! Er spricht von einer Sauce und ist selber geimpft. Wenn die Impfung so riskant wäre, hätte er sich nicht impfen lassen!
Glarner: Mir geht es darum, dass die Impfung freiwillig bleibt. Ich habe mich wegen der Auslandreisen impfen lassen. Es ist mir einfach zu blöd, mir ständig ein Stäbchen in die Nase führen zu lassen. Aber ich verstehe jedes Land, das sagt, bei uns kommen nur Geimpfte rein ...
Gallati: ... offenbar hat Herr Glarner keine Mühe, wenn andere Staaten einen Impfzwang einführen.
Glarner: Jedes Land ist frei, welche Regeln es für die Einreisenden erlässt. Das ist kein Impfzwang. Man ist nicht gezwungen, nach Taiwan zu reisen.
Herr Gallati, Sie lancieren in diesen Tagen eine Impfkampagne mit Aargauer Prominenten. Was schwebt Ihnen vor?
Gallati: Wir klären auf und zeigen Vorbilder. Menschen, die sich haben impfen lassen. Wie Herrn Glarner, er ist ein positives Impf-Vorbild!
Glarner: Ich will um Gottes Willen kein Vorbild sein!
Herr Glarner, wenn man Ihnen zuhört, stellt man sich die Frage, ob Sie sich einen anderen SVP-Regierungsrat wünschen?
Glarner: Nein, auf keinen Fall! Er ist der Beste, den wir haben können.
Aber?
Glarner: Schauen Sie, wir haben unterschiedliche Rollen. Er wählt einen anderen Weg, als ich wählen würde.
Gallati: Die Frage ist, ob man das Virus als Bedrohung für das Gesundheitssystem sieht oder nicht. Wenn man wie Herr Glarner sagt, es sei kein Problem, es sterbe fast niemand, es gäbe wahrscheinlich kein Long Covid ...
Glarner: Entschuldigung, ich habe nie gesagt, es gäbe kein Long Covid. Ich bin selber betroffen von einer nachhaltigen Müdigkeit, seit ich Corona hatte.
Was wünschen Sie sich voneinander in Bezug auf die Corona-Politik?
Gallati: Mach die Augen auf und schau, was da draussen passiert.
Glarner: Baut endlich die Spitalkapazitäten aus. Koste es, was es wolle.
Schreibt Blick.
Das Erstaunen, das BLICK in der Titel-Schlagzeile mit «Ausgerechnet ein SVPler!» ausdrückt, verstehe wer will. Dass die SVP Wasser predigt und selber mehrheitlich Wein trinkt, müsste eigentlich auch dem Boulevardblatt von der Dufourstrasse in Zürich bekannt sein.
Laut Aussage von Bundesrat Ueli Maurer im Jahr 2019 gewinnt die SVP die Wahlen ausschliesslich mit den Themen «Ausländer, Flüchtlinge und EU».
Dass die strammen Burschen und Mädels der SVP aber Ausländer herzlich willkommen heissen, solange sie als billige Arbeitskräfte unserem Land dienen, bestätigt der Aargauer SVP-Präsident Glarner, den man laut einem Gerichtsurteil als «Dummschwätzer» bezeichnen darf, einmal mehr.
So wie Industriebosse mit dem SVP-Parteibuch keine Hemmungen haben, ihre Produktionsstätten zum Wohle ihres eigenen Profites aus der Schweiz in Billiglohnländer der EU zu verlegen.
Besonders übel ist der Stimmenfang der SVP auf dem Rücken der Flüchtlinge. Ist es doch ausgerechnet die «Flüchtlingsindustrie», von der vor allem SVP-Granden profitieren.
Wie zum Beispiel im Schweizer Wohnungsmarkt. Wer präsidiert denn die Schweizer Hauseigentümer-Verbände? Google hilft Ihnen weiter. Sie werden staunen, wie viele davon SVP-Mitlieder sind.
Hätten Sie zu diesem Thema gerne eine Geschichte, die ich jederzeit beweisen kann? Was sagen Sie denn dazu, wenn eine zu einem günstigen Mietpreis ausgeschriebene (!) Mietwohnung auf Weisung des Hauseigentümers plötzlich zu einem um hunderte von Franken pro Monat höheren Mietzins an ein Flüchtlings-Ehepaar mit drei Kindern vermietet wird? Dem Ehepaar aus Afghanistan sei die – nicht unbedingt tolle – Wohnung gegönnt. Nicht aber der überhöhte Mietzins dem Hauseigentümer.
It takes two to tango: Einen gierigen SVP-Hausbesitzer, der die gesetzlich verankerten Miettarife für Flüchtlinge auf den Rappen genau kennt und ein Sozialamt, das nicht einmal in der Lage ist, die örtlichen Mietpreise vorher zu kontrollieren, bevor es einen Mietvertrag unterzeichnet.
Es sei hier festgehalten, dass von diesem Goldregen nicht nur SVP-Hausbesitzer profitieren. Wenn ein staatliches System diese zwar legale, aber moralisch verwerfliche Selbstbedienung an Geldern der Steuerzahlern*innen zulässt, greifen wohl die meisten Hausbesitzer querbeet durch alle Schweizer Parteien bis hin zur SP zu.
Nur machen die anderen Parteien nicht schamlos Stimmung gegen die Flüchtlinge fürs berühmte «Wahlvolch», um gleichzeitig staatlich sanktioniert von den über das Land schwappenden Flüchtlingswellen in hinterhältiger Art und Weise zu profitieren. Weit über die Mietwohnungen hinaus! Googlen Sie mal, wem die meisten Security-Firmen gehören, die bei den Flüchtlingsheimen eingesetzt werden? Genau. Sie ahnen es...
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.8.2021 - Tag des Balkans
Wildwest in Emmenbrücke LU: Hier schlagen mehrere Männer auf einen Autofahrer ein
Wildwest-Szenen am Freitagabend in Emmenbrücke LU. Verfeindete Gruppen geraten aneinander. Ein wehrloser, im Auto sitzender Serbe (53) wird übelst verprügelt und verletzt – er muss ins Spital gebracht werden. Hauptverdächtiger ist ein Bosnier (33).
Mehrere Personen prügeln auf eine Person ein, die im Auto sitzt. Ein Schläger geht ums Auto herum, versucht, sein Opfer via Beifahrertüre aus dem Kleinwagen zu zerren. Minutenlang ist dem Mann im Auto wohl Angst und Bange. Schliesslich gelingt es einem der Schlägertypen, das Opfer aus dem Wagen zu zerren, wo der am Boden liegende mit Fäusten und Fusstritten traktiert wird.
Andere Verkehrsteilnehmer hupen. Zwei Frauen steigen aus, getrauen sich aber nicht, einzugreifen.
Die Wildwest-Szene ereignete sich am Freitagabend an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke LU. Ein Gewerbler aus der Nachbarschaft sagt: «Es war etwa 18 Uhr, als ich die Auseinandersetzung bemerkte. Ich arbeitete, konnte also nicht hingehen. Erst später kam die Polizei.» Um was es bei der gewalttätigen Attacke ging, wisse er nicht.
Streit unter «verschiedenen Gruppierungen»
Simon Kopp, Sprecher der Kantonspolizei Luzern, bestätigt gegenüber Blick, dass es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung kam. Der Fahrer des Autos, ein Serbe (53), sei anschliessend mit dem Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren worden. «Weitere Personen wurden zur Einvernahme auf den Polizeiposten mitgenommen, aber es wurde niemand in U-Haft gesetzt», so Kopp. Es habe sich um einen Streit «unter verschiedenen Gruppierungen», gehandelt. Offenbar scheine die Schlägerei eine Vorgeschichte zu haben – das werde nun untersucht.
Der Hauptverdächtige ist laut Polizei ein Bosnier (33). Zwei weitere Personen wurden als Auskunftspersonen im Anschluss noch befragt. Schreibt BLICK.
Frei nach Peter Scholl-Latour, jedoch leicht abgewandelt (Anm. Balkan an Stelle von Kalkutta):
«Wer den halben Balkan aufnimmt, hilft nicht etwa dem Balkan, sondern wird selbst zum Balkan!»
Das ist ein Naturgesetz, ähnlich der Gravitation im Universum. Wie könnten sich sonst Andromeda und die Milchstrasse aufeinander zu bewegen?
Siehste! So ist das nun mal.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.8.2021 - Tag des albanischen Drogendealers auf der Intensivstation
Bezug zu Balkanländern im Fokus: Viele der neuen Covid-Patienten haben Migrationshintergrund
Viele Covid-Patienten auf Intensivstationen haben Migrationshintergrund und Bezug zu Balkanländern. Dies bestätigen medizinische und politische Kreise. Das Thema wird jedoch nur ungern angesprochen, aus Angst vor politischem Missbrauch oder falscher Korrektheit.
In den Spitälern liegen derzeit grösstenteils Covid-19-Patienten mit Migrationshintergrund. Viele von ihnen sind schlecht qualifiziert, schlecht informiert und eben aus ihren Sommerferien im Heimatland zurückgekehrt. Das berichtet die «NZZ am Sonntag» unter Berufung auf medizinische und politische Kreise. Lukas Engelberger (46), Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, bestätigt: «Aufgrund dessen, was ich aus den Spitälern höre, ist das ein Problem.»
Aus Angst vor politischem Missbrauch oder falscher Korrektheit werde ungern über das Problem geredet. Klartext sprach kürzlich Hans Pargger, Leiter der Intensivstation am Universitätsspital Basel, im «Tages-Anzeiger». Mehrere Patienten hätten sich im Ausland angesteckt: «Wir haben einen hohen Anteil an Patienten mit Migrationshintergrund. Manche wollten sich nicht impfen lassen. Andere haben nicht gemerkt, dass sie sich hätten impfen lassen sollen.»
Mehrheit der Covid-Erkrankten mit Bezug zu Balkanländern
Demnach sind es nicht laute Impfgegner, die jetzt schwer an Corona erkranken. Klare Worte wählte diesbezüglich auch der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin (42, SVP). Auf einen Vorstoss im Kantonsparlament erklärte er: Die Mehrheit der Covid-Erkrankten im Spital habe Bezug zu Balkanländern. Man habe es gegenüber diesen Personen offenbar nicht geschafft, betreffend Impfung «erfolgreich zu kommunizieren».
Demnach hat die Impfkampagne des Bundes diese Bevölkerungsgruppen bislang kaum erreicht. Nun verstärken Kantone ihre Bemühungen, Migranten auch per Whatsapp, mit Flyern sowie über Vereine, Integrationsstellen und Botschaften zu erreichen. Engelberger will dem Bund daher eine unpopuläre Massnahme vorschlagen: «Wir müssen uns ernsthaft überlegen, die Einreisequarantäne wieder einzuführen.»
Sprachbarrieren sind ein Grund. Marius Brülhart, Wirtschaftsexperte in der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, will auch die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. «Ein beträchtlicher Teil der Ungeimpften scheint eher bildungsfernen Arbeitermilieus zu entstammen», so Brülhart. Dies rechne sich auch für die betroffenen Firmen und Betriebe. Schreibt der SonntagsBlick.
2020 Reload – Mama, der Mann mit dem Koks ist nicht mehr da! (Copyright by Falco).
Hatten wir das nicht schon im Jahr 2020 mit der dritten Welle, die vor allem von den Balkan-Rückkehrern*innen ausgelöst wurde?
Was machen jetzt nur unsere armen Drogenkinder rund um den Luzerner Bahnhof, auf dem Inseli und der Aufschütti und vor der Swiss Mall in Ebikon, wenn der Albaner mit dem weissen Pulver auf der Intensivstation liegt?
Gibt's da wenigstens eine Help-Line für die trockenen Nasen? Vielleicht gar bei der Luzerner Stadtpolizei, die der Meinung ist, «dass Drogen zu einer Stadt gehören»? Setzen sich wenigstens die Grünen und die Jusos für ihre Klientel ein?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.8.2021 - Tag der Talibancamps
Die USA sind weg, China übernimmt in Afghanistan
China wird der Profiteur vom Abzug der USA aus Afghanistan. Peking wird wohl wesentlich vorsichtiger, zurückhaltender und damit letztlich erfolgreicher agieren als die Amerikaner.
Schon zeichnet sich die neue Ordnung in Afghanistan ab, bei welcher China die Schlüsselrolle spielen wird: Aussenminister Wang Yi empfing diesen Sommer eine hochrangige Delegation der Taliban. Seine Sprecherin Hua Chunying reagiert auf deren Machtübernahme in Kabul ausgesprochen positiv: Die Taliban seien an guten Beziehungen zu China interessiert und würden dessen starke Beteiligung an der Entwicklung des Landes begrüssen.
Nicht die Seidenstrasse, aber Kupfer und Erdöl
Peking habe in Afghanistan, mit dem es ein paar Dutzend Kilometer Landgrenze verbindet, ein doppeltes Interesse, sagt der Buchautor Azeem Ibrahim, Direktor der Denkfabrik Newsline Institute in Washington und Dozent am US Army War College: «Zum einen die regionale Stabilität. Zum andern die bisher fast unangetasteten Rohstoffvorkommen in Afghanistan. Bereits jetzt ist China beteiligt an einer Kupfermine bei Kabul und an Erdölfeldern im Norden des Landes.»
Für das chinesische Projekt der neuen Seidenstrasse sei Afghanistan hingegen unerheblich: Denn die wichtigsten Verkehrs- und Transportwege führten nördlich und südlich des Landes durch. Wichtig sei bloss, dass von Afghanistan keine destabilisierende Wirkung auf die Nachbarländer ausgehe, also nach Pakistan oder Zentralasien, wo China stark engagiert sei.
Keine chinesische Militärpräsenz zu erwarten
Klar sei, so Ibrahim, dass China das Vakuum füllen wolle, das die USA und der Westen insgesamt hinterlassen. China habe das gescheiterte Engagement der USA gründlich analysiert und ziehe Lehren daraus.
Die Wichtigste: «Bloss keine zu hohen Ambitionen.» Die Chinesen wollten in Afghanistan keinen neuen Staat aufbauen, sondern sich auf Einfluss und Investitionen beschränken. Diese werde China keinesfalls mit eigenen Soldaten schützen, sondern mit bezahlten Söldnern.
Eine chinesische Militärpräsenz in Afghanistan werde es nicht geben, ist Ibrahim überzeugt. Berater und Techniker für die Taliban-Armee dürften hingegen die Russen stellen. Peking habe auch keinerlei Erwartungen an die Taliban, wie diese ihr Land regieren sollen.
Pragmatisch mit allen Machthabern
China arrangiert sich mit wem auch immer an der Macht. Menschenrechte, Demokratie, Medienfreiheit, all das spielt keine Rolle. Die einzige entschiedene Forderung an das Taliban-Regime lautet: Unterstützt nicht muslimische Gruppierungen in China, und verhindert, dass aus Afghanistan Terroranschläge auf unserem Territorium lanciert werden. Das haben die Taliban bereits zugesichert.
Für die Taliban bedeutet die Verbindung zu China eine gewaltige Rückenstärkung: Wenn Peking und wohl auch Moskau das Regime anerkennen – und als Folge davon viele weitere Staaten –, ist Afghanistan nicht länger isoliert, egal was der Westen tut. «Die Taliban können sich um westliche Forderungen foutieren, weil sie dann weder politisch noch wirtschaftlich auf den Westen angewiesen sind», sagt Ibrahim.
Chinas Engagement in Afghanistan ist also durchaus erfolgversprechend. Gerade, weil es diskreter sein wird als bisher das westliche. Dank geringerer Sichtbarkeit gibt es zudem kaum Anlass für die afghanische Bevölkerung, China als Besatzungsmacht zu sehen.
Eine ganz andere Frage ist natürlich, was die Auswechslung der USA durch China als dominierende ausländische Macht für das afghanische Volk bedeutet, vor allem für die Frauen und die freiheitlich gesinnten Kräfte im Land.
Wie steht es um die USA als Weltmacht?
Auch Constanze Stelzenmüller von der Denkfabrik Brookings Institution in Washington schaute nach eigenen Angaben mit Entsetzen auf den unerwartet raschen Abzug der USA in Afghanistan. Nun sei wohl allen nach der Inauguration am 6. Januar klar geworden, wie gewaltig der innenpolitische Druck auf US-Präsident Joe Biden und seiner Regierung laste.
Angetreten als empathischer Präsident gegen das chaotische und häufig menschenverachtende Team von Donald Trump habe Biden mit der Afghanistan-Entscheidung nun gezeigt: «Amerika definiert seine nationalen Interessen sehr kühl und eng und dies offensichtlich unter der Wahrnehmung gewaltigen innenpolitischen Drucks.»
Verständlicherweise machten sich Taiwan, andere asiatische Verbündete und auch die EU nach diesem Signal der USA Sorgen. Dies wäre laut Stelzenmüller angesichts der innenpolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme in den USA schon lange nötig gewesen, welche die Supermacht in ihrer Verantwortung überlasteten: «Da haben sich die Europäer viel zu lange im Windschatten ausgeruht.» Die Europäer müssten sehr viel mehr im transatlantischen Bündnis tun – im eigenen Interesse und unabhängig davon, was die Amerikaner tun oder lassen.
Ungeachtet dessen sei das Bündnis mit den Amerikanern unverzichtbar, sagt Stelzenmüller: «Das spürt man in Europa und auch in der Schweiz an der Intensität und Ruppigkeit, mit der sich nicht nur Russland, sondern auch China in europäische Angelegenheiten einmischen. Das ist keine Situation, in der man sich einfach nach Hause zurückziehen kann.»
Ni hao!
Schon Konfuzius sagte «Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die grossen Vorhaben zum Scheitern».
Dass China in Afghanistan die dominierende Rolle einnehmen wird, ist nur ein weiterer Stein im Puzzle der asiatischen Supermacht auf ihrem langen Weg der «grossen Vorhaben». Die Weisheiten von Konfuzius spielten schon immer eine gewichtige Rolle in den langfristig angelegten Plänen im «Reich der Mitte».
Selbst Staatspräsident Xi Jinping scheut sich nicht, ab und zu ein Zitat des chinesischen Philosophen in seine Reden einzubauen, wie er am WEF in Davos eindeutig bewies.
Die Frage stellt sich nicht, ob nach dem von den USA und dem Westen dominierten Zeitalter nun die von China dominierte asiatische Epoche eintreten wird. Sie ist längst beantwortet und über sämtliche Kontinente hinweg in vollem Gang. Afghanistan ist nur eine weitere logische Folge, die den Chinesen in den Schoss fällt.
Der Westen hat es unter der Führung des transatlantischen Hegemons der kommenden Weltmacht China über Jahrzehnte hinweg aber auch leicht gemacht. Während die westlichen Industriestaaten die Globalisierung wie eine heilige Kuh rund um den Erdball zur Staatsdoktrin erklärten, musste China nur geduldig abwarten. Erinnert an die Taliban: «Ihr habt die Uhr. Wir haben die Zeit».
Der unermesslichen Gier der westlichen Hochfinanz und Börsen, allen voran die Wall Street in New York, konnte sich die «Gelbe Gefahr», wie China bei einer Rede vom längst verstorben deutschen Bundeskanzler Adenauer in einer Rede einmal warnend betitelt wurde, sicher sein. Was ist schon eine «Wall Street» gegenüber der Jahrtausende alten «Great Wall» (Chang Cheng; chinesische Mauer) aus dem Land des Lächelns?
Ein Industriezweig nach dem andern wurde zum Wohle westlicher Oligarchen an China verscherbelt. Die «Volksrepublik» mit der «kommunistischen» Einheitspartei lächelte sich ins Fäustchen. Wohlwissend, dass sich der Westen damit in eine Abhängigkeit Chinas manövriert, die über einen langen Zeitraum hinweg nicht mehr zu korrigieren ist. Machen wir uns nichts vor: Da stecken wir längst mittendrin!
Denn die westlichen Weltenlenker mit dem Dollarblick in den Augen waren sich nie bewusst, dass mit diesem industriellen Ausverkauf, den China ab einem gewissen Moment übrigens äusserst smart steuerte, auch unendlich viel Wissen verloren ging.
Heute sind die USA und Europa nicht einmal mehr in der Lage, ohne gütige Hilfe aus Asien eine lächerlich simple Corona-Schutzmaske herzustellen. Geschweige denn ein Smartphone, einen Fernseher oder einen Computer.
Der ehemalige Kopist entwickelte sich von der billigen Werkbank des Westens zu einem gigantischen industriellen Globalplayer, der nicht nur die Zukunftsindustrien wie KI mit eigenem Wissen bestens beherrscht, sondern selbst im Weltraum technologisch mitmischt. Dass China inzwischen für viele Produkte auch der wichtigste Markt der Welt ist, kommt hinzu.
Das Fiasko des Westens in Afghanistan ist nach den kriegerischen Interventionen im Irak, in Syrien, Libyen und etlichen anderen Staatsgebilden nur eine weitere Episode im Versagen um die Deutungshoheit systemischer und kultureller Überlegenheit.
Vom amerikanischen Leitmotiv «He may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch» (Anm. gemeint war Kubas Diktator Fulgencio Batista) wich die westliche Streitmacht auch am Hindukusch nicht ab. Eine vom Westen installierte und gelenkte Scheinregierung in Kabul entsprach in Sachen Kleptomanie und Korruption genau dieser jeglicher Moral widersprechenden und bis heute gültigen Denkweise des Westens, die auch von der chinesischen Nomenklatura intensiv gepflegt wird.
Doch im Gegensatz zum Westen versteigt sich China nicht in einen heuchlerischen und inzwischen absurden Wertekanon, der nicht nur einer Kultur aus dem Steinzeitalter wie dem Islam fremd ist, sondern uns selbst langsam aber sicher unheimlich wird.
Statt gendergerechte Toiletten in Kabul zu bauen, wird China nun langfristig die Bodenschätze Afghanistans zum Wohle Chinas plündern und das Projekt der «Seidenstrasse» um einen Staat erweitern. Gelebte Demokratie und Menschenrechte hingegen gehören nicht zum Wortschatz der Söhne und Töchter von Konfuzius.
Das kann den Taliban nur recht sein. Für die leibliche Versorgung des leidgeprüften afghanischen Volkes wird sowieso weiterhin der Westen mit seinen NGO und Hilfsgeldern in Milliardenhöhe zuständig sein. Nach den in den letzten 20 Jahren verballerten Billionen spielen ein paar weitere Milliarden keine Rolle mehr.
Und sollten für China doch noch alle Stricke reissen, haben die Machthaber aus Peking genügend Erfahrung mit renitenten Muslimen im eigenen Land.
Wer mehr als eine Million Uiguren wegsperren kann, wird doch sicherlich auch in der Lage sein, für paar Hunderttausend Taliban-Krieger in Flip Flops ein Umerziehungscamp einzurichten, um ihnen die Vorteile konfuzianischen Denkens inklusive Genuss von Schweinefleisch schmackhaft zu machen.
Ni hao!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.8.2021 - Tag der Erstbesteigung von Beatrice Egli
«Wahnsinn!» – Beatrice Egli hat das Matterhorn bestiegen
Sie sei fix und fertig und brauche erst einmal eine Rösti: Der Schwyzer Schlager-Star ist Teil eines Projekts, bei dem reine Frauenseilschaften innerhalb von sieben Monaten 48 Viertausender erklimmen.
Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (33) hat nach eigenen Angaben erfolgreich das Matterhorn bestiegen. «Ich glaub’s noch gar nicht! Wahnsinn!», schrieb sie auf Instagram. Besonders der Abstieg sei anstrengend gewesen, sie sei «fix und fertig», erzählte sie in einem Video. Sie werde nun als Erstes Rösti essen gehen.
Für das Projekt mit anderen Bergsteigerinnen hatte sie ein Dreivierteljahr trainiert, wie sie der Deutschen Presse-Agentur vor wenigen Tagen sagte. «Es gab Momente, da wollte ich aufgeben, aber in einer starken Gruppe mit Frauen zu sein, gibt mir Kraft.»
Zum Weltfrauentag hatte Schweiz Tourismus eine Aktion ins Leben gerufen, bei der 48 Viertausender der Schweiz innerhalb von sieben Monaten von reinen Frauenseilschaften bestiegen werden sollen. 47 Gipfel sind nach Angaben der Veranstalter bereits erklommen. Das Tourismusbüro von Zermatt gratulierte Egli nun bei Instagram.
Die Sängerin veröffentlicht kommende Woche ein neues Album, auch mit einem Song namens «Matterhorn». Sie singt ihn in Schweizerdeutsch. Der Song sei erst nach der Idee mit der Besteigung entstanden, sagte sie. Schreibt 20Minuten (beziehungsweise Beatrice Egli auf Instgram).
Die Maria Callas der Schlagersängerinnen hat also das Matterhorn bestiegen! Gott sei Dank war's nicht umgekehrt. Man stelle sich mal den #-me too-Shitstorm vor, hätte das Matterhorn die wunderbare und einzigartige Beatrice Egli bestiegen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.8.2021 - Tag der islamistischen Atombombe
Ehemaliger US-Sicherheitsberater Bolton: «In Afghanistan drohen neue nukleare Risiken»
John Bolton (72) war bis September 2019 Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus. Einen Abzug aus Afghanistan hielt er immer für falsch – als Donald Trump auf die Taliban zuging, trat Bolton zurück. Im RND-Interview warnt er jetzt: Das Chaos in Kabul blamiert die USA rund um den Globus – und schafft neue nukleare Risiken, über die weltweit bislang viel zu wenig gesprochen werde.
Botschafter Bolton, Sie haben sich, solange Sie noch im Weißen Haus waren, gegen den schon damals von Trump geplanten Abzug aus Afghanistan gestemmt. Warum? Sind 20 Jahre Stationierung von US-Soldaten am Hindukusch nicht genug?
Mal ehrlich: Was sind schon 20 Jahre? In Deutschland waren wir 45 Jahre stationiert, bis die Mauer fiel. Auch danach sind wir, wie Sie wissen, geblieben. Und das ist genau richtig so. Denn Amerikas Präsenz in Mitteleuropa liegt im beiderseitigen strategischen Interesse. Jede Abzugsdebatte schadet da nur. Für Südkorea und Japan gilt das Gleiche. In diesem Sinne hätte man auch über Zentralasien reden sollen: ganz nüchtern, interessenorientiert.
War Trump dazu nicht bereit?
Nein. Er beleuchtete das Thema Afghanistan – ebenso wie alle anderen Themen – ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, in welcher Weise es sich auf seine mögliche Wiederwahl auswirken könne. Wie verhängnisvoll sich diese Betrachtungsweise in den Jahren 2018 und 2019 auf die Außenpolitik der USA auswirkte, habe ich in meinem Buch „Der Raum, in dem alles geschah“ beschrieben. Der Streit um Afghanistan war einer der Gründe für meinen Rücktritt.
Hatte Trump nicht doch das richtige Gespür? Umfragen aus diesem Sommer haben gezeigt, dass eine Mehrheit der Amerikaner des Afghanistan-Einsatzes wirklich müde war.
Heute ist eine Mehrheit entsetzt über das Chaos in Kabul. Es kommt sehr darauf an, wie ein US-Präsident seine Politik begründet. Die Amerikaner können, das Beispiel Deutschland zeigt es, in Wirklichkeit auch sehr geduldig und sehr verständnisvoll sein, wenn ihnen klar wird, dass es um langfristige strategische Interessen geht.
In Afghanistan war oft feierlich von „nation building“ die Rede, man bohrte Brunnen, baute Mädchenschulen. Hat der Westen sich selbst und anderen die falsche Geschichte erzählt?
Ich war immer dafür, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Wir sind nicht nach Afghanistan gegangen, um dort ein zentralasiatisches Musterland aufzubauen, so sehr ich den Afghanen jeden zivilen Fortschritt wünsche. Es ging in Afghanistan um Sicherheitsinteressen der USA und des westlichen Bündnisses, Punkt. Nach dem Anschlag aufs World Trade Center haben wir das Terrornetzwerk Al-Kaida zerstört, dem das Talibanregime Schutz und Schirm geboten hatte. Und danach haben wir es auch hinbekommen, dass die Taliban nicht zurückkehrten. Jetzt aber, nach dem von Trump geplanten und von Biden durchgezogenen Rückzug, einem gravierenden weltpolitischen Stockfehler, bei dem die Kontrahenten kurioserweise einig sind wie Tweedledee und Tweedledum, passiert genau das: Wir fallen zurück in einen Zustand wie vor dem 11. September 2001. Darin liegt sicherheitspolitisch ein Risiko für die gesamte Welt.
Viele sagen, die Taliban seien doch inzwischen gemäßigt.
Wir dürfen jetzt bitte nicht naiv sein, sondern müssen genau hinsehen. Was genau machen sie mit den Frauen? Wie gehen sie mit ihren politischen Gegnern um? Ich bin da ehrlich gesagt nicht optimistisch. Die haben sich doch nicht 20 Jahre lang mühsam versteckt, um jetzt zu sagen: Okay, nun ist ein guter Moment gekommen, um unsere Grundsätze aufzugeben. Statt neue Illusionen aufzubauen, sollten wir den neu entstehenden Bedrohungen ins Auge sehen.
Was haben Sie da konkret vor Augen?
In Afghanistan drohen neue nukleare Risiken, nicht morgen oder in 30 Tagen, aber mittelfristig. Viele übersehen einen wichtigen Punkt. In Afghanistan ging es nie nur um Afghanistan. Unsere Präsenz dort hat immer auch dazu gedient, Informationen aus zwei problematischen Nachbarländern mit Nuklearprogrammen zu sammeln, Pakistan und Iran. Unsere Fähigkeit, die Region zu durchleuchten, wird jetzt durch den Abzug reduziert. Dass auch die Taliban an Atomwaffen interessiert sind, wissen wir bereits seit 2001.
Ist es nicht aber für das arme Afghanistan noch ein weiter Weg bis zur Atommacht?
Gegenfrage: Was passiert im Fall eines Umsturzes in Pakistan? In einem Szenario mit Kontrollverlust könnten Fundamentalisten, die bereits den Einsturz des World Trade Centers bejubelt haben, in den Besitz der Atombombe gelangen. Man braucht keinen B‑52‑Bomber, um sie dann etwa in die USA zu bringen. Man kann damit über die mexikanische Grenze fahren, man kann damit auch in den Hafen von New York segeln. Ich bin für „forward defense“, für wachsame Präsenz in problematischen Regionen. Leider haben mittlerweile schon drei US-Präsidenten hintereinander wenig Verständnis für diesen Ansatz gezeigt: Biden, Trump und Obama. Aus dieser fortgesetzten Politik der Schwäche zieht jetzt die Welt ihre Schlüsse. Für viele Menschen ist das bedrückend, etwa in Taiwan, der Ukraine oder Belarus.
In China höhnte eine Staatszeitung, die zerstobene reguläre Regierung in Kabul zeige, wie es jenen ergehe, die auf die USA vertrauten.
Damit beschreiben Sie exakt das Glaubwürdigkeitsproblem, das Biden soeben für die USA geschaffen hat – und nebenbei gesagt auch für sich persönlich. Die Wirren in Kabul haben sein Ansehen als außenpolitisch besonders engagierter und versierter Präsident beschädigt. Noch schlimmer ist, dass Biden nun eigenhändig seine gute Idee sabotiert, die Demokratien der Erde enger zusammenzuführen. Eben noch sprach er davon, Amerika sei zurück, nun gehe es um ein Bündnis aller Menschen, denen Freiheit wichtig ist. Und dann schubst er die Afghanen unter den Bus. Beim besten Willen: Das passt nicht zusammen.
Botschafter Bolton, herzlichen Dank für das Gespräch. Schreibt RND.
Scheinbar war mein gestriger Kommentar nicht ganz so abwegig wie einige meinten, die mir den berühmten Vogel zeigten, weil ich vor der Unterwanderung der islamischen Atommacht Pakistan durch die Taliban warnte. Deshalb wiederhole ich meinen gestrigen Kommentarheute nochmals. Diesmal mit dem Segen von John Bolton.
Nicht um mir auf die Schulter zu klopfen. Sondern um Sie ohne Paranoia nochmals auf diesen einen Satz aus Samuel P. Huntingtons Buch «The Clash of Civilizations» (wörtlich auf deutsch «Zusammenprall der Zivilisationen») hinzuweisen: «Wir werden dieser Kraft (Anm. gemeint ist der Islam) nichts entgegenzusetzen haben.»
Denken Sie über diesen Satz einmal nach, wenn Sie Zeit und Musse dazu finden. Oder noch besser: Lesen Sie Huntingtons Buch. Vergleichen Sie danach einige Buchpassagen mit persönlichen Erfahrungen, die Sie mit hier ansässigen Muslimen der zweiten Generation gemacht haben. Ohne Vorurteile in die eine oder andere Richtung.
Man muss den republikanischen «Falken» und US-Hardliner nicht mögen. Man darf ihm sogar die üblichen amerikanischen Kriegsgelüste vorwerfen. Aber ein Dummkopf ist Bolton nicht. Es ist auch anzunehmen, dass er doch etwas mehr Informationen über die weltweiten Krisenherde hat als wir.
Mein Posting vom 18.8.2021: Mehr Gedanken sollte sich die westliche «Wertegemeinschaft» darüber machen, dass die erste Ausgabe des «Islamischen Emirats Afghanistan» in den Jahren 1996 bis 2001 unter dem einäugigen Mohammed Omar als Staatsoberhaupt nur von drei Staaten offiziell anerkannt wurde: Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Pakistan.
Die beiden erstgenannten Länder bekannt als beste Freunde und Business-Partner der «Wertegemeinschaft», während es sich bei Pakistan um eine ernstzunehmende «Atommacht» handelt. Laut westlichen «Experten» soll Pakistan längst von den Taliban unterwandert sein, die zu einem grossen Teil in den pakistanischen Koranschulen gezeugt und zu Gotteskriegern erzogen wurden.
Das kann ja noch heiter werden, wenn uns die bärtigen Flip Flop-Söhne Allahs zeigen, wo man den Most holt.
Auf die westlichen Geheimdienste sollte man sich auf jeden Fall nach all den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte nicht unbedingt verlassen. Auf die «Wertegemeinschaft» schon gar nicht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
18.8.2021 - Tag der islamistischen Atombombe
Schweizer Taliban-Freunde feiern «eindeutigen Sieg» in Afghanistan
Die «Liga der Gelehrten des Arabischen Maghreb» mit Sitz in Genf freut sich über den Sieg der Taliban in Afghanistan. Wer sind die Schweizer Anhänger der radikalislamischen Bewegung?
In einem Schreiben vom 15. August segnet der Verein «La Ligue des Savants du Maghreb Arabe», zu Deutsch «Die Liga der Gelehrten des Arabischen Maghreb» den Sieg der Taliban in Afghanistan. Er drückt seine Freude darüber aus, dass «Allah unseren afghanischen Brüdern einen eindeutigen Sieg bescherte, nachdem es eine Zeit lang keine solchen Siege der Muslime über ihre Feinde gegeben hat.»
Der Verein ist in Genf registriert. Hierzulande kennt kaum jemand die Organisation. Auch bei muslimischen Vereinen in der Schweiz, etwa beim islamischen Zentralrat, zucken viele Angefragte nur mit den Schultern. Recherchen zeigen: Gegründet wurde der Verein 2013 in Istanbul. Zeichnungsberechtigt ist laut der Registrierung ein Albaner aus Tirana, Sekretär ist ein in der Schweiz lebender Tunesier, Kassier ist ebenfalls ein Tunesier.
Präsident wegen Terrorismus verurteilt
Präsident der Bewegung ist Hassan Kettani, wie er in seinem Twitter-Profil schreibt. Kettani wurde 2003 im Zusammenhang mit Terroranschlägen im marokkanischen Casablanca verhaftet und zu 20 Jahren Haft verurteilt, wobei er stets seine Unschuld beteuerte. Im Zuge des arabischen Frühlings wurde Kettani 2012 gemeinsam mit weiteren Islamisten vom König begnadigt.
Allfällige Verstrickungen in die Terroranschläge wurden nie sauber aufgearbeitet. Kettani gilt aber als einer der Geistlichen des salafistischen Dschihadismus und habe wiederholt gegen Säkularisten in Marokko agitiert. Das schreibt Kacem El-Ghazzali, atheistischer Aktivist, Menschenrechtsexperte und Essayist mit marokkanischer Herkunft auf Twitter.
Das Schreiben vom 15. August spricht laut El-Ghazzali eine klare Sprache: «Es werden eindeutig salafistische, militante Begriffe verwendet. Es ist zum Beispiel von der Eroberung al-fateh die Rede, ein dschihadistischer Begriff, der oft in Zeiten des Krieges gegen die Ungläubigen oder der grossen islamischen Expansionen des siebten Jahrhunderts verwendet wird.» Auch die mehrfache Erwähnung der Feinde des Islams machen laut El-Ghazzali deutlich: «Es handelt sich bei dieser Nachricht der Liga nicht um eine emanzipatorische Freude an der Befreiung, sondern um ein salafistisches, dschihadistisches Lexikon.»
Behörden geben sich zugeknöpft
Doch was macht «La ligue» in der Schweiz? Und stellt die Bewegung eine Bedrohung dar? Die Behörden zeigen sich zugeknöpft. Laurent Paoliello, Kommunikationsleiter des Genfer Sicherheitsdepartements, schreibt, dass man sich zu diesem Zeitpunkt nicht zur «Situation» äussern werde. Ob die Genfer Vereinigung den Behörden bekannt ist, bleibt unklar. Das Bundesamt für Polizei Fedpol verweist auf Anfrage an den Nachrichtendienst des Bundes, der «für die Einschätzung der Bedrohungslage zuständig sei». Dort blieb eine Anfrage am Dienstag unbeantwortet.
Für El-Ghazzali ist klar: Genf wurde nicht zufällig ausgewählt, um den Sitz zu registrieren: «Solche radikalen Organisationen brauchen für die Koordination der Finanzströme eine Postanschrift und ein Bankkonto. In den Mahgreb-Staaten sind die Hürden dafür aber viel höher und die Kontrollen der Mitglieder rigoroser.» In der Schweiz schaue man oft nicht so genau hin, wenn ein islamischer Verein gegründet werde.
«Man darf nicht alle in der Schweiz registrierten muslimischen Organisationen unter Generalverdacht stellen. Aber Organisationen wie die Liga, die sich in ihrem Gründungsregister einer politisch korrekten Sprache bedient, um sich als ‘moderate Gruppe’ zu präsentieren, in Wirklichkeit aber eindeutig fundamentalistisch ist, sind eine Herausforderung für die Behörden», sagt El-Ghazzali. «Es sollte einen Mechanismus geben, um die Ziele und Aktivitäten solcher Organisationen auch nach ihrer Gründung zu evaluieren.»
Kacem El-Ghazzali
Der säkulare Essayist und Menschenrechtsexperte ist Schweizer mit marokkanischer Herkunft. El-Ghazzali verfasst regelmässig Texte für Schweizer Medien wie die NZZ. Seit 2012 ist El-Ghazzali Vertreter der Internationalen Humanistischen und Ethischen Union beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sowie Nahost- und Nordafrikaberater bei der NGO Humanists International. Schreibt 20Minuten.
Dass sich die islamischen Bartlis freuen – und dies längst nicht nur in der Schweiz, sondern around the World – «dass «Allah unseren afghanischen Brüdern einen eindeutigen Sieg bescherte, nachdem es eine Zeit lang keine solchen Siege der Muslime über ihre Feinde gegeben hat» ist nachvollziehbar.
Die hehre westliche «Wertegemeinschaft» unter der Führung der mächtigsten Militärmaschinerie der Welt hat ja 20 Jahre lang auch wirklich nichts unterlassen, um letztendlich den bärtigen Gotteskriegern mit den Birkenstock-Flip Flops an ihren Füssen den Sieg über die «Ungläubigen» auf dem Silbertablett zu servieren.
Wenn eine Velotöffli-Armee gegen eine hochgerüstete Streitmacht in gepanzerten Humvees kampflos einen Staat mit knapp 40 Millionen Einwohnern*innen übernehmen kann, ist Hohn und Spott nicht nur unvermeidbar, sondern auch angebracht. Besonders bei den armseligen arabischen Losern, die für ihre prosaische Grossmäuligkeit im Namen von Allah uakbar seit Jahrhunderten bekannt sind. Nicht aber für Fleiss und Arbeitsamkeit.
Die Prahlereien hirnverbrannter Islamisten sind vernachlässigbar. «Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein kleiner Schritt», wie Napoleon Bonaparte treffend bemerkte.
Mehr Gedanken sollte sich die westliche «Wertegemeinschaft» darüber machen, dass die erste Ausgabe des «Islamischen Emirats Afghanistan» in den Jahren 1996 bis 2001 unter dem einäugigen Mohammed Omar als Staatsoberhaupt nur von drei Staaten offiziell anerkannt wurde: Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Pakistan.
Die beiden erstgenannten Länder bekannt als beste Freunde und Business-Partner der «Wertegemeinschaft», während es sich bei Pakistan um eine ernstzunehmende «Atommacht» handelt. Laut westlichen «Experten» soll Pakistan längst von den Taliban unterwandert sein, die zu einem grossen Teil in den pakistanischen Koranschulen gezeugt und zu Gotteskriegern erzogen wurden.
Das kann ja noch heiter werden, wenn uns die bärtigen Flip Flop-Söhne Allahs zeigen, wo man den Most holt.
Auf die westlichen Geheimdienste sollte man sich auf jeden Fall nach all den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte nicht unbedingt verlassen. Auf die «Wertegemeinschaft» schon gar nicht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.8.2021 - Tag des Kadavergehorsams gegenüber Amerika
Scholl-Latour erklärte 2014 Afghanistan für verloren
Im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags hat Peter Scholl-Latour den deutschen Afghanistan-Einsatz zerrissen. Der Bundeswehr warf der Reporter vor, ihre Lager am Hindukusch kaum noch zu verlassen.
Wenn der Auswärtige Ausschuss des Bundestags tagt, tut er dies hinter geschlossenen Türen. Am Mittwoch machte er eine Ausnahme. Der Grund: Bei einer Anhörung sollte es um die Lektionen gehen, die Deutschland aus dem Einsatz der Internationalen Schutztruppe für Afghanistan (Isaf) ziehen kann. Der Einsatz endet am 31. Dezember 2014.
Dass die Besuchertribüne dabei voll besetzt war, lag am Thema, aber auch am Stargast der Sitzung. Denn als Experte war Peter Scholl-Latour eingeladen. Der inzwischen 90-jährige Journalist verkörpert wie kein anderer den Typus des Kriegsreporters, der die ganze Welt bereist hat.
Er war mit französischen Fallschirmjägern in Indochina, erlebte den kongolesischen Bürgerkrieg und begleitete Ajatollah Khomeini, als dieser aus dem französischen Exil in den Iran zurückkehrte. Auch Afghanistan kennt Scholl-Latour schon lange, er ist mehrfach im Land unterwegs gewesen. In der Wissenschaft ist der Bestseller-Autor gleichwohl umstritten: Kritiker werfen ihm vor, in seinen Analysen eindimensional, oberflächlich und mitunter rassistisch zu sein.
Warnung vor „Stimmzettelfetischismus“
Scholl-Latour ficht das nicht an. Diplomatie hat er sich stets für die heiklen Begegnungen mit den Warlords aufgehoben; zum Beispiel dann, wenn es darum ging, eine Einladung zum Tee lebend zu überstehen. Dem Auswärtigen Ausschuss sagte er hingegen deutlich, was er vom Einsatz in Afghanistan hält. „Der Krieg in Afghanistan ist verloren – das sollten wir uns eingestehen“, lautet die Bilanz von Scholl-Latour. „Und wir sollten uns überlegen, wie wir da rauskommen.“
Die internationale Gemeinschaft habe in den vergangenen zwölf Jahren offenbar nichts dazugelernt. Die Vorstellung, man könne nach einem Abzug der Schutztruppe mit einem kleinen Restkontingent die afghanische Armee ausbilden, sei „völlig illusorisch“. Zumal Letztere, das habe er selbst in Gesprächen mit Soldaten erfahren, aus gesinnungslosen „Tagelöhnern“ bestehe. Dies sei auch der Grund, warum 2001 der Versuch, Al-Qaida-Führer Osama bin Laden bei der Schlacht um Tora Bora dingfest zu machen, gescheitert sei: weil man die Aktion den Afghanen überlassen habe.
Er selbst würde heute nicht mehr ohne Schutz außerhalb Kabuls reisen, sagte Scholl-Latour. Wer sich von der bevorstehenden Wahl eine Besserung der Lage verspreche, der betreibe „Stimmzettelfetischismus“. Denn die Wahllisten würden von Warlords dominiert.
Scharfe Kritik an der Bundeswehr
Auch die Bundeswehr kam bei Scholl-Latour nicht gut weg: Diese verlasse ihre Lager kaum noch und sei für den „Partisanenkrieg“, der Afghanistan beherrsche, nicht vorbereitet. Zumal jeder zwölfjährige afghanische Junge ein „geborener Partisan“ sei.
Es sind Sätze wie diese, die bei den anderen geladenen Experten ein Wispern hervorriefen. Auch sie hatten auf die schlechte Lage vor Ort hingewiesen, dabei aber auch Möglichkeiten der Verbesserung skizziert. Der Westen müsse sich stärker auf die Entwicklungshilfe konzentrieren, sagte etwa Thomas Ruttig, langjähriger Mitarbeiter der UN-Mission in Kabul. Die Vertreterin des dortigen Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, Adrienne Woltersdorf, forderte eine stärkere Unterstützung für den Wirtschaftsaufbau.
65 Prozent der afghanischen Bevölkerung seien unter 25 Jahre; für die müsse es Beschäftigungsperspektiven geben, wenn man die Lage stabilisieren wolle, betonte Woltersdorf. Als Einzige in der Runde verwies sie mehrfach auf die positiven Entwicklungen im Land. Dass dort Ende der Woche tatsächlich die Präsidentschaftswahl stattfinden würde, sei „ein Erfolg“. Von den Afghanen selbst werde kritisch gesehen, dass sich unter den Kandidaten viele Warlords tummeln würden.
Mehrheit der Bürger teilt Scholl-Latours Meinung
Es sei aber auch eine neue Form der „Kompromisskultur“ erkennbar, meinte Woltersdorf: „Afghanische Politiker haben verstanden, dass es nicht nur um eine Ethnie gegen eine andere gehen kann.“ Deutschland genieße nicht zuletzt aufgrund der historischen Verbindungen beider Länder immer noch ein besonderes Vertrauen in der afghanischen Bevölkerung und könne bei der künftigen Entwicklung eine „besonders positive Rolle“ spielen.
Scholl-Latour kann solchen Überlegungen nicht viel abgewinnen. Man müsse Afghanistan den Afghanen überlassen, sagte er. Diese Position vertritt er bereits seit Jahren. Die Mehrheit der Deutschen teilt Umfragen zufolge seine Meinung: Sie hält den Einsatz für einen Fehlschlag. Schrieb DIE WELT am 2.4.2014.
In ihrer atemlosen Sensations-Berichterstattung in den Live-Tickern überbieten sich die Schmalspur-«Medienschaffenden» und selbsternannten «Afghanistan»-Experten gegenseitig im Minutentakt an Dummheit und historischer Unwissenheit über das Land am Hindukusch in ihren von US-Presseagenturen abgeschriebenen oder entlehnten Short-Messages und «Kommentaren». Die häufigste Titelüberschrift folgt dem immergleichen Tenor «Wie konnte das nur passieren?» oder «Wie konnten die Taliban nur so schnell Kabul erobern?».
2014 gab der inzwischen verstorbene Peter Scholl-Latour im Auswärtigen Ausschuss des deutschen Bundestags auf die heute so aktuellen Fragen bereits seine unmissverständliche Antwort und prangerte die Schönfärberei des Westens an. Er wurde darauf von den gleichen Leuten, die heute, mehr als acht Jahre später, händeringend nach Antworten und Erklärungen suchen, mit «Leitartikeln» überzogen, die vor Verachtung trieften und ihn nicht selten gar als «Rassist» verurteilten. Scholl-Latour mag für viele wegen seiner schonungslosen Offenheit ein unangenehmer Zeitgenosse gewesen sein. Ein Rassist war er nie.
Es ist inzwischen leider in den Medien zur Gewohnheit geworden, nicht dem Mainstream entsprechende Aussagen mit der inflationär angewendeten Rassismus-Keule zu brandmarken, wenn Argumente fehlen. Eine Keule des heutigen Zeitgeistes, die aber die Abscheulichkeit des Begriffs «Rassismus» eher verharmlost, wenn sie in falschen Zusammenhängen angewendet wird. Es macht Scholl-Latour nicht zum Rassisten, wenn er die bedingungslose Zustimmung und den Kadavergehorsam Europas seit dem Vietnamkrieg (!) gegenüber den amerikanischen Kriegszügen scharf kritisiert.
Wie dieser von Scholl-Latour benannte blinde Gehorsam Europas gegenüber Amerika letztendlich seit Jahrzehnten und vielen Waffengängen der hehren westlichen Wertegemeinschaft im Gleichklang mit den USA endet, erleben wir einmal mehr in diesen Tagen. Mitgegangen, mitgefangen. The same procedure as every war. Das wird uns die kommende Flüchtlingswelle eindeutig vor Augen führen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.8.2021 - Tag der US-Geheimdienste
Die Folgen des Taliban-Siegeszugs
Neun Tage nach der Eroberung der ersten Provinzhauptstadt sind die radikal-islamistischen Taliban bis in die afghanische Hauptstadt Kabul vorgerückt. In der Bevölkerung ist die Angst vor Vergeltungsaktionen der Fundamentalisten groß. Auch international herrscht Besorgnis über die Folgen des Taliban-Siegeszugs.
In „30 bis 90 Tagen“ werde Kabul an die Taliban fallen, lautete die Einschätzung der US-Geheimdienste noch vergangene Woche. Die Annahme hielt nicht einmal fünf Tage: Am Sonntag sind die Islamisten in die Hauptstadt Afghanistans eingedrungen und haben den Präsidentenpalast besetzt. Präsident Ashraf Ghani hat das Land fluchtartig verlassen. Nach Angaben des früheren afghanischen Staatschefs Hamid Karzai wurde ein „Koordinierungsrat“ gebildet, der eine friedliche Machtübergabe an die Fundamentalisten gewährleisten soll.
In den vergangenen Tagen nahmen die Taliban zahlreiche wichtige Städte ein, viele davon kampflos, wie etwa die Handelsstadt Jalalabad. Auch die große Schlacht um Kabul blieb aus. Die afghanischen Sicherheitskräfte – die zwei Jahrzehnte lang mit Milliarden aus dem Westen aufgebaut wurden – leisteten kaum Widerstand. Auch die sich in der Stadt befindlichen 5.000 Angehörigen der US-Streitkräfte griffen nicht ein. Ihre Mission war es einzig und allein, den Abzug des diplomatischen Personals zu sichern.
Furcht vor Vergeltung
20 Jahre, nachdem die USA und ihre Verbündeten im Rahmen der „Operation Enduring Freedom“ die Herrschaft der Taliban beendeten, greifen die Fundamentalisten wieder nach der Macht. In der Bevölkerung weckt das düstere Erinnerungen an die Jahre 1996 bis 2001, als die Islamisten gemäß ihrer Auslegung des islamischen Rechts (Scharia) Hinrichtungen durchführten, Frauen das Arbeiten verboten, Mädchenschulen schlossen und die meisten Sportarten, Musik und Tanz untersagten.
Im Juni stellten die Taliban „Erleichterungen“ für Frauen und eine Möglichkeit zur Ausbildung in Aussicht. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen wolle man ein „echtes islamisches System“ errichten, in dem Rechte von Frauen und Minderheiten in diesem Sinne geschützt werden, erklärten die Taliban bei „Friedensverhandlungen“ mit der afghanischen Regierung in Katar.
„Wir wollen mit jedem Afghanen zusammenarbeiten, wir wollen ein neues Kapitel des Friedens, der Toleranz, der friedlichen Koexistenz und nationalen Einheit für unser Land und das Volk von Afghanistan aufschlagen“, sagte Taliban-Vertreter Suhail Shahin am Sonntag der BBC. Wie viel die Ankündigung wert ist, wird sich weisen. Die Tausenden Afghaninnen und Afghanen, die für die westlichen Militärs tätig waren, fürchten Racheakte der Islamisten. Hinzu kommen Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten, die schon in den vergangenen Jahren oft Ziel von Anschlägen der Islamisten wurden.
Warnung vor neuen Flüchtlingsbewegungen
Europa beschäftigt indes die Sorge vor einer neuen Flüchtlingsbewegung. Tausende Afghaninnen und Afghanen waren in den vergangenen Tagen im eigenen Land auf der Flucht vor den vorrückenden Taliban. Viele suchten Schutz in Kabul. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach sich noch am Sonntag abermals gegen einen generellen Abschiebestopp aus. Nehammer und ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg planen eine Afghanistan-Konferenz mit den zentralasiatischen Nachbarländern des Krisenlandes und einigen EU-Ländern, um möglichst zielsicher Hilfe vor Ort bieten zu können, wie sie am Sonntag mitteilten.
Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, drängte angesichts der erwarteten Fluchtbewegung aus Afghanistan auf eine schnelle Einigung bei der EU-Migrationspolitik. „Die Krise in Afghanistan, aber nicht nur sie, macht es noch offensichtlicher, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass es Zeit ist, sich über den neuen europäischen Migrationspakt zu einigen“, sagte Schinas der italienischen Tageszeitung „La Stampa“.
Der an Afghanistan grenzende Iran hat nach eigenen Angaben bereits mit der Einrichtung von Pufferzonen an den Grenzen begonnen. Albanien und der Kosovo kündigten unterdessen die vorübergehende Aufnahme afghanischer Geflüchteter an. Die Menschen sollen später in die USA gebracht werden.
Das Ende der westlichen Militärinterventionen
Die Geschehnisse in Afghanistan haben zudem weltpolitische Tragweite. Das Land könne zu einem „Quell der Instabilität für die ganze Region werden“, warnte der „Spiegel“. Afghanische Warlords könnten sich gegen die Taliban in Stellung bringen, die umliegenden Regionalmächte Iran, Pakistan und Indien könnten sich über Stellvertretertruppen einmischen.
Ob sich die USA und Europa nochmals militärisch in der Region engagieren werden, ist höchst ungewiss. „Das monumentale Afghanistan-Debakel markiert eine Wende: In absehbarer Zeit wird es wohl keine westlichen Militärinterventionen mehr geben, so dick kann der humanitäre Anstrich gar nicht sein“, kommentierte die „Presse“.
Eine „neue Ära der Gleichgülitgkeit“ beginne, schrieb das Blatt: „Das wird autokratische Regime ermuntern, ihre neuen Grenzen auszuloten.“ So könnte etwa China in die Lücke vorstoßen, die Washington hinterlässt. Eine Taliban-Abordnung war Ende Juli bereits in Peking zu Gast.
Scharfe Kritik an Biden
In den USA wird nach dem Scheitern des Westens in Afghanistan Kritik an Präsident Joe Biden lauter. Der Abzug der US-Truppen aus dem Land war zwar noch von Bidens Vorgänger Donald Trump auf den Weg gebracht worden; Biden war es jedoch, der ungeachtet der sich verschlechternden Sicherheitslage die Truppen heimholte. Noch Anfang Juli erklärte Biden, es sei „unwahrscheinlich“, dass die Taliban das Land überrennen könnten.
Sicherheitsexpertinnen und -experten versuchten Biden laut US-Medien davon zu überzeugen, den Truppenabzug um einige Monate zu verschieben, um der afghanischen Armee Zeit zu geben, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Biden blieb hart: Bis spätestens 11. September – dem 20. Jahrestag der 9/11-Terroranschläge – werde der Abzug abgeschlossen, erklärte der Präsident.
Von einem Tag auf den anderen verlor der afghanische Armee die Luftaufklärung und Luftunterstützung des US-Militärs. Ebenso schwer wog der gleichzeitige Abzug privater Sicherheitsunternehmen, die unter anderem für die Wartung und Instandhaltung der afghanischen Luftstreitkräfte zuständig waren.
Allein die Kosten der USA für den Afghanistan-Einsatz belaufen sich auf 2.200 Mrd. Dollar. Mehr als 90 Mrd. Dollar davon wurden für den Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte ausgegeben. Viele der angekauften Waffen, gepanzerten Fahrzeuge und Kampfdrohnen fielen in die Hände der Taliban. Das nährt die Angst vor Terror: Es sei „sehr wichtig, dass der Westen zusammenarbeitet, um dieser neuen Regierung – ob es Taliban sind oder jemand anderes – klarzumachen, dass niemand will, dass Afghanistan wieder zur Brutstätte für Terrorismus wird“, sagte der britische Premier Boris Johnson. Schreibt ORF.
«In 30 bis 90 Tagen werde Kabul an die Taliban fallen, lautete die Einschätzung der US-Geheimdienste noch vergangene Woche.»
So viel zum Geheimdienst der Amerikaner.
«Errare humanum est», wie wir Lateiner*innen zu sagen pflegen. (Anm. für alle Unbedarften, die der lateinischen Sprache nicht mächtig sind: Irren ist menschlich).
Das war schon mit den «Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein» im Irak der Fall. Hat mit «errare humanum est» aber rein gar nichts zu tun. Das war nichts anderes als eine faustdicke Lüge, konstruiert von den US-Geheimdiensten, um eine Rechtfertigung für den Irak-Feldzug vor der UNO präsentieren zu können.
Was sagt uns dies? Dass die UNO sich jeden Bären aufbinden lässt und dass auf die US-Geheimdienste kein Verlass ist. Wenn sie sich nicht irren, lügen sie.
Unerträglich ist derzeit auch die Heuchlerei des Westens um das neue Staatsgebilde des «Islamischen Emirats Afghanistan», das nun auch de jure die Scharia einführen wird. De facto existierte sie am Hindukusch schon immer. Und hat Millionen von Anhängern*innen unter der afghanischen Bevölkerung.
So viel Wahrheit und ein Minimum an Geschichtskenntnissen über Afghanistan sollte schon sein! Ganz abgesehen davon, dass beim NATO-Partner Türkei «Frauenrechte» oder gar «Rechte für Homosexuelle» ebenfalls nicht existieren. De facto auch sowas wie Scharia.
Worüber fürchtet sich denn der Westen? Wir leben doch in einträchtiger Freundschaft mit den Scharia-Staaten am Golf und dem PetroleumgigantenSaudi Arabien; warum soll uns das mit Afghanistan nicht gelingen?
Immerhin beliefert Afghanistan als grosser Player die Drogensüchtigen des Westens mit Opium, aus dem Heroin hergestellt wird. Ach so, Afghanistan könnte ja unter der «radikal islamistischen Führung der Taliban» wieder zur Brutstätte für Terrorismus werden.
Da vergessen die «Experten» schlicht und einfach, dass die erfolgreichste Terrorzelle islamistischer Fundamentalisten, die in den USA Wolkenkratzer in die Luft sprengten und das Pentagon angriffen, vorwiegend aus Saudi Arabien stammten. Selbst der Terrorfürst und al-Qaida-Boss Bin Laden war ein Saudi aus einer wohlhabenden saudischen Familie.
Der Westen sollte sich eher Sorgen um die Tatsache machen, dass die Taliban den Verfechtern des Hardcore-Islams – und das sind so ziemlich alle mühseligen und beladenen Muslime ohne jede Zukunftsperspektive ausser «Allahu akbar» rund um den Erdball – die Blaupause für den erfolgreichen Dschihad geliefert haben und aufdecken, wie einfach es ist, einen Staat im Namen des Korans zu übernehmen. Selbst wenn er von der mächtigsten Militärmaschinerie des Universums «beschützt» wird.
Wie sagte ein Taliban ebenso kurz und bündig wie auch zutreffend zu einem SPIEGEL-Reporter: «Ihr habt die Uhren. Wir haben die Zeit!» Afghanische Prosa mit konfuzianischer Qualität.
Wer diese Waffe gezielt und ohne Rücksicht auf Verluste einsetzten kann, gewinnt jeden asymmetrischen Krieg. Das haben die bärtigen Gotteskrieger mit den Velotöfflis und Flip Flops an den Füssen eindeutig bewiesen. Wie schon vor mehr als 50 Jahren die Vietkongs.
Wenn der Schweizer Afghane Abdul Wasseh Habib in 20Minuten* sagt, er habe Angst um seine Familie, die in Kabul festsitzt: «Die Geschichte wiederholt sich: Die Reichen können das Land verlassen, die Armen müssen bleiben», sollte uns das bei aller Anteilnahme am Schicksal der Familie von Abdul auch zu denken geben.
Mehr als 50 Prozent der afghanischen Bevölkerung leben in Armut. Also rund 20 Millionen Menschen. Sollen diese 20 Millionen denn nun alle ihr Heimatland Afghanistan verlassen und in die gelobten Länder der sozialen Rundumversorgung des Westens ziehen?
Diese Frage lassen wir jetzt mal im Raum hängen wie einen Schluck Wasser in der Luft.
*https://www.20min.ch/story/die-aktuelle-situation-ist-sehr-schmerzhaft-fuer-uns-alle-825851128315
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.8.2021 - Tag der afghanischen Eilmeldungen
Taliban nehmen Provinzhauptstadt Masar-i-Scharif ein
Die radikalislamischen Taliban haben offenbar die nordafghanische Stadt Masar-i-Scharif erobert. Vor Kurzem stand dort noch ein Feldlager der Bundeswehr. Die Stadt wurde offenbar kampflos übergeben. Schreibt DER SPIEGEL in einer «Eilmeldung».
Taliban nehmen ehemaligen Bundeswehrstandort Masar-i-Scharif ein. Und? In China ist ein Sack Reis umgefallen.
Als 1989 die Russen – gedemütigt durch die Niederlage gegen die von den USA gehätschelten und mit Waffen wie den Stinger-Raketen hochgepumpten afghanischen Mudschahedin – vom Hindukusch abzogen, tobte die westliche Medienlandschaft vor Schadenfreude.
Auch wenn sich die damals von den Westmedien zu Helden hochstilisierten Mudschahedin ideologisch nicht wesentlich von den heutigen Taliban unterschieden. Endlich hatte der Westen den Kommunisten eine Falle gestellt, in die der russische Bär auch prompt hineintappte.
Dass Afghanistan mit dem russischen Abzug den islamistischen Mudschahedin, den Warlords und den neu von den USA und Pakistan erschaffenen Taliban in die Hände fiel, spielte damals bei der hehren westlichen Wertegemeinschaft so gut wie keine Rolle. Als dann wenige Zeit später auch noch die UdSSR zerfiel, knallten die Korkzapfen der Champagnerflaschen in Amerika und Europa: Ziel erreicht.
Heute, im Sommer 2021, knallen die Korkzapfen möglicherweise im Kreml und in Peking. Jetzt erlebt der heuchlerische Westen, angeführt von der Kriegsmacht USA mit ihrem Deep State der einflussreichsten Waffenindustrie des Erdballs, sein beschämendes Waterloo am Hindukusch.
Wenigstens konnte noch MOAB, die mächtigste Bombe der Welt, durch die USA am 13. April 2017 über Afghanistan gezündet und getestet werden.
Die Guten von damals sind heute die Bösen: Wie die Zeiten sich ändern!
Allerdings nicht für das seit vielen Jahrzehnten geschundene afghanische Volk. Das bezahlt als Spielball der verschiedenen Mächte wie immer den höchsten Preis mit unermesslichem Leid, unzähligen Toten, Vertreibung und einem steinzeitlichen Leben unter der Knute der Scharia.
Allahu akbar. Mag ja sein. Nur sind die Flugzeugträger der westlichen Führungsmacht USA halt doch etwas grösser.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.8.2021 - Tag der afghanischen-Live-Ticker-Berichterstattung
Die Medien überschlagen sich seit Tagen mit dem Thema Afghanistan. Einige von ihnen berichten sogar im Live-Ticker-Format. Die Qualität der angebotenen Artikel lässt allerdings zu wünschen übrig, weshalb hier und heute darauf verzichtet wird, einen dieser bis zum Exzess wiedergekäuten Pressebeiträge speziell hervorzuheben.
Der Grundtenor ist ohnehin bei allen identisch und ab und zu an Dummheit und fehlenden Kenntnissen über die Geschichte Afghanistans und des Islams kaum mehr zu überbieten.
Dass jetzt plötzlich alle Medienschaffenden die Missachtung der Frauenrechte in der afghanischen Gesellschaft unter der Herrschaft der Taliban entdecken, ist nichts anderes als widerwärtige Heuchlerei. Als ob in einem der mehr als 50 islamischen Staaten auf unserer Erde irgendwo Frauenrechte nach westlichen Vorstellungen herrschen würden!
UN-Generalsekretär António Guterres hat die Taliban zu einem sofortigen Stopp ihrer Offensive in Afghanistan aufgerufen. Die Aufforderung der UNO dürfte bei den fundamentalen Steinzeitislamisten wohl kaum mehr als ein Lächeln verursachen. Schlottern vor Angst werden sie jedenfalls nicht. Die wissen inzwischen ganz genau, wie der Westen tickt.
Eine weitere UN-Farce sondergleichen. «Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit», sinnierte ein Taliban im Gespräch mit einem westlichen Journalisten. Auf den Punkt getroffen!
The Winner takes It All! Das gilt vor allem für die Hinterlassenschaft der US-Army und die vom Westen as usual zu erwartenden Hilfsgelder für Afghanistan. Man schaue sich die Bekleidung der Gotteskrieger an! In die vorsintflutlichen Unisex-Kleidungsstücke mit den überdimensionalen Hosentaschen passt einiges rein an Dollarscheinen.
Die hehre westliche «Wertegemeinschaft» unter der Führung des Hegemons USA führte einen sinnlosen 20-jährigen Rachefeldzug für Nine Eleven und hat sich unrühmlich vom Hindukusch verabschiedet. Afghanistan wird nun den islamistischen Despoten überlassen.
Nicht aber die zu erwartende Flüchtlingsflut. Laut UNO sind mittlerweile bereits 250'000 Personen aus Afghanistan unterwegs in die gelobten Länder Europas mit den grössten afghanischen Kommunen wie Deutschland (250'000), Österreich (50'000) und Schweiz (20'000).
Aus naheliegenden Gründen will niemand in Ungarn, Tschechien, Polen, dem Balkan oder gar in muslimischen Bruderländern wie der Türkei um Asyl nachsuchen. In all diesen Ländern ist die finanzielle Rundumversorgung denn doch etwas zu tief. Ganz abgesehen davon, dass die reichen islamischen Staaten wie Saudi Arabien und die Emirate überhaupt keine Flüchtlinge aufnehmen. Nicht mal ihre eigenen Brüder und Schwestern im Sinne des salafistischen und wahhabitischen Geistes.
Saudi Arabien und die Emirate sind schliesslich für die Finanzierung der sunnitischen Moscheen in den obgenannten drei europäischen Ländern zuständig. Um die schiitischen Muslime Afghanistans kümmert sich der Iran.
Einem Naturgesetz gleich überlassen die USA die Flüchtlinge wie gewohnt den Europäern. Irak, Syrien und Libyen schicken Grüsse aus einer gar nicht so fernen Vergangenheit. 2015 wird sich wiederholen, auch wenn sämtliche Politiker*innen der Wertegemeinschaft EU ganz andere Töne zur Beruhigung der kochenden Volksseele anschlagen.
Dafür werden die weltweiten Hilfsorganisationen, die UNO und NGO (nicht gewählte Organisationen mit staatlicher Alimentierung) auch dieses Mal sorgen. Europa hat aus 2015 nichts gelernt.
Was wir 2015 nicht geschafft haben, werden wir dieses Mal erst recht nicht schaffen. Die finanziellen Erpressungen des Sultans vom Bosporus und NATO-Partners Erdogan werden nicht lange auf sich warten lassen.
Dass sich Kanada nach dem Skandal um die grausame Behandlung bis hin zur Ermordung seiner indigenen Ureinwohner in vorauseilendem Gehorsam bei der UNO bereits verpflichtet hat, 20'000 afghanische Flüchtlinge aufzunehmen, ist wohl der Aufpolierung des angekratzten Images geschuldet. Den Ansturm der afghanischen Flüchtlinge auf Europa wird dieser Tropfen auf den heissen Stein jedoch nicht beeinflussen.
20'000 mehr oder weniger werden bei den zu erwartenden Zahlen keine Rolle mehr spielen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.8.2021 - Tag der Steinzeit-Islamisten
USA verlegen Tausende Soldaten nach Afghanistan
Elf Städte haben die Taliban in nur einer Woche erobert. Nun schickt das US-Militär 3000 Soldaten nach Afghanistan, um den Flughafen Kabul zu sichern. Botschaftsmitarbeiter werden mit täglichen Flügen außer Landes gebracht.
Eigentlich will das US-Militär bis Ende August Afghanistan verlassen, nun schickt das Pentagon 3000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten ins Land. Sie sollen die Sicherheit am Flughafen Kabul verstärken. Es gehe darum, die Reduzierung des US-Botschaftspersonals zu unterstützen, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag. Diese könne auch die Sicherung von Konvois von und zum Flughafen umfassen. Die Truppen könnten das Außenministerium auch bei der Evakuierung früherer afghanischer Mitarbeiter des US-Militärs unterstützen.
Der Einsatz soll in den kommenden 24 bis 48 Stunden beginnen. Die zeitweise Verstärkung sei angesichts des jüngsten Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Teilen Afghanistans eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Kirby. Die Verstärkung sei angesichts der sich rasch verschlechternden Sicherheitslage »angemessen«, sagte er.
Zuvor hatte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace angekündigt, bis zu 600 Soldaten für eine Evakuierung einzusetzen. Beide Staaten haben wie auch Deutschland ihre Staatsbürger aufgefordert, das Land zu verlassen.
Das Personal in der US-Botschaft soll in den kommenden Wochen deutlich verringert werden. »Wir gehen davon aus, dass wir unsere diplomatische Präsenz in Afghanistan in den kommenden Wochen auf ein Minimum reduzieren werden«, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price in Washington. Die Botschaft in Kabul bleibe aber an ihrem derzeitigen Standort geöffnet. »Wir haben vor, unsere diplomatische Arbeit fortzusetzen«, so Price. Die Botschaft in Kabul bleibe weiterhin geöffnet, es handle sich bei der Reduzierung des zivilen Personals der Botschaft Kabul um eine Vorsichtsmaßnahme.
Bis Ende August wollen die USA ihren Militäreinsatz in Afghanistan vollständig beenden – nach knapp 20 Jahren. Danach sollen nur noch US-Soldaten zum Schutz der Botschaft in Afghanistan bleiben. Am Donnerstag war die drittgrößte Stadt Afghanistans, Herat, an die Taliban gefallen. Auch die zweitgrößte Stadt Kandahar ist schwer umkämpft. Das US-Militär werde helfen, einen geordneten und sicheren Abbau unseres Personals zu ermöglichen.
USA richten tägliche Luftbrücke für afghanische Helfer ein
Die USA wollen ihre früheren Ortskräfte in Afghanistan schneller als bisher außer Landes bringen. Für Dolmetscher und andere afghanische Mitarbeiter, die bei einer Machtübernahme durch die Taliban Repressalien zu befürchten hätten, solle es künftig täglich Flüge geben, die sie außer Landes bringen, so Price. Zugleich kündigte er die Stationierung von US-Soldaten am Flughafen von Kabul an, welche die Ausreise von Botschaftspersonal sichern sollen.
Welt wird keine gewaltsame Machtübernahme in Kabul anerkennen
Price sagte zudem, dass die internationale Gemeinschaft keine neue afghanische Regierung anerkennen, falls diese die Macht mit Gewalt an sich gerissen haben sollte. Diese »Botschaft an die Taliban« werde später auch in einer gemeinsamen Stellungnahme mit mehreren internationalen Partnern, darunter auch Deutschland, ausgedrückt werden, sagte Price. Eine gewaltsame Machtübernahme durch die Taliban würde Afghanistan international isolieren, woraufhin auch Hilfszahlungen eingestellt würden, so Price. Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung im Emirat Katar appellierte Price an alle Parteien, sich auf einen gemeinsamen politischen Prozess für die Zukunft des Landes zu einigen.
Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell drohte den Taliban mit Isolation, sollten sie gewaltsam die Macht in Afghanistan übernehmen. Zudem forderte der EU-Chefdiplomat die Taliban auf, unverzüglichen wieder Gespräche aufzunehmen und einen dauerhaften Waffenstillstand herbeizuführen. »Die anhaltenden Angriffe verursachen unannehmbares Leid für die afghanische Bevölkerung«, sagte Borrell am späten Donnerstagabend. Die EU sei bestrebt, eine Unterstützung für das afghanische Volk fortzusetzen. Zudem sei von entscheidender Bedeutung, dass Errungenschaften wie der Zugang von Frauen und Mädchen zu Bildung erhalten blieben.
Dänemark setzt Abschiebungen vorübergehend aus
Nach Deutschland und einer Reihe von anderen EU-Ländern setzt auch Dänemark Zwangsrückführungen nach Afghanistan aus. Abgewiesene Asylbewerber werden zunächst bis zum 8. Oktober nicht in das Land abgeschoben, teilte das dänische Ausländerministerium am Donnerstag dem Ausländer- und Integrationsausschuss des Parlaments in Kopenhagen mit.
Grund dafür sei, dass Afghanistan die EU am 8. Juli informiert habe, wegen der Sicherheitslage im Land vorübergehend keine abgeschobenen Menschen aufzunehmen. Dänischen Medienberichten zufolge sollten zuletzt 45 abgewiesene Afghanen zwangsweise aus Dänemark nach Afghanistan zurückgeführt werden. Schreibt DER SPIEGEL.
1973 verliessen die Amerikaner nach jahrelangem Krieg Vietnam – zwei Jahre später fiel Saigon. Die damalige Lage erinnert fatal an die aktuelle Situation in Afghanistan. Vor dem Einmarsch der Nordvietnamesen flüchteten die letzten Amerikaner aus Saigon.
Am 29. April 1975 kletterten Südvietnamesen auf der Flucht vor nordvietnamesischen Truppen über die Mauer der US-Botschaft in Saigon, um die Hubschrauber der Amerikaner zu erreichen. Auch die zum Schutz der US-Botschaft zurückgebliebenen US-Soldaten konnten die flüchtenden Zivilisten nicht aufhalten.
Einer der Hubschrauber stürzte vor der USS Blue Ridge ins Meer. In den letzten Stunden, bevor Saigon eingenommen wurde, flogen die Amerikaner noch Hunderte «gefährdete Personen» aus.
Das waren schmachvolle Bilder für die USA, die bis heute im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten in den Köpfen der älteren Bevölkerung herumspuken.
Déjà-vu: Diese Bilder eines verlorenen Krieges, die um die Welt gingen, will der Hegemon mit der mächtigsten Kriegsmaschinerie des Universums diesmal verhindern. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die hehre westliche «Wertegemeinschaft» den 20 Jahre dauernden Krieg in Afghanistan «verloren» hat. Auch wenn sich alle Beteiligten des westlichen Bündnisses bemühen, die Niederlage am Hindukusch schönzureden.
Demokratie und Islam sind zwei Begriffe, die sich gegenseitig widersprechen. Der Westen ist schlicht und einfach unfähig, nach all den gescheiterten Kriegsmissionen (Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan usw.) die richtigen Schlüsse aus den verheerenden Folgen seiner Machtpolitik des «Regime Change» (Neusprech «Nation Building») zu ziehen und neue Strategien zu entwickeln.
Erdogan zitierte 1997 nicht ohne innere Überzeugung an einer Wahlkampfveranstaltung in Istanbul die Zeilen eines Gedichtes: «Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.»
Dass die Welt eine gewaltsame Machtübernahme der Taliban in Afghanistan nicht «anerkennt», wird die neuen Herrscher über die «Islamische Republik Afghanistan» (offizielle Bezeichnung Afghanistans seit der Installation der Marionetten-Regierung) und deren Verbündete der salafistischen und wahhabitischen Staaten der muslimischen Welt rund um den Erdball kaum beeindrucken.
Die waffentechnische, logistische und finanzielle Unterstützung Pakistans, Saudi Arabiens, der Emirate, Türkei usw. ist den Gotteskriegern jetzt schon sicher. Und sollten alle Stricke reissen, haben die Steinzeit-Islamisten immer noch das einträgliche Opium, mit dem Afghanistan seit mehr als 20 Jahren den Weltmarkt flutet.
Die westliche «Wertegemeinschaft will partout nicht zur Kenntnis nehmen, dass eine überwältigende Mehrheit der ländlichen Bevölkerung Afghanistans einer Machtübernahme durch die Taliban und damit der Errichtung eines Scharia-Staates zustimmend gegenübersteht. Nach 20 Jahren der von den «Besatzern» verordneten Pseudo-Schaufenster-Demokratie irgendwie auch verständlich.
Der anfänglich von westlichen Rezensenten zu Unrecht als «Rassist» betitelte Samuel P. Huntington schreibt in seinem Buch «Kampf der Kulturen: Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21 Jahrhundert» (Originaltitel «Clash of Civilisations») einen bemerkenswerten Satz. «Der Westen wird dieser Kraft (gemeint ist der Islam) nichts entgegenzusetzen haben.»
Das ist leider zu befürchten. 1683 standen die Türken schon einmal vor Wien. Heute sind sie längst in Wien und vielen anderen Metropolen angekommen. Erdogan hat Millionen seiner türkischen Landsleute in aller Welt parkiert.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.8.2021 - Tag der Futtertröge
Verpflichtung für Covid-19-Test bei der Ausschaffung von Personen, die die Schweiz verlassen müssen
Personen, welche die Schweiz verlassen müssen, können künftig zu einem Covid-19-Test verpflichtet werden, wenn der Wegweisungsvollzug sonst nicht möglich ist. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 11. August 2021 die entsprechende Botschaft zur Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) verabschiedet.
Die Vernehmlassung zu dieser Vorlage dauerte vom 23. Juni bis zum 7. Juli 2021. Praktisch alle Kantone, die Konferenz der Kantonalen Polizei- und Justizdirektorinnen und -direktoren (KKJPD), die Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden (VKM) und ein Teil der politischen Parteien begrüssen die Gesetzesänderung und erachten diese als wichtig und notwendig. Das UNHCR begrüsst grundsätzlich, dass mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf für die Durchführung von Covid-19-Tests eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll. Ein Teil der politischen Parteien sowie die anderen Vernehmlassungsteilnehmenden - darunter die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, NGOs und Hilfswerke - lehnen sie ab. Aufgrund der Vernehmlassung ist neu unter anderem vorgesehen, dass die Tests generell durch spezifisch geschultes medizinisches Personal und bei Minderjährigen unter 15 Jahren keine Covid-19-Tests gegen deren Willen durchgeführt werden.
Der Bundesrat hat dem Parlament beantragt, die Änderung des AIG für dringlich zu erklären und sofort in Kraft zu setzen. Wird die neue Regelung angenommen, bleibt sie bis am 31. Dezember 2022 gültig. Für die Anordnung und Durchführung der Tests sind die Kantone zuständig.
Zahlreiche Staaten verlangen einen negativen Covid-19-Test für die Rückübernahme der von der Schweiz weggewiesenen Personen. Auch viele Fluggesellschaften akzeptieren nur negativ getestete Passagiere. Es kommt aber immer häufiger vor, dass Ausreisepflichtige den bisher nicht obligatorischen Test verweigern, um den Wegweisungsvollzug zu verhindern. Dadurch entstehen erhebliche Mehrausgaben im Bereich der Nothilfe und der Administrativhaft. Vor diesem Hintergrund ist rasches Handeln angezeigt, um die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der schweizerischen Asylpolitik zu gewährleisten. Schreibt das Staatssekretariat für Migration.
«Ein Teil der politischen Parteien sowie die anderen Vernehmlassungsteilnehmenden - darunter die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, NGOs und Hilfswerke - lehnen sie ab.»
Dass die Profiteure der «Flüchtlingsindustrie» wie NGOs (Nicht gewählte, vom Staat alimentierte Organisationen) und Hilfswerke die Bundesmassnahmen gegen die Tricks Ausreisepflichtiger ablehnen, war zu erwarten. Wer gibt schon freiwillig die Futtertröge der Nation auf?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.8.2021 - Tag der Wohlfühl-Rundumversorgung illegaler Migranten
Österreichisches Innenministerium schickt weitere Polizisten an die ungarische Grenze
27 zusätzliche Polizisten sollen das Bundesheer bei der Grenzsicherung unterstützen. Erst kürzlich wurde die Zahl der Soldaten von 600 auf 1.000 aufgestockt.
Das Innenministerium stockt die Zahl der Beamten zur Grenzsicherung im Burgenland weiter auf. 27 Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Salzburg verstärken den Einsatz an der burgenländischen Grenze, gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. "Die Maßnahmen im Burgenland dienen der Schleppereibekämpfung, um die Routen unattraktiv zu machen", so der Minister.
Fremdenpolizei und Spezialisten im Grenzdienst
Die zusätzlichen Kräfte seien notwendig, um den verstärkten Grenzeinsatz des Bundesheeres entsprechend strukturieren zu können – die Zahl der Soldaten wurde erst kürzlich von 600 auf bis zu 1.000 aufgestockt, so das Innenministerium. "Wir arbeiten aber auch auf internationaler Ebene eng mit den Staaten des Westbalkan zusammen, um den Zweig der organisierten Kriminalität bei der Schlepperei zu bekämpfen", sagte Nehammer. Bei den eingesetzten Polizeibeamten handelt es sich um Spezialisten im Bereich Grenzdienst und Fremdenpolizei.
Bewährt habe sich auch der Einsatz von Drohnen, hieß es aus dem Innenressort. Bisher seien bereits mehr als 500 Flugstunden absolviert worden. Im Kampf gegen die Schlepperei und illegale Migration wurden seit Jahresbeginn bereits 1,5 Millionen Einsatzstunden von Polizisten an der Grenze geleistet. Auch habe man seit Jahresbeginn mehr als 200 Schlepper festnehmen können, sagte Gerald Tatzgern, der Leiter des Büros zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Schlepperei im Bundeskriminalamt zur APA. Dies entspreche einer Steigerung von rund 50 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Möglich geworden sei dies u.a. aufgrund der verstärkten Maßnahmen aber auch wegen der verstärkten grenzübergreifenden Zusammenarbeit.
Schlepper vermehrt auf Tiktok
Auffallend sei, dass Schlepper die sozialen Netzwerke als "zentrale Plattform für die Werbungen" nutzen. Immer häufiger werde dabei die Plattform "TikTok" verwendet, um Menschen für Schleppungen anzusprechen. Schlepper würden dort als vertrauenswürdig präsentiert, so Tatzgern. Die Behörden würden auch diesen Hinweisen nachgehen und entsprechende Ermittlungen und Maßnahmen setzen. Schreibt DER STANDARD.
Es ist langsam unappetitlich, wie sich die Regierung Österreichs unter dem «Message-Control»-Kanzler Kurz dank willfährigen Medien während dem medialen Sommerloch mit Fake-Massnahmen in Szene setzt. Denn etwas anderes als ein Fake sind weder 27 zusätzliche Polizisten noch die Aufstockung von 600 Soldaten an der Grenze auf 1000 Mann.
Da Push Back-Massnahmen von illegalen Migranten angeblich aus rechtlichen Gründen nicht zulässig sind, bedeuten die zusätzlichen Polizisten und Bundeswehr-Soldaten nichts anderes als die Aufstockung des Empfangskomitees, das die skrupellose Arbeit der Schlepperbanden vollendet und die Migranten, die illegal die österreichische Grenze überschritten haben, ins gelobte Land der Wohlfühl-Rundumversorgen geleiten.
Gekommen um zu bleiben: Dafür werden die scheinbar allmächtigen NGO (Nicht Gewählte Organisationen; alimentiert vom Staat)und Links-Grüne Parteien zum Wohle der illegalen Migration bei allfälligen Abschiebungen wie gewohnt schon sorgen.
Hat der PR-Kanzler Sebastian Kurz, der sich bei Wahlkämpfen stets damit rühmte, die Balkan-Route geschlossen zu haben, aus 2015 nichts gelernt? Wie lange lässt sich das Stimmvolk mit verlogenen Placebo-Massnahmen in Österreich noch hinters Licht führen?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.8.2021 - Tag des freien Freitags
Religiöse Gleichstellung im habsburgischen Militär zur Zeit der napoleonischen Kriege
Kaiser Joseph II. befahl, dass Juden, genau wie alle anderen Untertanen, auch in der Armee dienen müssen. Dies brachte die Frage auf, wie jüdische Soldaten unter diesen neuen Umständen ihre religiösen Gebote einhalten können.
Wir schreiben das Jahr 1806. Das Kaisertum Österreich erholt sich von einer schweren Niederlage durch das napoleonische Frankreich. Für den Wiederaufbau der Armee wird in den habsburgischen Ländern stark rekrutiert. Parallel dazu werden die Soldaten, die für den weiteren Kriegsdienst untauglich sind, aus den Kampfeinheiten abgezogen. Die Männer, die noch leichten Dienst leisten können, wurden als "Halb-Invaliden" an verschiedene Garnisonsabteilungen oder Militärämter übergeben. Sogenannte "Reale Invaliden" (auch "Voll-Invaliden genannt), die durch Verletzungen oder eine lange Dienstzeit völlig versehrt sind, dürfen entscheiden: Sie können ein einmaliges Geldgeschenk annehmen und die Armee endgültig verlassen. Die andere Möglichkeit ist, in ein Invalidenhaus mit lebenslanger Versorgung aufgenommen zu werden. In beiden Fällen wird dieser Beschluss durch einen Befehl vom regionalen Militärkommando formell bestätigt.
Am 5. September 1806 wurde vom Ober- und Innerösterreichischen Militärkommando in Graz verordnet, drei Reale Invaliden aus dem 43. Infanterie Regiment "Freiherr von Simbschen" ins Pettauer Invalidenhaus zu schicken. Nach der Ankunft des Befehls im Regimentshauptquartier in Laibach, wurde am 17. September für diese Soldaten eine förmliche Transferierungs-Liste vorbereitet. Als dieses behördliche Formular bereits fertig war, wurde der erste Mann – der zweimalige Kriegsveteran und gemeine Soldat Wolf Czermess – jedoch wieder von der Liste gestrichen. Der Grund dafür ist auf dem Rand des Dokuments notiert und sehr bemerkenswert: "Ist zu Frist bey Lauben-fest der Juden und wird dessen Transferierungs-Lista nachgetragen werden". Mit anderen Worten: Die Versetzung des Soldaten Czermess nach Pettau wurde wegen eines jüdischen Feiertags verschoben.
Trotz Motiv – gleiche Rechte
Obwohl es heute kaum noch bekannt ist, war die Habsburgermonarchie der erste Staat der Neuzeit, der seine jüdischen Einwohner zum Wehrdienst verpflichtete. Dies geschah durch die persönliche Initiative Kaiser Joseph II., welche trotz des Widerstands der Armee und der jüdischen Gemeinden im Jahr 1788 durchgesetzt wurde. Durch diesen Schritt hoffte der Kaiser die Juden besser in die Gesellschaft zu integrieren, was letztlich zu einer stärkeren Assimilation der jüdischen Bevölkerung führen sollte. Trotz dieses tieferen Motivs, und obwohl er kein Freund der Befolgung religiöser Regeln war, sorgte Joseph II. dafür, dass jüdische Soldaten ihren Glauben ohne Einschränkungen ausüben durften.
Für jüdische Rekruten wurde zum Beispiel der militärische Eid eigens modifiziert. Jesus, die Heilige Dreifaltigkeit und die christlichen Märtyrer wurden durch den Allmächtigen Gott, die drei Erzväter und König David gemeinsam mit anderen biblischen Helden ersetzt. Während die anderen Soldaten direkt mit Essen versorgt wurden, wurde jüdischen Soldaten erlaubt, statt Lebensmitteln den gleichen Wert in Geld zu erhalten, um sich selbst mit koscheren Speisen zu versorgen. Schließlich wurden jüdische Soldaten am Samstag von Aufgaben und Pflichten befreit ähnlich, wie die christlichen Soldaten am Sonntag. Das war allerdings kein großes Zugeständnis für die Armee, da der Sonntag den Christen kaum Dienstbefreiungen brachte. Viel entscheidender war die symbolische Bedeutung, die durch diese offiziellen Regeln zum Ausdruck gebracht wurde: In ihren religiösen Angelegenheiten hatten die jüdischen Soldaten die gleichen Rechte und Pflichten wie ihre christlichen Kameraden.
Vorgabe und Umsetzung
Doch wurde diese Politik im Geiste der Aufklärung in der Armee tatsächlich gelebt? Der Kaiser und die zentralen Militärbehörden saßen alle in Wien. Tief in Galizien, Ungarn, Böhmen und in den anderen Provinzen, wo die meisten habsburgischen Truppen in Garnison lagen, lag die eigentliche Autorität bei deren Offizieren. Zusammen mit den Hauptleuten, die ihre individuellen Kompanien fast wie eine kleine Herrschaft befehligten, hatte letztlich der Regimentskommandant vor Ort über das tägliche Leben seiner Untergebenen zu entscheiden.
Und das ist der Grund warum die Anmerkung zur Transferierung des Soldaten Czermess aus historischer Sicht so wichtig ist. Wie in anderen Dokumenten dieser Art, wurden die Transferierungsbogen vom Kommandanten des 43. Infanterie-Regiments, des Oberst Vital von Kleimayrn (1747–1828), persönlich unterschrieben. Die Entscheidung, Soldat Czermess länger in seiner alten Einheit zu belassen, damit er die jüdischen Feste feiern kann, wurde somit auf höchster Ebene getroffen. Das liefert uns heute den unmittelbaren Nachweis, dass die habsburgische Militärverwaltung sich der religiösen Bedürfnisse ihrer jüdischen Soldaten bewusst und auch bereit war, diese bis zu einem gewissen Grad tatsächlich in der Praxis zu berücksichtigen.
Nicht ein, sondern drei Feiertage
Der Fall des Soldaten Czermess wird übrigens noch interessanter, wenn man den gregorianischen mit dem hebräischen Kalender vergleicht. Im Jahr 1806 begann das wochenlange Laubhüttenfest (auf Hebräisch Sukkot) erst am Abend des 27. September. Mit zehn Tagen wäre es theoretisch möglich die 140 Kilometer Reise zwischen Laibach und Pettau vor dem Beginn des Sukkot rechtzeitig zu schaffen. Aber genau in die Mitte dieser Zeitspanne, auf den 22. September, fiel Jom Kippur (Versöhnungstag). Dieser heiligste Tag des jüdischen Kalenders wird mit großer Feierlichkeit und einem strengen Fasten begangen. Wenn also Soldat Czermess wie geplant am 17. September nach Pettau geschickt worden wäre, hätte er einige Tage später irgendwo mitten im ländlichen Slowenien den wichtigsten Tag seines Glaubens allein feiern müssen. Die Verzögerung seiner Versetzung zum Invalidenhaus ermöglichte ihm stattdessen, bei seinem alten Regiment Jom Kippur, Sukkot sowie auch den unmittelbar darauffolgenden Feiertag Simchat Tora in Ruhe zu begehen.
Transferierungen zwischen verschiedenen Einheiten der Habsburger Armee wurden einmal pro Monat durchgeführt. Mit 17. Oktober 1806 wurde für den Gemeinen Wolf Czermess ein neuer Transferierungsbogen ausgestellt. Der Soldat bekam vom Regiment Verpflegung und Gehalt bis zum 31. Oktober, dem Tag seiner voraussichtlichen Ankunft in Pettau. Dann begann im dortigen Invaliden-Haus ein neuer Abschnitt in seinem Leben. Schreibt Ilya Berkovich im STANDARD.
Für den Machterhalt und um Kriege zu gewinnen, sprangen die Mächtigen dieser Welt schon immer über jedes Stöckchen. Nicht nur die Habsburger.
Auch GRÖFAZ (grösster Führer aller Zeiten) Adolf Hitler und seine Kamarilla hatten gegenüber dem Islam keine Vorbehalte, solange er ihnen als Mittel zum Zweck diente. Die Nazis pflegten eine merkwürdige Allianz mit den Muslimen, die der junge Historiker David Motadel in seinem Buch «Für Prophet und Führer. Die Islamische Welt und das Dritte Reich» beschrieben hat. (Erstveröffentlichung 11. November 2017).
So habe Hitler den Katholizismus als «schwache und verweichlichte» Religion verurteilt, während er den Islam oft als «starke, aggressive Kriegerreligion» lobte. Das NS-Regime versuchte, Muslime zum Kampf gegen die angeblich gemeinsamen Feinde zu mobilisieren, nachdem sich die militärische Lage ab 1941 für die Deutschen zunehmend verschlechterte.
Heinrich Himmler soll sich laut Motadel (in einem Interview mit dem Deutschlandfunk) zu den Muslimen, die in einigen Divisionen der Wehrmacht als Soldaten dienten, bei einer Tagung vor Funktionären des «Rassenpolitischen Amtes der NSDAP» wie folgt geäussert haben: «Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts. Denn er erzieht mir in dieser Division seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion.» ZynischerPragmatismus at its best.
Dumm nur für die Nazis, dass Allahs Söhne jeweils am Freitag wegen dem «Freitagsgebet» partout keine Lust hatten, für den Führer und das Deutsche Reich zu sterben.
Das dürfte auch bei den Habsburgern mit den jüdischen Soldaten der Fall gewesen sein, feiert doch die jüdische Religionsgemeinschaft am Freitag mit dem «heiligen» Sabbat ihren freien Wochentag.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
9.8.2020 - Tag der moralgeschwängerten Utopien
Taliban erobern Kundus: Röttgen warnt vor »Desaster« in Afghanistan
In Afghanistan überrennen die Taliban Stadt für Stadt. CDU-Politiker Norbert Röttgen fordert den Westen auf, den Vormarsch zu stoppen, auch die Bundeswehr solle helfen. Widerspruch bekommt er aus der eigenen Partei.
Nach der Eroberung der afghanischen Stadt Kundus durch die radikalislamischen Taliban hat Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, vor einem internationalen »Desaster« gewarnt. Zudem brachte er die Beteiligung der Bundeswehr an einem Militäreinsatz ins Spiel.
In Afghanistan bestehe die Gefahr, dass die Islamisten das ganze Land eroberten, einschließlich der Hauptstadt Kabul, sagte der CDU-Politiker am Sonntag der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«: »Es darf jetzt nicht zugelassen werden, dass sie militärisch einseitig Fakten schaffen.« Dann bestünde auch keine Aussicht mehr auf eine politische Lösung.
Röttgen appellierte an die internationale Gemeinschaft, insbesondere US-Präsident Joe Biden, den Vormarsch der Taliban zu stoppen – aus Verantwortung für die eigene Sicherheit und die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung. Dies könne auch eine Beteiligung der Bundeswehr bedeuten.
Die Ergebnisse von 20 Jahren dürften nicht zunichtegemacht werden, sagte er. »Wenn es also militärische Fähigkeiten der Europäer, auch der Deutschen, gibt, die jetzt benötigt würden, dann sollten wir sie zur Verfügung stellen«. Gegenwärtig gehe es offenbar vor allem darum, den Vormarsch der Taliban durch Luftschläge zu stoppen. Damit hätten die Amerikaner ja bereits begonnen, so Röttgen.
Widerspruch kam am Sonntagabend vom CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul. »Der Bundeswehreinsatz wurde auf Nato-Ebene beendet. Ich sehe weder politisch noch militärisch einen Ansatzpunkt für eine neue Einsatzentscheidung«, sagte er der dpa. Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann äußerte sich ablehnend: »Mit Vorschlägen von N. Röttgen würden wir wieder in 2002 ankommen. So hatte es begonnen«, schrieb sie auf Twitter. »Neben versprochener Luftunterstützung der USA muss Bundesregierung auf UN-Sondersitzung dringen.«
Deutsche waren zehn Jahre lang in Kundus stationiert
In Kundus hatte die Bundeswehr rund ein Jahrzehnt lang einen Stützpunkt betrieben. Von 2003 bis 2013 überwachten deutsche Soldaten vom Feldlager aus die Sicherheit im Norden des Landes. Am Sonntag eroberten die Taliban die Provinzhauptstadt – es ist einer ihrer wichtigsten Erfolge, seit die internationalen Truppen mit ihrem Abzug begonnen haben.
Die Islamisten hätten die wichtigsten Regierungseinrichtungen der Stadt übernommen, bestätigten drei Provinzräte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. »Die Leute von der Regierung sind geflohen. Die Taliban haben Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen. Wir haben weder Wasser noch Strom«, berichtete Anwohner Schekib Salarsai. »Die Straßen sind gesperrt. Keiner kann die Verletzten in die Krankenhäuser bringen.« Die Polizisten hätten ihre Waffen niedergelegt und liefen in ziviler Kleidung herum. Seine Nachbarn seien dabei, ihre Sachen zu packen.
Provinzrat Amruddin Wali sagte der Nachrichtenagentur, Sicherheitskräfte und Regierungsvertreter hätten sich in das ehemalige deutsche Feldlager am Rande des Flughafens zurückgezogen. Die Regierung halte nur noch ein Gebiet rund um den Flughafen und diese Basis. Am Sonntagnachmittag Ortszeit dauerten die Gefechte rund um den Flughafen an.
Taliban erobern mehr und mehr Städte
Kundus ist ein wichtiges Handelszentrum nahe der Grenze zum Nachbarland Tadschikistan. Die Taliban hatten die Stadt bereits 2015 und 2016 kurzzeitig eingenommen. Beide Male wurden die Islamisten durch US-Luftangriffe zurückgedrängt. Auch momentan fliegen die USA Luftschläge.
Die US-Truppen sind jedoch praktisch schon abgezogen. In weniger als drei Wochen endet die US-Militärmission offiziell. Bisher gab es noch kein Zugeständnis der USA, die afghanischen Sicherheitskräfte auch danach gegen die Taliban zu unterstützen. Am Sonntag war zunächst unklar, ob Regierungskräfte in einer großen Aktion versuchen würden, Kundus zurückzuerobern.
Seit dem Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen Anfang Mai haben die Taliban in mehreren Offensiven massive Gebietsgewinne verzeichnet. Sie eroberten zudem mehrere Grenzübergänge. Kundus ist bereits die vierte Provinzhauptstadt, die von den Islamisten binnen drei Tagen erobert wurde.
Am Freitag war schon Sarandsch in Nimrus an der iranischen Grenze gefallen – praktisch kampflos. Am Samstag folgte Schiberghan in Dschausdschan im Norden. Fast zeitgleich mit Kundus nahmen die Islamisten Sar-i Pul ein, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Norden.
Die USA hatten die »neue gewaltsame Offensive der Taliban gegen afghanische Städte« bereits am Samstag verurteilt. Das Auswärtige Amt sieht nun eine zunehmende Verschlechterung der Sicherheitslage. Die Situation entwickle sich rasant, sagte ein Ministeriumssprecher am Sonntag in Berlin.
Die Taliban versuchen nun offenbar, ihren Vormarsch fortzusetzen. Sie drangen lokalen Medienberichten zufolge ins Zentrum von Talokan vor, der Hauptstadt der Provinz Tachar, die an Kundus grenzt. Schreibt DER SPIEGEL.
Hat CDU-Politiker Norbert Röttgen wirklich noch alle Tassen im Schrank? «Wenn es also militärische Fähigkeiten der Europäer, auch der Deutschen, gibt, die jetzt benötigt würden, dann sollten wir sie zur Verfügung stellen», sagt CDU-Politiker Norbert Röttgen.
Dass die militärischen Fähigkeiten der Europäer, auch und vor allem der Deutschen, nach verheerenden Kollateralschäden mit vielen zivilen Toten aus der afghanischen Bevölkerung während den 20 Jahren westlicher Besatzung der «Islamischen Republik Afghanistan» zu einem Desaster sondergleichen ausarteten, scheint diesem Vollpfosten der Kriegsrhetorik nicht bewusst zu sein.
Die hehre westliche «Wertegemeinschaft» hatte zu keinem Zeitpunkt des blutigen Rachefeldzugs – etwas anderes war der durch «Nine Eleven» ausgelöste Afghanistankrieg nie – eine Agenda, die salafistischen Gotteskrieger saudischer Prägung wirksam zu bekämpfen.
Im Gegenteil: Die mächtige Militärmaschinerie unter dem Befehl der USA schaffte es, dass die Taliban inzwischen bei der ländlichen Bevölkerung höchste Zustimmungsraten geniessen.
Die Kriegsziele der Amerikaner waren ganz klar definiert: Al-Quaida Chef Bin Laden dingfest zu machen und die Basis der IS-Terroristen in Afghanistan zu zerschlagen. Nebenbei noch eine dem Westen genehme Raubritter-Regierung unter dem Deckmantel der Demokratie zu installieren, die afghanische Armee mit Milliarden aufzupeppen und ein paar Brunnen zu bauen. Das wars denn auch schon.
Nach zehn Jahren wurde 2011 das erste und damit für die Amerikaner wichtigste Kriegsziel mit der Tötung Bin Ladens in Pakistan erreicht. Die Gotteskrieger im Namen Allahs kämpfen aber bis zum heutigen Tag munter weiter. Nicht nur im Nahen Osten wie Syrien, Irak und Libyen, sondern auch mit gezielten Attentaten in westlichen Metropolen und Städten.
Den saudischen Terrorfürsten Osama bin Laden hätten die Amerikaner auch ohne diesen verheerenden Krieg verhaften und seiner Strafe zuführen können. Es waren ja nicht die US-Bomben, die den al-Quaida-Chef in einer pakistanischen (!) Villa ans Messer und damit vor die Schnellfeuergewehre der US-Marines lieferten, sondern CIA-Schmiergelder in Millionenhöhe an den pakistanischen Geheimdienst.
So wie auch der Diktator Saddam Hussein nicht durch den Irak-Krieg gefasst wurde, sondern dank US-Millionenzahlungen an örtliche arabische Landesfürsten. Muslime sind nicht weniger korrupt als der Rest der Welt. Egal, was immer in den «heiligen Schriften» der monotheistischen Religionen steht.
Deutschlands Politiker vom Schlage eines Norbert Röttgens täten gut daran, ihr lächerliches Weltmachtgehabe im Schlepptau des amerikanischen Hegemons und ihre moralgeschwängerten Utopien fern jeglicher Realität zu überdenken.
Der zu erwartende Flüchtlingsstrom aus Afghanistan – und nur darum geht es Röttgen – ist nicht durch militärischen Einsatz am Hindukusch zu verhindern. Sondern einzig und allein mit einem wirksam Grenzschutz Europas.
Wer weiss, vielleicht schaffen wir ja diesmal, was 2015 nicht geschafft wurde...
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.8.2021 - Tag des Grünen Gesinnungsterrors
Wahlkampf: Merz provoziert Grüne mit Falschaussagen in Tweet
Friedrich Merz schaltet sich in den Bundestagswahlkampf ein und attackiert die Grünen mit zweifelhaften Methoden. Aussagen zu deren geplantem Einwanderungsministerium wies die Partei als »an den Haaren herbeigezogen« zurück.
Es ist gerade ein paar Tage her, dass sich führende Christdemokraten wie der Hamburger Christoph Ploß dafür aussprachen, der CDU-Politiker Friedrich Merz möge »eine zentrale Rolle« im Bundestagswahlkampf spielen. Die Rufe wurden offenbar erhört.
Das Team um Merz hat sich nun die Grünen vorgeknöpft – allerdings mit zweifelhaften Methoden: »Ein grünes ›Einwanderungsministerium‹ soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen«, schrieb Merz auf Twitter und in einem Beitrag auf »Focus Online«. Auch solle die »Gender-Sprache uns allen aufgezwungen und das Land überzogen werden mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben«.
Die Grünen wollen tatsächlich Themen rund um Gleichberechtigung und Teilhabe in einem eigenen Ministerium bündeln. »Dazu werden wir die Aufgaben zur Einwanderungsgesellschaft aus dem Innenministerium herauslösen«, heißt es im Wahlprogramm.
Doch von Einladung möglichst vieler Einwanderer oder Zwang zur Gendersprache steht da nichts.
Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Samstag zu den Vorwürfen von Merz: »Das Ganze ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen.« Kellner fügte hinzu: »Ich würde mir von Friedrich Merz wünschen, dass er es mal mit eigenen Vorschlägen probiert – dann streiten wir gern darüber.« Die stellvertretende Grünenchefin Ricarda Lang schrieb auf Twitter: »Menschen mit Migrationsgeschichte sind für die Union nur dann Teil dieser Gesellschaft, wenn es gerade passt, sobald es schlecht läuft, werden sie als Feindbild instrumentalisiert.« Schreibt DER SPIEGEL.
«Das Ganze ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen», sagte der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner. Dieser Satz ist wegen dem Wörtchen «ziemlich» kein Dementi, sondern definitiv DIE BESTÄTIGUNG der Merz'schen Aussage. Auch wenn die Titelzeile vom SPIEGEL etwas ganz anderes suggeriert. Egal, ob man Friedrich Merz nun mag oder nicht mag.
Ein paar Muster aus der Irrsinns-Schublade der Grünen Deutschlands bezüglich Migrations- und Flüchtlingspolitik; nach Faktencheck durch «correctiv.ord.» nachweisbar!
Der Fairness halber sei festgehalten, dass viele unbestätigte Aussagen Grüner Politiker*innen in den Social Media herumschwirren, die so nie gesagt wurden. Eine Dummheit sondergleichen, wenn derart viel verwertbares, echtes Material zur Verfügung steht. So viel Wahrheit muss ebenfalls sein!
• «Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen.» Çigdem Akkaya – Die Grünen
• «Migration ist in Frankfurt eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie woanders hinziehen.» Nargess Eskandari-Grünberg – Die Grünen
• «Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen.» Joschka Fischer – Die Grünen
• «Natürlich gehört der Islam zu Deutschland, und natürlich gehören Muslime zu Deutschland. Und ich finde, darüber können wir ganz schön froh sein. Es wäre sehr langweilig, wenn wir nur mit uns zu tun hätten.» Vorsitzende der Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckardt – Die Grünen
• «Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf.» Vorsitzende der Bundestagsfraktion Göring-Eckardt – Die Grünen auf einem Parteitag der Grünen
• «Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiss es bis heute nicht.» Robert Habeck – Co-Parteichef Die Grünen in seinem Buch «Patriotismus – Ein linkes Plädoyer»
• «Der deutsche Nachwuchs heisst jetzt Mustafa, Giovanni und Ali!» Cem Özdemir – Die Grünen
• Die Abschaffung der Eidesformel «Zum Wohle des deutschen Volkes» wird im NRW-Landtag einstimmig beschlossen. Arif Ünal – Die Grünen war der Antragsteller für die Änderung
Dass die Grünen im Wahlkampf 2021 um den deutschen Bundestag wie alle anderen Parteien Kreide fressen bis zum Abwinken, ändert nichts an ihrem Gesinnungsterror bezüglich Migration und Flüchtlingswesen sowie einer verlogenen Klimapolitik, die vor allem die sozial Schwachen zur Kasse bittet.
Diese in den Parteistatuten festgeschriebene Gesinnung aber während dem Wahlkampf verstecken zu wollen, zeugt von der heuchlerischen Dummheit dieser widerwärtigen Bonzenpartei und ihren verirrten Mitläufern*innen. Aber auch von der Inkompetenz des Wahlvolks, das nicht fähig ist, Wahlprogramm und Parteistatuten miteinander zu vergleichen.
«Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber.» Dem ist nichts hinzuzufügen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.8.2021 - Tag der mediengeilen Politiker
Erstarkte Taliban: Schweiz will weiterhin Flüchtlinge nach Afghanistan abschieben – die Geisterdiskussion von zwei Schweizer Politikern
In Afghanistan spitzt sich mit den Angriffen der Taliban die Sicherheitslage zu. Trotzdem bleiben Abschiebungen möglich. Trotz der Angriffe der Taliban und Eskalation der Gewalt, will die Schweiz weiterhin afghanische Flüchtlinge ausschaffen können. Doch wie lange noch? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Österreich die Abschiebung eines afghanischen Asylbewerbers bereits vorübergehend verboten. Das Gericht befürchtete eine unmenschliche Behandlung und Folter.
«Konsequent Schutz gewähren»
Die Schweiz müsse nun auch reagieren, fordert SP-Nationalrat Fabian Molina. Heute herrsche in Afghanistan im ganzen Land ein kriegsähnlicher Zustand, in dem täglich Menschen sterben würden. «Es ist deshalb völlig unzumutbar, Menschen in dieses Land zurückzuschicken. Die Schweiz muss ihre Praxis dringend anpassen und den Menschen, die hier Schutz suchen, auch konsequent Schutz gewähren.»
«Es ist völlig unzumutbar, Menschen in dieses Land zurückzuschicken.» – Fabian Molina - Nationalrat (SP/ZH)
Im Juli hat die afghanische Regierung die europäischen Länder gebeten, für die nächsten drei Monate auf Abschiebungen zu verzichten. Die nordischen Länder Norwegen, Schweden und Finnland folgen diesem Wunsch. Deutschland, Österreich und die Schweiz bisher aber nicht.
Harter Kurs angekündigt
Es sei richtig, eine harte Haltung gegenüber afghanischen Flüchtlingen einzunehmen, findet SVP-Nationalrat Thomas Aeschi. «Deutschland und Österreich haben einen harten Kurs gegenüber afghanischen Migranten angekündigt. Auch die Schweiz muss hart bleiben», betont er.
«Auch die Schweiz muss hart bleiben.» – Thomas Aeschi - Nationalrat (SVP/ZG)
«Vor allem auch als Abschreckung, dass nicht noch mehr junge afghanische Männer über sichere Drittstaaten in die Schweiz illegal einreisen und hier ein Asylgesuch stellen.»
Trotz der Eskalation der Gewalt: Die Schweiz hält denn auch nach wie vor an der Möglichkeit fest, abgewiesene Flüchtlinge nach Afghanistan abschieben zu können. Seit 2019 hat die Schweiz niemanden mehr unfreiwillig nach Afghanistan zurückgeschickt, wie das Staatssekretariat für Migration SEM mitteilt. Aber es schliesst nicht aus, in den kommenden Monaten vereinzelt Rückführungen vorzunehmen – zum Beispiel von straffälligen Personen. Schreibt SRF.
Eine seltsame Sommerloch-Diskussion, die SVP-Hardliner Thomas Aeschi und der Weltenretter aller Mühseligen und Beladenen, Fabian Molina von der schwächelnden SP, vom Zaun brechen.
Krieg herrscht in Afghanistan seit Jahrzehnten und nicht erst seit der erneuten Machtübernahme durch die Taliban, die übrigens seit ihrer Erfindung durch God's own Country (USA) with a little Help from Pakistan, nie weg waren.
Etwas anderes als Krieg mit tausenden von zivilen Toten durch Kollateralschäden der Besatzertruppen der "hehren westlichen Wertegemeinschaft" herrschte nie während den letzten 20 Jahren am Hindukusch. Das müsste selbst dem vermutlich historisch etwas unbedarften Molina bewusst sein.
Es gibt Gründe, weshalb die ländliche Bevölkerung Afghanistans die Machtübernahme durch die Taliban begrüsst. Einer davon ist die unsägliche Korruption der vom Westen in Afghanistan installierten, pseudo-demokratischen Regierung aus Landesfürsten und Warlords. Milliarden wurden vom Westen planlos in dieses mafiöse Konstrukt verbuttert, von denen nichts bei der Bevölkerung ankam.
Vergessen Sie die Mär der Brunnen und Schulhäuser, die angeblich gebaut wurden. Das war nicht einmal der berühmte Tropfen auf den heissen Stein. Also vernachlässigbar, aber gut für die heimische Legitimation der Verteidigung der westlichen Freiheit am Hindukusch.
Vollends absurd wird das Palaver zur Selbstdarstellung der beiden Politiker über Abschiebungen afghanischer Asylbewerber unter Berücksichtigung der Tatsache, dass laut dem Staatssekretariat für Migration SEM seit 2019 kein einziger Asylbewerber - auch nicht straffällige - nach Afghanistan abgeschoben wurde.
Worüber unterhalten sich also diese beiden Partei-Granden via willfährigen Medien? Über Abschiebungen, die es seit 2019 gar nicht mehr gibt und die auch nicht stattfinden werden! Und sollte das SEM mit Abschiebungen liebäugeln, wüssten die NGO ("Nicht gewählte Organisation" mit staatlicher Alimentierung) dies zu verhindern.
Verschwenden die beiden Selbstdarsteller auch nur einen einzigen Gedanken daran, dass sie mit ihrem parteipolitisch gefärbten Gesülze, das Pauschalurteile fördert, den integrierten Afghanen in der Schweiz nur schaden, den kriminellen Asylbewerbern und Wirtschaftsmigranten aus dem mehrheitlich salafistisch geprägten Steinzeitland jedoch helfen?
Eine vernünftige Lagebeurteilung über die anstehende Flüchtlingswelle tut Not, wollen wir Zustände in der Schweiz verhindern, wie sie derzeit in Österreich bereits herrschen. https://www.krone.at/2479126.
Eine weitere Flüchtlingsflut wie 2015/2016 würde die Schweizer Gesellschaft zerreissen und den vorhersehbaren Untergang der Schweizer SP nur noch beschleunigen. Wer halb Afghanistan aufnimmt, hilft nicht etwa Afghanistan, sondern wird selbst zu Afghanistan!
Narzisstischer Sommerlochmüll und Geisterdiskussionen von zwei selbstverliebten, mediengeilen Schweizer Politikern helfen da definitiv nicht weiter.
Molinas Anliegen der unbegrenzten Aufnahme der afghanischen Bevölkerung wird längst erfolgreich von den NGO betrieben. Und wenn Nationalrat Aeschi der Meinung ist, dass die Einreise junger afghanischer Männer über sichere Drittstaaten in die Schweiz tatsächlich «illegal»ist, dann soll er gefälligst gegen diese Illegalität im Parlament ankämpfen. Wozu haben denn die «Bürgerlichen» eine parlamentarische Mehrheit?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.8.2021 - Tag der albanischen Kriminaltouristen
Aarburg: Heroin und Kokain im Wert von mehreren hunderttausend Franken beschlagnahmt
Am Dienstagnachmittag konnte die Kantonspolizei Aargau drei Personen anhalten, die mehrere Kilogramm Heroin und Kokain mit sich führten.
Die Kantonale Staatsanwaltschaft führt gegen drei Albaner im Alter von 26, 41 und 58, die sich als Touristen in der Schweiz aufhalten, ein Verfahren wegen des Verdachts auf qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beschuldigten stehen unter dringendem Verdacht, mit grösseren Mengen Heroin und Kokain gehandelt zu haben.
Am Dienstag, 03. August 2021, konnte die Kantonspolizei Aargau nach umfangreichen Ermittlungen die Beschuldigten in Aarburg anhalten. Bei der Anhaltung führten die Beschuldigten mehrere Kilogramm Heroin und Kokain sowie eine grössere Menge Bargeld mit sich. Die Beschuldigten wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat in der Zwischenzeit Untersuchungshaft beantragt. Die Betäubungsmittel wurden durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Strassenwert der beschlagnahmten Ware beträgt mehrere hunderttausend Franken.
Schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihrer Medienmitteilung.
Nicht jeder Albaner ist ein Drogendealer. Aber beinahe jeder in der Schweiz verhaftete Drogendealer stammt entweder aus Albanien oder dem Kosovo. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Albanien laut Wikipedia im Länderranking des Kokainkonsums weltweit an zweiter Stelle liegt. Getoppt nur von God's own Country, den USA. Wieviel Kokain die albanische Bevölkerung snifft und wieviel in den Export geht, weiss vermutlich nicht mal Wiki.
Ärgerlich ist, dass die drei albanischen Kriminaltouristen mit grösster Wahrscheinlichkeit eine Landesverweisung von geschätzten fünf Jahren kassieren, zwei drei Wochen später aber dank ungeschützter Grenzen bereits wieder irgendwo in der Schweiz auf der Matte stehen, um ihre harten Drogen an die Drogenkids zu verkaufen.
Die Landesverweisung ist leider nichts anderes als ein Placebo zur Beruhigung des Volkes, das vor Jahren die SVP-Initiative "Kriminelle Ausländer raus" an der Wahlurne abgesegnet hat. Die Wirkungslosigkeit dieser staatlich verfügten Lachnummer wird Ihnen sogar die Luzerner Polizei bestätigen, die ja mit dem abstrusen Karma hausiert, "dass Drogen halt zu einer Stadt gehören". So wie Drogenhandel und Albanien samt der Filiale Kosovo Begriffe sind, die zusammengehören wie Yin und Yang.
Bei allem Ärger sollten wir jedoch niemals vergessen, dass es in der Schweiz einen kaufkräftigen, bis tief in die höchsten Gesellschaftsschichten hinein reichenden Markt für harte Drogen gibt. Und wo ein florierender Markt ist, sind die Händler nicht weit. Das ist ein Naturgesetz. Bevor wir jetzt über die Albaner den Stab brechen, sollten wir uns an die eigenen, versnifften weissen Nasen greifen. Soviel Ehrlichkeit muss sein.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.8.2021 - Tag der Flüchtlingswelle
Litauen drängt Migranten nach Belarus zurück
Litauen hat damit begonnen, über Belarus ins Land kommende Flüchtlinge und Migranten zurückzuweisen und notfalls auch zurückzudrängen. Innenministerin Agnė Bilotaitė wies die Behörden an, die Asylsuchenden aufzuhalten und zu internationalen Grenzübergängen und diplomatischen Vertretungen "umzuleiten". Dabei dürfen die Behörden gegebenenfalls auch Gewalt anwenden.
Abschreckende Maßnahmen sollen gegen jene ergriffen werden, die den Anordnungen nicht folgen, hieß es. Was das im Detail bedeutet, wurde nicht verraten. Wie die größte baltische Nachrichtenagentur BNS berichtet, haben die litauischen Grenzschützer bereits an den beiden vergangenen Tagen die Mehrzahl der angehaltenen Menschen zurückgewiesen. Genaue Zahlen wollten die Behörden nicht nennen.
Laut Bilotaitė ist das Vorgehen völkerrechtskonform. Parlamentspräsidentin Viktorija Čmilytė-Nielsen räumte jedoch ein, die Maßnahme könnte eventuell internationalem Recht zuwiderlaufen.
Warten auf Stacheldraht
Aufgrund der Migrationsbewegungen an der 680 Kilometer langen Grenze zu Belarus hat Litauen mit dem Bau eines Grenzzauns begonnen. Weil aber nicht genug Nato-Draht vorhanden ist, muss Vilnius auf die Lieferungen befreundeter Länder warten. Mit Anfang der Woche sind heuer bislang 4.000 Flüchtlinge und Migranten angekommen, sagte Außenminister Gabrielius Landsbergis dem Nachrichtenportal "Politico" – im gesamten Jahr 2020 waren es 80.
Klar ist für ihn und viele andere, dass Belarus' Machthaber Alexander Lukaschenko die Migranten als "politische Waffe" einsetzt, als Rache für EU-Sanktionen gegen sein Land. Die meisten von ihnen kommen aus dem Irak, Syrien und afrikanischen Ländern wie dem Kongo. Laut Landsbergis lässt sie Belarus ins Land einfliegen und schickt sie dann in Richtung litauische Grenze.
Proteste in Litauen
Wenn sich nichts ändert, rechnet der Außenminister bis Ende des Sommers mit 10.000 Neuankünften – oder sogar mehr. Litauen hat daher die EU um Hilfe dabei gebeten, die Grenze zu schützen und Druck auf Belarus und die Herkunftsstaaten zu erhöhen.
In Litauen selbst wurde protestiert – gegen die Migranten und dagegen, dass Unterkünfte für sie errichtet werden sollen. Schreibt DER STANDARD.
Litauen scheint aus der Flüchtlingskrise 2015 und dem derzeit rebellierenden Volk seine eigenen Schlüsse gezogen zu haben. Trotz der Tatsache, dass die Gesamtzahl der Einwohner von 1990 bis 2017 wegen der Emigration von 3,7 auf 2,8 Millionen Einwohner*innen geschrumpft ist, was unter anderem mit dem Exodus der russischen Minderheit des baltischen Staates heim ins russische Mutterland zusammenhängt.
Trotz dem Negativsaldo der Einwohnerzahl verzichtet Litauen auf die Geschenke des Diktators Alexander Lukaschenko aus dem Nachbarland Belarus. Wohlwissend, dass bei dieser Flüchtlingsflut nicht nur Flugzeugingenieure, Universitätsabsolventen, Ärzte und IT-Koryphäen auf dem Weg ins gelobte Land sind, sondern auch eine grosse Anzahl von Analphabeten.
Eigenartig mutet hingegen an, dass der übliche Shitstorm seitens der EU-Granden gegenüber den (angeblich verbotenen) ziemlich konsequent und mit aller Härte durchgeführten Push-back-Massnahmen des EU-Vorzeigestaates Litauen ausbleibt, wie ihn Griechenland, die FRONTEX, Ungarn und weitere EU-Staaten bisher erlebt haben. Seltsamerweise wird auch von «Zurückführung» und nicht von «Push back»-Massnahmen gesprochen.
Push-back-Massnahmen übrigens, die auch von den USA, dem Anführer der «hehren westlichen Wertegemeinschaft», an der Grenze zu Mexico durchgezogen werden. Selbst unter Papa Joe Biden. Da kann es ja wohl kaum sein, dass die Zurückweisung von Migranten an der Landesgrenze völkerrechtswidrig ist, wie der Litauische Parlamentspräsidentin Viktorija Čmilytė-Nielsen befürchtet. Wenn selbst der Leuchtturm der Demokratie und Menschenrechte, die Vereinigten Staaten von Amerika und Guantanamo, dieses Mittel anwendet.
Könnte es sein, dass die hohen Kommissäre*innen der EU inklusive Frau von der Leyen seit dem Brexit gelernt haben, welche gesellschaftliche Sprengkraft eine weitere Flüchtlingsflut hat, die notabene längst im Gang ist? Oder ist die Kehrtwendung allein dem Umstand zu verdanken, dass mit dem Push back der Flüchtlinge von Litauen nach Belarus der mit EU-Sanktionen überzogene Machthaber Alexander Lukaschenko in die Schranken gewiesen werden soll?
Fragen über Fragen, die sich übrigens auch die Schweiz mit der längst angerollten Flüchtlingswelle des Sommers 2021 und der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan demnächst stellen muss. Auch wenn die NGO («Nicht gewählte Organisation» mit Staatsalimentierung; für diese wahrheitsgetreue Umschreibung werden jetzt wohl einige mit einer Schnappatmung kämpfen) das ganz anders sehen.
Die Mitteilung des Kantons Luzern, dass allein im Kanton Luzern knapp Tausend Flüchtlinge aus den Jahren 2015/16 nach Beendigung der Schule im Sommer 2021 in der Sozialhilfe landen, sollte eigentlich Warnung genug sein. Nicht alles kann allein der Corona-Pandemie in die Schuhe geschoben werden. Fakt ist, dass die Integration dieser tausend Flüchtlinge in den Schweizer Arbeitsmarkt (im Niedriglohnsektor) auf Jahre hinaus zwar nicht gescheitert, aber mit Kosten in Millionenhöhe verbunden ist.
Ein weiteres Versagen der Politik wie 2015 würde auch die Schweizer Gesellschaft (noch mehr) spalten und letztendlich nur der SVP dienen, die durchaus weiss, wie man aus solchen Themen Kapital schlägt. Das haben inzwischen sogar Grüne und Rote Politiker*innen erkannt. Für den Machterhalt und den Verbleib an den Futtertrögen der Nation springen auch Gutmenschen über ihre eigene Ideologie. Wetten, dass...
PS: Mehr Informationen und Hintergründe über Herkunft und Netzwerke bzw. Schlepperorganisationen der Migranten an Litauens Grenze finden Sie (auf englisch) hier: https://euobserver.com/migration/152583?utm_source=euobs&utm_medium=email
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.8.2021 - Tag der Jasskollegen und des Politikversagens
Image-Kampagne im Aargau: Pflegeheime buhlen mit umstrittenen Plakaten um neue Kundschaft
Jasskollegen finden: Der Verband der Aargauer Heime möchte älteren Menschen die Angst vor dem Heim nehmen.
«Ich geniesse die vielen Kontakte im Alterszentrum», «Ich freue mich, wenn meine Familie zum Essen kommt» Oder: «Von meinem Zimmer habe ich eine grossartige Aussicht». Mit solchen Slogans werben Plakate im Aargau für einen Aufenthalt im Pflegeheim. Hinter der Aktion steht der Verband der Aargauer Heime Vaka.
In Coronazeiten haben viele ältere Menschen die Lust am Wohnen im Heim verloren. Todesfälle während der Corona-Wellen, die Angst vor Isolation und dem monatelangen Verzicht auf Besuch ist für sie wenig attraktiv. Diverse Heime mussten wegen der schlechten Auslastung der Betten bereits Stellen streichen, zum Beispiel das städtische Seniorenzentrum in Zofingen. Der finanzielle Druck auf die Alters- und Pflegeheime ist gross.
Plakate mit elf verschiedenen Sujets sollen zeigen, was der sogenannte Heimvorteil für die Bewohnenden eines Pflegeheims sein kann. Von Juli bis Ende August sind die Slogans auf Plakaten und Bussen im Aargau zu sehen. Die Kampagne kommt aber nicht überall gut an, gerade während der noch andauernden Pandemie.
SVP-Kritik an Plakat-Kampagne
Die Plakate wurden unter anderem von der Aargauer SVP-Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin Martina Bircher in der Aargauer Zeitung kritisiert. Die Kampagne vermittle ein falsches Bild. Pflegeheime seien für Menschen, die stationäre Pflege nötig hätten, und nicht für die Suche von Jasskollegen konzipiert, findet sie. Heime müssten die Betten nicht zwingend auslasten, sondern nach der Coronakrise allenfalls umdenken und neue Konzepte erarbeiten.
Man wolle mit der Aktion auf keinen Fall ältere Menschen ins Heim «abschieben», sondern ihnen die Angst vor dem Heim nehmen, erklärt der Präsident der Aargauer Heime, André Rotzetter, gegenüber SRF. Das Ziel der Kampagne: Wer ein Pflegeheim für seinen Alltag brauche, solle sich getrauen. Die Situation in den Heimen sei längst wieder anders.
«Klar, am Anfang gab es schwierige Situationen. Nach zwei bis drei Monaten war das aber vorbei. Es gab wieder Besuch und interne Aktivitäten in den Heimen. Das Image entspricht nicht der Realität», betont Rotzetter.
Der Verband der Aargauer Heime will nach vorne schauen. «Die Pflegeheime, das Personal, die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Angehörigen haben eine belastende Zeit hinter sich. Jetzt wollen die Einrichtungen der Bevölkerung im Aargau zeigen, dass die Pflegeheime für Menschen mit Unterstützungsbedarf ein sicherer und guter Ort zum Leben sind», hält André Rotzetter vom Verband fest und hofft, dass die Plakat-Aktion ihr Ziel erreicht. Schreibt SRF.
Wenn es stimmt, was die (ehemals) vertrauenswürdige NZZ vor Jahren schrieb, dass jede/jeder zehnte Arbeitnehmer*in der Schweiz im Gesundheitswesen beschäftigt sein soll, kommt die Schweizer Gesellschaft nicht umhin, sich irgendwann mit dem komplexen Thema der schweizerischen Gesundheitsindustrie zu befassen. Bevor sich nur noch die Gutverdienenden die Krankenkassenprämien leisten können.
Gefragt ist eine Diskussion jenseits von Zynismus, dafür aber mit Blick auf die Realität und die Naturgesetze. Von der Wiege bis zur Bahre! Ohne selbst auferlegte Tabus. Logischerweise kann diese Debatte nur ausserparlamentarisch geführt werden. Zu umfangreich und zu eng sind die Verstrickungen und Netzwerke zum persönlichen Profit des Schweizer Parlaments querbeet durch alle Parteien hindurch mit dem Gesundheitswesen.
Bundesrat Ueli Maurer sagte ja nicht umsonst, dass markante Veränderungen im Schweizer Gesundheitssystem zum Wohle der Prämienzahler*innen nicht möglich seien, solange «das Flugzeug (Anm. gemeint war die Gesundheitsindustrie) von 200 Piloten gesteuert werde». Mit diesen 200 Piloten war niemand anders als die Mitglieder*innen des Schweizer Parlaments (Nationalrat und Ständerat) angesprochen.
Nachdem die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr bei der «vulnerablen» Gruppe der Risikopatienten über 80 Jahre gewütet hatte, beklagten etliche Schweizer Altersheime leere Betten in ihren zur Bereicherung politisch dominierter Verwaltungsräte*innen privatisierten Etablissements.
Einige, unter anderen auch die Stadt Zofingen, jammerten über diese «Tragödie der leeren Altersheimbetten» sogar in ihren Newslettern und entliessen in hektischer Betriebsamkeit sogar Pflegepersonal, das während der Corona-Krise noch für die heroische Leistung beklatscht wurde. Dafür stellten besonders emsige Altersheime, wie zum Beispiel das Zofinger Altersheim, eine neue Koryphäe fürs Marketing ein. Ein Schelm wer Böses denkt.
Die Schweiz hat sich durch die «bürgerliche Mehrheit» des abartigen Neoliberalismus dazu hinreissen lassen, Kernaufgaben des Staates zu privatisieren. Die teilweise verheerenden Folgen führte uns die Pandemie mit erschreckender Deutlichkeit vor Augen.
Wie zum Beispiel die Beschaffung fehlender Masken zum Schutz vor Corona durch die private Firma Emix Trading GmbH, die zwei SVP-Jungspunds aus Zürich mit exzellenten Verbindungen in die Politik plus einen Internetportal-Ableger aus dem Balkan zu Multimillionären beförderte. https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/dank-corona-zur-luxuskarosse-zwei-zurcher-jung-unternehmer-verdienen-millionen-mit-maskenverkauf-ld.1231251
Ein Politik- und Staatsversagen sondergleichen! Ein Staat lässt es zu, dass sich charakterlose Individuen auf Kosten einer notleidenden Bevölkerung ohne jegliche strafrechtliche Verfolgung mit horrenden Beträgen, die das Vorstellungsvermögen der meisten Bürgerinnen und Bürger übersteigen, masslos bereichern dürfen. Das muss man sich erst auf der Zunge zergehen lassen!
Ausgerechnet unsere demokratisch gewählten Politiker*innen, die in der Arena-Narrenshow und bei jedem Interview – besonders vor Wahlen – für jedes gesellschaftlich anstehende Problem als allwissende Instanzen stets eine vorgestanzte Parteiparole zur Hand haben und ihre hohlen Phrasen dreschen, versagen in einem Moment der Not und der Krise kläglich.
Die zuständigen Departemente sind nicht einmal in der Lage, einen Allerweltsartikel wie Schutzmasken selber zu beschaffen. Mehr noch: Sie verwandeln unseren Staat in eine Bananenrepublik.
Nachdem die Zürcher Bentleyboys vom Herrliberg der Schweizer Armee zum Teil mangelhafte zehn Millionen Hygienemasken und 500’000 FFP2-Masken zu Wucherpreisen verkauft und geliefert hatte, strengte Bundesrätin Viola Amherd nicht etwa ein gerichtliches Verfahren gegen die Parasiten an, sondern gab sich mit einer Ersatzlieferung für die schadhaften Produkte zufrieden.
Dass bei solch üblen Vorkommnissen – sogar auf Bundesratsebene – die Volksseele hochkocht und sich in unsäglich abstrusen Demonstrationen durch die Schweizer Städte entlädt, sollte eigentlich niemanden verwundern.
«Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt», sagte der ehemalige Präsident der Bundesrepublik Deutschland Gustav Heinemann. Ein weiser Mann. Diesen Pfad der Tugend, der für eine «soziale Marktwirtschaft» heilig sein sollte, hat die Schweiz unter dem Einfluss der Staatsdoktrin «Der Markt regelt alles» verlassen.
Dass der Markt längst nicht alles regelt, bewies die Corona-Pandemie mit schonungsloser Deutlichkeit. Die «Maskenaffäre» ist mit den «verlochten» Millionen nur ein Nebenkriegsschauplatz unter all den Milliarden, die seit Beginn der Corona-Krise bis heute nach dem Giesskannenprinzip vom Bund verteilt worden sind.
Viele davon sicherlich zu Recht. Einige zu Unrecht, wie Bundesrat Ueli Maurer in der NZZ mutmasste: «Vier Milliarden der Hilfskredite werden wohl nicht zurückbezahlt.» Damit stapelte er allerdings etwas tief. Experten gehen von einem wesentlich höheren Betrag aus.
Bei solch schwindelerregenden Zahlen mutet es etwas skurril an, dass unsere gewählten und allwissenden Politiker*innen aus dem Hohen Haus für die fehlende Milliarde in der AHV bis jetzt ausser «Rentenalter hinaufsetzen» keine Lösung gefunden haben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.8.2021 - Tag von God's own Children
Mehr Hinrichtungen in Saudi-Arabien nach Ende der G20-Präsidentschaft
In Saudi-Arabien ist die Zahl der Todesstrafen nach Abgabe des G20-Vorsitzes nach Angaben von Amnesty International wieder angestiegen. Zwischen Jänner und Juli dieses Jahres wurden 40 Menschen in dem Königreich hingerichtet, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation hervorgeht. Das sind mehr als im gesamten Jahr zuvor. 2020 – während der Zeit der saudischen G20-Präsidentschaft – waren insgesamt 27 Menschen hingerichtet worden.
Allein im Dezember wurde bei neun Menschen die Todesstrafe vollstreckt – am 1. Dezember hatte Saudi-Arabien den Vorsitz wieder abgegeben. "Sobald das Rampenlicht der G20 auf Saudi-Arabien verblasst ist, haben die Behörden ihre rücksichtslose Verfolgung von Menschen wieder aufgenommen", sagte die stellvertretende Direktorin für den Nahen Osten und Nordafrika der Organisation, Lynn Maaluf. Mehrere Menschen seien auf "Grundlage eines grob unfairen Verfahrens" zu Haftstrafen und mitunter auch zum Tode verurteilt worden. So werden nach Amnesty-Angaben etwa durch Folter "Geständnisse" erzwungen.
Menschenrechtsaktivisten in Haft
Unter anderem für satirische Netzbeiträge und Menschenrechtsaktivismus hätten Menschen in der ersten Jahreshälfte auch langjährige Haftstrafen bekommen. Nach dem Gefängnis erwarteten viele von ihnen unter anderem Reiseverbote. Ein solches wurde auch für die berühmte Frauenrechtsaktivistin Loujain al-Hathloul verhängt. Sie war wegen ihres Engagements für ein Ende des Fahrverbots für Frauen zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt worden.
Der G20-Vorsitz, den das Königreich im Dezember 2019 übernommen hatte, sei lediglich eine "kurze Atempause der Repression" in dem Golfstaat gewesen, folgert Amnesty. Mindestens 39 Menschen sitzen den Angaben nach derzeit noch wegen ihrer Menschenrechtsarbeit oder freier Meinungsäußerung in saudischen Gefängnissen. Das Königreich gehört zu den Ländern mit den meisten Hinrichtungen weltweit. 2019 waren nach Recherchen von Amnesty 184 Menschen – teils auch öffentlich – hingerichtet worden. Schreibt DER STANDARD.
Sparen Sie sich Ihre Schnappatmung!
Dass Saudi Arabien, mit dem die «hehre westliche Wertegemeinschaft» intensive und lukrative Handelsbeziehungen pflegt, ein Unrechtsstaat ist, muss wohl kaum betont werden.
Doch was Hinrichtungen im Namen von «Allahu akbar» anbelangt, glänzt nicht nur der salafistische Scharia-Staat aus dem Nahen Osten.
Auch der Hegemon und Anführer der «hehren westlichen Wertegemeinschaft», besser bekannt unter dem Namen «United States of America», lässt sich nicht lumpen, was die Hinrichtungen von Verurteilten anbelangt: Allein im glorreichen Bundesstaat Texas wurden von 2014 bis 2021 64 Menschen hingerichtet.
Während sich die islamistischen Wüstensöhne auf ein Steinzeitbuch mit dem Namen «Koran» berufen, handeln «God's own Children» (gemäss Ronald Reagan; Google hilft weiter!) im Namen der Verfassung von «God's own Country».
Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Auch wenn beide im Namen eines imaginären «Gerechten» handeln, der zu allem Übel, liebe Vertreter*innen der weltweiten Genderideologie (wertfrei!), stets männlich ist. Was für die Muslime Allah ist, ist für die Evangelikaler Jesus Christus.
Mehr Heuchelei geht nicht. Und dies im Jahr 2021 – 67 Jahre nach Albert Einsteins «Gottesbrief» aus dem Jahr 1954.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.8.2021 - Tag der Nullsummenspiele
Flüchtlingswelle in Österreich: Neue Welle von Aufgriffen an der Grenze
Nur eine Woche nachdem an der burgenländischen Grenze innerhalb von zwölf Stunden 104 Migranten gestoppt worden sind, schwappte auch dieses Wochenende eine Flüchtlingswelle zu uns über: Diesmal wurden 147 Männer - viele aus Afghanistan und Syrien - entlang der grünen Grenze gestellt. Schlepper hatten sie in Ungarn ausgesetzt.
Drückende Schwüle, angespannte Gesichter und eine surrende Drohne, die bei Nikitsch in die Lüfte abhebt - die „Krone“ ist beim Start einer nächtlichen Grenzpatrouille an der grünen Grenze zu Ungarn dabei. Kurz vor Mitternacht der erste Kontrollerfolg: Das „fliegende Auge“ der Polizei hat Migranten aufgespürt. Sie sind als helle Punkte auf dem Steuerungsdisplay klar erkennbar.
Binnen Minuten werden sie aufgegriffen: vier junge Syrer, von teuer bezahlten Schleppern in Ungarn ausgesetzt und weiter Richtung Österreich geschickt. Zusammengekauert im grünen Gemüsefeld glaubten sie, nicht entdeckt zu werden. Alle vier Burschen tragen einen Rucksack. Voll mit dem Allernotwendigsten und der versprochenen, aber falschen Hoffnung auf ein Eldorado im Westen: Unterkunft, Arbeit, Lebensglück.
Verstärkung des Grenzschutzes
Nachdem ihnen Uniformierte Covid-Masken übergeben hatten, Transport in eine Erstaufnahmestelle - eine Momentaufnahme von nur einem Grenzeinsatz. Wie berichtet, haben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) bereits vor einer Woche für eine Verstärkung des Grenzschutzes gesorgt. Seither kontrollieren 1000 Soldaten und 400 Polizisten den Illegalen-Strom.
Ein Flüchtlingsstrom, der weiter fließt. Allein in der Nacht auf Sonntag wurden in Schattendorf, Andau, Mannersdorf, Deutschkreutz und Niktisch 147 junge Männer aufgegriffen. Wie durchgesickert ist, hat man in Oberpullendorf bereits eine Notaufnahmestelle eingerichtet. Schreibt die Kronen-Zeitung.
Österreichs Regierung entwickelt sich mit atemberaubender Geschwindigkeit zu einem Narrenkäfig. Nach dem brutalen Tod der 13-jährigen Leonie, die von vier afghanischen Asylbewerbern in Wien sexuell missbraucht worden war, kocht die Volksseele.
Bei den einschlägigen Themen in den österreichischen Medien melden sich rekordverdächtige 6'000 (und mehr) Leserinnen und Leser im Forum und machen ihrem Entsetzen über das grausame Verbrechen an einem Kind und der Wut über das Politikversagen Luft. Und dies nicht nur in den Boulevardmedien.
Die im Polit-Marketing bestens geschulte ÖVP-Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz ist sich sehr wohl bewusst, dass die österreichische Asylpolitik gesellschaftlich eine enorme Sprengkraft bis hin zu Neuwahlen besitzt und vor allem die rechtsradikale Oppositionspartei der FPÖ stärkt.
Mit lächerlichen Schuldzuweisungen an Fehler aus der Vergangenheit und Amtsstellen, die vom Koalitionspartner (Die Grünen) besetzt sind, weist sie jede Schuld von sich. Unsäglicher Placebo-Aktionismus soll dem empörten (Wahl-) Volk Sand in die Augen streuen und Handlungsfähigkeit in der Asylpolitik der Regierung suggerieren.
Die österreichische Verteidigungsministerin (ÖVP) schickt 1'000 Soldaten und Hightech-Gerät wie Drohnen zur Unterstützung der Polizei an die Grenze zu Ungarn und lädt publikumswirksam auch noch Journalisten ein, die live in Wort und Bild darüber berichten, wie «illegale Asylanten» entlang der «grünen Grenze» aufgespürt werden. Public Relation der Regierung in eigener Sache, die aber als Lachnummer gewaltig in die Hosen geht.
Zumal es «illegale Asylanten» nicht gibt: Entweder sind es Asylanten, und wenn nicht, fallen sie in die Kategorie der Migranten.
Inzwischen realisieren die aufgebrachten Bürgerinnen und Bürger Österreichs, dass der von der Regierung medial hochgejazzte Armee-Einsatz das Geschäft der Schlepper sogar befeuert. Push-Back-Aktionen von Flüchtlingen sind in der EU so oder so verboten. Ganz abgesehen davon, dass Ungarn die «Geschenke» auch nicht zurücknehmen würde. Sowohl Ungarn wie auch Polen akzeptieren keine Flüchtlinge muslimischen Glaubens. Wie die beiden Staaten dies trotz anderslautender EU-Verordnung schaffen, bleibt ein Geheimnis.
Der Armee-Einsatz bewirkt lediglich, dass die in der Nacht mit den Drohnen entdeckten Flüchtlinge etwas früher bei der österreichischen Polizei landen, um das allmächtige Wort «Asyl» auszusprechen, das ihnen Tür und Tor ins gelobte Land öffnet. Ob das nun während der Nacht oder erst im Verlauf des Tages stattfindet, ist ein reines Nullsummenspiel. Die «Flüchtlingswelle» landet in jedem Fall in Österreich.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.8.2021 - Tag des wandelnden Lexikons
Hirn an! Weisst du, wie alt diese Luzerner Bauwerke sind?
Tagtäglich laufen wir in der Stadt Luzern an der Kapellbrücke, dem Zunfthaus zu Pfistern und anderen geschichtsträchtigen Bauwerken vorbei, die älter sind, als wir uns vorstellen können. Beweise uns im Quiz, wie gut du dich mit der Geschichte der Leuchtenstadt auskennst.
Die jahrhundertealte Geschichte der Stadt Luzern ist heute noch vielerorts sichtbar. Sei es bei Häusern, Strassen oder Brücken. Und es ist erstaunlich, wie alt gewisse Orte tatsächlich sind. Bist du sattelfest in der Luzerner Geschichte? Dann zeige uns im Quiz, was du über die Entstehungsjahre einiger der bekanntesten Orte in Luzern weisst!
Es gilt in sieben Runden jeweils drei Orte in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das modernste Gebäude kommt zuoberst, das älteste zuunterst. Du kannst die Bilder swipen oder mit den Pfeilen arrangieren. Aber aufgepasst! Pro Fragerunde hast du nur zwei Versuche. Scheiterst du, heisst es «Game over». Schreibt ZentralPlus.
Ich gebe es zu: «Game over» fand bei mir schon nach dem ersten Foto statt. Da hilft nur noch «das wandelnde Lexikon» vom Artillerie-Verein Zofingen, mit bürgerlichem Namen bekannt als unser aller Res Kaderli.
Da wundert es auch niemanden, dass das geflügelte Wort «zum Haare ausreissen» bei ihm nicht stattfindet.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
31.7.2001 - Tag der Düfte
Es liegt was in der Luft ...
Es blüht, es summt und schwebt! Die Luzerner Stadtgärtnerei hat zusammen mit dem Umweltschutz Luzern und der ZHAW bei der Ufschötti und bei der Kantonsschule Alpenquai Versuchsflächen bepflanzt. In diesem Forschungsprojekt werden ökologisch wertvolle und attraktive Wildstauden-Mischpflanzungen für humusreiche Böden entwickelt. Das Projekt dauert drei Jahre und findet in verschiedenen Städten statt. Angepflanzt werden ausschliesslich in der Schweiz heimische Arten. Schreibt die Stadt Luzern auf Facebook.
Schade, dass man den wunderbaren Duft der Blumen auf der Schütti wegen den Marihuana-Schwaden, die dort allzeit in der Luft hängen, nicht riechen kann.
Drogenrausch statt Blütenrausch.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.7.2021 - Tag der Halsabschneider
21-Jähriger soll Mann in Obdachlosenunterkunft den Kopf abgetrennt haben
Grausame Tat im niederbayrischen Regen: Nach einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft soll ein 21-jähriger Mann sein Opfer erstochen haben. Der Tatverdächtige war der Polizei bereits zuvor durch Eigentumsdelikte und Körperverletzung aufgefallen.
Ein 21-jähriger Mann soll in einer Obdachlosenunterkunft im niederbayerischen Regen einen Mitbewohner getötet und ihm den Kopf abgetrennt haben. Gestorben sei das 52-jährige Opfer laut Obduktionsergebnis durch eine Vielzahl von Messerstichen, teilte die Polizei am Montag mit.
Es sehe so aus, als habe der Mann zum Zeitpunkt der Enthauptung nicht mehr gelebt. Der somalische Tatverdächtige war wenige Stunden nach dem Tod des 52-Jährigen am vergangenen Montag festgenommen und später in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht worden.
Das Tatmotiv sei noch unklar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Der Beschuldigte habe bisher keine Angaben zur Sache gemacht. Das Opfer hatte eine deutsche und kasachische Staatsangehörigkeit.
Man gehe von einem Streit zwischen Täter und Opfer aus, die einander gekannt hätten. Für ein politisches oder religiöses Motiv gebe es bisher keine Hinweise. Der 21-jährige Flüchtling sei in den vergangenen Monaten bereits durch Eigentumsdelikte und Körperverletzung aufgefallen und auch schon im Bezirkskrankenhaus gewesen, sagte der Polizeisprecher.
Bürgermeister kritisiert Behörden
Der Regener Bürgermeister Andreas Kroner (SPD) kritisierte, dass die zuständigen Behörden die Stadt nicht über die Gefährlichkeit des Tatverdächtigen informiert hätten. „Nachdem er zum ersten Mal im Bezirkskrankenhaus war, wurde er einfach zu uns zurückgeschickt, ohne dass man uns gesagt hat, was mit ihm los ist. Das ist für mich untragbar.“
Mehrere Menschen, darunter Flüchtlingshelfer und Mitarbeiter der örtlichen Tafel, hätten sich in Absprache mit der Stadt um die Bewohner der Obdachlosenunterkunft gekümmert, so Kroner: „Man mag sich nicht vorstellen, was da alles hätte passieren können. Das weckt Erinnerungen an den Fall Würzburg.“ Der Bürgermeister will nun einen Brief an das Innenministerium schreiben und Kontakt zum Bayerischen Städtetag aufnehmen, um in derartigen Fällen bessere Absprachen zwischen den Behörden anzuregen. Schreibt DIE WELT.
Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg
Leichtere Verletzungen erlitt am Dienstagabend ein 51-jähriger Taxifahrer bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Forchheimer Bahnhofsvorplatz. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger iranischer Herkunft konnte vor Ort festgenommen werden. Er sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.
Der 51-jährige Verletzte, der im Laufe des Abends Taxifahrten durchführte, weigerte sich zunächst, den späteren Beschuldigten mit seinem Taxi zu transportieren, da sich dieser äußerst aggressiv verhalten hatte. Als er nach einem Auftrag wieder zu dem Taxiparkplatz vor dem Forchheimer Bahnhof zurückkehrte, ging der 23-Jährige, der immer noch dort verweilte, unvermittelt und mit einem Einhandmesser bewaffnet auf den Taxifahrer los.
Bei der folgenden handgreiflichen Auseinandersetzung gelang es dem Angegriffenen, die Stichversuche abzuwehren und den Beschuldigten am Boden zu fixieren, bis eine herbeigerufene Streife der Forchheimer Polizei ihm zu Hilfe kam und den Mann festnahm. Der Taxifahrer erlitt durch die Attacke Verletzungen im Bereich des Oberkörpers.
Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten stellten das Messer sicher und veranlassten zudem eine Blutentnahme, die den Blutalkoholwert des Tatverdächtigen dokumentieren soll.
Am Mittwochnachmittag wurde der 23-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der junge Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Kripo Bamberg bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich bei den Kriminalbeamten unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.
Auch wenn umstritten ist, ob er das überhaupt je gesagt hat, zitieren wir dennoch wieder einmal den unvergesslichen Peter Scholl-Latour: «Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht etwa Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta!»
Die Liste der Messerstechereien der letzten Tage liesse sich beliebig fortsetzen. Ein Küchenutensil erobert die Kriminalstatistiken der europäischen Länder.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.7.2021 - Tag der Herdenimmunität
Sinkende Zahl an Neuinfektionen sorgt für Corona-Mysterium in Grossbritannien
Die Briten bleiben rätselhaft. Kaum hat die konservative Regierung von Boris Johnson alle Covid-Beschränkungen aufgehoben, sinkt plötzlich die Zahl der positiv Getesteten um ein Drittel. Epidemiologen bleiben skeptisch. "Bitte bleiben Sie weiterhin sehr vorsichtig", warnte daher auch Premierminister Boris Johnson am Mittwoch die Bevölkerung.
Seit Mitte Mai, als Pubs und Restaurants auch im Innenraum wieder öffnen durften, war die Infektionsrate scheinbar unaufhaltsam angestiegen. Mit der entsprechenden Verzögerung galt dies auch für die Zahl von Patienten, die einer Behandlung im Spital bedürfen, sowie für die Corona-Toten.
Zuerst steiler Anstieg ...
Superspreader-Events wie mehrere EM-Fußballspiele in Glasgow und London leisteten ihren Beitrag zur neuen Welle. Kopfschüttelnd, teils auch mit scharfer Kritik begleiteten führende Wissenschafter das Vorgehen der Regierung. Bei den Spielen waren bis zu 60.000 Fans im Stadion selbst erlaubt, zusätzlich feierten (und randalierten) Hunderttausende in den Städten. Neil Ferguson, ein prominentes Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Regierung, hielt in diesem Sommer bis zu 200.000 tägliche Neuinfektionen für möglich.
Stattdessen könnte der Peak von knapp 55.000 bereits zehn Tage zurückliegen. Noch am Mittwoch vergangener Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 472, seither gab es aber einen Rückgang um 31 Prozent – wie kommt’s?
Weniger Tests, lautet die naheliegende, aber nicht ausreichende Antwort. Denn ihre Zahl ging über die Woche zwar zurück, aber nur um 14 Prozent. Als weitere Faktoren nennen Experten das Ende des Schuljahres und die Reiselust vieler Briten.
Zudem haben einer Schätzung des Statistikamtes ONS zufolge mittlerweile 92 Prozent der Erwachsenen in England und Wales Antikörper gegen das Virus im Blut.
... dann fallende Zahlen
Zwar mag von Herdenimmunität kaum noch jemand reden; doch der Effekt scheint mehr und mehr realistisch zu sein – ironischerweise gespeist von Events wie der Fußball-EM. Dass diese Ereignisse "so eine große Wirkung haben würden, wie das offenbar der Fall war", sagt Medizinprofessor Paul Hunter, "wäre mir nie in den Sinn gekommen".
Vorsicht bleibt angebracht, schließlich liegt die Aufhebung von Maskenpflicht und Mindestabstand erst eine gute Woche zurück. Zudem bleibt ihre Auswirkung offenbar begrenzt: Restaurant- und Ladenbetreiber berichten vielerorts, dass zumindest ältere Briten über 40 an den monatelang eingeübten Verhaltensweisen festhalten. In Bussen und Bahnen wird dies ohnehin weiter empfohlen, in der Londoner U-Bahn ist es sogar verpflichtend.
Wissenschafter wie James Naismith von der Uni Oxford warnen vor voreiligen Schlüssen, denn hoch genug liegt die Inzidenz immer noch, am Mittwoch immerhin bei 417. Steigend bleibt auch die Zahl der Covid-Patienten im Krankenhaus.
Dieser Tage beseitigt das Kabinett ein Hindernis, das der milliardenschweren Tourismusbranche bisher schwer zugesetzt hat: Derzeit besteht die alberne Situation, dass die auf der Insel mit Astra Zeneca, Biontech/Pfizer oder Moderna Geimpften ohne Quarantäne nach England zurückkehren dürfen, wer aber seine beiden Dosen dieser Medikamente auf dem europäischen Kontinent oder in den USA bekommen hat, sich für fünf oder sogar zehn Tage isolieren muss. Das hat vor allem die lukrativen Kurzbesuche zum Erliegen gebracht. Schreibt DER STANDARD.
Dass nun ausgerechnet Superspreader-Events wie mehrere EM-Fussballspiele in Glasgow und London zur Herdenimmunität beigetragen haben, ist eine interessante These von Sebastian Borger aus London. Möglicherweise ist sie gar nicht so abwegig. Auch wenn die Experten der Virologen-Zunft dagegen Sturm laufen werden. Wetten, dass?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
28.7.2021 - Tag der amerikanischen Kriegslügen
Folge von Cyberangriff: US-Präsident Biden warnt vor «echtem Krieg»
»Mehr als wahrscheinlich, dass wir in einem Krieg enden«: Joe Biden hat eine mögliche militärische Eskalation nach einer Cyberattacke umrissen. Konkret nannte der amerikanische Präsident Russland und China.
Zuletzt hatte es eine ganze Serie von groß angelegten Hacks auf US-Unternehmen gegeben – mit Folgen weit über die betroffenen Firmen hinaus. Vor diesem Hintergrund warnt US-Präsident Joe Biden vor einer wachsenden Bedrohung eines echten Krieges.
»Ich denke, es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir in einem Krieg enden werden – einem echten Krieg mit einer Großmacht – als Folge eines Cyberangriffs von großer Tragweite, und die Wahrscheinlichkeit nimmt exponentiell zu«, sagte Biden bei einem Besuch des Büros des Leiters des nationalen Nachrichtendienstes (ODNI) am Dienstag.
Die Regierung in Washington sehe eine wachsende Bedrohung durch Russland und China. Biden sagte, der chinesische Präsident Xi Jinping sei »todernst« wenn es darum ginge, »die mächtigste Militärmacht der Welt sowie die größte und bedeutendste Volkswirtschaft der Welt bis Mitte der 40er-Jahre, also bis 2040, zu werden«.
Das Thema Cybersicherheit steht auf der Agenda der Biden-Regierung weit oben. Zuletzt hatte eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Angriffen auf Unternehmen wie die Netzwerkmanagementfirma SolarWinds, die Firma Colonial Pipeline, den Fleischverarbeitungsbetrieb JBS und die Softwarefirma Kaseya den USA weit mehr geschadet haben als nur den gehackten Unternehmen. Einige der Angriffe wirkten sich in Teilen der Vereinigten Staaten auf die Kraftstoff- und Lebensmittelversorgung aus.
Bidens Vorgänger lag im Dauerstreit mit den Geheimdiensten
Biden betonte, dass er auf den Nachrichtendienst, der 17 Geheimdienste beaufsichtigt, keinerlei politischen Druck ausüben werde. Seine Äußerung bedeuten eine klare Abkehr von der Politik seines Vorgängers Donald Trump, der wiederholt mit den US-Geheimdiensten aneinandergeraten war.
Streitthemen waren etwa Russlands Rolle bei Trumps Wahlsieg 2016 oder auch bei der Enthüllung, dass der damalige Präsident Druck auf die Ukraine ausgeübt hat, Ermittlungen gegen Biden einzuleiten. Trump wechselte innerhalb seiner vierjährigen Amtszeit vier Direktoren der nationalen Geheimdienste aus. Schreibt DER SPIEGEL.
US-Präsident Joe Biden bedient mit verdächtiger Regelmässigkeit rhetorisch die Kriegstrommel. Vor allem gegen den Herausforderer China. Bezüglich Cyberangriffen dürften die USA allerdings wohl kaum hinter China und Russland zurückstehen. Wenn drei Staaten das Gleiche tun, ist es halt dennoch nicht das Gleiche.
Wann immer es in der Vergangenheit darum ging, einen plausiblen Grund für Angriffskriege unter dem Deckmantel der Verteidigung hehrer Werte der globalen Führungsmacht aus dem Ärmel zu zaubern, waren die USA schon immer äusserst kreativ.
So schossen sie im August 1964 bei einem Scharmützel im Golf von Tonkin aus allen Rohren ihrer vor Ort stationierten Kriegsschiffe auf einen angeblich vietnamesischen Feind, der gar nicht da war: Die Marines lieferten den USA damit jedoch den perfekten Vorwand, endlich in den Vietnamkrieg zu ziehen.
Eine Art Freibrief für den damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson, sich beim Kongress die notwendige Zustimmung für den Angriffskrieg – etwas anderes war der Vietnamkrieg nie – zu holen.
Mit den Veröffentlichungen der geheimen Pentagon-Papiere durch den «Whistleblower» Daniel «Dan» Ellsberg über rechtswidrige Handlungen des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten und des Weissen Hauses wurde 1971 die jahrelange Täuschung der US-amerikanischen Öffentlichkeit über wesentliche Aspekte des Vietnamkriegs aufgedeckt. Unter anderem auch die bewusste und von mehreren US-Regierungen und US-Geheimdiensten gesteuerte Lüge über den «kriegerischen» Vorfall im Golf von Tonkin.
Auch die Memoiren von Johnsons Verteidigungsminister Robert McNamara belegen, dass die US-Regierung die Vorfälle durch bewusste Falschdarstellung zur Durchsetzung ihres seit 1963 geplanten direkten Kriegseintritts benutzte.
Die Vereinigten Staaten von Amerika begannen einen Krieg, in dem während elf Jahren 7,8 Millionen Bomben in Vietnam und den Nachbarstaaten explodierten, Napalm und das chemische Entlaubungsmittel «Agent Orange» https://de.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange eingesetzt wurden und 58'134 Amerikaner sowie geschätzte zwei (mindestens) bis fünf Millionen asiatische Kriegsopfer, darunter circa 1,3 Millionen Soldaten ums Leben kamen. Bei den restlichen Kriegsopfern handelte es sich um Zivilisten.
Wann immer US-Präsident Johnson die Eskalationsspirale der Gewalt im Vietnam-Einsatz erhöhte, berief er sich auf die Tonkin-Resolution; eine konstruierte Lüge.
Die Liste der Erfindung kreativer Kriegslügen durch die USA liesse sich beliebig fortsetzen. Denken wir an die Lüge der «Massenvernichtungswaffen» von Saddam Hussein zurück, mit der Amerika unter Präsident George W. Bush zusammen mit der «Koalition der Willigen» den verheerenden zweiten Krieg gegen den Irak mit einer flammenden Rede des damaligen US-Aussenministers Colin Powell vor der UNO legitimierte. Der sinnlose Krieg destabilisierte die ganze nahöstliche Region mit Folgen, die bis heute nachwirken.
Powell selbst bezeichnete 2005 diese Rede als «Schandfleck seiner Karriere» und entschuldigte sich wenigstens öffentlich dafür. Ray McGovern, der 27 Jahre lang für die CIA in herausgehobenen Positionen arbeitete, sagte: «Die Geheimdienstinformationen (Anm. über die irakischen Massenvernichtungswaffen) waren nicht einfach fehlerhaft, sie waren gefälscht.» Trotzdem glaubt selbst heute noch immer ein grosser Teil der amerikanischen Bevölkerung an das von US-Geheimdiensten zusammengeschusterte Fake-Konstrukt.
Die Kriegsrhetorik von Joe Biden sollte uns nachdenklich stimmen. Getroffene Löwen brüllen bekannterweise nicht grundlos. Der noch herrschende Hegemon hat mit China wirtschaftlich und längerfristig auch militärisch einen mächtigen Gegenpart erhalten. Den sich die USA zusammen mit den «Untergebenen» der hehren westlichen Wertegemeinschaft vor lauter Gier nach den billigsten Produkten, die den grössten Gewinn versprechen (iPhone!), selbst erschaffen haben. So viel Wahrheit muss sein.
Vielleicht sollte sich Joe Biden gelegentlich Goethes «Zauberlehrling» zu Gemüte führen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
27.7.2021 - Tag der Legalitätsfrage
Legal. Illegal. Luzerns «Anti-Graffiti-Team»
Den illegalen Sprayereien im öffentlichen Raum nimmt sich in der Stadt Luzern neu ein Anti-Graffiti-Team an. Dieses setzt sich situativ aus Mitarbeitenden des Arbeitsintegrationsprogramms ReFIT zusammen und entfernt Graffiti von öffentlichen Infrastrukturen. Sie sorgen damit für eine schöne Stadt Luzern.
Helft auch Ihr mit und nutzt die legalen Spraywände der Stadt Luzern. Mit Kreativität und Farbe können die legalen Spraywände entlang des Freigleis im Bereich Kriens-Mattenhof sowie einer Tunneleinfahrt der Sentimatt gestaltet werden.
Schreibt die Stadt Luzern auf Facebook.
Das erstaunt jetzt doch etwas. Wer ausser unserer Stadtregierung und ein paar ewig Gestrigen stört sich denn an kunstvoll gesprayten Graffitis und deren Messages? Haben wir in Luzern mit dem grauen Betonfassaden nicht schon genug Darkness?
Würde dieselbe Stadtregierung und die ihr unterstellten Behörden, wie beispielsweise die Luzerner Polizei, mit der gleichen Vehemenz gegen die unsägliche Vermüllung der Stadt Luzern durch Littering und gegen den überbordenden Drogenkonsum vorgehen, wäre vermutlich mehr zu erreichen.
Die Stadt Luzern würde im nicht unbedingt schmeichelhaften Drogenranking der Schweizer Städte vom zweiten Platz in tiefere Regionen zurückfallen. Ausserdem könnte die Stadt vielleicht tatsächlich den Claim der Stadtluzerner Regierung "LUZERN GLÄNZT" endlich rechtfertigen und nicht wie bis anhin mit sündhaft teuren "Sensibilisierungskampagnen" zur reinen Lachnummer verkommen lassen.
"Arbeitsintegrationsprogramm" tönt ja im ersten Moment gut und sozial, wie es sich für eine (beinahe) linke Stadtregierung gehört. Aber die Frage sei erlaubt, ob solche weltfremden Programme den Flüchtlingen auf ihrem langen Weg in die Arbeitsmigration tatsächlich weiterhelfen? So richtig sexy wirken die Bilder mit den beiden "Arbeitsmigranten" in der Staubwolke jedenfalls nicht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
26.7.2021 - Tag des Zauberwortes
Österreichs Grüne stossen sich an Kosten für aufgestockten Assistenzeinsatz der Armee wegen dem zu erwartenden Flüchtlingsstrom aus Afghanistan
Es wird grüner entlang der heimischen Grenzen. Die Regierung verschärft aufgrund offensichtlich steigender Flüchtlingszahlen den Grenzschutz und stockt die aktuell 1000 zum Assistenzeinsatz abbeorderten Soldaten um 400 Mann auf. Zu welchem Preis, ist allerdings noch völlig offen.
Abgerechnet wird nämlich erst am Schluss. "Es ist im Vorfeld schwer zu sagen, was die Aufstockung kosten wird", sagt Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, zum STANDARD. "Es gibt einfach offene Fragen: Wie sieht das Personal aus? Wie viele Grundwehrdiener werden eingesetzt, die natürlich dann billiger sind. Gibt es für die Unterkunft eine Kaserne? Dann wären in diesem Bereich die Kosten gleich null. Oder müssen Unterkünfte angemietet werden?"
Geld-zurück-Garantie
Im Verteidigungsministerium geht man jedenfalls davon aus, dass die Aufstockung kein zusätzliches Loch in den Regelbudget-Topf reißen wird. Bauer: "Wir bekommen die Kosten zu 100 Prozent ersetzt."
Der Optimismus auf olivgrüner Seite bekommt beim Blick auf die Abrechnung der letzten Jahre einen gehörigen Dämpfer. Im Vorjahr nahm nämlich der Rechnungshof den Assistenzeinsatz und die Unterstützungsleistungen des Bundesheers zum Grenzmanagement seit 2015 unter die Lupe – und stellte dabei erhebliche Mängel fest. So musste das Bundesheer die Kosten für die Assistenz- und Unterstützungsleistungen, die zwischen 2015 und 2017 rund 273 Millionen Euro betrugen, zu einem großen Teil aus dem jährlichen Regelbudget finanzieren, weil Innen- und Finanzministerium nur teilweise für die Kosten aufkamen.
Kritik vom Rechnungshof
Das Verteidigungsministerium erhielt für die Assistenz- und Unterstützungsleistungen nur 90,42 Millionen Euro budgetwirksam ersetzt, stellt der Rechnungshof in seinem Bericht fest. Und empfahl dem Innen- und dem Verteidigungsministerium, eine "gesamthafte und umfassende Evaluierung der Wirkungen und des Nutzens des Assistenzeinsatzes zum Grenzmanagement im Verhältnis zu den eingesetzten Ressourcen" vorzunehmen.
Im Zeitraum September 2015 bis Februar 2016 kamen im Durchschnitt rund 131.500 Flüchtlinge pro Monat nach Österreich. Ab dem Frühjahr 2016 gab es einen deutlichen Rückgang. 2015 erreichten insgesamt 736.247 Flüchtlinge Österreich, 2016 nur noch 153.068. Und die Zahlen sanken weiter auf 27.950 im Jahr 2017 und 10.300 im ersten Halbjahr 2018. Trotz sinkender Zahlen wurde der Assistenzeinsatz mit rund 900 Soldaten weiter aufrechterhalten.
"Weder das Verteidigungsministerium noch das Innenministerium führte eine gesamthafte Evaluierung des Assistenzeinsatzes – im Hinblick auf Wirkungen und Nutzen einerseits und Ressourceneinsatz andererseits – durch. Dies, obwohl die Zahlen der Aufgriffe deutlich zurückgingen", kritisierte der Rechnungshof damals.
Vermehrt Aufgriffe
Offen ist, ob es diese dringend eingeforderte Evaluierung je gegeben hat. Die aktuelle Personalaufstockung an der Grenze begründet Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) jedenfalls erneut mit den steigenden Zugriffszahlen "illegaler Migranten" und mit EU-Asylrichtlinien, "die keine Wirkung zeigen". Heuer habe es bereits 15.768 Aufgriffe gegeben, im Vorjahr 21.700, so Nehammer – das EU-Asylsystem sei "gescheitert".
Grüne für Befristung
Besonders die Grenze zu Ungarn sei ein Hotspot für illegale Grenzübertritte, heuer seien bereits 200 Schlepper aufgegriffen worden, hieß es seitens des Innenministers, der scharfe Kritik an den Asylrichtlinien der EU übte: "Wir bekommen keine Unterstützung vonseiten der EU-Kommission, die sich damit aufhält, über Verteilungsfragen von Flüchtlingen zu debattieren."
Vom Regierungspartner kommt jedenfalls kein grünes Licht für die Aufstockung. "Wir Grüne stehen einem derartig langen und unbefristeten Assistenzeinsatz kritisch gegenüber", stellt Wehrsprecher David Stögmüller im STANDARD-Gespräch klar. Es fehle eine "gesamthafte Evaluierung" des Assistenzeinsatzes. Stögmüller: "Einsätze des Bundesheers sind wesentlich teurer für die Steuerzahler, als würde es die Polizei selber durchführen."
Stögmüller: Geld fehlt für Investitionen
Das Bundesheer müsse hier "abermals auf eigene Kosten, wie der Rechnungshofbericht aufzeigt, für die Versäumnisse des Innenministeriums einspringen". Das Geld fehle dann für dringend notwendige Investitionen oder für die Ausrüstung der Truppe, so Stögmüller.
Laut Ministeriumssprecher Bauer befinden sich aktuell 1000 Soldaten im Grenzeinsatz, rund 230 im Bereich der Botschaftsbewachungen, etwa 350 im Covid-Einsatz, und 134 sind bei Katastrophenhilfen im Inland im Einsatz. Im Ausland befänden sich derzeit 850 Soldaten. Schreibt DER STANDARD.
Kosten hin oder her: Der Einsatz von Bundeswehrsoldaten an der österreichischen Grenze zu den Nachbarländern ist nichts anderes als eine reine Farce.
Haben Migranten*innen österreichischen Boden über die «Grüne Grenze» erreicht, weil es dem österreichischen Nachbarland so gefällt, sind den Bundeswehrsoldaten die Hände gebunden.
Push-Back von Migranten ist gemäss EU-Asylgesetz nicht erlaubt. Also bleibt den Armeeangehörigen nichts anderes übrig, als die betreffenden Personen «einzusammeln» und der österreichischen Polizei zu übergeben. Dort angekommen folgt das übliche Prozedere.
Das Zauberwort «Asyl» öffnet Tür und Tor für die vorübergehende Aufenthaltsbewilligung in Österreich. Weitergehende Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich.
Wenn nun der österreichische Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) weinerlich festhält, das «EU-Asylgesetz sei gescheitert», ist das nichts anderes als eigenes Versagen. Gesetze können auch in der EU geändert werden.
Dafür ist es nun allerdings zu spät: So wie die Staatenlenker*innen der EU nach dem Ausbruch des Syrienkriegs 2011 wussten, dass irgendwann die Flüchtlingskolonnen Europa überfluten würden, ist ihnen jetzt bewusst, dass Millionen von afghanischen Koffern nach dem Abzug der westlichen Truppen aus dem geschundenen Land am Hindukusch mit 38 Millionen Einwohnern (2019, laut Wikipedia) längst gepackt sind.
Dass Österreich mit einer afghanischen Community von knapp 50'000 Personen ein bevorzugtes Zielland sein wird, dämmert nun auch Innenminister Nehammer. Die derzeitige Sommerloch-Auseinandersetzung der beiden Koalitionspartner der österreichischen Regierung ist nicht nur widerwärtiges Polit-Gezänk und teurer Aktionismus, sondern auch der billige Versuch beider Parteien (ÖVP und Grüne), von ihrem eigenen Versagen abzulenken.
Dass die Truppen der «hehren westlichen Wertegemeinschaft» aus Afghanistan abgezogen werden, ist seit Donald Trumps Entscheidung aus dem Jahr 2020 längst bekannt. Ebenso die daraus resultierenden Folgen einer Machtübernahme durch die Taliban.
Wer oder was hinderte die österreichischen Politiker*innen, frühzeitig entsprechende Worst-Case-Szenarien zu entwickeln, statt zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist wie schon 2015?
Nichts!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.7.2021 - Tag der sonnengebräunten Kultfiguren
Jetzt wird auch noch seine geliebte Sonnenterrasse abgerissen: Mieser Sommer treibt Kult-Sünneler Peter Nyffeler an den Rand der Verzweiflung
Nichts mit Hitze diesen Sommer. Das treibt Kult-Sünneler Peter Nyffeler «langsam aber sicher in den Wahnsinn». Dem miesen Wetter nicht genug wird jetzt auch noch sein Zweitwohnsitz abgerissen: die Sonnenterrasse seiner geliebten Badi.
Er sei im Elend und am Rande der Verzweiflung. Mit diesem Hilferuf meldet sich der Aargauer Kult-Sünneler Peter Nyffeler (69) aus dem Sommer, der keiner ist. Nicht nur das miese Sommerwetter setzt ihm zu. Jetzt wird auch noch seine 100-jährige Aarburger Stammbadi zwecks Sanierung geschlossen. Seine geliebte Terrasse der Badeanstalt, seit Jahren sein Zweitwohnsitz im Sommer, fällt der Modernisierung zum Opfer. «Niemand kann sich den Peter ohne die Terrasse vorstellen», klagt Nyffeler zu Blick.
Die Terrasse diente ihm auch als Aussichtsturm, um seinen Blick über Land und Badi schweifen zu lassen. Jetzt werde seine «Zweitwohnung dem Erdboden gleichgemacht». Auch wenn es wieder eine warme Jahreszeit gebe, ein ebenbürtiges Zuhause gebe es nicht länger. Und auch die nahen Badis in Olten SO und Reiden LU sind wegen den Überschwemmungen geschlossen.
Für Nyffeler zu viel des Verkraftbaren. Er fühlt sich am Rande eines Nervenzusammenbruchs: «Dieser Sommer ist eine herbe Enttäuschung für mich Sünneler, mit Corona und dem katastrophalen Wetter mit all seinen Überraschungen». All dies treibe ihn «langsam aber sicher in den Wahnsinn». Er habe «ja schon viel erlebt in meinem Leben, aber das ist der Gipfel von allem». Schreibt SonntagsBlick.
Der arme Peter Nyffeler. Der hat ja Sorgen! Um die werden ihn wohl viele Leute beneiden.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.7.2021 - Tag der Unkenntnis
«Es gibt keinen Grund, Afghanistan mit Stolz zu verlassen für die Bundeswehr»
Markus Lanz' Talkrunde zog Bilanz aus fast zwanzig Jahren Afghanistan-Einsatz. Während eine Ex-Soldatin mangelnde Wertschätzung beklagte, stellte Fernsehjournalistin Katrin Eigendorf das Ende der afghanischen Demokratie in Aussicht.
Wer einen Eindruck davon bekommen will, was die Bundeswehr für die Menschen leisten kann, braucht derzeit nur einen Blick in die Überflutungsgebiete im Westen Deutschlands zu werfen. Hunderte Soldatinnen und Soldaten sind dort im Einsatz, um mit schwerem Gerät, Expertise und Muskelkraft bei den Aufräumarbeiten und der Wiederherstellung der Infrastruktur zu helfen. Eine Unterstützung, die angesichts der mancherorts katastrophalen Zustände geradezu uneingeschränkt willkommen ist.
Überwiegend negativ fällt hingegen die Beurteilung des Einsatzes in Afghanistan aus, wobei sowohl die fast zwanzigjährige Präsenz der Bundeswehr in dem asiatischen Land als auch der jüngst erfolgte Abzug der Truppen Kritik ernten. Dass Afghanistan wieder in die Hände radikaler Kräfte fallen könnte und in Teilen schon gefallen ist, sorgt bei vielen für Kopfzerbrechen.
Markus Lanz machte beides – die ungewisse Lage an der Ahr und Erft, vor allem aber jene am Hindukusch – in seiner ZDF-Talkrunde zum Thema und diskutierte darüber mit der Auslandsreporterin Katrin Eigendorf, der freien Journalistin Nadia Nashir-Karim, der Ex-Soldatin Dunja Neukam und dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
Letzterer zeigte sich in Anbetracht der schweren Unwetterfolgen hierzulande fassungslos, erinnerte daran, dass man sich an solche Starkwetterlagen wahrscheinlich gewöhnen müsse, und setzte sich für „unkomplizierte Hilfen“ ein. Er sagte also, was man in dieser oder ähnlicher Form in den letzten Tagen aus dem Munde so ziemlich aller Politikerinnen und Politiker gehört hat. Dass sich davon gerade eine so große Zahl in den betroffenen Gebieten aufhält, verteidigte Klingbeil: „Das ist ja auch ein Signal, dass wir die Menschen dort nicht alleine lassen.“
„Am Ende entscheiden die Köpfe“
Besonders für den Kanzlerkandidaten seiner Partei, Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, hatte der SPD-Generalsekretär – wie nicht anders zu erwarten – viel Anerkennung übrig. „Das ist derjenige, der jetzt in einer schwierigen Situation für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sofort gehandelt hat und sofort Dinge auf den Weg gebracht hat“, lobte Klingbeil. Zudem ließ er keinen Zweifel daran, dass die Wahlkampagne der Sozialdemokraten noch immer auf einen Wahlsieg ziele und ganz auf Scholz fokussiert sei. „Am Ende entscheiden die Köpfe“, lautete das Fazit des SPD-Politikers.
Im Zuge der Debatte über die strategischen Machtoptionen der SPD verbissen sich Lanz und Klingbeil in einen sehr unergiebigen Streit darüber, wie unfair der Umgang der SPD mit Armin Laschets und wie nachsichtig mit Annalena Baerbocks Fehlleistungen im Wahlkampf gewesen sei. Da kamen der ungewohnt harte Bruch und das neue Thema Afghanistan-Einsatz gerade recht. Als Sohn eines Berufssoldaten und als Abgeordneter, in dessen Wahlkreis der große Bundeswehrstandort Munster liegt, hatte Klingbeil auch hierzu einiges beizutragen.
Aus Zivilisten wurden Feindbilder
Allerdings war es die Ex-Soldatin Dunja Neukam, die mit ihren Erfahrungen die Diskussion fortan prägte. Die gelernte Krankenschwester war auf der Intensivstation der Militärbasis „Camp Warehouse“ tätig und blickte auf vier Einsätze zurück. Sie berichtete von den anfänglichen Hoffnungen der Truppe, etwas errichten und für die afghanische Bevölkerung erreichen zu können, sowie von der anschließenden Ernüchterung, als klar geworden sei, dass die Amerikaner weniger Interesse an einem Aufbau des Landes gehabt hätten, und nach Anschlägen das Misstrauen gegenüber den Einheimischen zugenommen habe.
Aus Zivilisten seien Feindbilder geworden, schilderte Neukam und fügte zusammenfassend hinzu: „Es macht schon was mit einem.“
Die ehemalige Soldatin beklagte einen Mangel an Wertschätzung für die Leistungen und an Verständnis für die Nöte der Einsatzkräfte. Diese müssten im Falle einer posttraumatischen Belastungsstörung immer noch den komplizierten Nachweis erbringen, „dass etwas passiert ist“ und wo sie wie seelisch verwundet worden seien. „Das ist ganz schön traurig, dass sich da noch nichts gebessert hat“, so Neukam.
Die Journalistin Katrin Eigendorf konstatierte ebenfalls eine fehlende Würdigung, forderte aber zusätzlich „eine politische Debatte, über die Fehler, die gemacht wurden“, und stellte fest: „Es gibt keinen Grund, Afghanistan mit Stolz zu verlassen für die Bundeswehr.“
Aus Sicht der erfahrenen Auslandsberichterstatterin war schon der Ansatz, „ein Land militärisch von außen demokratisieren“ zu wollen, fragwürdig. Auch hätten besonders die USA den Einfluss der Taliban unterschätzt. „Die Amerikaner sind in das Land reingegangen mit wirklich dramatischer Unkenntnis“, kritisierte Eigendorf.
Düstere Prognose für Afghanistan
Die Taliban, die vor allem bei der ländlichen Bevölkerung einem gewissen Wunsch nach Ordnung entgegenkämen, wollten nun einen Scharia-Staat errichten. „Es gilt dann in Afghanistan islamisches Recht, das ist dann keine Demokratie mehr. Es wird dann auch keine Wahlen mehr geben“, prognostizierte die Journalistin und dämpfte damit auch die Erwartungen an die möglichen Ergebnisse eines innerafghanischen Dialogs.
„Ich glaube, sie haben ihre Strategie geändert“, lautete hingegen die verhaltene Hoffnung von Nadia Nashir-Karim, der zweiten Journalistin in der Runde, mit Blick auf die „neue Generation“ von Taliban. Als Beispiele nannte sie einen im Vergleich zu früher freieren Umgang mit Medien und die mögliche Bereitschaft, auch Mädchen zu unterrichten. Allerdings sei allgemein eine stärkere religiöse Ausrichtung in der Erziehung zu erwarten, so die Mitbegründerin und Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins e.V. sinngemäß.
Nashir-Karim, die im afghanischen Kabul geboren wurde und in Kundus aufwuchs, warb in diesem Zusammenhang noch einmal um Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft bei den Friedensverhandlungen. Sie zeigte sich zudem besorgt, Afghanistan könne mehr noch als bisher zum Spielball der Nachbarländer werden.
Wer es bis hierher noch nicht begriffen hatte, bekam außerdem von der Journalistin die vielleicht elementarste Erkenntnis der Sendung und des gesamten NATO-Einsatzes mit auf den Weg in die Nachtruhe: „Afghanistan ist sehr, sehr komplex.“ Schreibt DIE WELT.
Spätestens beim Auftritt der «erfahrenen Auslandsberichterstatterin» und Fernsehjournalistin Katrin Eigendorf, die das «Ende der afghanischen Demokratie» ohne Einspruch der Debattenrunde in Aussicht stellte, war die Talk-Show von Markus Lanz gelaufen. Jedenfalls für mich. Obschon ich sie mir bis zum bitteren Ende angesehen habe.
Geschätzte «erfahrene Auslandsberichterstatterin» Katrin Eigendorf: Afghanistan war noch nie eine Demokratie und wird auch in absehbarer Zeit keine werden. Das aus diversen Afghanistan-Konferenzen seit 2001 von der hehren westlichen Wertegemeinschaft im Einklang mit afghanischen Stammesfürsten und Warlords zusammengeschusterte Konstrukt der «islamischen Republik Afghanistan», das zur Demokratisierung und Befriedung des Landes führen sollte, war von allem Anfang an eine Farce mit dem Ziel, den Rachefeldzug sowie die Milliardenbeträge für die «Wiederaufbauhilfen» der USA im Gleichschritt mit der NATO nach Nine-Eleven zu rechtfertigen.
Islam und Demokratie sind zwei Begriffe, die sich gegenseitig ausschliessen. Es gibt auf diesem Erdball keine einzige «islamische Demokratie». Das müsste auch einer «erfahrenen Auslandsberichterstatterin» bekannt sein!
Knöpfen wir uns die «Geberkonferenz für Afghanistan» vom 21./22. Januar 2002 in Tokio vor, die «Wiederaufbauhilfen» in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar zusagte. Diese Hilfsgelder flossen zum grössten Teil in die Taschen der korrupten, «demokratisch» gewählten Regierungen unter Hamid Karzai und Aschraf Ghani. Bei dem seit Jahrzehnten geschundenen afghanischen Volk kam von diesen Milliarden an Hilfsgeldern kaum etwas an. Bei den Warlords hingegen schon. Da muss man sich nicht wundern, dass die Steinzeit-Islamisten der Taliban mit ihren Vorstellungen eines «fundamental islamischen Gottesstaates» salafistischer Prägung breite Zustimmung der afghanischen Bevölkerung geniessen.
Dass an vorgenannter Geberkonferenz ausgerechnet Italien für den «Aufbau der Justiz» und damit für die «Bekämpfung der Korruption» in Afghanistan beauftragt wurde, sagt alles über Werte und Moral des Westens an diesen unsäglichen Afghanistan-Konferenzen aus.
Wenn dann auch noch DIE WELT zum Schluss kommt, der Satz der zweiten Journalistin der Talkrunde, Nadia Nashir-Karim, «Afghanistan ist sehr, sehr komplex» sei die elementarste Kenntnis aus der Talk-Show gewesen, bleibt einem ausser Kopfschütteln über die Naivität der Artikelschreiberin Daniele Raffaele Gambone nichts mehr übrig.
Wer mit so viel Unkenntnis gesegnet ist, gepaart mit Dummheit, sollte besser keine Artikel schreiben. Trifft doch dieser als Erkenntnis hervorgehobene Satz so ziemlich auf sämtliche Länder der Erde zu.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.7.2021 - Tag der Risikogruppen
«Es gab eine Menge Liebe»: Trump spricht über Kapitol-Attacke
Inmitten der Streitereien um das Gremium zur Kapitol-Attacke sorgen Interview-Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump über den 6. Januar für Aufregung.
«Und es war übrigens auch eine liebevolle Menschenmenge. Es gab eine Menge Liebe. Das habe ich von allen gehört», sagt Trump nach einem Audiomitschnitt der «Washington Post»-Reporter Carol Leonnig und Philip Rucker.
Leonnig und Rucker haben Trump für ihr neues Buch «I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year» (etwa: Nur ich kann es richten: Donald J. Trumps katastrophales letztes Jahr) im März interviewt. Er glaube, es sei die grösste Menschenmenge gewesen, zu der er jemals zuvor gesprochen habe, sagte Trump weiter.
Anhänger Trumps hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kapitol-Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner freigesprochen.
In der kommenden Woche soll im Repräsentantenhaus der Ausschuss zur Untersuchung der Attacke auf das Kapitol beginnen. Zwischen Demokraten und Republikanern war es über das Gremium zuletzt zu Zerwürfnissen gekommen. Nancy Pelosi, die Vorsitzende der Kongresskammer, hatte zwei Kandidaten der Republikaner für das Gremium abgelehnt. Die beiden gelten als treue Anhänger Trumps. Der republikanische Minderheitsführer der Kongresskammer, Kevin McCarthy, drohte danach mit einem Boykott des Ausschusses.
«Das ist todernst», sagte Pelosi. «Es geht um unsere Verfassung, es geht um unser Land. Es geht um einen Angriff auf das Kapitol, der aus irgendeinem Grund auf Kosten der Wahrheitsfindung falsch dargestellt wird.» Nach Äusserungen und Handlungen der abgelehnten Kandidaten wäre es «lächerlich», wenn sie Teil dieses Ausschusses wären. Schreibt Blick.
Wir alle, die wir in der Risikogruppe der «alten weisen Männer» angekommen sind, verstehen The Donald.
Ab einem gewissen Alter muss man Liebe annehmen, woher immer sie auch kommt. Das gilt auch für die nicht zur Risikogruppe gehörenden «alten weissen Frauen und Frauinnen*).
* Der Genderismus treibt bei mir derart seltsame Blüten, dass ich wohl bald einer weiteren Risikogruppe zuzuordnen bin.
Sincerly Yours Harvey Einstein
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.7.2021 - Tag des Obes an Stadt und Kanton Luzern
Luzerner Hochwasserschutz-Strategie hat sich bewährt
Die Starkniederschläge der letzten Wochen haben zu einer prekären Lage am Vierwaldstättersee und an den Flüssen im Kanton Luzern geführt. Grössere Schäden blieben aber aus. Die Zwischenbilanz zeigt, dass die umgesetzten Schutzmassnahmen Wirkung zeigten, es dennoch aber einiges zu tun gibt.
Die Starkniederschläge der letzten Wochen füllten Bäche, Flüsse und Seen im Kanton Luzern. Die intensiven Gewitter Anfang Juni bis Juli trafen zudem das Wiggertal stark. Der Vierwaldstättersee, die Reuss und die Kleine Emme erreichten in der letzten Woche hohe bis sehr hohe Pegelstände. Das Hochwasserereignis erinnert stark an dasjenige von 2005, ist aber punkto Abflussmengen in der Kleinen Emme und in der Reuss nicht mit jenem Jahrhundertereignis zu vergleichen, wie die Staatskanzlei Luzern in einer Mitteilung schreibt.
Eine erste Zwischenbilanz des diesjährigen Ereignisses zeigt jedoch: Die Hochwasserschutzmassnahmen, welche seit 2005 im Kanton Luzern umgesetzt wurden, haben sich bewährt und den Kanton vor grösseren Schäden bewahrt. Wie die Gefahrenkarten zeigen, ist das Hochwasserrisiko im Kanton Luzern jedoch nach wie vor hoch und es gibt noch viele wichtige Projekte umzusetzen.
Grosse Investitionen in den Hochwasserschutz seit 2005
Beim verheerenden Hochwasserereignis 2005 entstanden im Einzugsgebiet der Kleinen Emme und der Reuss Schäden von rund 345 Millionen Franken. Bund, Kantone und Gemeinden haben im Nachgang viel in die Vorsorge und die Prävention zum Schutz vor Hochwasser investiert. So auch der Kanton Luzern. 2011 wurde das Reusswehr für rund 23 Millionen Franken saniert und für die Zukunft fit gemacht.
Bei der Kleinen Emme wurden verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen – etwa Ausbau der Abflusskapazität am Seetalplatz und der Bau einer Holzrückhalteanlage in Ettisbühl – realisiert. Insgesamt wurden bis heute rund 72 Millionen Franken entlang der Kleinen Emme verbaut. Kleine Flüsse und Bäche bergen ebenfalls ein grosses Schadenpotenzial bei Unwettern. Auch hier investiert der Kanton viel in den Hochwasserschutz. So wurde etwa beim Götzentalbach in Dierikon der Abschnitt Dörfli offengelegt und ausgebaut sowie verschiedene Hochwasserrückhaltebecken beispielsweise in Buttisholz und Menznau realisiert.
Kanton treibt Hochwasserschutz-Projekt Reuss voran
Extrem-Ereignisse wie beispielsweise Starkniederschläge werden in Zukunft häufiger auftreten. Obwohl schon einiges realisiert wurde, stehen noch viele wichtige Hochwasserschutz-Projekte in der Pipeline, die umgesetzt werden müssen, um das Siedlungsgebiet vor Überschwemmungen zu schützen. Der Kanton wird dafür gemäss dem Massnahmenprogramm 2020 bis 2024 zum Schutz vor Naturgefahren in den kommenden Jahren durchschnittlich 50 Millionen Franken pro Jahr in den Hochwasserschutz investieren.
Insbesondere treibt der Kanton das noch ausstehende Hochwasser- und Renaturierungsprojekt Reuss voran, welches die Bevölkerung und die Unternehmen im Reusstal schützen soll und rund 200 Millionen Franken kosten wird. Die Dämme an der Reuss sind ungefähr 150 Jahre alt. Deren Stabilität ist aufgrund einer möglichen Durchsickerung oder bei Überströmung nicht gewährleistet, womit ein Dammbruch nicht ausgeschlossen werden kann.
«Das Schadenpotenzial in diesem dicht besiedelten Wohn- und Wirtschaftsstandort ist nach wie vor enorm hoch», sagt Regierungsrat Fabian Peter, Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, und fügt hinzu: «Um die Bevölkerung, die Infrastruktur und die Wirtschaft zu schützen, müssen wir weiterhin in diese Richtung investieren. Es gibt in Sachen Hochwasserschutz noch einiges zu tun.»
Hochwasserschutz ist interdisziplinäre Daueraufgabe
Der Hochwasserschutz wird primär durch den Unterhalt der Gewässer und durch raumplanerische Massnahmen gewährleistet. Mit dem Gewässerunterhalt sollen die Gewässer, Bauten und Anlagen so unterhalten werden, dass sie ihre Funktionen stets erfüllen. Die risikoorientierte Raumplanung sowie das naturgefahrengerechte Bauen tragen entscheidend zur nachhaltigen Steuerung der Hochwasserrisiken bei. Dort, wo diese Massnahmen nicht ausreichen, werden wasserbauliche Massnahmen getroffen.
Der betriebliche Gewässerunterhalt an den grossen Fliessgewässern sowie der bauliche Gewässerunterhalt und der Wasserbau sind in der Zuständigkeit des Kantons. Wogegen der betriebliche Gewässerunterhalt an allen anderen Gewässern sowie die raumplanerischen Massnahmen Aufgabe der Gemeinden sind.
Kanton mahnt wegen Pegelständen nach wie vor zur Vorsicht
Zu einem umfassenden Hochwasserschutz gehören weitere Massnahmen: So haben beispielsweise in den letzten Jahren die Gemeinden für ihre Siedlungsgebiete Gefahrenkarte erstellt. Weiter gibt es seit 2005 eine flächendeckende Notfall-Planung der Feuerwehren: Die Einsatzkräfte trainieren die Bewältigung von Unwetterereignissen gemeinsam mit den Fachleuten der kantonalen Abteilung Naturgefahren aus der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur sowie den Behörden. Damit einher ging auch der Aufbau eines Pikettdienstes Naturgefahren. Dieser dient als Kontaktstelle für die Einsatzkräfte. Die Fachleute der Abteilung Naturgefahren unterstützen im Ereignisfall die Einsatzkräfte vor Ort.
Obwohl sich die Situation aktuell beruhigt und die Pegelstände zurückgehen, ist noch immer Vorsicht geboten. Zudem zeigen die Wettervorhersagen für das kommende Wochenende eine wieder zunehmende Gewitter- und Schauerneigung: Weiterhin gilt deshalb, in der Nähe von Gewässern wachsam zu bleiben. Schreibt ZentralPlus.
Stadt und Kanton Luzern veröffentlichen eine positive Zwischenbilanz über das Hochwasserdrama im Juli 2021. Eine Redensart sagt, dass Eigenlob stinkt. Doch in Bezug auf die Zwischenbilanz der Hochwasser-Strategie von Stadt und Kanton Luzern im Sommer 2021 ist diese Redensart nicht zutreffend.
Als einer, der die Hochwasserkatastrophe in der Stadt Luzern im Jahr 2005 im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib mit ausgezogenen Schuhen und Socken, bis ans Knie hinaufgezogenen Hosenbeinen und nassen Füssen erfahren hat, muss ich lobend feststellen, dass Stadt und Kanton aus diesem verheerenden Naturereignis von damals gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen haben.
Ein neuer Massnahmenkatalog für Naturkatastrophen wurde erarbeitet, der sich jetzt bestens bewährte. Vorwarnungen und Schutzmassnahmen funktionierten ebenso professionell wie reibungslos und einwandfrei. Ein Kompliment an Stadt und Kanton Luzern ist tatsächlich angebracht.
Ein Dankeschön an Stadt und Kanton Luzern von einem, der Euch schon oft kritisiert hat, aber nicht mit Lob spart, wenn es angebracht ist.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.7.2021 - Tag der Klimahysterie
Bauern und Klima: Muss Klimaschutz beim Bauern anfangen?
Ob starke Niederschläge oder grosse Trockenheit – die Bäuerinnen und Bauern bekommen den Klimawandel immer häufiger zu spüren.
Die starken Niederschläge der letzten Woche haben auch der Landwirtschaft zugesetzt. Vor allem Gemüsebauern müssen mit spürbaren Einbussen rechnen. Und laut den Klimaforschern wird es in Zukunft wegen des Klimawandels vermehrt zu extremen Wetterereignissen kommen.
Kilian Baumann, Bio-Bauer aus Suberg im Berner Seeland und Nationalrat der Grünen, hat die Unwetter der letzten Woche deutlich zu spüren gekriegt. «Wir hatten extremen Hagelschaden und auch Überschwemmungen bei unserem Bauernhaus, das seit 200 Jahren am selben Ort steht», erzählt er. In den letzten fünf Jahren sei sein Haus bereits zweimal von Überschwemmungen betroffen gewesen.
«Fleischkonsum reduzieren»
Gerade die Landwirtschaft müsste dringend für den Klimaschutz einstehen, fordert Baumann, der auch die Kleinbauernvereinigung präsidiert. Schliesslich führe der Klimawandel zu mehr Stürmen und Hagelschlag und dann auch wieder zu extremer Trockenheit.
Um der Klimakrise entgegenzuwirken, stellt Baumann auch unbequeme Forderungen: «Wir müssen den Fleischkonsum reduzieren. Insbesondere in der Schweiz ist er viel zu hoch.» So könnte der Tierbestand reduziert werden, sagt Baumann.
Auf Klimawandel vorbereiten
Dass es einen Klimawandel gibt, bestreitet auch SVP-Nationalrat Martin Haab nicht. Der Präsident des Zürcher Bauernverbandes ist aber kritisch gegenüber staatlichen Klimaschutzmassnahmen. Die kleine Schweiz könne da ohnehin nicht viel ausrichten.
Viel wichtiger sei es, dass sich die Bäuerinnen und Bauern auf den Klimawandel vorbereiteten. Zum Beispiel mit trockenresistenten Pflanzensorten. «In trockenen Gebieten im Süden ist zum Beispiel Hirse/Sorghum als Futterpflanze Gang und Gäbe», betont Haab. «Bei uns kennt man das nicht oder noch fast nicht. Vielleicht gibt es bei uns in Zukunft einen Wechsel beim Anbau von Silomais in Richtung Futtersorghum.»
Angst vor hohen Treibstoffpreisen
Zum im Juni gescheiterten CO2-Gesetz hatte der Schweizer Bauernverband die Ja-Parole gefasst, sich aber nicht wirklich dafür eingesetzt. Für das CO2-Gesetz war auch Erich von Siebenthal, Landwirt aus dem Berner Oberland und SVP-Nationalrat.
Er weiss aber, dass viele Bauernkollegen aus Angst vor höheren Treibstoffpreise Nein gestimmt haben. «Wir haben eigentlich gar keine Wahl», erklärt er. «Wir müssen noch mit Diesel und Benzinmotoren unsere Arbeit erledigen und können nicht ausweichen auf einen anderen Motor.»
Der Klimawandel beschäftigt die Schweizer Bauern. Nicht umsonst gibt es mittlerweile auf vielen Bauernhof-Dächern Solarzellen. Bei der Frage, wie weit staatliche Klimaschutzmassnahmen gehen sollen, gibt es aber keinen Konsens. Schreibt SRF.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Nein! Ich bestreite den Klimawandel nicht. Allerdings verbunden mit einigen, bis jetzt unbeantworteten, Fragen. Wie viel vom Klimawandel «menschgemacht» ist, können in diesem babylonischen Stimmengewirr weder die oft selbsternannten Klima-Experten noch die Klima-Forschenden exakt auf den Punkt bringen. Dass wir den Klimawandel beschleunigen, dürfte wohl ausser Frage stehen.
Aber: Die eine Studie widerspricht der anderen. Nicht selten sogar innerhalb hochangesehenen und renommierten Universitäten. Die vor sich hin serbelnden Massenmedien nehmen die Geschenke dankend an. So passiert es immer öfters, dass zwei sich widersprechende Studien mit Aufmacher auf der Frontseite eines Mediums zeitgleich präsentiert werden.
Kein Verbrechen. Das ist absolut legal. Nur fehlt da meistens der Quervergleich zwischen den Studien. Oder die fachliche Analyse eines Experten, um die hochkomplexen Zusammenhänge auch für unbedarfte Personen wie mich verständlich zu erklären.
Klimathemen sind in den notleidenden Massenmedien zum überlebenswichtigen Clickbaiting verkommen, während sie sich für die meist etwas klammen Universitäten zur Geldmaschine entwickelt haben. Daran ist nichts auszusetzen, solange es der Allgemeinheit dient. «Für die interdisziplinäre Forschung wurden in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Instituten geschaffen, in denen industrielle und universitäre Forschung zusammenwirken», schreibt Wikipedia.
Dass sich aus der Klimaforschung eine Industrie gebildet hat, ist in der heutigen Zeit nichts anderes als eine logische Konsequenz. Hat aber den gravierenden Nachteil, dass sich bei jeder Studie die Frage stellt, wer hat die Studie bezahlt? Wessen Interessen werden damit gesteuert?
Dass Kilian Baumann, Bio-Bauer und Nationalrat der Grünen, die Gelegenheit beim Schopf packt und gleich den Fleischkonsum von uns Menschen an den Pranger stellt, entspricht der Verbotsideologie der Grünen. «Im Westen und bei den Grünen nichts Neues», wie Erich Maria Remarque wohl sagen würde.
Denn längst wird der Klimawandel querbeet durch alle Parteien und Organisationen für die nicht immer altruistischen, eigenen Zwecke instrumentalisiert.
Aktuell zu beobachten beim deutschen Bundestagswahlkampf, der vor lauter Betroffenheitskundgebungen der handelnden Polit-Akteure in den verwüsteten Hochwassergegenden Deutschlands zur Farce abgleitet. Oder in die Substanzlosigkeit, wie Peter Huth gestern in DER WELT schrieb.
Hochwasser und Hagelgewitter gab es schon immer. Ob sie heute tatsächlich häufiger stattfinden als früher, kann ich nicht beurteilen. Dazu fehlen verlässliche Zahlen aus der Forschung, die über mehr als nur die letzten zehn Jahre hinausgehen. Mag auch sein, dass ich die entsprechenden Forschungsergebnisse nicht gefunden habe. Wenn dem so ist, sage ich als Lateiner: «Mea culpa.»
Gefühlt würde ich jedoch meinen, dass es in meiner Zeit als Kind und Jugendlicher, die immerhin einige Jahrzehnte zurückliegt, nicht öfter, aber auch nicht seltener, schwere Gewitter und Hagelschlag in den Sommermonaten gab. Ich erinnere mich an diese beiden Naturgewalten deshalb so gut, weil ich mich als Kind davor gefürchtet habe und oft wie Espenlaub zitterte, was in meinem Gedächtnis bis heute verankert ist.
So ist beispielsweise in meinem Kopf haften geblieben, wie Blitzschläge über Jahre hinweg mehrmals Äste von den Obstbäume auf dem Hof meines Vaters abrissen oder gar den ganzen Baumstamm entzweiten.
Oder dass der Agent der Hagelversicherung jedes, aber auch wirklich jedes Jahr meinen Vater besuchte. Erst sassen sie zusammen in der Küche, um anschliessend nach ein paar «Kaffee Lutz» die vom Hagel verwüsteten Getreidefelder zu besuchen und die Entschädigung für den Hagelschaden festzulegen.
Mein älterer Bruder klärte mich einmal mit einem Augenzwinkern auf: «Vater und der 'Versicherungsgummi' lassen es jetzt hageln.» Auch wenn ich mich widerhole: Das fand in einem Zeitraum von circa zehn Jahren jedes Jahr statt. Warum? Weil es jedes Jahr gehagelt hat.
Es sei allen empfohlen, die vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, stets daran zu denken, dass es den Klimawandel trotz der unsäglichen Hysterie von Medien und Politik tatsächlich gibt.
Aber die Rettung des Klimas beginnt vor der eigenen Haustüre. Beim eigenen Lifestyle. Damit wäre vermutlich mehr zu erreichen als mit Verboten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.7.2021 - Tag der Mission accomplished
Mindestens 35 Tote bei Anschlag auf Markt in Bagdad
Bei einem Terroranschlag in Bagdad sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Auf einem Marktplatz hat am Montagabend ein Attentäter einen selbstgebauter Sprengsatz gezündet, berichtete die staatlichen Nachrichtenagentur INA unter Berufung auf Sicherheitskreise. Nach Angaben von Reuters gab es mindestens 60 Verletzte.
Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag nun für sich reklamiert. Ein Selbstmordattentäter habe einen Sprengstoffgürtel in dem mehrheitlich schiitischen Vorort Sadr City gezündet, teilte die Miliz am Dienstag auf Telegram mit. Zum Zeitpunkt des Anschlags drängten sich zahlreiche Menschen auf dem Markt. Sie waren unterwegs, um Lebensmittel für das bevorstehende islamische Opferfest Eid al-Adha einzukaufen.
Weiterhin aktive Terrorzellen
Armeesprecher Jahia Rasul leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein. Erst im Jänner waren bei einem schweren Terroranschlag in Bagdad 32 Menschen getötet und 110 Menschen verletzt worden. Auch damals bekannte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu der Tat.
Der Irak leidet immer noch unter den Folgen des Kampfes gegen die sunnitische IS-Terrormiliz, die zwischen 2014 und 2017 große Gebiete im Norden und Westen des Landes beherrscht hatte. Immer wieder erschütterten damals auch Terrorattentate das Land. Die irakischen Sicherheitskräfte konnten den IS mit internationaler Unterstützung – insbesondere der USA – militärisch besiegen. Zellen der Terroristen sind aber weiterhin aktiv und verüben Anschläge. Schreibt DER STANDARD.
Eigenartig. Jetzt haben uns doch die führenden Staatsmänner und Staatsfrauen der hehren westlichen Wertegemeinschaft stets erklärt, das Ziel, den IS auszurotten und damit unschädlich zu machen, sei durch die Kriege in Afghanistan, im Irak und und in Syrien erreicht worden.
Ab 1. Mai 2003 offenbarten dies im Gleichklang George W. Bush (in seiner Rede «Mission accomplished» auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln; Teil-Abzug der Truppen aus dem Irak), 2020 Donald Trump (Syrien-Krieg; Truppenabzug), 2021 Joe Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Afghanistankrieg; Truppenabzug).
Scheinen Fake-News gewesen zu sein. Ausser verbrannter Erde, unendlichem Leid der betroffenen Bevölkerung, Kollateralschäden, Flüchtlingswellen und «Failed States» hat die westliche Wertegemeinschaft nichts erreicht. Schon gar nicht die Eliminierung der salafistischen Gotteskrieger, die sich IS-Miliz nennen. Das ist die brutale Wahrheit.
Der angestrebte «Regime Change» (neues Wording «Nation Building») ist bei all den vorgenannten Staaten krachend gescheitert. Vielleicht sollte die unsägliche «Wertegemeinschaft» das Übel endlich an der Wurzel anpacken und die Finanzströme sowie die waffentechnische und logistische Unterstützung an den IS ausschalten. Auch wenn es sich dabei um «strategische Partner» wie Saudi Arabien, die Emirate, Pakistan und die Türkei (NATO-Mitglied!) handelt. Dann würden sich sinnlose Kriege von selbst erledigen.
Doch leider wird das nie eintreten. Dazu basieren die «strategischen Partnerschaften» zu sehr auf wirtschaftlichen Interessen, die allerdings nicht im Einklang mit einer «Wertegemeinschaft» stehen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.7.2021 - Tag der lachenden Betroffenheit
Wahlkampf in den Trümmern: #LaschetLacht (Der lachende Kanzlerkandidat)
Wie kann man nur? Scherzen und lachen, während der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in bewegenden Worten zu den Opfern der Flut spricht. Laschet konnte – und erntete damit den ersten medialen Shitstorm dieser Katastrophe und den Hashtag #LaschetLacht.
Vor Ort präsentierte sich die Szene anders. Steinmeier und Laschet hatten in Erftstadt in der örtlichen Feuerwehr Hilfskräfte getroffen und sich danach vor die Presse gestellt. Steinmeier sprach nicht vor Opfern der Flut, sondern vor Journalisten. Die Bewohner der Stadt, falls präsent, konnten den Präsidenten höchstens aus der Distanz sehen.
Während Steinmeier sprach, wartete Laschet zwanzig Meter entfernt im Feuerwehrgebäude, unterhielt sich mit seinen Begleitern und lachte auch zwischendurch. Das sah man aus dem Augenwinkel und es störte, weil es eine Respektlosigkeit war, nicht gegenüber den Opfern, sondern gegenüber dem Bundespräsidenten. Und dieselbe kurze Irritation gab es nochmals, als auch der Bundespräsident sich amüsierte, während Laschet sprach. Aber wie relevant ist das, angesichts der Verwüstungen wenige Meter entfernt?
Dass Laschet und Steinmeier die Katastrophe nicht ernst nehmen, kann man getrost ausschliessen. Und jeder und jede lacht mal, gerade in Stress-Situationen. Bewegende Worte fanden sie beide nicht, eher Floskeln – den meisten Politikern fehlt das rhetorische Charisma. Entscheidend ist ohnehin, ob sie «boots on ground» bringen, wie die Amerikaner sagen, was sie also konkret bewirken.
Wenn der Shitstorm zum Soufflé wird
Die Realität und ihr Kontext sind das eine, die rezipierte Wirklichkeit aber ist offenkundig viel wichtiger. Nicht was passiert, sondern wie es interpretiert wird, ist das alles Entscheidende. Das ist besonders in Zeiten der sozialen Medien so, aber es ist überhaupt nicht neu. In der berühmt-berüchtigten Emser Depesche verkürzte Reichskanzler Bismarck für die Öffentlichkeit die Fakten 1870 absichtlich so, dass er Frankreich zu einer Kriegserklärung provozierte, was zum deutsch-französischen Krieg führte.
Heute entsteht ein Shitstorm einfach viel schneller als damals. Und kann auch rasch wie ein Soufflé in sich zusammenfallen, vor allem, wenn man sich wie Laschet einfach pro forma entschuldigt. So funktioniert politisches Teflon.
Mit Entschuldigungen und Lippenbekenntnissen aber lässt sich der Klimawandel nicht abspeisen. Unabhängig davon, ob dieses oder jenes Ereignis direkt darauf zurückzuführen ist; der Klimawandel wird sichtbar und ist endgültig als Wahlkampfthema in Deutschland angekommen. Vor allem seit nun auch Bayern und Sachsen von Unwettern betroffen sind. Die Union muss zeigen, dass ihr das Thema ernst ist. Und die Grünen müssen zeigen, dass sie bei der Rettung des Klimas nicht das Land wirtschaftlich in den Ruin treiben. Schreibt SRF.
Da scheint sich einer, der antritt um Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden, der Macht der Bilder nicht bewusst zu sein.
Bilder können Wahlen positiv oder negativ beeinflussen. Sie bleiben viel länger im Gedächtnis hängen als eine reine Schlagzeile.
Bundeskanzler Schröder gewann gewann die Bundestagswahl 2002 gegen Edmund Stoiber mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,01 Prozent (ca. 6'000 Stimmen) dank einem inszenierten Bild. Deutschland wurde damals im Sommer mitten in der Ferienzeit von einer Hochwasserflut heimgesucht.
Schröder und Edmund Stoiber unterbrachen ihre Ferien. Medienprofi Schröder stellte sich in Gummistiefeln und martialischer Katastrophenbekleidung mitten in eine überflutete Zone und suggerierte Elan und Tatkraft, während Stoiber im blauen Polohemd in einer geschützten Zone Interviews gab.
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück fuhr bei der Bundestagswahl 2013 gegen Angela Merkel das bis damals schlechteste Ergebnis der SPD ein. Nicht zuletzt wegen einem dämlichen Bild, das den selbstverliebten Kanzlerkandidat mit einer «Stinkefinger»-Pose zeigte.
Man darf sich fragen, welche Koryphäen die kandidierenden Politiker*innen als «Medienexperten» beraten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
18.7.2021 - Tag der steigenden Covid-Zahlen
Covid-Zahlen steigen – Rechnen Sie wieder mit 10'000 Fällen täglich, Herr Berset?
Seit Anfang Juli verdoppeln sich die Corona-Infektionen in der Schweiz wöchentlich – aktuell sind es rund 600 pro Tag. Rechnet man konsequent weiter, dürften wir gegen Ende August auf 10'000 positive Tests an einem Tag kommen. Die Behörden haben keine Massnahmen zur Einschränkung ergriffen. SRF News hat beim obersten Verantwortlichen der Schweiz, Bundesrat Alain Berset, nachgefragt, wie lange das noch so bleiben wird.
SRF News: Rechnen Sie mit 10'000 Fällen pro Tag auf Ende August?
Alain Berset: Ich glaube, die Situation ist nicht unerwartet so. Es war immer klar, dass es wieder einmal steigen wird. Jetzt ist es aber eine völlig andere Situation als das letzte Mal. Jetzt haben wir die Impfung. Zwei Drittel der erwachsenen Leute in unserem Land haben schon mindestens eine erste Impfung bekommen. Aber klar, das ist nicht angenehm und klar, die Pandemie ist noch nicht vorbei.
Wir haben die Impfung. Aber doch: Ende August 10'000 Infektionen, Anfang September wären es dann 20'000, wenn sich das konsequent verdoppelt. Wie lange wollen Sie das so laufen lassen?
Es ist unmöglich, mit Prognosen zu arbeiten. Wir müssen aber mit Szenarien arbeiten. Und alles ist schon ziemlich klar. Der Bundesrat hat schon im April oder Mai das Drei-Phasen-Modell festgelegt.
Wir arbeiten weiter entlang dieser Strategie. Im Moment sind die Hospitalisierungen ganz, ganz tief. Das Virus zirkuliert unter den jüngeren Menschen. Und man muss sagen, es wird eine Welle geben, die primär die Ungeimpften betreffen wird.
Im Moment stecken sich vor allem junge Leute an. Sie belasten die Spitäler offenbar nicht, sterben im Normalfall auch nicht an Covid-19. Kann man den Jungen diese hohen Infektionsraten zumuten? Fühlen Sie sich da wohl dabei?
Seit dem Anfang hat der Bundesrat alles gemacht, damit die Leute die Wahl haben. Bis Anfang dieses Jahres gab es nur das Risiko, sich anzustecken. Und seit Anfang dieses Jahres haben wir die Auswahl, eine Infektion zu riskieren oder eine Impfung zu machen. Für die jüngeren Menschen stellt die Infektion sehr oft, fast immer, kein grosses Problem dar und sie ist wie andere Infektionen, die schon bei uns existieren.
Rund die Hälfte ist im Moment geimpft in der Schweizer Bevölkerung. Doppelt ein bisschen weniger, einfach ein bisschen mehr. Sind Sie enttäuscht, dass es doch nur so wenige sind?
Nein. Ich glaube, es hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Unser Ziel Anfang Jahr war es, einen Punkt zu erreichen, bei dem 75 Prozent der vulnerablen Personen und 60 Prozent der restlichen Bevölkerung geimpft sind.
Dieses Ziel ist schon übertroffen. Aber mit der Delta-Variante brauchen wir noch mehr als früher. Und jetzt ist wirklich der Moment, wo man sich noch für eine Impfung entscheiden kann.
Rund die Hälfte ist noch nicht geimpft und trotzdem trifft man keine Massnahmen, wenn die Zahlen so stark ansteigen. Das heisst, die Hälfte der Bevölkerung ist betroffen, wenn das Virus wieder stärker zirkuliert. Ist das zulässig?
Wenn man sich nicht impfen lassen kann, ist es eine völlig andere Situation. Für diese Personen haben wir andere Möglichkeiten, um sie gut zu schützen. Und für die, die sich nicht impfen lassen wollen, ist das eine Möglichkeit. Es ist eine Freiheit, die man in unserem Land hat und wir sind sehr daran gebunden. Es ist wichtig, dass das so bleibt. Aber so oder so werden wir alle früher oder später in Kontakt mit dem Virus kommen. Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten: Ein kontrollierter Kontakt mit der Impfung, wenn man das so sagen kann, oder das Risiko, sich anzustecken.
Man könnte auch mehr Druck machen. Frankreich, Griechenland oder auch Grossbritannien haben jetzt eine Impfpflicht eingeführt für Pflegepersonal. Wäre das eine Option für die Schweiz?
In der Schweiz haben wir immer klar gesagt, es ist eine Eigenverantwortung, zu entscheiden, was man mit der Impfung machen will.
Wir sind nach wie vor der Meinung, wir müssen überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Noch einmal mehr erklären, dass das Produkt sehr sicher ist. Es ist sehr wahrscheinlich eine der sichersten Impfungen, die es je gegeben hat auf der Welt, die so viel geimpft worden ist, wie fast keine vorher.
Das Gespräch führte Roger Brändlin.
Und immer wenn Du glaubst jetzt geht endlich ein bisschen mehr, kommt eine neue Virusvariante daher.
Kolumbianische Corona-Variante ist in Österreich angekommen
Bei Kläranlagen-Abwasseranalysen in der Kläranlage Wörthersee West in Kärnten wurden Spuren der kolumbianischen Coronavirus-Variante B.1.621 nachgewiesen. Dies teilte das Österreichische Institut für Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt am Samstag in einer Aussendung mit.
Diese gilt als "Variant of Interest" und wird weltweit beobachtet, da bei ihr der Verdacht auf eine erhöhte Übertragbarkeit besteht. Die Variante wurde zuerst in Kolumbien nachgewiesen, dieser wurde von der WHO noch kein griechischer Buchstabe zugeschrieben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.7.2021 - Tag der Gummistiefel
Gemüsebauer Michael Moser (37) hat den Salat: Auf den Feldern ertrinken sogar die Regenwürmer
Die Unwetter der letzten Tage haben Folgen. Die Felder stehen unter Wasser, die Ernte ist kaputt. Im Winter droht jetzt ein Engpass beim Lagergemüse. Das spüren Konsumenten bei den Preisen.
Michael Moser (37) steht knietief im Wasser. Seine Kartoffeln verfaulen auf dem Feld. Die Unwetter der letzten Tage sorgen für einen Totalausfall beim Gemüsebauern aus Kerzers FR.
Wo das Feld noch nicht komplett überflutet ist, präsentiert sich ein völlig durchnässter Boden. Die Gummistiefel sinken ein, bleiben im morastigen Schlamm stecken. Unter diesen Bedingungen wächst fast nichts mehr. Die Wurzeln des noch jungen Gemüses verfaulen. Das Ganze ist selbst für die Regenwürmer zu viel. Sie verenden im Wasser, sagt Bauer Moser, und treiben in den Lachen auf dem Feld oder den Pfützen am Wegrand. Land unter im Berner Seeland.
«Das ist ein Jahrhundertereignis», sagt Moser. Zuerst der Hagel Ende Juni, dann der grosse Regen. «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Bitter: «Der Hagel hat alles niedergemäht, den Mais zerhauen, den Lauch und den Salat durchlöchert.» Was überlebt hat, ertrinkt mit den Würmern jetzt im Wasser. «Das Gemüse verfault im nassen Boden», sagt Moser. Die Ware eignet sich nicht einmal zum Viehfutter.
Bauer Moser ist kein Einzelfall in der Region
Die meisten Bauern aus der Region teilen das Schicksal von Moser, zeigt eine Umfrage von Blick. Ihre Felder sind verwüstet. Und das hat Folgen für die Konsumenten im ganzen Land, denn das Seeland ist die Gemüsekammer der Schweiz. 25 bis 30 Prozent des inländischen Gemüses wächst im Boden rund um den Murten-, den Bieler- und den Neuenburgersee. Es landet in den Regalen aller grossen Händler.
Tatsächlich sind Migros, Coop, Aldi, Lidl und die anderen Händler bereits jetzt vermehrt auf Importgemüse angewiesen, sagt Markus Waber (31), stellvertretender Direktor vom Verband Schweizer Gemüseproduzenten. Betroffen sind die typischen Sommergemüse wie etwa Broccoli, Blumenkohl oder Salat.
«Bei dem Gemüse auf dem Feld gibt es besonders hohe Ausfälle», so Waber. Nur Tomaten, Gurken oder Auberginen wachsen in Gewächshäusern und waren dort vor den Unwettern geschützt. Aber selbst unter der Glaskuppel gibt es Probleme: Der verregnete Sommer sorgte für lichtarme Verhältnisse, das Gemüse wuchs nur verzögert. Die Migros sagt, dass sie momentan mehr importieren muss als in anderen Jahren. «Fast alle Kulturen sind betroffen», so ein Sprecher.
Wie stark der Preisanstieg ist, zeigt sich noch
Der Mangel an Schweizer Gemüse könnte bis zum Frühling anhalten. Im Juli sollten die Gemüsebauern Karotten und Zwiebeln säen, um damit das Lager für die Wintermonate zu füllen. «Jetzt sind die Böden aber noch zu nass dafür», sagt Waber. Und je später die Gemüsegärtner säen können, desto mehr reduziert sich erfahrungsgemäss der Ernteertrag.
«Das kann sich auch auf den Preis niederschlagen», so Waber. Wird das Angebot kleiner, steigt der Preis. «Wie hoch, kann man aber noch nicht beziffern.»
Er hofft jetzt auf das Verständnis von Detailhandel und Konsumenten. «Es kann sein, dass das Gemüse nicht perfekt aussieht oder man den Salat vielleicht einmal mehr waschen muss.» Wenn das Konsumenten und Detailhandel akzeptieren, könnte ein Teil der Ernte doch noch verkauft werden.
Kartoffeln nicht versichert
Bauer Moser bleibt derweil auf seinem Schaden sitzen. Die Hagelversicherung zahlt nur für den zerschlagenen Lauch und den zerlöcherten Salat. Die verfaulten Kartoffeln sind nicht versichert.
«Wir haben mit einem Ertrag von 30 bis 40 Tonnen gerechnet», sagt er – und zeigt auf ein Feld mit Frühkartoffeln. Das Wasser bedeckt grosse Teile davon. Möwen aus dem nahen Murtensee schwimmen darin, essen die toten Würmer. Die Kartoffeln im Boden sind uneinbringbar. Der Verlust für Bauer Moser: 40’000 bis 50’000 Franken.
Moser hat drei Kinder. 50 Angestellte arbeiten für seinen Betrieb. Der Hofladen im Dorfkern ist eine Anlaufstelle für alle Einwohner der 5000-Seelen-Gemeinde im Kanton Freiburg. «Eigentlich müsste ich jetzt Leute entlassen», sagt Moser, «Kosten senken.» Aber er hält an seinem Personal fest und sitzt das schwierige Jahr aus.
Hoffnung für das Lagergemüse
Immerhin: Die Frühkartoffeln sind geerntet, das Gemüse in den Gewächshäusern ist unversehrt – ein Glück für Moser. Er hofft darauf, dass er beim Verkauf einen guten Preis erzielen kann.
Der Betrieb ist seit Generation in Familienbesitz. Sein Grossvater war schon Bauer, der Vater ebenfalls. Er war es auch, der das Unternehmen ganz auf Gemüse ausgerichtet hat, weg vom Vieh. Produziert wird sowohl konventionell als auch biologisch.
Die letzten Rüebli gräbt Moser im November oder im Dezember aus. Es ist das berühmte Lagergemüse, der wichtige Nährstofflieferant für die langen Wintermonate. Damit könnte es noch was werden, sagt Moser. Aber für den Kabis sieht es schlecht aus. Auch dem habe das Unwetter den Garaus gemacht.
Wie ist das möglich?
Gewitter oder Starkregen können für Regenwürmer tödlich sein. Der Wurm wird durch die Vibration der Regentropfen aus seiner Wohnröhre an die Oberfläche gelockt. In Pfützen und stehenden Gewässern fehlt ihm dann der Sauerstoff, den er über die Hautatmung aufnimmt. Hier sprechen Naturschützer vom Tod durch Ertrinken beziehungsweise durch Ersticken. Andere erklären in Pfützen treibende, tote Würmer mit dem UV-Licht, dass die empfindliche Haut der an die Oberfläche gelockten Regenwürmer verbrannt hat, sodass die Hautatmung versagte. Schreibt Blick.
Mit allem Respekt und Trauer um die Regenwürmer: Dass ich heute in Luzern meine Samstagseinkäufe in Gummistiefeln bewältigen muss, interessiert scheinbar niemanden.
Steht jedenfalls nichts davon im Bligg.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.7.2021 - Tag der Sommerflut
Wunderwürste und Wetterglück: Warum wir bisher vom Schlimmsten verschont wurden
Videos aus dem überschwemmten Schleitheim SH: Hochwasser-Flut reisst Wohnwagen mit
Verschnaufpause - endlich kommt der Sommer: So beruhigen sich jetzt das Wetter und Hochwasser - zumindest vorübergehend
Über 50 Hochwasser-Tote in Deutschland: «Es hätte auch die Schweiz treffen können»
Windsurfer am Bielersee: «Ich surfe bis die Polizei kommt»
Mindestens 58 Hochwasser-Tote in Deutschland – Dutzende vermisst: Zerstörter 700-Seelen-Ort: «Wie ein Tsunami»
Die Hochwasserflut hat auch Blick erreicht. Siehe Bild vom Startseitenaufmacher. Über was würde unser aller Boulevard-Zeitung von der Zürcher Dufourstrasse ohne die Naturkatastrophe mitten im Sommerloch nur berichten? Eine alte Regel besagt: Nichts bringt mehr Quote als Tote. So wird denn auch das verwüstete deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz insgesamt gleich drei Mal auf der Frontseite präsentiert.
Was für die Betroffenen eine Katastrophe sondergleichen darstellt, ist für die Medien willkommenes Sommerlochfutter. Fairerweise sei festgehalten, dass die atemlose Flut-Berichterstattung von Blick nicht die Ausnahme im Schweizer Blätterwald ist, sondern derzeit die Regel.
Bei diesem sensationsgierigen Nachrichten-Overkill kann man nur noch hoffen, dass die Naturkatastrophe bald ihr Ende findet und der Sommer Einzug hält.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.7.2021 - Tag der Palastrevolutionen
Sultan Erdoğan verliert die Gunst des Volkes
Schon die Straße ist ein Statement. Rund 17 Kilometer lang zieht sie eine tiefe Schneise durch eine einst dicht bewaldete Landschaft. Ganze Hügel wurden abgetragen, die Hänge sind jetzt kahl und müssen durch aufwendige Stützmauern vor dem Abrutschen geschützt werden. Rund 50.000 Bäume sollen nach Angaben von Naturschutzorganisationen für den Bau der Straße abgeholzt worden sein, doch gebraucht wird sie offenbar nur sehr selten. Drei kleine Dörfer passiert der Reisende auf der leeren Straße, dann ist plötzlich Schluss. Die kilometerlange Schneise endet vor einer großen Sperre der Gendarmerie. "Bitte wenden Sie umgehend und fahren Sie zurück" ist alles, was der mit einer MP bewaffnete Wachhabende zu sagen hat.
Dank der oppositionellen Zeitungen "Cumhuriyet" und "Sözcü" weiß man seit Neuestem, was am Ende der aufwendig gebauten Straße wartet: die pompöse neue Sommerresidenz des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Lange war der Bau der Sommerresidenz eine Art geheime Staatsaktion, kaum jemand wusste, was da am Ufer der Okluk-Bucht am Gökova-Golf etwas nördlich der Tourismusmetropole Marmaris wirklich gebaut wurde.
Dann machte der Hofarchitekt von Erdoğan, Sefik Birkiye, den Fehler, Pläne und Skizzen des Sommerpalasts auf seiner Website zu veröffentlichen. "Sözcü" entwickelte daraus animierte Fotos und stellte sie ins Netz, dazu Satellitenaufnahmen, die das Ausmaß der Anlage zeigen. Jetzt kann man sich den 300-Zimmer-Palast virtuell von innen und außen anschauen. Es sieht aus wie ein Luxushotel mit Pools, einem künstlich angelegten weißen Sandstrand und einem Hafen für Luxusyachten.
Pünktlich zum fünften Jahrestag des Putschversuchs gegen den Präsidenten am 15. Juli 2016 ist die Sommerresidenz nun fertig geworden – unweit des Orts, wo vor fünf Jahren ein von Ankara entsandtes Kommando der Putschisten Erdoğan in einem Hotel festnehmen sollte. Damals verpasste das Kommando Erdoğan um Stunden – er hatte das Hotel in Marmaris längst verlassen, als die Putschisten ankamen.
Heute, angesichts seiner neuen Sommerresidenz, käme ein Kommando noch nicht einmal mehr in seine Nähe. Für seinen persönlichen Schutz hat Erdoğan mittlerweile in vielfältiger Weise gesorgt, doch es geht ihm nicht nur um Sicherheit. Der türkische Präsident, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, liebt den Luxus und gefällt sich darin, Protz auszustellen. Der Mann, der in einer in Istanbul verrufenen Hafengegend am Goldenen Horn aufgewachsen ist, bewegt sich heute nur noch von einem Palast zum anderen.
Umbau des politischen Systems
Fünf Jahre nach dem Putsch scheint es, dass Erdoğan alles erreicht hat, was ein autokratischer Alleinherrscher erreichen kann. Ein Jahr nach dem Putsch wurde durch eine Verfassungsänderung das parlamentarische System der Türkei in ein Präsidialsystem geändert, und ein weiteres Jahr später, im Sommer 2018, setzte Erdoğan das System mit seiner Wahl zum dann fast allmächtigen Präsidenten in Kraft. Seitdem geht es Erdoğan persönlich immer besser und dem Land immer schlechter.
Kurz nach der Wahl 2018 ließ der Präsident die Bauarbeiten am Sommerpalast bei Marmaris beginnen. Gleichzeitig wurde ganz im Osten des Landes, nahe der iranischen Grenze am Van-See, mit dem Bau eines sogenannten Winterpalasts begonnen. Hoch symbolisch wird dieser nun an der Stelle gebaut, wo angeblich das Zelt des Seldschuken-Sultans Alp Arslan gestanden haben soll, als dieser 1071 in der Schlacht von Manzikert das Heer der Byzantiner besiegte und so für die Türken den Weg nach Anatolien freimachte.
Erdoğan liebt solche Rückgriffe auf die Geschichte: Schon seinen Präsidentenpalast in Ankara, den er bereits im Vorgriff auf seine Präsidentschaft in den Jahren von 2010 bis 2014 in einem Naturschutzgebiet auf den Hügeln vor der Stadt bauen ließ, schmücken vielfältige architektonische Zitate der Seldschuken und Osmanen.
Pompöse Empfänge
Auch in Istanbul ließ es Erdoğan nicht an Prachtentfaltung fehlen. Die Präsidentenresidenz der Republik am Bosporus genügt ihm schon lange nicht mehr. Noch als Ministerpräsident ließ er sich – erstmals, seitdem 1923 die türkische Hauptstadt von Istanbul nach Ankara verlegt worden war – wieder Amtsräume im Dolmabahçe-Palast, dem letzten Regierungssitz der Osmanen, einrichten. Dort und im Yıldız-Sultanspalast empfängt er jetzt gelegentlich Staatsgäste und nötigt sie, auf überdimensionalen vergoldeten Stühlen Platz zu nehmen, wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erleben musste, deren Füße kaum auf den Boden reichten. Das blieb Ursula von der Leyen dann ja bekanntermaßen erspart, die kürzlich statt auf dem goldenen Stuhl auf dem Sofa Platz nehmen musste.
In Istanbul hat Erdoğan sich noch ein weiteres Kleinod einrichten lassen. Fast in fußläufiger Reichweite zu seiner Privatwohnung auf dem Çamlıca-Hügel ließ er einen verfallenen Sultanspalast in Çengelköy restaurieren, in dem nun bevorzugte Gäste wie der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Alijew, bei Besuchen in Istanbul nächtigen können.
Das alles kostet natürlich viel Geld. Der Sommerpalast soll nach Angaben der Opposition rund 63 Millionen Euro verschlungen haben, für den Präsidentenpalast in Ankara sollen insgesamt fast 400 Millionen Euro geflossen sein. Allein die Nebenkosten für den Präsidentenpalast in Ankara (Strom, Wasser etc.) sollen nach Berechnungen der Architektenkammer jeden Monat weit über 100.000 Euro betragen. Das persönliche Budget des Präsidenten wird jedes Jahr kräftig erhöht. Im Haushalt 2021 ist es mit vier Milliarden Lira veranschlagt, das sind 400 Millionen Euro für Repräsentation und sonstige Kleinigkeiten, rund 28 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Tiefe Wirtschaftskrise
Lange hat das Publikum die Prachtentfaltung Erdoğans hingenommen, einige haben darin sogar die angebliche neue Größe der Türkei erblickt, doch das war in der Zeit, als die Türkei hohe Wachstumsraten hatte und es etwas zu verteilen gab. Jetzt liegt die Inflationsrate bei 18 Prozent, Lebensmittel sollen sich innerhalb des letzten Jahres sogar um 60 Prozent verteuert haben, und Millionen Menschen haben keine Arbeit mehr.
Das erzeugt Wut und Ärger. Erdoğan, dessen Wahlkämpfe sich früher einmal dadurch auszeichneten, dass er wusste, was "die einfachen Leute" wollen, scheint in seinen Palästen völlig den Kontakt zu seinen Wählern verloren zu haben. Nach Umfragen verschiedener Institute waren die aktuellen Zustimmungswerte für seine Regierung, für das Präsidialsystem und ihn persönlich seit seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten 2003 noch nie so niedrig wie jetzt. Die Diadochenkämpfe im Palast und die immer kleiner werdende Gruppe von Leuten, denen Erdoğan noch vertraut, sind klare Anzeichen des Verfalls.
Das merkt auch die Opposition. Als Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu im Konflikt um den milliardenteuren Bau eines Kanals zwischen dem Schwarzen Meer und dem Marmarameer internationale Investoren forsch warnte, man werde die Kredite nach einem Regierungswechsel nicht mehr bedienen, nahm selbst die Deutsche Bank diese Ankündigung ernst. Vor ein paar Jahren hätte man noch über Kılıçdaroğlu gelacht. Schreibt DER STANDARD.
Da dürfte wohl eher der Wunsch Vater des Artikels von Wolf Wittenfeld sein. Dass Erdogan wegen einem luxuriösen Sommerpalast die Macht verliert, ist ziemlich unwahrscheinlich. Da hat der Sultan vom Bosporus mit der Einführung des Präsidialsystems 2018 vorgesorgt.
Erdogan ist nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef. Er regiert per Dekret und hat grossen Einfluss auf die Justiz: Er bestimmt direkt oder indirekt sechs von 13 Mitgliedern des Rates der Richter und Staatsanwälte. Die restlichen sieben Mitglieder bestimmt das Parlament, auf das der Präsident aber als Parteichef grossen Einfluss hat. Als Präsident ernennt er ausserdem zwölf der 15 Verfassungsrichter. Mit solchen Machtmitteln ausgestattet, braucht sich kein Diktator grosse Sorgen wegen der Opposition zu machen. Und erst recht nicht um die Gunst des Volkes.
Dass die Deutsche Bank sich Gedanken um ein Investment für den Bau eines Kanals zwischen dem Schwarzen Meer und dem Marmarameer macht, dürfte mehr mit der momentan prekären wirtschaftlichen Lage der Türkei zu tun haben als mit den Drohungen der zerstrittenen türkischen Opposition.
Hat es Vladimir Putin geschadet, dass die russische Politgruppe um Alexei Nawalny den millardenteuren Palast des Zaren von Russland über YouTube veröffentlicht hat? Das russische Volk nahm den professionellen Videoclip mit einem Schulterzucken wahr: Ist halt so.
Die Nebenkosten für den Präsidentenpalast in Ankara von weit über 100.000 Euro dürften in der Türkei ebenfalls kein Thema sein. Regierungen, Parteien und Politiker*innen kosten nun mal Geld. Das ist selbst in lupenreinen Demokratien der Fall. Deutschlands zweitgrösstes Parlament der Welt nach China dürfte ja auch einiges kosten. Ganz zu schweigen von den Unsummen der EU-Institutionen. Dagegen sind die türkischen Ausgaben wohl Peanuts.
Diktaturen werden in der Regel durch die heimische Armee weggefegt, wie die Geschichte mannigfach beweist. Was aber für das Volk meistens vom Regen in die Traufe führt. Das hat der Putschversuch der türkischen Armee im Jahr 2016 einmal mehr bewiesen. Erdogan wurde nicht gestürzt, seine Macht aber umso grösser.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.7.2021 - Tag der Hysterie
«Klimabericht»-Podcast: Rettet am Ende die Wirtschaft das Klima, nicht die Politik?
Der Autor Toralf Staud sagt vorher, dass ausgerechnet die großen Unternehmen den Klimaschutz vorantreiben werden. Doch wie realistisch ist das? Darüber sprechen wir mit ihm in dieser Folge «Klimabericht».
In der SPIEGEL-Bestseller-Liste steht gerade ein Buch, das die Zukunft vorhersagen will – »Deutschland 2050 – Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird«. Jedes Kapitel beschreibt einen Themenkomplex, etwa: Energie, Natur, Verkehr – und: Wirtschaft.
Dabei ist es kaum vorherzusehen, wie sich die Industrie in diesem Zeitraum entwickeln wird. Die Coronapandemie ist dafür das beste Beispiel. Im Buch steht aber zum Beispiel sehr konkret: »Bis 2050 wird der Klimawandel die deutsche Wirtschaft rund 800 Milliarden Euro kosten.« Kann man wirklich so genau vorhersagen, wie sich das Klima in den kommenden rund 30 Jahren verändern wird?
»Ja, man kann es«, sagt der Autor des Buchs, Toralf Staud, »es gibt mittlerweile Ergebnisse von Klimamodellen vor 40 Jahren und es ist verblüffend: Die sind fast punktgenau.« Staud ist in dieser Woche zu Gast im »Klimabericht«-Podcast. Und wir sprechen darüber, wie sich die deutsche Wirtschaft im Anbetracht des Klimawandels verändert.
Ein großes Problem etwa, auf das sich die Unternehmen schon jetzt einstellen müssen, sind Hitzewellen. »Auf Baustellen kann im Sommer nicht mehr gearbeitet werden«, sagt Staud, »manches Material kann man in der Hitze nicht mehr verarbeiten, es schlägt Blasen. Auch die Landwirtschaft kriegt den Klimawandel zu spüren, etwa durch Dürren. Und weit nicht alle Bürogebäude sind klimatisiert.«
Eine überraschende These in »Deutschland 2050«: Große Konzerne sind schon heute nicht mehr die Bremser bei den Klimaschutzmaßnahmen – sie treiben den Klimaschutz sogar voran. Staud sagt: »Unternehmen sind weitsichtiger als die Politik. Sie gucken sich an, womit sie in den nächsten Jahrzehnten rechnen müssen.« Die Firmen versuchen also, rechtzeitig mit entsprechenden Investitionen gegenzusteuern.
Das könnten die Unternehmen aber nicht allein stemmen. Die Politik müsse den Klimaschutz gleichzeitig mit richtigen Investitionen voranbringen. »Die Ausbauziele für die erneuerbaren Energien müssen jetzt hochgesetzt werden«, so Staud. Es brauche zum Beispiel mehr Windräder oder Solaranlagen, und die Rahmenbedingungen kann nur die Politik liefern.
Wie wird Deutschland 2050 aussehen? Welche Folgen hat die Klimakrise auf die Wirtschaft? Und sind große Firmen wirklich die unverhoffte treibende Kraft in Sachen Klimaschutz, während die Politik trödelt? Darum geht es in dieser Folge von »Klimabericht«, dem wöchentlichen SPIEGEL-Podcast zur Klimakrise. Schreibt DER SPIEGEL.
Die Erkenntnis, dass letztendlich die Wirtschaft zusammen mit den entsprechenden Forschungsanstalten und Universitäten zumindest versucht, das Erdklima zu retten, ist für vernunftorientierte Menschen nicht neu. Dazu braucht es eigentlich keinen SPIEGEL-Podcast. Denn jeder einigermassen vernünftige Unternehmer weiss, dass der Klimawandel auch sein eigenes Geschäftsmodell massiv bedroht.
Kommt hinzu, dass in Wirtschaft und Forschung wohl die klügeren Köpfe vorhanden sind als in der Politik. Um den Klimawandel zu stoppen, braucht es kluge Lösungen und nicht die perverse Instrumentalisierung auf die eine oder andere Seite eines überlebenswichtigen Themas um anstehende Wahlen zu gewinnen. Die Wendehalspolitik der FDP bei den Parlamentswahlen 2019 ist ein gutes Beispiel dafür, wie Frau Gössi es nicht hätte machen sollen.
Auch die Grüne Partei Deutschlands leistet sich derzeit im Bundestags-Wahlkampf 2021 diese populistisch verlogene Instrumentalisierung mit Fokus auf ein einziges Thema. Einen Katalog mit gesellschaftlich und wirtschaftlich undurchführbaren Verbotsmassnahmen ohne Angaben der relevant dafür anfallenden Kosten wie eine Monstranz vor sich herzutragen ist genau so verwerflich wie das Leugnen des Klimawandels. Ein positiver Klimawandel braucht Lösungen und nicht Verbote.
Die Schweiz ist bezüglich Forschung mit entsprechenden Modellen zur Lösung der Klimakrise nicht schlecht aufgestellt. Um diese Tatsache in den Diskurs einzubringen, müssten allerdings die Artikel über die entsprechenden Arbeiten der Forschenden gelesen werden.
Doch leider finden diese öffentlich zugänglichen Artikel von den Schweizer Universitäten und Forschungsanstalten kaum den Weg in die meinungsmachenden Opinion Leader-Medien.
Und wenn, dann höchstens irgendwo unter einer Rubrik wie «Wissenschaft», die fürs Clickbaiting nicht wesentlich ist. Hysterische Klimawandel-Nachrichten im Live-Ticker-Format auf der Starseite sind da in Sachen Klicks ganz andere Kaliber.
So wurde beispielsweise mit einer Aufgeregtheit sondergleichen anfangs Juli 2021 über 486 Hitzetote «infolge Klimakrise» in Kanada berichtet. https://www.tagesschau.de/ausland/hitze-kanada-103.html
Selbst auf die Gefahr hin zynisch zu wirken: Übermässige Hitze setzt nun einmal – wie eine normale Grippe im Winter – betagten Menschen mit einem geschwächten Immunsystem ganz besonders zu.
So verstarben im Hitzesommer 2003 in Frankreich mehr als 11'000 vornehmlich betagte Menschen. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/hitzetote-fast-11-500-menschen-in-frankreich-an-hitze-gestorben-1117542.html Doch kaum jemand erinnert sich daran.
Warum eigentlich? Der Klimawandel war 2003 noch kein Quoten-Thema. Deswegen wurde die französische Sommertragödie im August 2003 auch kaum zur Kenntnis genommen. So wie Grippetote im Winter ebenfalls kaum Beachtung in den Medien finden. Der Tod von betagten Menschen – so schwer er auch für die Hinterbliebenen ist – bedeutet nun einmal den letzten Akt im Leben aller Menschen; Tiere mit eingeschlossen.
Und das ist gut so. Als einzig wahre Gerechtigkeit betrifft es alle Wesen auf unserer Erde. Vom Schacher Seppli bis hin zum reichsten Mann der Welt. Vom Tod kann sich niemand freikaufen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.7.2021 - Tag von Heinz Günthardt
Tennis-Experte muss gehen – SRF schmeisst Heinz Günthardt raus
Der Aderlass in der Sportredaktion des Schweizer Fernsehens geht weiter. Diesmal ist es kein freiwilliger Abgang. SRF verzichtet auf die Dienste von Heinz Günthardt.
Kommentator Stefan Bürer hat seinen Abgang vor wenigen Wochen kommuniziert. Bürer geht zu den Rapperswil-Jona Lakers. Jetzt muss mit Heinz Günthardt auch sein langjähriger Experte bei den Tennis-Übertragungen den Stuhl räumen. Günthardt geht nicht aus freien Stücken. Man hat dem renommiertesten Tennisexperten des Landes den Abgang nahe gelegt.
«Ich habe noch keine Planung für die nächste Saison erhalten», sagt Heinz Günthardt im Interview mit Blick vor wenigen Wochen. Er könne sich gut eine Zukunft auch ohne Mikrofon-Kollege Bürer vorstellen. «Ich habe schon oft an der Seite von Stephan Liniger und Manuel Köng kommentiert», so Günthardt.
Fast dreissig Jahre dabei
Dazu kommt es nicht. Man plant im Leutschenbach einen Neustart in der Tennis-Berichterstattung ohne Heinz Günthardt. Die Altersguillotine mag bei der Trennung des 62-Jährigen ein Grund sein. Dazu kommt, dass Günthardt kein günstiger Mitarbeiter ist. Kompetenz kostet.
Allerdings verliert SRF Sport mit dem beliebten und breit anerkannten und geschätzten Tennis-Experten ein weiteres Aushängeschild und einen Mann, der die Tennis-Berichterstattung in den letzten fast dreissig Jahren markant geprägt hat. Schreibt BLICK.
Wertfrei, ob man Heinz Günthardt mag oder nicht mag: An seiner Kompetenz als Tennis-Experte oder gar an seinem Alter liegt der Abgang definitiv nicht. Russi war 69 Jahre alt, als er für SRF das letzte Ski-Rennen kommentierte. Dagegen ist Günthardt mit seinen 62 Jahren ein junges Rehlein.
Der «Rausschmiss» dürfte eher aus einem Mix von Kostengründen und sinkenden Zuschauerzahlen erfolgt sein. Einerseits sind Flüge rund um den Erdball und Hotels für ein Kommentatoren-Team in Zwei-Mann-Stärke teuer. Die Übertragungsrechte verschlingen – wie bei der Formel1 – exorbitante Summen.
Andererseits fehlen schon jetzt und vor allem in der unmittelbaren Zukunft die beiden Zugpferde und Zuschauermagneten Federer und Wawrinka. Mit miserablen Einschaltquoten bei den Grand-Slam-Übertragungen lässt sich Werbung, die das Spektakel finanzieren soll, nur noch schwer verkaufen.
Es wird den Tennis-Fans (wie auch den Formel1-Fans) in Zukunft nichts anderes übrig bleiben, als Sportunterhaltung über Bezahlkanäle zu geniessen.
Und das ist gut so. Es ist längst nicht mehr vermittelbar, wieso eine ganze Nation mittels Zwangsgebühren in Haft genommen wird, um Minderheitsprogramme eines Staatssenders zu finanzieren, die mit «Systemrelevanz» und dem vielgepriesenen «Service Public» nichts zu tun haben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.7.2021 - Tag der Langeweiler
Reden wir doch mal über Armin Laschet
Selbst die Union befasst sich aktuell lieber mit der Kanzlerkandidatin der Grünen als mit Armin Laschet. Dabei sagt der oft faszinierende Dinge – vor allem zu seiner Klimapolitik.
Lassen Sie uns mal kurz über Armin Laschet reden. Ich weiß, das ist nicht sehr populär, weil er als so furchtbar langweilig gilt. Sogar die Union möchte augenscheinlich viel lieber über Annalena Baerbock sprechen.
Aber es lohnt sich, dem Kandidaten der Union mal ein bisschen zuzuhören. Er sagt nämlich oft faszinierende Dinge. Ob es die Art von Faszination ist, die Vertrauen in politische Gestaltungsfähigkeit weckt, oder doch eher die Art von Faszination, die ein Erdrutsch, ein brennender Ozean oder eine tödliche Hitzewelle auslösen – entscheiden Sie selbst!
Alice »im Wunderland« Weidel sagt »leider«
Eine hervorragende Quelle faszinierender Sätze des Kanzlerkandidaten der Union ist eine Interviewreihe, die in der »Zeit« erschienen ist. Den Spitzenkandidaten aller Parteien werden darin mehr oder weniger die gleichen Fragen zum Thema Klimapolitik gestellt.
Es lohnt sich, all diese Gespräche zu lesen, sogar das mit Alice »im Wunderland« Weidel, die einmal mehr fälschlicherweise behauptet, es gebe »leider keinen stichhaltigen Nachweis«, dass der Mensch für die Erderwärmung verantwortlich sei.
Olaf Scholz erfindet in seinem Gespräch das Wort »Verzichtsideologie«; Christian Lindner will künftig mit Elektroautos 145 km/h fahren dürfen; Janine Wissler hält daran fest, dass die Linke keinen CO₂-Preis will; Annalena Baerbock kündigt konkrete, durchaus nicht populäre Maßnahmen wie ein Tempolimit, eine Kerosinsteuer oder ein Verbot von Verbrennungsmotoren an – und windet sich bei der Frage, wie der ständig gegen Infrastrukturprojekte protestierende Teil ihrer Partei bei der Transformation des Landes eingebunden werden soll.
Das kann sich alles blitzschnell ändern
Das faszinierendste Gespräch aber ist das mit Armin Laschet. Weil es so schön zeigt, wie der CDU-Vorsitzende argumentiert. Nennen wir es mal: situativ. Wobei sich die jeweilige Situation blitzschnell ändern kann. Zum Beispiel an der Stelle, an der es zuerst ums Fliegen und dann ums Heizen geht, also um zwei Aktivitäten, bei denen nach heutigem Stand viel CO₂ erzeugt wird.
Zum Thema Billigflüge sagt Laschet: »Ich finde es falsch, wenn nur die Reichen fliegen und die anderen sich den jährlichen Mallorca-Flug nicht mehr leisten können. Das ist eine soziale Frage.«
Direkt im Anschluss kommt die Frage nach dem von der Union blockierten Vorschlag, Mieter und Vermieter gleichermaßen am CO₂-Preis fürs Heizen zu beteiligen, also noch eine »soziale Frage«. Laschet: »Letztlich müssen die Kosten für den Verbrauch von Energie auch von dem getragen werden, der diese Energie nutzt.« Also von den Mietern allein.
Flugenergie ungleich Heizenergie?
Ich kann mir diese Gegenüberstellung – Energieverbrauch beim Fliegen ist keine Privatsache, Energieverbrauch beim Heizen schon – nur so erklären: Für Armin Laschet sind Flugenergie und Heizenergie irgendwie unterschiedliche Kategorien.
Zur Wissenschaft hat Armin Laschet generell ein etwas angespanntes Verhältnis. Wieder und wieder scheint er zum Beispiel davon überrascht zu werden, dass Viren sich viral, also im ungünstigsten Fall exponentiell verbreiten.
Diese Woche sorgte Laschet für Empörung, als er einem Redner von der AfD ausgerechnet in Fragen der Wissenschaftlichkeit recht gab. Wörtlich sagte er im Landtag von Nordrhein-Westfalen, der Mann von der AfD habe »einen wahren Satz gesagt: Immer, wenn jemand ankommt und sagt ›die Wissenschaft sagt‹, ist man klug beraten, zu hinterfragen, was dieser gerade im Schilde führt. Denn ›die Wissenschaft‹ hat immer auch Mindermeinungen. Und wenn es ein Einzelner ist.«
Doch, man kann schon unterscheiden
Das ist genau die Argumentation, mit der nicht nur die AfD seit Jahr und Tag den menschengemachten Klimawandel in Zweifel zu ziehen versucht, garniert mit der verschwörungsraunenden Wendung »im Schilde führen«. Natürlich gibt es »die Wissenschaft« als homogenes System mit einer dauerhaft unveränderlichen Position zu beliebigen Themen nicht.
Aber es gibt schon zu vielen Themen einen weitgehenden, vielfach empirisch abgesicherten Konsens über die aktuell beste (wenn auch nie perfekte) Beschreibung der Realität. Wenn man weiterhin »Mindermeinungen« von »Einzelnen« das gleiche Gewicht einräumt, ist die Erde in hundert Jahren weitgehend unbewohnbar. Aber das will ja eigentlich auch niemand außer Klimawandelleugnern.
Die Mindermeinungen von Einzelnen, die Laschet hier beschwört, sind seit den späten Achtzigern das sehr erfolgreich eingesetzte bevorzugte Propagandamittel derjenigen, die gerne weiter mit der CO₂-Produktion Geld verdienen wollen.
Laschet, klimabewegt seit Jahrzehnten?
Von der »Zeit« nach einem persönlichen Erlebnis gefragt, das ihm die Dringlichkeit des Klimaproblems verdeutlicht habe, antwortete Laschet mit einem Rückgriff in die ferne Vergangenheit: »Mitte der Neunzigerjahre« habe er im Rahmen von Tätigkeiten in der Entwicklungspolitik »die harten Folgen des Klimawandels erlebt«. Laschet, klimabewegt seit Jahrzehnten?
Mehr als 20 Jahre später, am Wahlabend der Europawahl 2019, sagte Laschet in einer Talkshow überrascht: »Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden.« Was genau ist zwischen der persönlichen Konfrontation mit den »harten Folgen des Klimawandels« und der Talkshow mehr als 20 Jahre später passiert? Man weiß es nicht. Laschet wird offenbar immer wieder überrascht von Dingen, die er selbst schon einmal wusste.
Jetzt aber: konkrete Ziele! Oder?
Jetzt aber hat er konkrete Ziele. Oder vielleicht doch nicht?
Hinweis der »Zeit« zu einem neuen, hart kritisierten Klimagesetz in Laschets Nordrhein-Westfalen: »Trotzdem haben Sie keine konkreten Maßnahmen festgelegt.«
Antwort Laschet: »Letztlich muss sich die Politik an Ergebnissen messen lassen, nicht an Zielen.«
Später, im gleichen Gespräch: »Die Klimaziele, die Sie selbst mitbeschlossen haben, zwingen zur Eile.«
Antwort Laschet: »Ich will, dass wir diese Ziele bis 2045 erreichen.«
Ziele, Maßnahmen, Ergebnisse, alles im Prinzip okay für Armin Laschet, solange man sich nicht ausgerechnet jetzt auf irgendetwas festlegen muss. Es könnte ja sein, dass doch noch eine »Mindermeinung« dazwischenkommt. Oder eine »soziale Frage«. Schönes Beispiel: Armin Laschet will CO₂-Kosten nicht mit einem Klimageld für alle ausgleichen, sondern mit »der Pendlerpauschale«. Ausgleich ja, aber nur für Leute mit Auto in der Garage.
Geleugnet, geschmiert, gewechselt
Die konzeptionelle Schärfe von Laschets Aussagen zum Thema Klimapolitik passen natürlich zur konzeptionellen Schärfe des Wahlprogramms der Union: Selbst die innerhalb der Partei gegründete »Klimaunion« findet: »Leider sind die Klimaziele des Wahlprogramms weder Paris-konform, noch erfüllen sie den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts.« Man darf bei alledem nie aus den Augen verlieren, dass die Union ihre Klimapolitik sehr lang von bekannten Klimawandel-»Skeptikern« hat machen lassen, und von diversen Leuten, die sich mutmaßlich haben schmieren lassen.
In ihrem Wirtschaftsministerium sitzen organisierte Windkraftgegner, ihren »Kohlekompromiss« ließ die Partei von jemandem verhandeln, der kurz darauf zu einem Kohlekonzern wechselte. Laschets Herumgeeiere spiegelt also vor allem die Tatsache, dass seine eigene Partei seit langer Zeit federführend bei der Verdrängung des größten Menschheitsproblems ist. Das wird man schwer wieder los.
Wenn Deutschland im Jahr 2030 noch konkurrenzfähig und auf einem 1,5-Grad-Pfad sein soll, dann wird die nächste Legislaturperiode entscheidend sein. Schön wäre, wenn dann jemand regieren würde, der auch eine Vorstellung davon hat, wie das gehen soll. Schreibt DER SPIEGEL.
Es steht ausser Frage, dass der deutsche Kanzlerkandidat Armin Laschet eher eine rhetorische Schlaftablette als ein Rockstar ist, der die Massen mit seinen Reden bewegt. Nur ist das kein Kriterium, ob jemand fähig ist, die immerhin noch viertgrösste Industrienation der Welt durch unsichere Zeiten der Veränderung zu führen.
Ich verstehe allerdings die vom Autor des SPIEGEL-Artikels hochgejazzte Aufregung über die Abwälzung höherer Heizölpreise auf die Mieter*innen beim besten Willen nicht.
Das ist seit jeher bei den meisten Mietwohnungen in den Nebenkosten genau so geregelt. Es sei denn, ein Mietvertrag wird "inklusive allen Nebenkosten" abgeschlossen, was aber nur selten der Fall ist. Im Umkehrschluss profitieren Mieter*innen ja auch von sinkenden Heizölpreisen, was in den letzten Jahren ab und zu der Fall war. Ich rede diesbezüglich aus positiven Erfahrungen.
Ausserdem haben die meisten Mieter*innen inzwischen die Möglichkeit, ihren persönlichen Heizölverbrauch über individuell regulierbare Heizungen der moderneren Art selbst zu beeinflussen. Wie ich zum Beispiel. Warm- und Kaltwasserverbrauch werden ja auch nach diesem System eruiert und abgerechnet.
Eine Abwälzung höherer Heizölpreise auf die Vermieter würde letztendlich vor jedem deutschen Gericht scheitern und hätte damit nichts anderes als eine Mietzinserhöhung zur Folge. Und das wäre, weil unumkehrbar, definitiv das grössere Übel.
Laschet, der Langeweiler vom Dienst, spricht hier nur die Wahrheit aus. Was seine Konkurrenz von der Grünen Partei mit unsäglichem Rumgeiere auf Teufel komm raus zu vermeiden sucht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.7.2021 - Tag der prall gefüllten Koffern
Afghanistan fordert vorübergehenden Abschiebe-Stopp aus Europa
Die afghanische Regierung hat europäische Staaten dazu aufgefordert, Abschiebungen in das Krisenland für drei Monate auszusetzen. Wegen der zunehmenden Gewalt der militant-islamistischen Taliban und steigender Corona-Infektionen sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber derzeit ein Grund zur Sorge, hieß es am Samstag in einer Erklärung des für Flüchtlinge zuständigen Ministeriums.
Außerdem sei man besorgt über eine wachsende Zahl von Menschen, die im Ausland Asyl suchten sowie im Land selbst auf der Flucht seien.
Viele europäische Länder schieben abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan ab, auch Österreich. Abschiebungen in das Krisenland sind umstritten. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen im September geht der Konflikt mit den Taliban weiter. Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan Anfang Mai hat sich die Sicherheitslage zugespitzt. Die Islamisten haben seither ein Viertel der Bezirke im Land neu erobert. Dabei haben sie Hunderte Regierungskräfte getötet, verwundet, gefangen genommen oder zur Aufgabe überredet.
Bomben und Tötungen
Nach UN-Daten mussten zwischen Anfang Mai und Ende Juni fast 84.000 Menschen innerhalb Afghanistans vor den Kämpfen aus ihren Dörfern und Städten fliehen. Täglich kommen Zivilisten in dem Konflikt im Kreuzfeuer bei Gefechten, durch Bomben am Straßenrand oder auch durch gezielte Tötungen ums Leben.
Österreichische NGOs wie die Asylkoordination, der Verein Autonome Frauenhäuser und ZARA fordern einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erteilte dieser Forderung unlängst eine Absage. "Es muss mehr und nicht weniger abgeschoben werden, besonders dann, wenn es sich um straffällig gewordene Asylwerber handelt", sagte Kurz, der darauf verweist, dass afghanische Staatsbürger in Österreich laut Sicherheitsbericht (2019) die größte ausländische Tätergruppe bei Sexualstraftaten darstellen.
Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte am Montag gesagt, er halte die bisherige Abschiebepraxis trotz der Zunahme der Gewalt noch für vertretbar. Die deutsche Bundeswehr hat Afghanistan Ende Juni verlassen. Der letzte Bundesheersoldat im Afghanistan-Einsatz kam am 18. Juni nach Österreich zurück. Der Abzug der US-Truppen sei zu mehr als 90 Prozent abgeschlossen, teilte das Pentagon am Dienstag mit. Schreibt DER STANDARD.
Das war zu erwarten. Die noch amtierende Regierung Afghanistans, die in Sachen Korruption den Taliban in nichts nachsteht, will vor ihrem Abgang noch einmal richtig abkassieren. Die für das Asyl- und Justizwesen zuständigen Minister*innen Europas werden mit prall gefüllten Geldkoffern demnächst in Kabul eintreffen.
Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber sind für korrupte Regierungen und NGO nicht erst seit 2015 ein lukratives Geschäftsmodell geworden.
Der kürzliche Algerien-Besuch von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, diente u.a. auch der Rückführung von mehr als 500 abgewiesenen Asylbewerbern, die das Geberland Algerien scheinbar seit Jahren nicht mehr zurücknehmen will; ein Verhalten, das wir – so viel Wahrheit muss sein – auch von Onlineshops kennen, die ihre einmal gelieferte Ware partout nicht zurücknehmen wollen. https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-verhindert-ausschaffung-werden-renitente-asylbewerber-bald-staerker-ueberwacht
Ob Frau Keller-Sutter mit einem Koffer in Algerien auftauchte, wissen nur die Schweizer Justizministerin und Moritz Leuenberger. Es gilt die Unschuldsvermutung. Abschiebungen von abgelehnten kriminellen Asylbewerbern nach Algerien sind bis jetzt allerdings keine bekannt.
In dieser Beziehung war die ehemalige Bundesrätin der Schweiz, Ruth Metzler, bei ihrem Besuch in Nigeria im Jahr 2003 erfolgreicher. https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-23883.html
Scheinbar war Metzler damals mit einem Koffer unterwegs. Irgendwo muss ja auch eine Bundesrätin ihre Kleider verstauen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.7.2021 - Tag der Quellenangaben
Buch von Annalena Baerbock soll Quellenangaben bekommen
Nach den Plagiatsvorwürfen gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird ihr Buch nun mit zusätzlichen Quellenangaben versehen. Die Sprecherin des Ullstein-Verlags, Christine Heinrich, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag einen entsprechenden „Bild“-Bericht. „In Absprache mit der Autorin werden wir in einer möglichen nächsten Auflage sowie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im E-Book zusätzliche Quellenangaben im Buch ergänzen“, teilte die Sprecherin mit. Dies entspreche grundsätzlich den Standards bei Nachauflagen und erfolge aus Gründen der Transparenz „auch unabhängig von der rechtlich zulässigen Übernahme von Passagen aus Public Domains“.
Baerbock wird vorgeworfen, in dem Buch mit dem Titel „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ Textstellen ungekennzeichnet aus anderen Veröffentlichungen übernommen zu haben. Seit Anfang vergangener Woche macht der österreichische Medienrechtler Stefan Weber immer mehr Stellen aus, an denen sich auffallende sprachliche Ähnlichkeiten finden.
In dem Buch gibt es keine Fußnoten und auch kein Quellenverzeichnis am Ende. Der Ullstein-Verlag erklärte aber, dass es auch jetzt schon Quellenangaben im Text gebe, die nun ergänzt würden. Über den Umfang der Ergänzungen und den genauen Zeitpunkt machte Ullstein-Sprecherin Heinrich keine Angaben.
„Wir können keine Urheberrechtsverletzung erkennen“
Baerbock, die seit einer Woche im Urlaub ist, hatte bereits in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ angedeutet, dass es Nachbesserungen in ihrem Buch geben könnte. „Rückblickend wäre es sicherlich besser gewesen, wenn ich doch mit einem Quellenverzeichnis gearbeitet hätte“, sagte sie der Zeitung. Sie habe bewusst auf öffentlich zugängliche Quellen zurückgegriffen, gerade, wenn es um Fakten gehe. Aber sie nehme die Kritik ernst.
Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hatte die Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock als „Rufmord“ bezeichnet. Den Vorwurf der Urheberrechtsverletzung haben sowohl die Grünen als auch der Ullstein-Verlag zurückgewiesen.
„Das Manuskript von Annalena Baerbocks Buch ist im Verlag sorgfältig lektoriert worden“, hatte der Verlag erklärt, kurz nachdem die Vorwürfe bekannt wurden. „Die Aufzählung von allgemein zugänglichen Fakten ist ebenso wenig urheberrechtlich geschützt wie einfache Formulierungen, mit denen solche Fakten transportiert werden. Wir können keine Urheberrechtsverletzung erkennen.“ Wie bei nichtwissenschaftlichen Werken üblich enthalte das Buch kein Quellenverzeichnis. Schreibt DIE WELT.
Wenn ich meinem Nachbarn frühmorgens in aller Herrgottsfrühe die «Luzerner Zeitung» aus dem Briefkasten zupfe, ist das nichts anderes als Diebstahl. Da sind wir uns wohl alle einig.
Doch wenn Annalena Baerbock, immerhin Kanzlerkandidatin der Grünen Partei Deutschlands, sich schamlos fremder Gedanken oder Ideen bedient und nicht nur einzelne Sätze, sondern ganze Textpassagen mittels Copy Paste teilweise eins zu eins in ihrem kürzlich veröffentlichten Buch übernimmt, wird dies von ihren Fans und der Grünen Partei als «halb so schlimm» abgetan.
Diesem Unsinn folgt die Verteidigungsstrategie der Baerbock-Partei auch in Bezug auf die Tatsache, dass das Kanzlerkandidatin-Buch grösstenteils von einem Ghostwriter geschrieben wurde, der aber nicht als Co-Autor aufgeführt wird. Er soll irgendwo unter «Special Thanks» namentlich, aber ohne Hinweis auf seine Mitarbeit am Buch, aufgeführt sein.
Unabhängig davon, dass eine Person, die antritt, um als Kanzlerin ein mächtiges Industrieland zu lenken, sich mit fremden Federn schmückt und intellektuell überhöht, stellt sich eine ganz andere Frage: Warum verfolgen wir zu Recht einen Zeitungsdieb, nicht aber jemanden, der geistiges Eigentum klaut?
Fehlt uns dafür der Respekt oder sind wir trotz Digitalisierung der etwas einfältigen Meinung, dass es der Urheber / die Urheberin nicht bemerkt?
Bei der intellektuell eher unbedarften Co-Präsidentin der Grünen Partei Deutschlands dürfte wohl beides zutreffen. Anders ist ihre verheerende Aussage in einer Talkshow nicht zu erklären: «Niemand schreibt ein Buch allein.» J. D. Salinger, Ernest Hemingway, Johanna Spyri und Jeremias Gotthelf würden sich wohl ob dieser dreisten Entgleisung fern jeglicher Intelligenz im Grab umdrehen.
Der ehemalige deutsche Verteidigungsminister und Shooting-Star der CSU, Karl-Theodor zu Guttenberg, musste 2011 wegen einer Plagiatsaffäre (Urheberrechtsverletzungen) im Zusammenhang mit seiner Dissertation (Doktorarbeit) vom Amt zurücktreten. Der Doktortitel wurde ihm aberkannt.
Damals kannte die Partei der Grünen gegenüber dem CSU-Politiker keine Gnade. Moralkeulen der verschärften Art bezüglich «Urheberrecht» und «Glaubwürdigkeit» wurden im deutschen Bundestag dem Plagiator aus dem Verteidigungsministerium um die Ohren gehauen.
Dabei war Guttenbergs Vergehen nichts anderes als das, was jetzt auch die Grüne Kanzlerkandidatin vollbracht hat: Er «vergass» die Quellenangabe bei den von ihm in seiner Doktorarbeit übernommenen Textpassagen. Intellektuell allerdings ein anderes Kaliber als Baerbock, schmückte sich auch Guttenberg mit fremden Federn. Hätte er die Quellen genannt, dürfte er heute noch seinen Doktortitel führen. Und wäre möglicherweise sogar Kanzlerkandidat.
Das gilt auch für die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Mit Quellenangabe hätte sie den Skandal um ihr Buch vermieden. Besser wäre das Buch, das sie je nach Belieben als «Fachbuch» oder als «Sachbuch» bezeichnet, damit allerdings auch nicht geworden. Ein Plagiat bleibt ein Plagiat.
Die nachträgliche Benennung der Quellen in Baerbocks Buch schützt sie immerhin vor Urheberrechtsverletzungen. Die Glaubwürdigkeit der Kanzlerkandidatin inklusive ihrer Grünen Partei aber ist für immer dahin.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
9.7.2021 - Tag der kosovarischen Botoxlippen
Skandalrapperin im Schlaf ausgeraubt: Hier brechen 10 bewaffnete Männer bei Loredana ein
Gleich von zehn bewaffneten Männern wurde Rapperin Loredana in der Nacht ausgeraubt. Während sie am schlafen war, haben sie diese beklaut.
Es ist ein Schock für Rapperin Loredana Zefi (25): Während sie am Schlafen war, wurde die Luzernerin beim Videodreh im Ausland überfallen. «10 Männer sind bewaffnet in unser Haus eingebrochen. Konnte es selber nicht glauben», berichtet sie auf Instagram.
Die Mutter einer zweijährigen Tochter hofft auf die Mithilfe ihrer Follower: «Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, bitte meldet euch.» Es gehe ihr nicht um das Geld, sondern um einen «sehr persönlichen Gegenstand», der ihr geklaut worden sei.
Loredana bittet um Hilfe
Wo genau die Tat passierte, ist unklar. Die von Loredana veröffentlichten Überwachungsvideos lassen aber darauf schliessen, dass der Überfall im Ausland stattfand. Laut ihren letzten Posts befindet sie sich aktuell unter anderem mit Ehemann Mozzik (25) in Barcelona (Spanien). Auch die Festplatten ihres Kameramanns, der mit den Musikern an einem neuen Videoclip arbeitet, seien geklaut worden.
Das Videomaterial von Loredana zeigt, wie die Räuber sich Zugang zu ihrer Villa verschaffen. Einer der Täter ist mit einem länglichen Gegenstand bewaffnet und steht Wache, während seine Kollegen ausschwärmen.
Die Rapperin steht noch unter Schock. Sie schreibt zum Schluss ihres Statements: «Gestern wurde mir klar: Sei für jeden Tag dankbar, den du hast.» Schreibt Blick.
Immer, wenn es um die skrupellose Skandalnudel aus dem Kosovo mit den Botox-Lippen ruhig wird oder ein neuer Song vor der Veröffentlichung steht, sorgt sie höchstpersönlich für Schlagzeilen. Mal ungewollt mit einem ziemlich hässlichen Betrug, bei dem sie einer Walliserin 432'000 Franken abluchste. https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/schein-und-sein-der-gangster-rapperin-was-in-loredanas-betrugsgeschichte-wirklich-passiert-ist-ld.1265864
Oder mit Fake-Postings. https://www.blick.ch/people-tv/schweiz/zweites-baby-der-rapperin-war-wohl-nur-promo-aktion-loredana-fuehrt-ihre-fans-hinters-licht-id16556123.html
Ein Schelm, wer jetzt bei diesem Sommerloch-Schmonzettchen Böses denkt. Das Video der Überwachungskamera weist jedenfalls einige Ingredienzen auf, die einen bestellten «Einbruch» nicht ausschliessen. Welcher Einbrecher taucht denn mit einem Bataillon von zehn Männern auf?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.7.2021 - Tag der Steinzeitreligionen
Die USA geben Afghanistan auf
Bilder wie jene der chaotischen Evakuierung des US-Personals in Saigon 1975 sind den Amerikanern aus Afghanistan bisher erspart geblieben. Rühmliches lässt sich über das Ende des zwanzigjährigen US-Einsatzes dennoch nicht sagen. Glaubt man den afghanischen Behörden, dann hat die US-Armee den Stützpunkt Bagram – Epizentrum ihrer Militärmission – am 2. Juli nicht über-, sondern aufgegeben. Wie sie ja im Grunde ganz Afghanistan und die Kriegsziele aufgegeben hat, die sie nach 9/11 im Herbst 2001 in das Land führt haben.
Eine "sich entfaltende Tragödie" nannte die "Washington Post" in einem Leitartikel, was sich gerade in Afghanistan abspielt. Die USA scheinen sich mit der Unvermeidlichkeit abgefunden zu haben, dass die Taliban wieder die Macht übernehmen. Niemand will auf den Fortbestand der Regierung von Ashraf Ghani in Kabul wetten. Die Taliban sind schon länger wieder auf dem Vormarsch, parallel zum Abzug der USA und ihrer Verbündeten hat er sich beschleunigt. Sie greifen die ersten größeren Provinzstädte an, was den Abmachungen des von den USA eingeleiteten Friedensprozesses mit Ghani klar widerspricht.
Nicht mehr die gleichen?
Aber sind es noch die gleichen Taliban, die von den USA gestürzt wurden, weil sie die Terrororganisation Al-Kaida – die am 11. September 2001 die USA angegriffen hatte – beherbergten? Für jene Afghanen und besonders Afghaninnen, die sie fürchten, darunter auch die schiitische Volksgruppe der Hazara, bedeutet die Entwicklung, die Veränderungen, die manche Experten den Taliban zusprechen, keine Beruhigung.
Sie mögen Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben, nicht mehr die wilde Gotteskriegertruppe von früher sein, sondern professioneller, kontrollierter agieren. Wo sie sich wieder ausbreiten, wollen sie offenbar nicht sofort die gesamte Bevölkerung verstören. Sie achten darauf, dass alles weiterläuft. Sie werden ihren Staat – ein islamisches Emirat – allein als afghanisches Projekt von innen bauen; das heißt, nicht von internationalen Jihadisten, wie damals von Al-Kaida, übernehmen lassen – die USA verbuchen das als Erfolg.
Die Taliban beteuern auch, die Hauptstadt Kabul nicht militärisch einnehmen zu wollen. Dass sie dort hinwollen, ist dennoch klar. An ihre Werteordnung, ein Gemisch aus radikalem Islam und paschtunischen Stammesbräuchen, sollen sich die Menschen langsam wieder gewöhnen. Dass die Frauen wieder zu Hause bleiben müssen, ist aber nur der erste Schritt, und der ist in den von ihnen kontrollierten Gebieten – etwa die Hälfte der Verwaltungszentren und 70 Prozent der ruralen Gebiete – bereits wieder Realität.
Ethnische Milizen
Im Land formieren sich erste Milizen, oft mit ethnischem – also nichtpaschtunischem – Hintergrund. Denn niemand vertraut darauf, dass die afghanischen Sicherheitskräfte die Taliban werden aufhalten können. Die afghanische Armee, die plötzlich fast auf sich allein gestellt ist, scheint es selbst auch nicht zu glauben. Zu Wochenbeginn setzten sich hunderte Soldaten ins Nachbarland Tadschikistan ab, das nun die eigenen Sicherheitskräfte an die Grenze geschickt hat. Russland hat Duschanbe bereits seine Hilfe zugesagt.
Die Milizen sehen viele als Vorboten des gefürchteten Bürgerkriegs, Folge einer totalen Fraktionierung. Auch jetzt schon breiten sich die Taliban nicht nur mit militärischen Mitteln aus. Es kommt auch zu Deals mit lokalen Behörden, die ihre Fahnen nach dem Wind richten. Es geht um die Machtverteilung, und das erinnert fatal an die Zeit nach dem Abzug der Sowjets im Jahr 1989.
Zwanzig Jahre Krieg
Afghanistan zu übergeben, aufzugeben, ist keine Idee, die Joe Biden in seine Präsidentschaft mitgebracht hat: Im Grunde gibt es in den USA und auch in anderen Afghanistan-Kriegsteilnehmerstaaten einen breiten Konsens, dass es nicht so weitergehen konnte. Zwanzig Jahre Krieg, tausende Tote und exorbitante Kosten sind genug. Die Folgen für Afghanistan selbst werden in Kauf genommen – genauso wie die erwartbaren strategischen Verschiebungen in der weiteren Region.
Der US-Abzug ist eine Sicherheitsherausforderung für alle Anrainer, und manche – man denke nur an den Iran, wenn der Wiener Deal mit den USA nicht zustande kommt, aber auch an Russland – werden die Situation für sich zu nützen verstehen. China wird seinen geostrategischen Einfluss ausweiten, einen Islamistenstaat in seiner Peripherie wird es einzudämmen wünschen.
Die USA haben zuletzt noch ein paar schwache Sicherheitsventile eingebaut. Das Konzept der Einsätze von außen wird überarbeitet. Der US-Kommandeur in Afghanistan, Austin Miller, wird etwas länger bleiben, und etwas mehr Personal – über die 650 Mann, die die US-Botschaft in Kabul schützen, hinaus – soll in der Region zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden sie nicht doch noch dafür gebraucht, Amerikaner aus Kabul herauszuholen. Schreibt DER STANDARD.
Eine Studie der Brown University über den Afghanistan-Krieg der USA veranschlagt Gesamtkosten für das Verteidigungs- und Kriegsveteranenministerium von 2001 bis Ende September 2019 auf 975 Mrd. US$. Die Universität schätzt auch, dass ohne die Ausgaben für die Kriege in Afghanistan, Pakistan und im Irak etwa 1,4 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze hätten geschaffen werden können. Schreibt Wikipedia.
Es ist müssig, sich Gedanken über die effektiven Kosten dieses unseligen, 20 Jahre dauernden Krieges zu machen, die auch ohne Universitätsstudie die Billionengrenze so oder so überschritten haben. Denn zu den US-Kosten kommen die Milliarden der «hehren westlichen Wertegemeinschaft» aus dem Bündnis der NATO hinzu, die in einer Allianz mit den USA die «Freiheit des Westens» am Hindukusch verteidigten.
Immerhin äusserte sich der neue US-Aussenminister Antony Blinken, dass die USA unter der Regierung von Joe Biden keine «Nation Building»-Kriege, besser bekannt als «Regime Change», mehr führen werden. Der «militärisch-industrielle Komplex», vor dem schon der ehemalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower am Ende seiner Amtszeit warnte, wird dies zu verhindern wissen. Gegen dieses mächtige Gebilde im Gleichschritt mit der Wall Street regiert kein amerikanischer Präsident.
Der Rachefeldzug gegen Al-Quaida-Chef Osama bin Laden und die IS-Gotteskrieger ist gescheitert wie der Irak-Krieg. Osama bin Laden und Saddam Hussein konnten zwar dank Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe seitens der USA eliminiert werden, doch die IS-Gotteskrieger kämpfen munter unter einem neuen Namen in Syrien, Irak und Libyen weiter. Dafür sorgen die salafistischen Hochburgen aus den islamistisch geprägten Staaten wie Saudi Arabien, den Emiraten und der Türkei sowie einigen verdeckt mitspielenden Playern wie Pakistan.
Das geschundene Land Afghanistan jedoch wird bleiben was es auch vor den Afghanistan-Kriegen, deren es ja mehrere gab, schon immer war: ein fundamental islamistisches Emirat nach den Vorstellungen der herrschenden Stämme, die ihre ganze Macht aus den Suren einer Steinzeit-Religion ableiten. Dagegen dürften selbst die mächtigen Nachbarn Afghanistans wie Indien und China hilflos sein. Sämtliche Mitglieder der Taliban einzusperren, wie es China mit den Uiguren macht, wird ja wohl kaum möglich sein.
Da würden die USA sehr schnell wieder eingreifen und die Taliban unterstützen, so wie sie die Taliban unter dem saudischen Al-Quaida-Chef Osama Bin Laden während dem russischen Feldzug gegen Afghanistan erschaffen haben. Frei nach dem Motto «der Feind meines Feindes ist mein Freund».
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.7.2021 - Tag der Sommermärchen
Der Wahlkampf bei den deutschen Grünen zerfleddert zusehends
Es gibt ein Ritual, das jeden Montag in Berlin stattfindet. Zunächst ziehen sich die Spitzen der Parteien zu Beratungen zurück, danach geben sie in Pressekonferenzen bekannt, was ihnen wichtig erscheint.
Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der deutschen Grünen, hat an diesem Montag einiges mitzuteilen. Etwa dass das Klimaschutzpaket der deutschen Regierung nicht ausreichend sei. Oder dass die Impfquote in Deutschland noch steigen müsse. Auch dass er mit jungen Grünen eine tolle "Summer School" abgehalten habe.
Das Buch
Kein Wort zur Causa prima, die derzeit allerorts diskutiert wird: das neue Buch von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Immer offensichtlicher wird, dass sie an vielen Stellen die Worte anderer übernommen hat, ohne die Quelle zu nennen.
So wies die "Bild"-Zeitung auf ein Interview hin, das der ehemalige grüne Außenminister Joschka Fischer (1998 bis 2005) im Dezember 2020 der "Neuen Zürcher Zeitung" ("NZZ") gegeben hat. Er sagte über die Gaspipeline Nord Stream: "Dieses Projekt war nie energiepolitisch, sondern immer geopolitisch motiviert seitens Russlands. Das Ziel war die Umgehung der Ukraine und Osteuropas, nicht Gaslieferungen nach Westeuropa."
In Baerbocks Buch heißt es auf Seite 202: "Diese Pipeline war seitens Russlands nie energiepolitisch, sondern immer geopolitisch motiviert. Das Ziel ist die Umgehung der Ukraine und Osteuropas, es sind nicht die Gaslieferungen nach Westeuropa."
In Kontakt mit Fischer und Trittin
Auch beim ehemaligen grünen Umweltminister Jürgen Trittin (1998 bis 2005) hat Baerbock nachgelesen. Dieser hatte im April in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Rundschau" mit Blick auf die Beziehungen zu den USA geschrieben: "Auf Feldern von strategischer Bedeutung wie Energie, Digitalisierung, Finanzindustrie gilt Bidens 'Buy American'. Europa muss das ernst nehmen."
Bei Baerbock heißt es: "Europa muss diese geoökonomischen Interessen ernst nehmen. Natürlich muss eine neue transatlantische Agenda auch in Feldern von strategischer Bedeutung wie Energie, Digitalisierung oder Finanzindustrie gelten (...)."
Festhalten an Baerbock
Bei den Grünen heißt es, selbstverständlich habe Baerbock Gedankengänge von Trittin und Fischer einfließen lassen können, die beiden seien ja bekanntlich einflussreiche Grüne, und Baerbock sei mit ihnen in Kontakt. Doch es wird schon auch die Frage gestellt, warum die Kanzlerkandidatin nicht einfach die beiden ehemaligen Minister als Quelle angegeben hat.
Über all das möchte Grünen-Geschäftsführer Kellner an diesem Montagnachmittag aber nicht sprechen. Doch es dauert nicht lange, und er muss. Ob damit zu rechnen sei, dass Robert Habeck übernehmen und als Kanzlerkandidat einspringen werde, wird er gefragt. Kellners Antwort: "Es gibt in diesem Wahlkampf ein gemeinsames Team Grün, das klar und deutlich hinter Annalena Baerbock steht und zusammenarbeitet."
Er mahnt dafür mehr Fairness im Wahlkampf ein. Ständig "Skandal, Skandal!" zu rufen werde "dem Ernst dieser Zeit nicht gerecht". Und er wünscht sich: "Wahlen sollten im fairen Wettstreit gewonnen werden."
Alleinstellungsmerkmal
Die Idee vom Kanzlerkandidaten Habeck ist nicht so unendlich weit hergeholt. Er führt seit 2018 mit Baerbock die Partei, und er hat kein Hehl daraus gemacht, dass er gerne Kanzlerkandidat geworden wäre. Doch als Frau hatte Baerbock das erste Zugriffsrecht.
Die Grünen erhofften sich bei dieser Entscheidung auch, dass sie vom Alleinstellungsmerkmal einer Kandidatin – neben Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) – profitieren könnten.
Doch derzeit ist davon nichts zu merken. In einer INSA-Umfrage für die "Bild am Sonntag" liegen die Grünen nur noch bei 18 Prozent, also wieder deutlich hinter der Union (28 Prozent) und nur noch einen Punkt vor der SPD (17 Prozent).
Klare Worte in der "Taz"
Besonders bitter für die Grünen: Nicht die "Bild"-Zeitung, sondern ausgerechnet die linksalternative "Tageszeitung" ("Taz"), die in grünen Kreisen hohes Ansehen genießt, sprach sich als erstes deutsches Medium für einen Wechsel bei der Kanzlerkandidatur aus. Baerbock solle zugunsten Habecks zurücktreten. Der Kommentar hatte den Titel "Es ist vorbei, Baerbock", und er wurde von vielen deutschen Medien zitiert.
Habeck schweigt seit Tagen, er scheint untergetaucht. Bei den Grünen hieß es am Montag, er sei im "wohlverdienten Urlaub", bevor er nächste Woche seine "Küstenreise" antrete. Habeck wird in seinem Heimatbundesland Schleswig-Holstein auf Sommertour gehen, Betriebe besichtigen und mit Menschen vor Ort sprechen.
Wenig Rückhalt
Eine Mehrheit der Deutschen hält es laut einer Civey-Umfrage für die "Augsburger Allgemeine" für einen Fehler, dass die Grünen mit Baerbock und nicht mit Habeck als Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl ziehen. 61 Prozent finden, dass sich die Grünen falsch entschieden haben, und nur 24 Prozent halten Baerbocks Kandidatur für richtig.
Zur Seite gesprungen ist Baerbock die ehemalige Familienministerin Franziska Giffey (SPD), die selbst wegen Plagiaten in der Doktorarbeit zurücktrat: "Was hier deutlich wird, ist, dass es in Deutschland einen Automatismus gibt: Es muss sich nur einer finden, der einen Plagiatsvorwurf erhebt, schon wird die Person komplett infrage gestellt und damit beschädigt." Schreibt DER STANDARD.
Der Hype um die deutsche Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, mutet fast wie ein Reload aus dem Jahr 2017 an.
Der Buchhändler und ehemalige Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, wurde am 19. März 2017 von einem ausserordentlichen Bundesparteitag mit 100 % (!) der gültigen Stimmen zum Parteivorsitzenden und zum Kanzlerkandidaten der SPD gewählt. Ein Wahlergebnis, das an die Wahlen von Parteifunktionären in die Volkskammer der ehemaligen DDR erinnert.
Die deutschen Medien nahmen den Ball dankbar auf und jazzten den unbedarften Schulz mit absolut realitätsfernen Artikeln zum neuen «Messias» und Retter der SPD hoch.
Die entsprechenden Umfrageergebnisse jenseits von Gut und Böse liessen nicht lange auf sich warten und die Lachnummer aus dem EU-Parlament wurde tatsächlich als ernsthafter Herausforderer Merkels hochgeschrieben.
Es kam wie es kommen musste. Innerhalb weniger Wochen fielen die himmelhochjauchzenden Umfrageergebnisse von Schulz ins Bodenlose. Dass er bei den Bundestagswahlen im Herbst 2017 das schlechteste Wahlergebnis in der langen Geschichte der deutschen SPD einfuhr, überraschte niemanden mehr.
Man könnte fast meinen, dass die Medien aus ihrer lächerlichen Komödie rund um Schulz aus dem Jahr 2017 nichts gelernt haben. Kaum war Annalena Baerbock zur grünen Kanzlerkandidatin erkoren, wurde sie von den gleichen Medien, die sie jetzt heftigst kritisieren, in den siebten Himmel hochgeschrieben.
Dabei waren die rhetorischen und intellektuellen Defizite Baerbocks von allem Anfang an jedem auch nur einigermassen seriösen Journalisten bekannt. Ihre Wahl zur Kanzlerkandidatin verdankte sie einzig und allein dem Umstand, eine Frau zu sein. Die Umfrageinstitute schlossen sich dem unsäglichen Presse-Wirbel an und veröffentlichten Prognosen, die mit der Realität rein gar nichts mehr zu tun hatten, sondern schlicht und einfach dem Medienhype geschuldet waren.
Der Absturz hat nur wenig mit den «kleinen» Sünden zu tun, die Baerbock nun vorgeworfen werden. Nicht gemeldete Geldspenden seitens der Partei an Baerbock? Na und? Machen das nicht die meisten Politiker? Geschönter Lebenslauf? Plagiatsvorwürfe bezüglich ihrem Buch, das von einem Gostwriter geschrieben wurde? An solchen Petitessen scheitert keine Parteikarriere oder Kanzlerkandidatur. So viel vernachlässigbaren Dreck haben die meisten Politiker*innen am Stecken.
Baerbocks Umfrage- und Beliebtheisranking dürfte eher mit der Heuchlerei rund um den Klimawandel zu tun haben und erinnert stark an die bachab geschickte Schweizer Volksabstimmung über das CO2-Gesetz. Die Parteipräsidentin der Schweizer FDP, Petra «Greta» Gössi lässt Frau Baerbock grüssen.
Auch wenn es trendy ist, sich mit hehren grünen Werten zu schmücken: Irgendwann holt die Realität die Apologeten von teuren staatlichen Zwangsmassnahmen und Verboten ein. Abgaben auf Flugtickets und Brennstoffe wie Öl und Gas führen letztendlich als Konsequenz ins eigene Portemonnaie. Da hört der Spass und die Begeisterung für die gute Sache schnell und endgültig auf. Wer bezahlt schon gerne eine höhere Wohnungsmiete oder höhere Nebenkosten bei Wohneigentum, nur weil die Heizölpreise staatlich verteuert werden?
Das Plattitüden-Buch von Baerbock dürften die wenigsten Deutschen gelesen haben. Das Wahlprogramm der Grünen hingegen schon. Dass die darin enthaltenen Abgaben und Verbote zur Rettung des Klimas jeden einzelnen deutschen Haushalt ziemlich viel kosten würden, dämmert nun auch dem Wahlvolk, je näher der Wahltermin rückt.
Wer A sagt, muss auch B sagen. Doch B führt nun mal direkt in den eigenen Geldbeutel und zu verheerenden, dafür aber realistischen Prognosen.
Und so findet jedes Sommermärchen irgendwann sein Ende. Spätestens im Herbst. Wenn der neue Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt wird. Eine Kanzlerin wird es definitiv nicht geben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.7.2021 - Tag des Steinzeit-Islams
Tadschikistan mobilisiert Armee nach Flucht aus Afghanistan, Taliban stellen Friedensplan in Aussicht
Angesichts der anhaltenden Kämpfe in Afghanistan zwischen Sicherheitskräften und den radikalislamischen Taliban mobilisiert das Nachbarland Tadschikistan 20.000 Militärreservisten zum Schutz der Grenze. Präsident Emomali Rachmon ordnete die Einberufung am Montag an, nachdem am Sonntag mehr als 1000 afghanische Sicherheitskräfte vor heranrückenden Taliban über die Grenze geflohen waren.
Zudem besprach er telefonisch die Lage mit Verbündeten in der Region, darunter mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Dieser sicherte Rachmon nach Angaben des Kreml Unterstützung bei der Grenzsicherung zu, wenn dies nötig sein sollte. Russlands größte Auslandsmilitärbasis liegt in Tadschikistan. Dort sind unter anderem Panzer und Hubschrauber stationiert.
"Gute Nachbarschaft"
Nach heftigen Kämpfen zwischen der afghanischen Armee und den radikalislamischen Taliban hatten 1.037 Soldaten die Grenze überquert, "um ihr Leben zu retten", wie das tadschikische Komitee für nationale Sicherheit mitteilte. Die Taliban hätten "volle Kontrolle" über sechs Bezirke in der Provinz Badakshan im Nordosten Afghanistans erlangt.
"Unter Berücksichtigung des Prinzips guter Nachbarschaft" sowie der "Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans", sei den Soldaten der Grenzübertritt gestattet worden, hieß es in einer von der staatlichen tadschikischen Nachrichtenagentur Khovar verbreiteten Mitteilung des Sicherheitskomitees.
Der in der Provinz Badakshan stationierte Soldat Abdul Basir zeigte Verständnis für die Entscheidung von einigen seiner Kameraden, nach Tadschikistan zu fliehen. "Sie wollten sich nicht ergeben. Sie hatten um Verstärkung gebeten, aber ihr Ruf wurde ignoriert", sagte er.
Befürchtungen
Beobachter befürchten, dass die Taliban nach dem vollständigen Abzug der Nato-Streitkräfte aus Afghanistan wieder die Macht in dem Land übernehmen könnten. Seit Wochen nimmt die Gewalt in dem Land am Hindukusch massiv zu, die Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung kommen nicht voran. Die Lage verschärfte sich zusätzlich, nachdem die USA am Freitag die Übergabe ihres Haupt-Militärstützpunkts Bagram an die afghanische Armee bekanntgegeben hatten.
Im Norden des Landes erzielten die Taliban am Wochenende bedeutende Gebietsgewinne. Die Provinzen Badakshan und Takhar wurden fast vollständig von den Radikalislamisten erobert; nur noch in den Provinzhauptstädten liegt die Kontrolle bei den afghanischen Streitkräften. Berichten zufolge gelang den Taliban zudem die Einnahme von strategisch wichtigen Bezirken außerhalb der südafghanischen Großstadt Kandahar sowie in der Provinz Helmand – beides traditionell Hochburgen der Radikalislamisten.
Die Einnahme weiter Teile von Badakshan und Takhar bedeutet für die afghanischen Streitkräfte eine dramatische Niederlage von hoher symbolischer Bedeutung. Beide Provinzen galten während des blutigen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren als zentrale Bollwerke der gegen die Taliban gerichteten Nordallianz.
Im Westen Afghanistans haben Taliban nach Behördenangaben unterdessen mindestens 16 Soldaten getötet. Die Kämpfer hätten in der Nacht einen Stützpunkt in der Provinz Herat angegriffen, teilten örtliche Ratsmitglieder am Montag mit. Die Extremisten sind dort in vielen Bezirken aktiv und greifen häufiger Sicherheitskräfte an.
Afghanistan plant Gegenoffensive
Zwar kündigte die afghanische Regierung eine Gegenoffensive an – ein entsprechender Einsatz werde "absolut" vorbereitet, sagte der Sicherheitsberater der Regierung in Kabul, Hamdullah Mohib, der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der Kabuler Experte Atta Noori warnte unterdessen vor einem Verlust der Kampfmoral bei den afghanischen Soldaten. Mohib ist ein wichtiger Berater des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani.
"In fast jeden Bezirk, den die Taliban einnehmen, schicken sie ein Team aus Dorfältesten, um mit den Soldaten zu sprechen und sie zur Kapitulation zu bewegen", sagte Noori, der von einer "Notsituation für die afghanische Regierung" sprach. Die angekündigte Gegenoffensive müsse "so schnell wie möglich" erfolgen.
Trotz des rapiden Vorpreschens der Taliban hält US-Präsident Joe Biden an seiner Entscheidung fest, bis spätestens zum 11. September alle verbliebenen US-Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. Ein Viertel der Bezirke im Land haben die Taliban seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen Anfang Mai erobert.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow beklagte in Moskau eine Destabilisierung in Afghanistan wegen des Abzugs der Truppen der USA und ihrer Verbündeten. Zur Frage möglicher zusätzlicher Kontingente für eine Verstärkung der in Tadschikistan stationierten russischen Streitkräfte sagte er, dies müssten das russische Militär und der Grenzschutz entscheiden. Eine Entsendung russischer Truppen nach Afghanistan werde es aber nicht geben, betonte er.
Taliban stellen Friedensplan in Aussicht
Die radikalislamischen Taliban stellten indes Fortschritte bei den Friedensbemühungen in Aussicht. "Die Friedensgespräche und der Prozess werden in den kommenden Tagen beschleunigt, und es wird damit gerechnet, dass sie in eine wichtige Phase eintreten. Natürlich wird es um Friedenspläne gehen", sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid am Montag. Einen schriftlichen Friedensplan könnte es innerhalb eines Monats geben.
Die jüngste Runde der Gespräche befinde sich an einem kritischen Punkt, sagte der Sprecher. "Obwohl wir (die Taliban) auf dem Schlachtfeld die Oberhand haben, nehmen wir Gespräche und Dialoge sehr ernst."
Die Sprecherin des afghanischen Ministeriums für Friedensangelegenheiten, Najia Anwari, bestätigte, dass die zuletzt auf Eis gelegenen Gespräche wieder aufgenommen worden seien. Es sei allerdings schwer vorstellbar, dass die Taliban in einem Monat eine schriftliche Fassung ihres Friedensplans vorlegen würden. "Aber lassen Sie uns positiv sein. Wir hoffen, dass sie (sie) präsentieren, damit wir verstehen, was sie wollen."
Von 1996 bis zu ihrem Sturz durch die US-geführten Truppen 2001 hatten die Taliban Afghanistan beherrscht und die Menschenrechte, vor allem die Rechte der Frauen, im Land massiv beschnitten. Die USA intervenierten an der Spitze eines Nato-Bündnisses kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan. Die Taliban-Regierung in Kabul hatte sich geweigert, gegen die Al-Kaida von Osama bin Laden, dem Drahtzieher der Anschläge in den USA, vorzugehen und wurden rasch gestürzt. Allerdings zogen sich ihre Kämpfer unter anderem ins Nachbarland Pakistan zurück und formierten sich neu. Schreibt DER STANDARD.
Dass ausgerechnet Russland den Abzug der von den USA geführten NATO-Truppen beklagt, hört sich wie ein schlechter Treppenwitz der Geschichte an. Andererseits gibt es für Putins Aktivität nachvollziehbare Gründe.
Der Islam ist vor allem die Religion von zahlreichen ethnischen Minderheiten in Russland. Das zahlreichste muslimische Volk in Russland sind die Tataren. Mit rund sechs Millionen Angehörigen sind sie nach den Russen (80 %) das zweitgrösste Volk (4 %) und zugleich auch die grösste Minderheit des Vielvölkerstaates. Ein Überschwappen des salafistischen Steinzeit-Islams kann sich Russland nicht erlauben.
Interessant wird auch sein, wie sich China, der mächtigste Player der Region, verhalten wird. Das «Swiss Institute for Global Affairs» hat mit «China in Afghanistan — Mächtiger Drache oder Schall und Rauch?» eine spannende Expertise veröffentlicht. https://www.globalaffairs.ch/2020/10/08/china-in-afghanistan-m%C3%A4chtiger-drache-oder-schall-und-rauch/
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.7.2021 - Tag der rumänischen Oligarchen
Bulgariens Premier Yanev über die Kohäsionsmilliarde: «Das Schweizer Geld hilft uns sehr»
Der bulgarische Premierminister Stefan Yanev (61) spricht über die Kohäsionsmilliarde der Schweiz, den Streit mit der EU, Bulgariens Probleme mit Korruption und dessen schrumpfende Bevölkerungszahl.
Bulgarien ist das ärmste und korrupteste Land der EU, die Bevölkerungszahl schrumpft, weil viele ihr Glück im Ausland suchen. Bulgarien profitiert von der Schweizer Kohäsionsmilliarde und hat als eines der 27 EU-Länder ebenso viel wie alle anderen Mitglieder darüber mitzureden, wie es nach dem Aus für das Rahmenabkommen weitergeht. Blick traf Premierminster Stefan Yanev (61) in seinem pompösen Büro mitten in Sofia – das palastähnliche Gebäude ist ein Relikt aus der Sowjetzeit. Yanew war Brigadegeneral und führt das Land übergangsmässig bis zu den nächsten Wahlen. Er ist neutral, direkt und präzis, wie ein General eben.
Blick: Sie waren General und sind heute Politiker. Was ist der Unterschied?
Stefan Yanev: Im Militär gelten klare Regeln. Als General konnte ich befehlen. In der Politik muss ich die Menschen mit Argumenten gewinnen, und das muss auch so sein.
Warum ist Bulgarien das korrupteste Land der EU?
Leider haben Sie recht. Gerade vor ein paar Wochen hat die US-Regierung bestimmte Personen und Unternehmen in Bulgarien sanktioniert – ein weiterer Beweis dafür, dass die Dinge nicht gut laufen. Die Menschen sind sich bewusst, dass Korruption seit Jahren ein grosses Problem ist. Was der Grund ist? Viele Politiker unternehmen nichts dagegen, und selbst wenn die Medien Missstände aufdecken, wird die Staatsanwaltschaft oft nicht aktiv. In Bulgarien sitzen weder Politiker noch Geschäftsleute wegen Korruption im Gefängnis, obwohl manche es verdient hätten.
Was muss sich ändern?
Zwei Dinge. Erstens braucht es die klare Botschaft der Wählerinnen und Wähler, dass sie Menschen in der Politik wollen, die nicht auf ihren persönlichen Gewinn fokussiert sind. Zweitens braucht es Gesetzesreformen, damit Staatsanwaltschaften und Gerichte effektiver arbeiten können.
Was tun Sie als Premierminister?
Meine geschäftsführende Regierung hat in erster Linie den Auftrag, die nächsten Wahlen zu organisieren und das Land gut zu führen. Es ist schwierig für mich, in der kurzen Zeit etwas Bedeutendes beizutragen. Ich versuche, in meinen Reden die Menschen zu überzeugen, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen.
Sind die Fördergelder der EU kontraproduktiv, weil sie das korrupte System speisen?
Für dieses Geld sind wir sehr dankbar. Anfangs dachten die Bulgaren, dass sich die Europäer darum kümmern werden, wie das Geld eingesetzt wird. Dann stellte sich heraus, dass jedes Land selbst dafür verantwortlich ist. Tatsächlich sind heute viele der Ansicht, dass das europäische Geld nicht auf gute Weise ausgegeben wurde und es zu Korruption kam.
Wäre es nicht Sache der EU, dafür zu sorgen, dass ihr Geld nicht in der Korruption landet?
Das ist kein Problem, das die EU lösen kann. Wir müssen selber dafür sorgen, dass unsere Systeme richtig funktionieren.
Bulgarien zählte in den 1980er-Jahren neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, jetzt sind es sieben und bis in dreissig Jahren noch gut fünf. Warum schrumpft Ihr Land?
Viele suchen im Ausland einen besseren Job. Bulgarien verliert viele Talente, was sehr beunruhigend ist. Wir müssen die Wirtschaft wieder aufbauen, so dass wir bessere Gehälter zahlen können. Immerhin läuft die IT-Branche sehr gut, es gibt viele Start-ups in diesem Bereich. Allerdings wächst dieser Sektor so stark, dass es in ein paar Jahren zu wenige Fachkräfte geben wird.
Haben EU-Beitritt und Personenfreizügigkeit den Trend zum Auswandern verstärkt?
Bis zu einem gewissen Grad bestimmt. Viele Bulgaren gingen auf der Suche nach einer besseren Arbeit nach Europa. Deshalb müssen wir Unternehmen darin unterstützen, ihr Geld so zu investieren, dass bessere und mehr Arbeitsplätze im Land entstehen. Die Politiker müssen sich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentrieren.
Bulgarische Ärzte wandern nach Deutschland aus, deutsche Ärzte in die Schweiz – vielen Dank, dass Sie die Ausbildung unserer Mediziner finanzieren!
Willkommen in der freien Wirtschaft! So ist das nun mal. Das Durchschnittsalter der Krankenschwestern im Norden Bulgariens steigt stetig. Sie müssen nach ihrer Pensionierung weiterarbeiten, weil die jungen auswandern.
Müsste die Schweiz für gut ausgebildete Arbeitskräfte bezahlen?
Nein. Es sei denn, es gäbe ein bilaterales Abkommen, das dies so vorsehen würde. Es ist in Ordnung, wenn junge Menschen ein paar Jahre im Ausland verbringen. Wir müssen aber bessere Bedingungen schaffen, damit diese Personen wieder zurückkehren und hier eine Familie gründen wollen.
Wie wichtig war die erste Kohäsionsmilliarde, welche die Schweiz für die neuen EU-Länder Osteuropas und damit auch an Bulgarien bezahlt hat?
Die Schweiz ist von der EU umgeben und arbeitet eng mit ihr zusammen. Sie hat mit dem Kohäsionsgeld die europäische Idee unterstützt. Die neuen Mitglieder haben davon profitiert – auch Bulgarien mit knapp 80 Millionen Euro. Dieses Geld wurde in ein Programm für die Entwicklung verschiedener Zweige der Wirtschaft und in das duale Bildungssystem investiert.
Unser Parlament berät über eine weitere Kohäsionszahlung, was allerdings umstritten ist. Verstehen Sie die kritischen Stimmen?
Es gibt in jedem Land kritische Stimmen. Sicher ist, dass die osteuropäischen Staaten weitere Unterstützung brauchen, um Infrastruktur und Investitionsumfeld zu verbessern. Das Schweizer Geld hilft uns sehr, aber natürlich müssen wir es sinnvoll nutzen.
Werden Sie unser Land nach dem Aus für das Rahmenabkommen unterstützen, damit es mit der EU eine Lösung gibt?
Das ist eine heikle Frage. Natürlich habe ich Kenntnis vom Verhandlungsabbruch. Beide Parteien haben ihre Sicht auf das Rahmenabkommen. Eine Lösung ist möglich und wünschenswert, sie muss einfach die Interessen beider Seiten berücksichtigen.
Wohin soll sich die EU entwickeln: in Richtung mehr Autonomie für jedes Land oder in Richtung Vereinigte Staaten von Europa?
Die Vereinigten Staaten von Europa sind nicht machbar, auch wenn es viele Bulgarinnen und Bulgaren gerne anders hätten. Sie wünschen sich, dass das bulgarische Parlament von aussen besser überwacht würde. Doch das wird nicht passieren. Es bräuchte eine gemeinsame europäische Armee und dafür eine gemeinsame Gesetzgebung. Eine unmögliche Mission!
Sind nicht einfach die Werte zu verschieden? Aktuelles Beispiel: das neue ungarische Anti-Homosexuellen-Gesetz von Viktor Orban. Wie stehen Sie dazu?
Orban macht vermutlich das, was das ungarische Volk von ihm will. Bulgarien ist ein tolerantes Land: Hier kann jeder so leben, wie er will. Allerdings finde ich, dass man private Dinge nicht immer nach aussen tragen muss. Schreibt Blick.
Ein gutes Interview von Blick und ein schonungslos offener Premier Yanev, der die Missstände in Bulgarien gar nicht erst zu beschönigen versucht.
Dass Rumänien als eines der korruptesten Länder der Welt in den entsprechenden Rankings seit Jahren an vordersten Positionen auftaucht, ist eine altbekannte Tatsache.
Rumänien war schon zu Zeiten des «Eisernen Vorhangs» unter dem diktatorischen Regime von Nicolae Ceaușescu und der kommunistischen Einheitspartei eine Korruptionshölle, die sich über Jahrzehnte von den obersten Parteikadern bis hinunter zum einfachen Dorfpolizisten in der Gesellschaft verbreitete und entsprechend etablierte.
Das war allen Beteiligten bei der Aufnahme Rumäniens im Jahr 2007 in die EU bestens bekannt.
Schon im Jahr 2004 wurde Rumänien Mitglied des hehren westlichen «Verteidigungsbündnis» aus strategischen Überlegungen in die NATO aufgenommen, um die militärische Macht des russischen Bären einzudämmen. Auch die NATO wusste ganz genau, welch kriminelle Mafia mit östlicher Prägung damit ins Boot geholt wurde.
Sowohl NATO- wie auch EU-Beitritt werden heute kritisiert. Selbst von Politikern, die sich damals mit «Feuer und Flamme» für die Beitritte einsetzten. Die Aufnahme Rumäniens in die beiden Bündnisse sei zu früh erfolgt, wird nun im Nachhinein argumentiert.
Falsch! Beide Bündnisse waren sich der toxischen Elemente in Rumäniens Gesellschaft bewusst. Doch statt mit den tatsächlich zur Verfügung stehenden Instrumenten von allem Anfang an eine Wende herbeizuführen, liessen sowohl NATO wie auch EU die herrschenden Eliten aus den Kadern der ehemaligen kommunistischen Partei auf ihren Raubzügen durch die Hilfsgelder in Milliardenhöhe gewähren.
Statt mit eiserner Härte und entsprechenden Sanktionen einzugreifen, schauten NATO und EU zu, wie sich zu Lasten der Zivilgesellschaft ein Unrechtsstaat etablierte.
Es ist leider anzunehmen, dass mit den Schweizer Kohäsionsmillionen, die erneut nach Rumänien fliessen sollen, einmal mehr die Falschen bedient werden. Denn hinter den rumänischen Start Up's steht in der Regel in Tat und Wahrheit ein rumänischer «Oligarch».
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.7.2021 - Tag der Warmblüter
FDP: Ja zur Ehe für alle und Nein zur sogenannten 99%-Initiative
Die Delegierten der FDP haben sich in Martigny im Kanton Wallis versammelt. Die abtretende Parteipräsidentin Petra Gössi sagte zur Begrüssung, sie sei stolz und glücklich, wie viel Positives man in den letzten fünf Jahren gemeinsam erreicht habe. Die Partei hat mit grosser Mehrheit eine Nein-Parole für die sogenannte 99%-Initiative beschlossen. Zur Ehe für alle fasste die Partei die Ja-Parole.
Laut Gössi ist die FDP wieder aufgewacht «wie aus einem Dornröschenschlaf». «Wir diskutieren und ringen miteinander über Inhalte. Das macht Freude und schafft Zuversicht», sagte die Parteipräsidentin. Sie betonte, wie wichtig es sei, dass die Parteileitung ihren Mitgliedern zuhört und ihre Meinung einholt. «Es ist ein Erfolgsrezept, unsere Mitglieder ernst zu nehmen.» Die FDP solle bewusst «breit arbeiten und sich nicht nur um Wirtschafts- und Steuerfragen kümmern». «Der zu enge Fokus hat uns in den vergangenen 20 Jahren keinen Zentimeter grösser, sondern nur kleiner gemacht. Es hat die SVP und die GLP gestärkt, nota bene zu unseren Lasten», sagte Gössi.
Für Gössi sind aktuell drei grosse Fragen politisch zu beantworten: Wie es weitergeht mit dem Verhältnis der Schweiz zur EU, wie die Alters- und Sozialpolitik gestaltet wird und wie die Folgen der Corona-Krise abgefedert werden können und die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze geschaffen werden kann. Für die Beantwortung dieser Fragen wolle sie die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, betonte Gössi.
Die 45-Jährige hatte Mitte Juni ihren Rücktritt auf spätestens Ende Jahr bekannt gegeben. Sie bedankte sich bei den Delegierten: «Es war und ist noch für ein paar Monate ein Privileg, eure Präsidentin zu sein.» Anfang Oktober will die FDP einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wählen.
Parolen für 26. September gefasst
Die Delegierten der FDP haben sich gegen die Initiative Kapitalbesteuerung der Jungsozialistinnen und -sozialisten (Juso) ausgesprochen. Das Volksbegehren will Kapitalerträge wie Zinsen, Mieten oder Dividenden eineinhalb mal so stark besteuern wie Lohneinkommen. Der Gesetzgeber würde einen Freibetrag festlegen.
Nationalrat Beat Walti (ZH) bezeichnete die Vorlage als Etikettenschwindel. Zudem berge die Initiative eine verzerrte Wahrnehmung von Ungleichheit. «Der soziale Ausgleich in der Schweiz funktioniert», sagte Walti. Das Kapital werde bereits heute stark besteuert.
Für die zweite Abstimmung über die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare beschloss die FDP die Ja-Parole. «Beim Projekt der Ehe für alle geht es im Kern darum, dass der Staat alle Menschen vor dem Gesetz gleich behandelt», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor den Delegierten. Es sei nicht die Aufgabe des Staates, die sexuelle Orientierung zu beurteilen.
Eine Minderheit der FDP-Delegierten stimmte gegen die «Ehe für alle». Die Schweizer Bevölkerung stimmt am 26. September über die «Ehe für alle» und die Initiative Kapitalbesteuerung ab. Schreibt SRF.
Gemäss der abgehalfterten Parteipräsidentin Gössi ist die FDP «aus dem Dornröschenschlaf» aufgewacht. Dass sich die FDP einstimmig gegen die Initiative «Kapitalbesteuerung» der Jungsozialisten aussprach, hat aber nichts mit Dornröschenschlaf zu tun. Das war anzunehmen. Pflege der Klientelpolitik ist schliesslich in der DNA der FDP verankert.
Bei der «Ehe für alle» hingegen gab es ein paar Abweichler. Der Luzerner FDP-Ständerat und Staatsmann Damian «ich bin nicht schwul» Müller gehörte nicht dazu. Der «eloquente» (NZZ) Luzerner Politiker, in einem herzigen Artikel mit dem Titel «Ein echter Warmblüter» https://www.damian-mueller.ch/wp-content/uploads/2021/06/Schweizer-Illustrierte-Reportage.pdfals fleissig, umgänglich und ehrgeizig bezeichnet, stimmte für die Annahme der Initiative. Ist ja irgendwie auch logisch. Eine Ablehnung der «Ehe für alle» würde nicht wirklich zu einem «echten Warmblüter» passen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.7.2021 - Steuersparmodelle
Stiftungen der Millionäre: Zuger Bevölkerung profitiert kaum vom Geld der Superreichen
Wohin mit dem Geld? Nicht unbedingt in den Wohnkanton. Zuger Millionäre unterstützen häufig nicht einheimische Projekte.
Teure Autos und mondäne Villen. Wer sich im Kanton Zug schon einmal aufgehalten hat, merkt es sofort: Hier riecht es nach Geld. Der Kanton Zug ist für die Superreichen steuerlich attraktiv. Ein Topmanager mit fünf Millionen Jahresgehalt zahlt in Zug praktisch die Hälfte der Steuern, die er etwa im Kanton Bern abliefern müsste. Und noch weitere eindrückliche Zahlen: Im Kanton Zug kommen inzwischen auf 1000 Steuerpflichtige 132 Vermögensmillionäre. Mit anderen Worten: Jede achte Person im Kanton Zug ist Millionärin oder Millionär. Dies hat eine Analyse des «Sonntagsblick» diesen Frühling aufgezeigt.
Was bringen diese reichen Menschen dem Kanton abgesehen von Steuergeldern sonst noch? Kommt von ihnen so etwas wie ein gesellschaftliches Engagement, das sich zum Beispiel in Mäzenentum oder Stiftungen ausdrückt?
Es gibt im Kanton Zug tatsächlich alteingesessene Stiftungen: Die Ernst Göhner Stiftung, die Beisheim Stiftung oder die Landys und Gyr Stiftung. Sie unterstützen Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Forschung und Kultur.
Grosser Unterschied zu Basel
Trotzdem hat das Stiftungs- und Mäzenenwesen kantonal nicht den Stellenwert, den es zum Beispiel in der Stadt Basel hat. Basel gilt als Philantropie-Hauptstadt. In keiner anderen Stadt in der Schweiz gibt es im Verhältnis zur Bevölkerung so viele Stiftungen. Auch Theater und Museen haben vermögende Leute in Basel ins Leben gerufen: die Fondation Beyeler oder das Tinguely-Museum zum Beispiel.
Dass die Basler Stiftungen so viele lokale Projekte unterstützen, habe einen Grund, sagt Georg von Schnurbein, Professor für Stiftungsmanagment an der Universität Basel: «Die Mehrzahl der Stiftungen sind unter kantonaler Aufsicht. Das heisst, sie haben einen regionalen oder sogar lokalen Zweck.» Anders sei das im Kanton Zug. Dort seien 55 Prozent der Stiftungen unter nationaler Aufsicht. Das wiederum bedeutet, dass sie nationale oder sogar internationale Projekte unterstützen können.
Deshalb profitiert die Zuger Bevölkerung viel weniger von den Geldern, die Stiftungen ausschütten.
Zug hat keine alte Stiftungstradition
Die Stiftungstradition ist im Kanton Zug noch relativ jung. Bis 1990 gab es sie kaum. «Über 80 Prozent der Stiftungen, die es im Kanton Zug gibt, sind in den letzten 30 Jahren entstanden», sagt Georg von Schnurbein. Der finanzielle Aufschwung kam erst in den letzten Jahrzehnten. Heute gibt es zehnmal mehr Millionäre im Kanton Zug als in den 1970er-Jahren.
Es gab zwar schon früher vermögende Familien im Kanton. Allerdings: «Eine breite Tradition und Verpflichtung von wohlhabenden Familien, sich gesellschaftlich zu engagieren, kennt man in der Zentralschweiz weniger», sagt Aldo Caviezel, Leiter vom Amt für Kultur im Kanton Zug. Es sei ein deutlicher Unterschied zum Kanton Basel-Stadt, der seit dem Mittelalter eine tiefe Tradition von grossen Familien habe, welche sich sehr stark für das Allgemeinwohl einsetzen.
Aber natürlich gäbe es auch im Kanton Zug Familien und Einzelpersonen, die den Kanton kulturell unterstützen - das sei wichtig. Öffentlich in Erscheinung treten diese allerdings selten. «Auch wenn Projekte von privaten Mäzenen gefördert werden, spüren wir ihre Präsenz wenig bis gar nicht», sagt Aldo Caviezel. Schreibt SRF.
Steuersparmodelle sind gar nicht der Wohltätigkeit gewidmet? Wer hätte das gedacht?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.7.2021 - Tag der No Go-Areas
Wer liefert das verbotene Cannabis?
Ab 2022 sollen die ersten Pilotversuche zur kontrollierten Abgabe starten. Dafür braucht es tonnenweise Cannabis.
Die ersten Pilotversuche sollen anfangs 2022 zur kontrollierten Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken starten. Das Projekt wird streng wissenschaftlich kontrolliert. Die Studien führt nicht der Bund selbst durch, sondern beispielsweise interessierte Gemeinden, Städte oder Universitäten. Dazu ist viel Hanf nötig.
«Bis zu mehreren Tonnen», sagt Adrian Gschwend vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und erklärt: «Das ist sehr schwierig einzuschätzen. Eine qualitative Studie kann 10 Personen haben und eine andere 5000. Dann braucht es dann schon eine Produktion im Umfang mehrerer Tonnen.»
Wer soll diese mehreren Tonnen produzieren?
Bis jetzt ist der Anbau von Cannabis mit einem THC-Gehalt von über einem Prozent verboten. Das ist die Menge, mit der eine berauschenden Wirkung erzielt werden kann. Nun geht es aber um Cannabis mit einem THC-Gehalt von bis zu 20 Prozent.
Infrage kommen Herstellerinnen von Medizinalhanf oder Produzenten von legalem CBD-Hanf. Gschwend hat eine weitere Idee: «Es gibt sicher auch diese Hanfpioniere aus den 80er- und 90er-Jahren, die hier noch aktiv sind und immer wieder aktiv werden.» Das sind also Produzentinnen und Produzenten, die bis jetzt oft illegal Cannabis anbauten.
Adrian Gschwend vom BAG sagt dazu: «Das wird sehr streng kontrolliert, was auch aufgrund des internationalen Rechts notwendig ist. Das heisst, die Produzentinnen und Produzenten brauchen eine Ausnahmegenehmigung von uns. Wir müssen das sehr genau verfolgen.»
Woher das Cannabis kommen soll, ist noch unklar
Wer baut also für die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken wie viel Hanf an? Vieles ist noch unklar. Bis jetzt ist noch kein Projekt eingereicht worden. Erste werden im Laufe des Sommers erwartet und dann geprüft. Erste Studienergebnisse sollen in drei Jahren vorliegen. Schreibt SRF.
Was für eine dämliche Frage: «Wer liefert das verbotene Cannabis?» Na, wer wohl, wenn nicht diejenigen, die es bereits liefern?
Cannabis mit einem THC-Gehalt von bis zu 20 Prozent, ja gar bis 30 Prozent und noch mehr in gewissen Fällen, ist beispielsweise im Schweizer Drogen-Hotspot Numero Zwei, also in Luzern, längst nicht mehr die Ausnahme sondern eher der Normalfall.
Die Lieferanten dieser 20-Prozent-Superbomben von der Balkan-Connection wären für Adrian Gschwend vom BAG an der Baselstrasse in Luzern relativ leicht aufzuspüren.
Allerdings nur in Begleitung eines schwerbewaffneten 20-Mann-Kommandos der Luzerner Spezial-Polizeitruppe «Luchs». Einzelne Luzerner Polizisten getrauen sich da nämlich gar nicht mehr hin.
Ein Hauch von Banlieue am Fusse des Pilatus.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.7.2021 - Tag der Betroffenheitsfloskeln
Die Afghanen
Die Afghanen. Sie sind großteils als "zweite Welle" 2015/16 gekommen, und zwar aus einer extremen Gewaltgesellschaft, wo von den Taliban Mädchenschulen in die Luft gesprengt werden. Das hat unweigerlich Folgen auch für uns.
Der/die Posterin "Achsel-des-Boesen" schreibt zu der entsetzlichen Tötung einer 13-Jährigen: "Von den ca. ein Dutzend Afghanen, denen ich Deutschunterricht gegeben habe, waren etwa die Hälfte überaus liebenswert, wissbegierig und sehr integrationswillig. Das waren größtenteils Hazara – Angehörige einer Volksgruppe, die in Afghanistan massiv diskriminiert wird. Dann gab es welche, die waren zurückgezogen, unzugänglich und offensichtlich überfordert von der Situation – aber harmlos. Und dann gab’s einen, der hat alle negativen Klischees erfüllt – ein unberechenbarer, notorischer Gewalttäter."
Fazit des Postings: "Es kommen echte Opfer her und echte Täter, das ist das Dilemma." So ist es, und das können viele bestätigen, die hier mit Afghanen zu tun haben. Die Tragödie dabei ist, dass in unserem System einerseits völlig integrierte junge Afghanen abgeschoben werden, andererseits die Abschiebung des bereits straffälligen Hauptverdächtigen im Fall der 13-Jährigen in der Justizbürokratie hängen blieb. Wir (die Behörden, die Hilfsorganisationen, die interessierte Öffentlichkeit) können nur eines tun: das Problem eingestehen und, so gut es geht, an seinem besseren Management arbeiten. Schreibt Hans Rauscher in DER STANDARD.
Die Tötung der 13-jährigen Leonie in Wien-Donaustadt sorgt für Entsetzen in Österreich. Zwei junge Flüchtlinge aus Afghanistan, der eine 16, der andere 18 Jahre alt, stehen laut Polizeibericht unter Verdacht, das Mädchen, das die beiden Asylanten kannte und freiwillig mit ihnen in die Wohnung des älteren Burschen ging, mit Drogen (vermutlich Ecstasy) gefügig gemacht zu haben. Danach wurde die 13-Jährige sexuell misshandelt, getötet und die Leiche anschliessend in der Nähe der Wohnung des Afghanen auf einem Rasenstück abgelegt.
Die österreichischen Medien überschlagen sich gegenseitig mit ihrer Berichterstattung im Live-Ticker-Format. Das Clickbaiting generiert in den Leserforen rekordverdächtige Posting-Zahlen. Egal, ob Boulevard oder linkes / rechtes Milieu.
So verbuchte beispielsweise DER STANDARD bei einem einzigen Artikel (unter vielen) 6015 Wortmeldungen. Frei nach der in Stein gemeisselten Uralt-Formel «Tote bringen Quote» scheint das Thema den notleidenden Medien Österreichs im medialen Sommerloch etwas Luft zu verschaffen.
Auch wenn jeder einzelne Click Werbeeinnahmen – vor allem aus dem von Algorithmen gesteuerten Google-Imperium – in die Kassen der Medien spült, ist die These mit dem Sommerloch zu kurz gesprungen.
Das Flüchtlings-Thema bewegt die Gesellschaft nach wie vor wie kaum ein anderes. Sechstausendundfünfzehn Wortmeldungen fallen nicht «einfach so» vom Himmel. Das Thema rund um die Migration war nie weg. Es wurde nur durch die Corona-Pandemie in den Hintergrund verdrängt.
Erinnern wir uns: Mit der je nach Standpunkt objektiv oder subjektiv wahrgenommen Problematik der Flüchtlingswellen ab dem Jahr 2015 wurden in der Zeit vor der Corona-Pandemie Wahlen gewonnen. Trump in den USA, Salvini in Italien, Sebastian Kurz (zusammen mit den Rechtsauslegern der FPÖ) in Österreich. Um nur drei Beispiele zu nennen.
In Deutschland wurde die 2014 kurz vor der endgültigen Versenkung in den Orkus gescheiterter Parteien gestandene AfD bei den Bundestagswahlen 2017 quasi ohne Parteiprogramm, dafür aber mit heftiger Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik, über Nacht zur stärksten Oppositionspartei des deutschen Bundestags gewählt. Weit vor den Grünen!
Bundesrat Ueli Maurer sagte ja nicht umsonst, dass «die SVP Wahlen nur mit den Themen Flüchtlinge, Ausländer und EU» gewinne.
Die österreichischen Parteien melden sich denn auch nach dem entsetzlichen Verbrechen mit den gewohnten Betroffenheitsfloskeln und den üblichen, markanten Lösungsvorschlägen zu Wort. Wohl wissend, dass diese Vorschläge nicht mit dem nationalen, internationalen und schon gar nicht mit dem EU-Recht kompatibel sind. Heuchelei und Vorspiegelung falscher Tatsachen at its best.
Doch langfristig werden die Politiker*innen, die Hilfswerke (!) und die Gesellschaft nicht umhin kommen, sich seriös und ohne ideologisch gefärbte Brille der Migrations-Problematik anzunehmen. Hans Rauscher schreibt denn auch treffend: «Wir (die Behörden, die Hilfsorganisationen, die interessierte Öffentlichkeit) können nur eines tun: das Problem eingestehen (!) und, so gut es geht, an seinem besseren Management arbeiten.»
Jetzt sämtliche Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen, wie es gerade in Österreich passiert, ist jedoch der falsche Wegund beschämend. Flüchtlinge zum reinen Marketinginstrument für Wahlkämpfe zu instrumentalisieren und zu missbrauchen ebenfalls. Die Politik ist gefordert, sich der Problematik zu stellen und vernünftige Lösungen zu erarbeiten. Genug Zeit hatte sie ja eigentlich; 2015 liegt immerhin sechs Jahre zurück.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.6.2021 - Tag der Stümper
«Strafe für drei Jahre Stümpern»: Deutsche rechnen mit Jogi Löw ab
Jogi Löw muss sich einiges fürs Ausscheiden bei der EM vorwerfen lassen. Die 0:2-Pleite gegen England könnte zudem für vier DFB-Stars der letzte Auftritt für die Nationalmannschaft gewesen sein.
Mit der 0:2-Niederlage gegen England kracht Deutschland aus der EM. Seinen Abschied hat sich Jogi Löw sicherlich anders vorgestellt. Geknickt ergibt er sich dem Interviewmarathon nach der Partie. Danach sitzt er mit gesenktem Kopf im Bus, der aus dem Wembley-Stadion fährt.
Was wurde nicht alles geschrieben nach den Peinlich-Auftritten der DFB-Elf gegen Spanien (0:6) und Nordmazedonien (1:2). Der 61-Jährige stand heftigst in der Kritik, bekam aber das Vertrauen für die EM-Endrunde. Alle rauften sich zusammen, schürten Hoffnungen, träumten gar vom Titel. Und jetzt das. Die nächste Riesenenttäuschung. Und wer trägt die Hauptschuld? Natürlich der Trainer. Wieder wird Löw in Deutschland zum Prügel-Jogi.
«Das ist ein bisschen ernüchternd. Man fühlt sich ohnmächtig. Ich verstehe nicht, warum der Bundestrainer so lange wartet mit Umstellungen», sagt Ex-DFB-Captain Michael Ballack bei MagentaTV. Auch für die späten Wechsel findet der 44-Jährige keine Erklärung.
«Das war Alibi»
Jamal Musiala (18), der gegen Ungarn mit seinem Kurz-Einsatz überzeugt hat, kommt erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit – beim Stand von 0:2. «Das war Alibi, das bringt gar nichts», so Hertha-Manager Fredi Bobic, «das muss sich der Bundestrainer vorwerfen lassen. Auch in der Vergangenheit waren seine Wechsel schon fragwürdig.»
«Ausgerechnet im 198. und letzten Spiel der Ära Joachim Löw lernen wir den Bundestrainer als Angsthasen kennen, der verzagten und passiven Fussball spielen lässt», schreibt das Online-Portal Spox.
Lehren nicht gezogen
Ohnehin wird das Konzept von Löw in Frage gestellt – aber auch der Verband wird in die Mangel genommen. Es sei die «Strafe für drei Jahre Stümpern», schreibt Sport1. Niemand habe seine Lehren aus dem WM-Blamage 2018 gezogen und Löw selbst den Moment des Absprungs verpasst.
«Der Bundestrainer war schon lange vor seinem letzten Spiel in der Verantwortung für die Nationalmannschaft kein Mann mehr, der noch einmal etwas hätte bewegen können», so die «Frankfurter Allgemeine».
Hin und Her mit Müller und Hummels
Sein angestrebter Umbruch gipfelte im Hin und Her bei Thomas Müller (31) und Mats Hummels (32) – nach der Endrunde in Russland mit Jérôme Boateng (32) aussortiert und für die EM wieder berufen. Wie gehts für die beiden weiter? «Ich glaube, das war das letzte Länderspiel von Müller und Hummels», so Ex-Profi und Experte Bastian Schweinsteiger gegenüber der ARD. Wie «Sport Bild» schreibt, würden sich auch Toni Kroos (31) und Ilkay Gündogan (30) mit einem Rücktritt befassen.
Hummels lässt seine Zukunft noch offen. Der BVB-Star werde sich mit dem Thema erst in ein paar Wochen befassen. Dann ist ein neuer Mann an der Seitenlinie der Deutschen. Hansi Flick (56) wird bekanntlich die Position des Bundestrainers übernehmen. In die Karten seiner Personalplanung lässt sich der Ex-Bayern-Trainer nicht schauen. Schreibt Blick.
From Hero to Zero: In Deutschland wird der bis gestern Abend respektierte Bundestrainer der deutschen Fussball-Nationalmannschaft nun der Stümperei bezichtigt.
Umgekehrt läuft es in der Schweiz: Da werden Fussballspieler, die bis zum Spiel gegen Frankreich noch querbeet durch alle Medien als charakterlose Stümper bezeichnet wurden, zu Helden, wenn nicht gar zu Göttern, hochgejubelt. From Zero to Hero.
Tja, so funktioniert nun mal grosses Unterhaltungs-Kino.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.6.2021 - Tag der Anstalt
Eine Nation fliegt übers Kuckucksnest
Erinnert sich noch jemand an einen der grössten Erfolge in der US-amerikanischen Filmgeschichte aus dem Jahr 1975? «Einer flog über das Kuckucksnest» (Originaltitel «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» von Miloš Forman nach Ken Keseys gleichnamigem Roman. Der Film mit Jack Nicholson in der Hauptrolle spielt in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt der USA.
Einige der üblichen Verdächtigen der medialen Sommerlochzunft erinnern heute tatsächlich an dieses Kuckucksnest. Allen voran Sascha Ruefer, der für SRF das EM-Fussballspiel Frankreich vs. Schweiz kommentierte.
Der gleiche Ruefer, der die Schweizer Nationalmannschaft nach dem blamablen Spiel gegen Italien im Studio nach Strich und Faden zerriss, schreit nach dem Penaltyschiessen des gestrigen Abends seine Emotionen wie ein pubertierender Halbstarker mitten im Stimmbruch ins SRF-Krähenrohr.
Die Frage drängt sich auf, wer diesem infantilen Schreihals die Eier abgeschnitten hat.
From Zero to Hero
«Der geilste Sieg aller Zeiten: Dieser Sieg gegen Frankreich ist der grösste in der Nati-Geschichte», meint der stv. Blick-Sportchef Andreas Böni.
Ausgerechnet der Böni, der die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft wie kein Zweiter für Nebensächlichkeiten wie Superautos und gefärbte Haare kritisierte, die bei allen anderen Superstars aus der Welt des Sport-Entertainments wie beispielsweise Federer, Messi und Ronaldo absolut normal sind.
«Wir haben vielen das Maul gestopft» rechnet Nati-Captain Xhaka nach EM-Coup mit den Kritikern ab.
Ob er dabei an die zwei Bewohner aus dem Kuckucksnest gedacht hat, lässt Xhaka offen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
28.6.2021 - Tag der verbrannten Jachten
Explosion an Bord: Strache entkommt Inferno auf Jacht in der Adria
Riesenglück für acht Österreicher - unter ihnen Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache - bei einem brenzligen Bootsdrama nahe Biograd in Kroatien. Nachdem die Motorjacht Feuer gefangen hatte, gelang es allen, sich ans Ufer zu retten. Trotz des Dramas sollen die gestrandeten Österreicher derzeit in Kroatien festsitzen.
Eine ohrenbetäubende Detonation, Feuerzungen, eine himmelhohe Rauchsäule und ein Inferno an Bord. Sonntagvormittag endete der Bootsausflug für die acht Österreicher katastrophal. Aus noch ungeklärten Gründen dürfte das etwa 15 Meter lange Schiff zwischen zwei Inseln nahe Biograd auf Grund gelaufen und in der Folge in Brand geraten sein.
Passagiere konnten sich aus eigener Kraft retten
Wie Recherchen unseres „Krone“-Fotoreporters Christian Schulter ergaben, dürften sich die Passagiere aber noch aus eigenen Kräften an die Küste gerettet haben. Danach trafen zwar Löschboote der kroatischen Küstenwache ein. Doch zu spät. Denn mittlerweile brannte die Jacht bereits lichterloh.
Obwohl die Hilfskräfte die Flammen aus allen Rohren bekämpften, gab es keine Rettung mehr für das Luxusschiff. Vom elitären Kunststoffboot blieb nur ein im Wasser treibendes verkohltes Wrack. Danach allerdings machten unterschiedlichste Gerüchte wie Seemannsgarn die Runde: Von Alkohol an Bord, Betrunkenen und Unachtsamkeit des Kapitäns war die Rede.
Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung, und die Untersuchungen werden die tatsächlichen Hintergründe des Unglücks ans Tageslicht bringen. Zudem soll allen Österreichern vorerst die Ausreise verweigert worden sein, bis die Brandursache geklärt ist. Schreibt die KRONEN ZEITUNG.
Irgendwie scheint dem ehemaligen österreichischen Vizekanzler und ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, kurz «HC» genannt, das Pech an den Fersen zu kleben, wenn er sich zwecks Urlaub Richtung Weltmeere aufmacht.
Mal ist es eine russische Fake-Oligarchen-Nichte mit dreckigen Zehennägeln, die ihn am 24. Juli 2017 auf Ibiza in eine Falle lockt. Die «bsoffne Gschicht», wie HC sein konspiratives Treffen mit der Russin in einer Villa nannte, wurde auf dem inzwischen berühmt-berüchtigten «Ibiza-Video» festgehalten.
Am 17. Mai 2019 veröffentlichten die Süddeutsche Zeitung und DER SPIEGEL kompromittierende Ausschnitte aus diesem Video. Die skandalöse Affäre liess nicht lange auf sich warten und ging als «Ibizagate» in Österreichs Geschichte ein.
Bundeskanzler Kurz liess darauf nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander van der Bellen die Regierungskoalition zwischen ÖVP (Kurz) und FPÖ (Strache) platzen. Bis zu den Neuwahlen im September 2019 wurden die Regierungsgeschäfte in Österreich ab 30. Mai 2019 von einer Übergangsregierung ausgeübt.
HC Strache verlor nicht nur seine Ämter als Vizekanzler und Minister der Kurz-Regierung, sondern auch den Vorsitz als Bundesparteiobmann der FPÖ; ein Amt, das er seit 2005 äusserst erfolgreich bekleidete.
Wo und wann immer HC Strache Fettnäpfe oder verbrannte Jachten zurücklässt, folgen die Ereignisse stets einem Roten Faden. Entsprechende Gerüchte rund um Drogen und Alkohol lassen nicht lange auf sich warten.
Soll er sich auf Ibiza noch Red Bull-Getränken und weissem Nasenpulver, unter uns Junkies Kokain genannt, hingegeben haben, ist beim jetzigen Bootsbrand von Alkohol und betrunkenen Bootsgästen die Rede.
Auch wenn bei beiden Vorkommnissen für HC Strache die Unschuldsvermutung gilt, kratzen solche Gerüchte längst nicht mehr an seinem Image: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
27.6.2021 - Tag der neuen börsenkotierten Geschäftsmodelle
Corona liess mit Uber Eats und Co eine neue Klassengesellschaft entstehen: Die neuen Dienstboten
Mit der Pandemie kam ein Heer von billigen, nahezu rechtlosen Helfern zur Erledigung von Botengängen und anderer Mühsal des täglichen Lebens. Welche Jobs der «Gig economy» werden überleben? Und warum auch reguläre Berufe betroffen sind.
Mittagszeit in Zürich-Oerlikon. Michele (21) schiebt sein Velo in den Schatten. Er trägt Trainerhosen und einen sperrigen Rucksack mit Aufdruck, das Zunftzeichen seiner Truppe.
Zwei Stunden nach Beginn der Schicht hat er 20 Kilometer abgespult, ist brenzligen Situationen ausgewichen und hat 23 Franken verdient. Er wird von Uber Eats, seinem Boss, pro Auftrag bezahlt. Heute waren es zwei.
Gig Economy nennt sich dieses System. Ein Heer freier Mitarbeiter sucht auf Online-Plattformen nach Jobs. Nur für diese «Gigs» werden sie bezahlt. Gig (engl. für «Auftritt») tönt gut, flexibel und selbstbestimmt, nach grosser Bühne und Rolling Stones. Die Realität erinnert mehr an Uli den Knecht.
Wenig Rechte viele Pflichten
Die Regeln machen nicht die rechtlosen Billigarbeiter, die alle Risiken tragen, sondern die Vermittlungsplattformen. Regeln gibt es in der schönen neuen Arbeitswelt ohnehin nur wenige: Versicherung, Ferien, Kündigungsschutz, Arbeitszeit, AHV-Beiträge ... vieles bleibt unreguliert. Mit Absicht.
So musste Michele seine Versicherung selber abschliessen. Auch das Velo kaufte er. «Besser ich mache keinen Unfall», scherzt der Kurier, der noch für andere fährt. Die Arbeit sei streng, aber er will nicht klagen, immerhin sei der Job besser als Sozialhilfe.
Wer in einer Schweizer Stadt wohnt, hat den Eindruck, über Nacht hätte sich ein neuer Typ Arbeitnehmer exponentiell vermehrt: Velokuriere, Vespa-Boten und Paketlieferanten gehören nun überall zum Strassenbild. Seit der Pandemie boomt dieser Wirtschaftssektor. Er lebt davon, dass Herr und Frau Schweizer immer weniger Zeit haben. Mit dem Virus kam die Angst vor Ansteckung dazu.
Eine neue Bequemlichkeit hat sich breitgemacht. 80 Prozent der Bürolisten wollen auch nach der Krise zumindest teilweise im Homeoffice bleiben, zeigte eine Umfrage im Mai. Allein bei Essenslieferanten hat sich der Umsatz seit 2018 fast verdoppelt: 2020 waren es bereits 2,1 Milliarden Franken.
Dienstboten der oberen Klassen
Die einen ordern, die andern liefern. An der Türschwelle und im Treppenhaus zeigt sich die neue Klassengesellschaft unseres Jahrhunderts. Das Virus macht oben und unten wieder klarer sichtbar.
Die Beschäftigung der Gig-Arbeiter sei in der Regel prekär, erklärt der Sozialwissenschaftler Marko Kovic. Die Leute verdienten schlecht, Ausbeutung sei keine Seltenheit, wer sich ein Bein breche, müsse selber schauen, jedermann sei beliebig austauschbar.
Kovic hingegen findet, wer Vollzeit arbeite, solle davon würdig leben können. Nur sei das mit Gig-Arbeit nicht garantiert. «Man hängt sich 60 Stunden rein und hungert trotzden am Ende des Monats.»
Die neue Dienstleistungskultur ist gekommen, um zu bleiben. «Strom, Internet und auch die Gig Economy – manche Erfindung ist nicht rückgängig zu machen», sagt Karin Frick, Zukunftsforscherin am Gottlieb Duttweiler Institut.
Mittlerweile geht es um mehr als nur eine neue Botenklasse. Das Gig-Modell, das System der Schwarmarbeiter, lässt sich auf nahezu jede Arbeit anwenden. Anders gesagt: Es kann fast jeden treffen.
Die Entrechtung der Lohnnarbeiter
Rechtsprofessor Kurt Pärli von der Uni Basel hat über diesen Plattform-Kapitalismus ein Buch geschrieben. Dieses System könnte sehr weit gehen. Der Kellner würde damit künftig nicht mehr vom Restaurant angestellt, sondern bekäme die Gäste über eine digitale Plattform zugeteilt. Der Professor arbeitete nicht länger für die Uni, sondern die würde ihm Studenten über eine digitale Plattform vermitteln.
Viele solche Beschäftigte seien schon heute pseudoselbständig, die Arbeitgeberstellung werde verschleiert, sagt Pärli. So lassen sich Sozialabgaben und Steuern sparen. Pärli: «Am Ende ist es ein Untergraben von sozialstaatlichen Errungenschaften.»
Rentner Hansjürg Tschanz (92) aus Zürich möchte Tennis schauen, aber das Internet bockt. Darum schickte die Swisscom einen Techniker. Der heisst Elmar Netzer und steht nun in Tschanz’ Wohnung. Der Clou an diesem Arrangement: Der Swisscom-Mann ist kein Swisscom-Mann, sondern ein Gig-Arbeiter.
Elmar Netzer, Hausmann und als IT-Berater selbständig im Nebenerwerb tätig, nimmt drei bis fünf solche Aufträge pro Woche an. Sie kommen von der Firma Mila, die bis 2020 im Besitz der Swisscom war, eine «Plattform für Nachbarschaftshilfe» betreibt und Techniker zu Kunden schickt. Um Sozialabgaben und Unfallversicherung kümmert sich Netzer selbst.
Der Algorithmus gibt den eingehenden Auftrag an jenen seiner Techniker, der die beste Kundenbewertung hat. Ist der Fachmann damit nicht der Launen seiner Kundschaft ausgeliefert? Am Ende muss der Büezer auch noch Kaffee servieren, damit die Bewertung stimmt
Netzer widerspricht. «Mit dem System werden die belohnt, die die Arbeit richtig machen», findet er. Sein 45 Minuten-Tarif liegt bei 84 Franken. Nach einer Viertelstunde läuft das Tennismatch wieder störungsfrei.
Sogar die Migros macht mit
Mittlerweile experimentieren also bereits Staatsbetriebe mit dem Versuchsballon Gig Economy. Diese Woche wurde auch bekannt, dass die Migros ihre umstrittene Kooperation mit der Gig-Lieferfirma Smood ausbaut. Zukunftsforscherin Frick befürchtet, dass dies in der Tendenz dazu führt, dass Festanstellungen mitsamt den damit verbundenen Errungenschaften wie Sozialleistungen oder unbefristeter Beschäftigung allmählich verschwinden.
Ihre Vision: Firmen suchen sich Projektteams auf der ganzen Welt zusammen. Lohn bekommt nur, wer gerade gebraucht wird. Je weniger qualifiziert man ist, je mehr andere die Leistung anbieten, umso schlechter die Bezahlung.
Höchstens 20 Prozent seien Spezialisten oder Koryphäen, schätzt die Zukunftsforscherin. Die seien auch international gefragt. Sie haben die Auswahl und können die bestbezahlten Gigs annehmen. Der Rest müsse wohl oder übel die Bedingungen akzeptieren, die gerade angeboten werden.
«Das ist das Obszöne am Ganzen», sagt Sozialwissenschaftler Kovic. Je mehr Leute auf einer Plattform seien, desto besser werde die Dienstleistung – desto mehr konkurrenzieren sie sich aber auch, und die Einkommen brächen ein.
Der Wandel der Arbeitswelt geschieht nicht in einer fernen Zukunft, er ereignet sich gerade jetzt. Manche sprechen bereits vom Beginn eines neuen Zeitalters.
Pandemie als Beschleuniger
Trendforscherin Frick sieht Parallelen zur Ära kurz vor der industriellen Revolution. Die Pandemie sei ein Beschleuniger gewesen, weil da klar geworden sei, wie viel von daheim erledigt werden könne. Der Arzt, der auf dem Bildschirm des Kranken erscheint, sitzt in Deutschland. Der Baggerführer, der die Baumaschine steuert, in Italien. Gewisse Berufe schienen gerade so zukunftssicher wie früher jener der Rohrpostbeamtin.
Das System der sozialen Sicherung, darunter auch die AHV, droht durch die neuen Formen der Beschäftigung wegzubrechen. Die Sorge: Am Ende der digitalen Revolution verarmt der Mittelstand.
Die Gig Economy lebe davon, dass es ein Überangebot an Arbeitskräften gebe und die Leute sich nicht zu Interessengruppen zusammenschliessen, sagt Karin Frick. Die Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, werde wieder wichtiger.
Noch ist Gig-Arbeit hierzulande die Ausnahme, für viele ist sie eine Gelegenheit zum Nebenverdienst. Gemäss einer Studie der Gewerkschaft Syndicom hat ein Drittel der Schweizer aber schon einmal nach Arbeit auf einer solchen OnlinePlattform gesucht. Das war vor der Pandemie.
Die Politik muss reagieren
Der Anteil solcher Jobs liegt im einstelligen Prozentbereich, könne aber «jederzeit exponentiell wachsen», so Kovic: «Wir stehen am Scheideweg. Die Politik müsste reagieren.»
Das tut sie. Nur anders, als gut wäre. Liberale Politiker wollen für die Gig Economy neue Gesetze und einen neuen Rang. Büezer wären darin weder selbständig noch abhängig, sondern irgendwas dazwischen. Die Gewerkschaften laufen dagegen Sturm.
Rechtsprofessor Kurt Pärli hält solche Ideen aus Bern für «eine unnötige Verkomplizierung». Es habe keinen Sinn, noch mehr prekäre Arbeitsverhältnisse zuzulassen. Systeme wie den Stundenlohn gebe es schon; sie müssten auch durchgesetzt werden. Pärli: «Wenn ein Unternehmen hier wirtschaftet, muss es sich an Schweizer Recht halten.»
Korrigiert der Markt zumindest die allerschlimmsten Auswüchse von selbst? Der britische Lieferdienst Deliveroo wollte im Frühjahr an die Börse. In letzter Minute drückten die grossen Investoren den Aktienpreis des Börsengangs. Der Grund: Sie waren wegen der prekären Arbeitsbedingungen der Fahrer dann doch skeptisch.
«Irgendwie wird alles entmenschlicht.»
In Zürich-Oerlikon trifft Velokurier Michele auf die Konkurrenz. Die heisst Katrin (27), trägt eine orangefarbene Montur und ist angehende Akademikerin. Ihre Situation zeigt, wie’s auch gehen könnte: Sie ist bei eat.ch angestellt, versichert, wird pro Stunde bezahlt, sogar für die Wartezeit. «Doch, der Job macht eigentlich Spass!», sagt sie.
Nur das Verhältnis zwischen Kunden und Dienstleistern verändere sich gerade. Die Leute wüssten nicht mehr, wo die Dinge herkommen: «Irgendwie wird alles entmenschlicht.»
Aber jetzt muss sie los. Die Glace schmilzt. Schreibt SonntagsBlick.
Es ehrt ja die Boulevard-Zeitung von der Zürcher Dufourstrasse, sich die neuen Klassengesellschaften der Schweiz vorzuknöpfen. Doch nun auch noch die prekären Arbeitsverhältnisse dem Corona-Virus in die Schuhe zu schieben ist nicht nur falsch, sondern verkennt auch die lange Entwicklungsgeschichte dieser Tragödie auf den Arbeitsmärkten der globalisierten Welt. Die Corona-Pandemie hat lediglich die hemmungslose Entfaltung dieser menschenverachtenden Gewinnmaximierung zum Wohl von börsenkotierten Unternehmen beschleunigt.
Das angeprangerte US-Unternehmen «Uber Eats» ist eine Online-Plattform für die Bestellung und Lieferung von Lebensmitteln, die 2014 von der Uber-Dachgesellschaft aus Kalifornien ins Leben gerufen wurde, die bereits weltweit – auch in der Schweiz – Taxifahrer als selbständige «Partner»-Fahrer über die Uber-Plattform vermittelt.
Uber sträubt sich vehement dagegen, als Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, auch wenn erste Schweizer Gerichtsurteile genau dies bestätigen. https://www.srf.ch/news/schweiz/plattform-oekonomie-modell-uber-in-der-schweiz-vor-dem-aus Laut der Gewerkschaft UNIA wären die Kantone in der Pflicht, als gesetzliche Arbeitsmarktaufsicht Uber endlich zu zwingen, ihre Arbeitgeberpflichten wahrzunehmen. Doch ausser Genf hat bis jetzt kein einziger Kanton gehandelt.
Wenn man die einzelnen Kantonsregierungen nach ihrer Parteizugehörigkeit unter die Lupe nimmt, wundert sich niemand. Das «bürgerliche» Parteienspektrum aus FDP, Mitte, Grünliberalen und SVP dominiert die meisten Kantonsparlamente. Und wo die SP mit einem lächerlichen Sitz «mitregieren» darf, versagt sie kläglich und toleriert die abartig neoliberalen Auswüchse, die niemandem mehr schadet als der ehemals ureigenen SP-Klientel der Arbeitnehmenden.
Dass diese prekären Arbeitsverhältnisse langfristig ein unglaubliches Sprengpotenzial als Spaltpilz der Gesellschaft besitzen, scheint die Neoliberalen rund um den Erdball kaum zu kümmern. Noch können sie sich auf die die «dummen Lämmer, die ihren Metzger selber wählen» indem sie eben nicht wählen, verlassen.
Dass ausgerechnet die USA als «Erfinderin» dieser üblen, börsenkotierten Geschäftsmodelle der totalen Ausbeutung die Spaltung der Gesellschaft nun im eigenen Land erlebt, sollte uns allen eine Warnung sein. Populisten wie Trump und zu allem entschlossene Wutbürger, die das US-Kapitol stürmen, sind nicht vom Himmel gefallen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
26.6.2019 - Tag des Indikativs
Sogar Lieblingskind Ivanka wendet sich immer mehr vom Vater ab: Trump bald allein zu Haus?
Trumps ewiges Geklöne über gestohlene Wahlen geht selbst Tochter Ivanka auf die Nerven. Sie und ihr Mann Jared Kushner werden immer weniger oft beim ehemaligen US-Präsidenten gesehen.
Ivanka Trump (39) und ihr Mann Jared Kushner (40) scheinen sich immer mehr von Donald Trump (75) abzuwenden. Das berichtet der Nachrichtensender CNN, der sich auf Aussagen von zwölf ehemaligen Funktionären des Weissen Hauses beruft.
Laut ihnen sollen Trumps nie enden wollende Schimpftiraden über die «gestohlenen Wahlen» seiner Tochter und seinem Schwiegersohn auf die Nerven gehen. Die Kluft zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten und den beiden werde von Woche zu Woche grösser.
Trumps Lieblingskind Ivanka und Jared Kushner seien in den vergangenen Monaten nur selten bei Trump gesehen worden. Ein Freund der Familie berichtet gegenüber CNN: «Zu den üblichen Frühlings- und Sommerveranstaltungen in Mar-a-Lago waren sie nicht da.»
Kushner will auspacken
Nebst den Schimpftiraden sei auch die wachsende Kritik Trumps an seinem Schwiegersohn ein Grund für den Rückzug. Kushner war Trumps Berater und schreibt nun ein Buch, in dem er über alles, was im Weissen Haus hinter verschlossenen Türen passiert ist, berichten will.
Weiter heisst es, dass die beiden schon seit längerem ein weniger kompliziertes Leben führen möchten. So herrscht auf Ivankas Social-Media-Kanälen grosse Stille.
«Nach vier Jahren Dienst und ausgedehnten Reisen im Land nimmt sich Ivanka Zeit mit Familie und Freunden», sagte ihre ehemalige Stabschefin Julie Radford gegenüber CNN. «Sie konzentriert sich auf ihre Kinder und verbringt Zeit mit ihnen, Punkt», wird ein Bekannter ihres Ehemanns Jared Kushners zitiert.
Im Spielfilm «Kevin – Home Alone 2: Lost in New York» von 1992 spielte Donald Trump eine kleine Nebenrolle. Nachdem sich immer mehr Leute von ihm abwenden, wird er nun zum Hauptdarsteller einer wahren Geschichte, die man mit «Trump Home Alone» betiteln könnte. Schreibt Blick.
Nie war The Donald für die Medien wertvoller als in den «Sommerlöchern». Auf ihn war Verlass. Während den vier Jahren als Präsident der USA rockte er mit jeweils maximal 280 Unicode-Zeichen über Twitter tagtäglich die Welt.
Im Schnitt waren es sieben Tweets pro Tag. Nebst banaler Selbstbeweihräucherung – ausschliesslich formuliert mit den maximalst möglichen Superlativen – hinterliess Trump auch unvergessene Wortschöpfungen wie die kryptische Buchstabenkombination «Covfefe», die bis heute nicht entschlüsselt worden ist.
Der Tweet wurde nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung im Mai 2017 gelöscht und trotz vieler bis heute andauernden Spekulationen war es nichts anderes als ein klarer Tippfehler.
Der damalige Pressesprecher des Weissen Hauses, Sean Spicer, verteidigte jedoch Trump und behauptete, sein Boss habe das Wort absichtlich geschrieben. «Ich denke, der Präsident und eine kleine Gruppe von Leuten wissen genau, was er meinte», sagte er der Presse, die sich nach der bizarren Botschaft bei ihm erkundigte. Eigentlich eine absolut einleuchtende Erklärung von Sean Spicer. Ein Genie wie Donald Trump kann sich gar nicht vertippen.
Doch die üppig sprudelnde Quelle des Entertainers Donald Trump ist versiegt, seit ihm Twitter den Account gesperrt und gelöscht hat. Spielt aber im Sommerloch keine Rolle. The Donald ist wieder da. Wenn auch nur im Konjunktiv.
Dann können wir ja auch gleich mal das ungelöste Rätsel von «Covfefe» lösen. Aber im Indikativ!
Wörtlich schrieb Trump damals in seinem Tweet: «Despite the constant negative press covfefe», was auf Deutsch nichts anderes heisst als «Trotz der dauerhaften negativen Presse covfefe». Covfefe ergibt in keiner der beiden Sprachen einen Sinn. Coverage hingegen schon: «Despite the constant negative press coverage»: «Trotz der ständig negativen Presseberichterstattung».
Et voila! Life can be so simply. Es war Donalds etwas zu dicker Fastfinger.
Auf Twitter lassen sich einmal abgesendete Tweets bekanntlich nicht mehr editieren. Es war also nicht möglich, den Fehler auszubessern. Covfefe aber hatte sich bereits wie ein Lauffeuer verbreitet und wurde vom POTUS ja nicht umsonst gelöscht.
In den Weiten des Internets wird aber bis heute immer noch über die Bedeutung des Wortes diskutiert. Bis hin zur Behauptung, es könnte sich um die geheimen Launch-Codes für die US-Nuklearwaffen handeln.
Was lernen wir daraus? Gegen den Konjunktiv ist der Indikativ machtlos. Weil nicht sein kann, was ist. Schon gar nicht mitten im medialen Sommerloch.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.6.2021 - Tag der Doppelmoral
Niederländischer Regierungschef: «Ungarn hat in der EU nichts mehr zu suchen»
Der Druck auf Ungarn wegen des umstrittenen Anti-LGBTQ-Gesetzes wächst. Der niederländische Regierungschef Rutte äußerte scharfe Kritik und will am liebsten eine EU ohne Ungarn, aber: «Ich kann sie nicht rausdrängen.»
Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat Ungarn wegen des jüngst verabschiedeten Homosexuellen-Gesetzes scharf kritisiert. «Meiner Meinung nach haben sie in der Europäischen Union nichts mehr zu suchen», sagte Rutte beim EU-Gipfel in Brüssel.
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hatte sich bei dem Gipfel geweigert, das umstrittene LGBTQ-Gesetz zurückzuziehen. Es wurde am Donnerstag in Kraft gesetzt und sieht die Beschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität vor. Offizielles Ziel ist der Schutz von Minderjährigen.
Anders als von Rutte suggeriert, gibt es aber kein Verfahren, um einen Mitgliedstaat aus der EU zu werfen. Nur aus eigenem Antrieb kann ein Land austreten.
Gegen Ungarn läuft aber wegen rechtsstaatlicher Defizite wie der Einschränkung der Unabhängigkeit der Justiz und Presse- und Meinungsfreiheit bereits ein Strafverfahren, das bis zum Entzug der Stimmrechte auf EU-Ebene führen kann. Bisher gab es für diesen Schritt keine ausreichenden Mehrheiten unter den Mitgliedstaaten.
«Ich kann sie nicht rausdrängen», sagte Rutte. Die EU müsse im Falle Ungarns Schritt für Schritt vorgehen. Orbán müsse klar werden, dass die EU «eine Gemeinschaft von Werten» sei. «Wir wollen Ungarn in die Knie zwingen.» Schreibt DER SPIEGEL.
Ob der ungarische Regierungschef Viktor Orbán homophob veranlagt ist, wie ihm die systemstreuen Medien der westlichen «Wertegemeinschaft» unterstellen, sei dahingestellt. Gegen den unappetitlichen ungarischen EU-Abgeordneten József Szájer von der Fidesz-Partei hatte der Parteivorsitzende Orbán jedenfalls nichts auszusetzen: Ausgerechnet der homosexuelle Bartli Szájer führte für Viktor Orbán in Brüssel den Kampf gegen angebliche LGBTQ-Zumutungen der EU.
Dumm nur, dass ausgerechnet dieser József Szájer nach einer illegalen Schwulen-Feier mit anschliessender Flucht vor den belgischen Polizeibeamten über Brüssels Dächer festgenommen wurde – zu allem Übel noch mit «Ecstasy»-Partydrogen im Rucksack. Szájer trat im Dezember 2020 von seinem Amt als EU-Abgeordneter zurück.
Naiv ist Viktor Orbán auf jeden Fall, sollte er tatsächlich an die Wirkung dieses dämlichen Gesetzes glauben. Das ungarische LGBTQ-Gesetz wird Ungarns Minderjährige nicht vor Informationen über Homo- und Transsexualität schützen. Auch ungarische Kids (mit einer Handydichte von 86 Prozent laut Statista im Jahr 2020) können sich über ihre Smartphones jederzeit genügend Informationen über internationale Kanäle beschaffen. Die Macht des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, sämtliche missliebigen Internetportale im eigenen Land abzuschalten, hat Orbán definitiv nicht.
Die vollmundigen Worte des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte sind zwar markig und tönen gut. Sie decken aber einmal mehr die ganze Verlogenheit und Heuchelei dieser «Wertegemeinschaft» des Westens auf. Wer Orbán Homophobie vorwirft und Ungarn deshalb aus der EU werfen möchte, müsste sofort jede Zusammenarbeit mit Saudi Arabien einstellen. Um nur einen dieser Unrechtsstaaten zu nennen, mit den die EU lukrative Geschäftsbeziehungen pflegt.
In Saudi-Arabien sind homosexuelle Handlungen strafbar und im Höchstmass mit der Todesstrafe bedroht. Die Gerichte verhängen auch Peitschenhiebe und Gefängnisstrafen von unterschiedlicher Dauer. Ende 2007 wurden zwei Männer wegen homosexuellen Geschlechtsverkehrs zu jeweils 7'000 Peitschenhieben verurteilt. Lesbischen Frauen droht die Steinigung.
Diese Doppelmoral um angebliche Werte macht die ganze Diskussion rund um Orbán und das ungarische LGBTQ-Gesetz wie so viele andere Sommerloch-Diskussionen zur lächerlichen Farce. Sieger gibt es keine. Verlierer jedoch viele.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.6.2021 - Tag des Sensenmannes
Toter fährt 6 Stunden im Tram durch Zürich und keiner merkts
Der 64-jährige P. starb am Montag in einem Zürcher Tram. Wie sein Sohn D. sagt, fuhr sein Vater danach stundenlang leblos im Tram mit.
Die Geschwister D.* und J.* (* Name der Redaktion bekannt) trauern um ihren Vater P.* Der 64-Jährige starb am Montag auf dem Weg zur Arbeit. Laut D. war sein Vater um 6.21 Uhr in das Tram der Linie 2 bei der Haltestelle Micafil in Zürich-Altstetten gestiegen. Rund 30 Minuten später hätte er beim Paradeplatz aussteigen sollen. Doch dazu kommt es nicht: «Mein Vater erlitt im Tram einen Herzstillstand», sagt D. Besonders schockierend für den 40-Jährigen. «Weder dem Tramchauffeur noch den anderen Passagieren fiel etwas auf. Mein Vater fuhr stundenlang leblos im Tram mit.»
Erst nach rund sechs Stunden sei einer Passagierin bei der Tramhaltestelle Tiefenbrunnen aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. «Sie informierte den Tramchauffeur und er schliesslich den Notruf», so D. Doch für P. kommt jede Hilfe zu spät: «Mein Vater war schon seit Stunden tot. Videoaufnahmen der VBZ zeigen, dass er bereits kurz vor der Tramhaltestelle Lochergut eingesackt war und regungslos sitzen blieb.»
D. versteht nicht, warum niemand reagierte: «Die Ignoranz der Leute macht mich fassungslos und traurig.» Wie er sagt, will er zusammen mit seiner Schwester auf die Problematik aufmerksam machen: «Zivilcourage ist leider nicht mehr alltäglich. Die Leute sind heutzutage zu sehr auf sich konzentriert und nehmen ihre Umwelt gar nicht mehr wahr.»
«Heutzutage fehlt es an Zivilcourage»
Melanie Wegel ist Dozentin am Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und gibt Kurse zum Thema Zivilcourage. Für Wegel ist das Geschehene ein tragischer Einzelfall: «Sechs Stunden ist eine sehr lange Zeit. Mir ist kein ähnlicher Fall bekannt.» Wegel sagt aber auch: «Vielen Menschen fehlt es heutzutage an Zivilcourage. Die Leute glauben, sie müssten nicht helfen und ein anderer wird sich schon drum kümmern.»
Sie wünscht sich mehr Achtsamkeit von ihren Mitmenschen. «Jeder Einzelne ist aufgefordert, zu helfen.» Sich selbst in Gefahr bringen sollte man aber nicht. «Hier gilt es, Hilfe zu organisieren. Entweder man spricht Personen um sich herum direkt an und fordert sie zum Handeln auf. Oder man alarmiert die Polizei.»
Bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) wie auch bei der Stadtpolizei Zürich hat man Kenntnis von dem Vorfall. «Die VBZ haben entsprechend unverzüglich Sanität und Polizei aufgeboten», sagt Sprecherin Daniela Tobler. Wie es bei der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage heisst, kann eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden. Schreibt 20Minuten.
Frau Wegel von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften scheint keine passionierte Tramfahrerin zu sein. Wer immer in den Schweizer Städten die öffentlichen Verkehrsangebote nutzt, trifft regelmässig auf scheinbar schlafende oder dahindösende Personen in Bus, Tram und Bahn. Es spricht eigentlich eher für noble Zurückhaltung der mitfahrenden Passagiere als für fehlende Zivilcourage, diese Personen nicht anzusprechen.
Vielleicht ist es auch Selbstschutz vor unangenehmen und gefährlichen Situationen. Wer weiss denn schon, aus welchen Gründen sich jemand im ÖV einem Nickerchen hingibt? Der Ursachen gibt es unendlich viele: Alkohol, Drogen, Übermüdung, psychische Störungen usw., die in Zeiten der Maskenpflicht im ÖV unmöglich visuell eruiert werden können. Da kann eine nette und fürsorgliche Intervention seitens mitfahrender Passagiere sehr schnell als Provokation missverstanden werden und entsprechende Reaktionen bis hin zu riskanten Situationen wie Schlägereien und Messerstechereien auslösen.
Der Tod eines Familienmitglieds verursacht immer Schmerz und Trauer. In diesem Fall kommt noch die Betroffenheit über den ungewöhnlichen Tod in einem Zürcher Tram hinzu. Dies ist zu respektieren.
Setzt das Schicksal den Hobel an, spielt es aber eigentlich keine Rolle, wo wir sterben. Dass Menschen bei einem schwerwiegenden körperlichen Organversagen ohne Vorankündigung im Auto, Bus, Tram, Zug, Flugzeug oder auf einem Kreuzfahrtschiff dem irdischen Dasein entschlafen, gehört zu einer mobilen Gesellschaft. Der Sensenmann kümmert sich nicht um Google Earth. Er mäht wo immer er mähen muss. Überall und zu jeder Zeit. Selbst auf den höchsten Berggipfeln bei einer Kletter- oder Wandertour.
Wir alle wissen, dass wir geboren werden um zu sterben. Niemand ist davon ausgenommen und kein Mensch kennt den genauen Zeitpunkt und die Örtlichkeit dieser Transformation vom lebenden Wesen zurück zum Sternenstaub oder zu was auch immer die Religionen den Leichtgläubigen versprechen. Ist dieser natürlich bedingte Zyklus nicht die grösste Gerechtigkeit der Natur, die sie ausnahmslos allen Lebenswesen der Erde zukommen lässt? Treffend besungen im Liedtext von «Där Schacher Seppli» vom unvergessenen Ruedi Rymann. Oder im «Hobellied» von Ludwig Hirsch.
Ein plötzlicher und schneller Tod ohne jede Vorankündigung und ohne Leiden, verursacht durch ein Organversagen, birgt auch tröstliche Momente in sich. Bevor jetzt die «Zynismus»-Keule geschwungen wird: Wer je erlebt hat, wie einem nahestehende Menschen mit einer schwerwiegenden Erkrankung dank Hightechmedizin und einer überbordenden Gesundheitsindustrie «künstlich» am Leben erhalten wurden, weiss wovon hier die Rede ist. Dies nicht selten trotz Patientenverfügung, die in der Praxis in der Anwendung immer wieder auf Schwierigkeiten trifft.
Wir sollten endlich den Mut aufbringen, das menschliche Leben in all seinen Facetten zu akzeptieren. Eine dieser Facetten ist der Tod, ohne den kein Leben stattfindet. Seitdem wir ins Universum blicken können, sollte uns bewusst sein, dass es DIE Ewigkeit ausserhalb von abstrakten Religions- und Philosophiethesen nicht gibt.
Inzwischen beobachten wir Sterne, ja sogar Galaxien, wie sie ihrem Ende zustreben und explodieren. Doch auch der «Tod» von Sternen und Galaxien hat eine tröstliche Seite. Aus dem Explosionsmüll entstehen neue Sterne und Galaxien.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.6.2021 - Tag des Fachkräftemangels
Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz: «Unsere Wirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften»
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung warnt vor einem Mangel an Fachkräfte-Zuwanderung aus der EU. Schon jetzt fehlten deutschen Unternehmen 270.000 qualifizierte Frauen und Männer.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, hat vor einem Mangel an Fachkräfte-Zuwanderung aus der Europäischen Union nach Deutschland gewarnt. »Unsere Wirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften«, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Schon jetzt fehlten deutschen Unternehmen 270.000 qualifizierte Frauen und Männer. »Gleichzeitig ist die Zahl von zusätzlichen Fach- und Arbeitskräften aus der EU in Deutschland im letzten Jahr um rund 25 Prozent eingebrochen«, sagte sie. Der Verlust von Arbeitskräften aus der EU schwäche die deutsche Wirtschaft erheblich.
Dank der EU-Zuwanderung sei die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren um 0,2 zusätzliche Prozentpunkte pro Jahr gewachsen, sagte Widmann-Mauz. Gerade in der Pflege, auf dem Bau oder in der Lebensmittelindustrie sei Deutschland auf Arbeitskräfte aus Europa angewiesen. Deshalb müsse für faire Arbeitsbedingungen und einen Schutz vor Gesundheitsrisiken für europäische Arbeitskräfte gesorgt werden.
Laut dem KfW-ifo-Fachkräftebarometer sahen sich im April 23,7 Prozent aller Firmen durch Fachkräftemangel beeinträchtigt. Der Fachkräftemangel erreichte somit zwar noch nicht den Stand vor der Coronapandemie, der Trend zeigte aber steil nach oben. Schreibt DER SPIEGEL.
Zu diesem SPIEGEL-Artikel vorab ein paar irritierende Zahlen der deutschen «Bundesagentur für Arbeit»: Im Mai 2021 waren offiziell 2'687'000 Personen arbeitslos; inoffiziell dürften es einige Hunderttausend mehr sein. Ausgesteuerte und in Kursen- und Beschäftigungsprogrammen stehende Arbeitslose werden bei der Bundesagentur für Arbeit nicht mitgezählt. Ausserdem wurden 2,61 Millionen Arbeitnehmern*innen Kurzarbeitergeld bezahlt und 6,9 Millionen Menschen in Deutschland fristeten im Wonnemonat Mai ihr Dasein als geringfügig entlohnte Beschäftigte. So die offiziellen Zahlen.
Erstaunlich ist, dass im Kern beinahe gleichlautende Artikel in Grossbritannien, Österreich, der Schweiz und vermutlich noch in etlichen anderen europäischen Ländern mitten im medialen Sommerloch fast zeitgleich erscheinen. Ein Adjektiv schmückt ohne Ausnahme jeden dieser von Agenturen gesteuerten Medienbeiträge: Die Fachkräfte werden «händeringend» gesucht. Ebenfalls synchron quer durch alle Länder folgt die Berichterstattung den immergleichen Jammerbranchen, die da wären: Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Pflege und Bau.
Dass das Vereinigte Königreich trotz (saisonbereinigt) rund 1,6 Millionen derzeit offiziell gemeldeten Arbeitslosen «händeringend» Fachkräfte sucht, ist ja irgendwie noch verständlich. Nach dem Brexit fehlen nun die billigen Arbeitskräfte aus Europa, vor allem aus Osteuropa, die unter prekären Arbeitsverhältnissen und Tiefstlöhnen jenseits von Gut und Böse die vorgenannten vier Branchen zum Wohle der Gewinnmaximierung und Dividendenausschüttung brummen liessen. Tiefstlöhne, für die kaum ein Brite frühmorgens aus dem Bett steigt.
Das genau Gleiche mit Ausnahme des Brexit gilt auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die exakten Berufsbezeichnungen werden mit dem Überbegriff «Fachkräfte» abenudelt, damit ja niemand an der Tragödie des «Fachkräftemangels» trotz irritierend hohen Arbeitslosenzahlen zweifelt.
Dabei müsste man sich schon langsam fragen, welche aussergewöhnlichen Qualifikationen für diese «Fachkräfte» verlangt werden, die eine Rekrutierung aus dem Heer der Arbeitslosen verunmöglicht? Matura, Universitätsausbildung und akademische Titel werden ja wohl kaum von Bedeutung sein für ehrbare, aber nicht akademische Jobs wie Serviertöchter und Kellner, Kassenmitarbeiter*innen bei Migros, Coop & Co., Pflegerinnen und Pflegern sowie Bauarbeitern.
Weil dem definitiv nicht so ist, stellt sich gleich die nächste Frage. Warum agieren die staatlichen Organisationen, wie beispielsweise die RAV (Regionale Arbeitsvermittlung) in der Schweiz auf die angebliche Misere nicht mit gezielten Kursen und Programmen, um Arbeitslose wieder in würdige «Brot und Arbeit» bringen? Exel-Kurse und die jahrelang praktizierten Gabelstaplerfahrkurse sind zwar gut gemeint und schaden niemandem, dürften aber dennoch die falschen Mittel sein.
Was sagt das uns? Der seit Jahren immer wieder selbst in der Zeit der Corona-Pandemie vorgegaukelte Fachkräftemangel liegt einzig und allein in der Problematik des Niedriglohnsektors. Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnbereich werden ja nicht umsonst «prekäre Arbeitsverhältnisse» genannt.
Doch wie kommt es, dass zeitgleich in den westlichen Industrienationen eine angebliche Problematik mit den gleichen Keulen-Adjektiven medial hochgejazzt wird? Am Sommerloch liegt es für einmal nicht.
Dafür aber bei mächtigen, untereinander perfekt bis tief in die Politik hinein vernetzten Think Tanks, Organisationen und Verbänden, die genau wissen, wie Lobbyismus funktioniert und daherzukommen hat, um in Politik und Gesellschaft seine Wirkung zu entfachen.
Eine Dokumentation von Tom Costello mit dem Titel «Wie der harte Brexit die Reichen noch reicher machen soll» zeigt exemplarisch auf erschreckende Art, welche geballte Macht diese Interessenvertreter länderübergreifend auszuüben vermögen. https://www.youtube.com/watch?v=bmoy5MKoL9g
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.6.2021 - Tag von Apple
Apple an Ermittler: Datenbestand zu Blümel-Accounts vorhanden
WKStA stellte Rechtshilfeersuchen an US-Justiz: Chat- und andere Daten seien für eine Aufklärung "alternativlos". Bei den Ermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) setzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf Hilfe aus den USA. Über das Justizministerium soll ein Rechtshilfeersuchen an die US-Justiz übermittelt werden und von dort an Apple gehen. Der IT-Konzern meldete bereits zurück, dass für die ÖVP-E-Mail-Adresse des Finanzministers sowie für dessen Handynummer Daten "konserviert" worden seien.
Laut WKStA sei die Übermittlung der Daten essenziell, weil die in der Causa Beschuldigten "überwiegend mittels Mobiltelefonen (Chats etc.) oder per E-Mail" kommuniziert hätten. Blümel hatte im U-Ausschuss angegeben, dass er seine Nachrichten "regelmäßig löscht". Allerdings wurden bei einer ersten Auswertung seines Smartphones auch spendenrelevante Kommunikationen aus dem Jahr 2019 gefunden, wie "Profil" im März berichtet hatte.
"Bräuchte einen kurzen Termin"
Blümels Smartphone war im Zuge einer Hausdurchsuchung in seiner Privatwohnung im Februar 2021 sichergestellt worden. Ermittler hielten in einem Anlassbericht einige Dinge fest: So sei Blümels Lebensgefährtin, die er vorab über die eintreffenden Beamten informieren durfte, mit dem gemeinsam benutzten Laptop außer Haus gegangen. Außerdem fand man Ladekabel, die zu keinen der sichergestellten Geräte passten.
Anlass für die Hausdurchsuchung war ein "Zufallsfund" auf dem Smartphone des einstigen Novomatic-Chefs Harald Neumann. Dieser hatte den damaligen nicht amtsführenden Wiener Stadtrat Blümel im Juli 2017 gebeten, ihm einen Termin beim damaligen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zu verschaffen. "Bräuchte einen kurzen Termin bei Kurz (erstens wegen Spende und zweitens bezüglich eines Problemes das wir in Italien haben!", schrieb Neumann.
Die WKStA sieht hier den Verdacht auf Bestechung: Es sei "lebensnah", dass Blümel seinem Vertrauten Kurz von dem Angebot erzählt habe, daher sei er verdächtigt, das mutmaßliche Bestechungsangebot weitergetragen zu haben. In ihrer Begründung für die Sicherstellung von Blümels Accounts wird die WKStA noch deutlicher: "Die Sicherstellungsanordnung steht im Lichte des nach der Verdachtslage gravierenden Tatverdachts der Bestechung eines der höchsten Beamten der Republik."
Bislang keine Geldflüsse gefunden
Blümel und Neumann bestreiten die Vorwürfe beide, es gilt die Unschuldsvermutung. Die ÖVP und Blümel geben an, in den vergangenen Jahren keine Spenden aus der Glücksspielbranche angenommen zu haben; Neumanns Anwalt sprach von einer "karitativen Spende", die in keinem Zusammenhang zur Hilfe beim "Problem in Italien" gestanden habe. Novomatic kämpfte damals gegen eine Steuerrückzahlung im südlichen Nachbarland.
Die WKStA schreibt, dass das "Spendenangebot von Mag. Neumann nicht von ihm als Privatperson unterbreitet wurde", da er "das Angebot mit einem Problem des Novomatic-Konzerns (...) verknüpfte". Außerdem gebe es in den Chats keine Hinweise, dass ÖVP-Politiker "private monetäre Zuwendungen" von Neumann erhalten hätten. Allerdings konnten bislang auch keine Geldflüsse von Novomatic an die ÖVP festgestellt werden. Unterstützung gab es für politiknahe Vereine, zum Beispiel für das von Wolfgang Sobotka gegründete Alois-Mock-Institut sowie das Institut für Sicherheitspolitik aus dem Umfeld der FPÖ. Schreibt DER STANDARD.
Die österreichische Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz steht seit einiger Zeit wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. Ausgelöst durch den sogenannten «Ibiza»-Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament.
Doch statt Licht ins Dunkle über das unrühmliche «Ibiza»-Video und den ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Obmann HC Strache zu bringen, das die damalige Regierungskoalition ÖVP-FPÖ zu Fall brachte und Neuwahlen hervorrief, förderte der Ausschuss unappetitliche Korruptions- und Bestechungsvorwürfe zu Tage, in die nebst Finanzminister Blümel auch Kanzler Kurz verwickelt sein sollen.
Die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA bekam Zugriff auf die WhatsApp-Chats von Blümel, Kurz und dem Chef der österreichischen Staatsholding ÖBAG und Kurz-Vertrauten, Thomas Schmid, der im Juni 2021 von seinem Posten mit sofortiger Wirkung zurücktrat.
Im Chatverlauf von Schmid fanden sich nebst anrüchigen Details über die Schützenhilfe von Kurz und Blümel bezüglich seiner Wahl zum obersten Chef der ÖBAG unter Mithilfe der beiden Politiker 2'500 (in Worten: Zweitausendfünfhundert) Penisbilder.Dass Schmid in seinen Chats auch noch Hinweise auf einen allfälligen Drogenkonsum lieferte, ging unter der schieren Wucht der Bilder unter. Was ist schon eine Koksnase gegen 2'500 Penisbilder?
Die schlüpfrigen Bilder führten anschliessend zum «Beidl»-Skandal (österreichisch für «Bilder-Skandal) und logischerweise zu üblen Verdächtigungen hinsichtlich «schwulen Polit-Seilschaften» in den Social-Media-Portalen. https://www.fuchsbriefe.de/.../europa/schwule-seilschaften
Doch wer dachte, damit sei die doch etwas unappetitliche Geschichte über digitale Vernetzung, anrüchige Seilschaften, Begünstigung, Korruption und seichte Penisbilder abgehakt, irrte sich gewaltig.
Die WKStA führte bei Minister Blümel eine Hausdurchsuchung durch, deren genauer Zeitpunkt ihm allerdings noch rechtzeitig von einem Staatsbeamten zugeflüstert worden war.
So fand der Minister genügend Zeit, seine Frau samt Kind und Apple-Laptop im Kinderwagen bei klirrender Kälte auf einen Spaziergang zu schicken. Dass die WKStA das Laptop des Ministers nicht finden konnte, auf welches sie es abgesehen hatte, liegt ja auf der Hand. Ein Schelm wer Böses denkt.
Die Daily-Soap über die «unendliche Geschichte» dreht sich weiter. Spannender hätte sie nicht einmal der verstorbene Schriftsteller Michael Ende schreiben können. Nun gut, der war ja auch Kinderbuch-Autor.
Mit Apple bereichert ein neuer, globaler Akteur der Tech-Giganten die Aufklärung um Käuflichkeit und Bestechung österreichischer Politiker.
Eigentlich jetzt schon die perfekte Vorlage für das Drehbuch eines Hollywood- oder Netflix-Blockbusters. Alles ist vorhanden. Weltweit (Kanzler Kurz) und lokal bestens bekannte Prominenz, digitale Giganten, Loser and Winner, Korruption, Bestechlichkeit und sexuelle Vielfalt.
Dass jetzt mit Apple ein weiterer Player die Bühne der österreichischen Korruptionsaffäre aufmischt, ist allerdings nicht ohne Brisanz.
Wer bisher im naiven Glauben an die Ehrlichkeit der US-Tech-Giganten dachte, die Verschlüsselung von Nachrichten könne nicht gelesen werden und schütze vor Nachforschungen, hat sich gewaltig geirrt. Mit der Bestätigung von Apple an die WKStA, dass die Daten von Blümels-Chatnachrichten auf seinem Laptop «konserviert» seien, steht fest, dass Apple verschlüsselte Daten aus einem iCloud-Backup sehr wohl lesen kann.
Das dürfte bei den anderen globalen Playern aus diesem Genre der digitalen Bild- und Nachrichten-Transformation nicht anders sein. Nicht mal beim russischen Messengerdienst TELEGRAM, auch wenn TELEGRAM etwas ganz anderes behauptet. Ein Umzug von St. Petersburg über London in arabische Gefilde macht den Messengerdienst auch nicht vertrauenswürdiger.
Ob Apple letztendlich die gewünschten Daten an die WKStA liefert bzw. liefern darf, ist eine andere Frage. Selbst wenn das europäische Recht mit dem EU-US-Privacy Shield dies zulassen würde, hat ein Mächtiger wie Sebastian Kurz wohl genügend Rechtsanwälte und Mittel, eine Übermittlung der Daten zu verhindern. Oder zumindest bis zum St. Nimmerleinstag zu blockieren.
Was lernen wir daraus, was wir mehr oder weniger schon immer wussten? Wir alle sind nicht Kunden von Apple & Co., sondern die Lieferanten. Unsere freiwillig gelieferten Daten stellen für die Tech-Giganten ab einem gewissen Zeitpunkt nichts anderes mehr als gelagerter Datenmüll dar. Sind die gespeicherten Daten bis zum geht nicht mehr verwertet und verwurstet, verlieren auch die digitalen Globalplayer ihr Interesse daran. Es sei denn, eine Staatsanwaltschaft klopft an.
Diese unangenehme Überraschung lernten Drogendealer samt ihren Konsumenten in Deutschland kürzlich bei einer koordinierten Aktion der deutschen Polizei mit dem BKA kennen, die dem TELEGRAM-Messengerdienst vertrauten.
So viel zur Unantastbarkeit der Verschlüsselung von Daten bei TELEGRAM.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.6.2021 - Tag der Fussballreporter
Zum Sieg gegen die Türkei: So macht diese Nati Freude!
Jaaa! Die Nati zeigt Feuer und schlägt mit einem heissen Auftritt zu – 3:1 gegen die Türkei! Jetzt beginnt das grosse Rechnen - und dann kommt hoffentlich die grosse Chance, doch noch Geschichte zu schreiben.
«Wenn Du mit dem Lamborghini vorfährst, musst Du auch wie ein Lamborghini spielen», sagte Nati-Rekordtorschütze Alex Frei. Nach zwei schwachen Auftritten spielt die Nati gegen die Türkei wie ein Rennwagen – gibt Vollgas und schlägt eiskalt zu.
Endlich! Dieser Sieg ist umso höher einzuschätzen, weil man mit dem Rücken zur Wand stand und siegen musste. Tattoo-Studio-Story und Figaro-Affäre – plötzlich ganz weit weg.
So macht diese Nati Freude! Weil in dieser Mannschaft eben doch ganz viel drinsteckt, wenn sie es nur zeigen will. Es ist ein Sieg der Reife und es ist auch ein Erfolg von Trainer Vladimir Petkovic.
Denn der Trainer darf sich durchaus als Sieger des gestrigen Abends bezeichnen. Petkovic, der gegen Italien einen Teil der Schuld auf sich nahm, hat die Mannschaft dieses Mal auf den Punkt genau heiss gemacht.
Und es ist gut, dass er sich nicht von den Taktik-Diskussionen ablenken lässt: Petkovic hat bei Haris Seferovic und Xherdan Shaqiri, denen er das Vertrauen schenkt, ein Gold-Händchen. Mit der Hereinnahme von Steven Zuber (3 Assists!) ebenso. Und dass Yann Sommer nach Papi-Pause zurück ist, ist sowas von wichtig. Wie auch der starke Auftritt von Captain Granit Xhaka.
Trotz dem 3:1 heisst es nun beten! Weil wir halt nach den schwachen Spielen gegen Wales (1:1) und Italien (0:3) doch nur Dritter geworden sind. An einer Weltmeisterschaft wäre man ausgeschieden und es gäbe Katzenjammer.
Aber an dieser EM müssen nur zwei der sechs anderen Gruppen-Dritten schlechter sein, damit es nach der WM 2014 in Brasilien, der EM 2016 in Polen und der WM 2018 in Russland die vierte Achtelfinal-Qualifikation in Folge an einem grossen Turnier wird.
Das Zittern geht vielleicht sogar bis Mittwoch. Mit vier Punkten hat die Nati allerdings eine grosse Chance, dass es auch so kommt – an der EM 2016 hätte es jedenfalls locker gereicht.
Die Nati geht jetzt ab nach Rom und wartet dort auf hoffentlich positive Kunde. Und sie kann dann hoffentlich ohne Druck gegen einen Gruppenersten spielen. Bis spätestens am Mittwoch weiss man gegen welchen.
Klar ist schon jetzt: Mögliche Spielorte wären Sevilla (am 27. Juni) gegen den Ersten der Gruppe B, Bukarest (am 28. Juni) gegen den Ersten der Gruppe F oder Glasgow (am 29. Juni) gegen den Ersten der Gruppe E.
Granit Xhaka hat bis zum Final gepackt. Das Minimalziel ist erreicht. Jetzt können wir mit träumen beginnen! Schreibt Andreas Böni aus Baku im Blick.
Der gleiche Böni, der die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nach dem Spiel gegen Italien im Blick aufs Übelste wie kaum ein zweiter Journalist zerriss, stimmt nun nach dem Spiel der Schweizer gegen die Türkei einen Jubelgesang an, der nur noch peinlich ist.
Dabei schreckt er nicht mal vor religiösem Schwachsinn zurück: «Trotz dem 3:1 heisst es nun beten». Hat dieser Mann, der sich wie weiland der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer keinen Deut um sein Geschwätz von gestern kümmert, wirklich noch alle Tassen im Schrank?
Was hat sich denn bei der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft charakterlich seit gestern Abend verändert, das diese Lobhudelei rechtfertigen würde?
Gut, die Schweizer haben ein Fussballspiel gegen eine türkische Nationalmannschaft gewonnen, welches vermutlich auch von etlichen Schweizer Fussball-Juniorenmannschaften siegreich beendet worden wäre. Derart hilflos und überfordert wirkten die türkischen Fussballer. Und dies nicht nur beim Match gegen die Schweizer Nationalmannschaft. Sondern bei allen drei Spielen. So lautet jedenfalls unisono das Urteil europäischer Fussballexperten über die türkische Nationalmannschaft an dieser EM.Null Punkte im Abschlussranking der Gruppe A kommen ja nicht von Nichts.
In seinem vorangegangenen Verriss übte Böni vor allem Kritik an den Luxuskarossen der Schweizer Spieler, den blondierten Haaren und dem Verweigern des Mitsingens der Schweizer Nationalhymne.
Das Einfliegen eines Starcoiffeurs aus Zürich nach Rom zwecks Haarfärbung wurde vom Trainer der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft, Vladimir Petković, darauf flugs zum «Menschenrecht» erklärt. Mit dieser etwas eigenartigen und vermutlich nur auf dem Balkan nachvollziehbaren Erklärung ist zumindest das Thema der blondierten Federn abgehakt.
Doch was ist denn bezüglich den Ferraris und Lamborghinis inzwischen passiert? Hat einer der Spieler sein protziges Spielzeug im Sinne von Mutter Theresa, die übrigens vom Balkan stammt, verkauft und den Erlös einer wohltätigen Stiftung gespendet?
Hat einer der kritisierten Spieler gestern Abend die Schweizer Nationalhymne mitgesungen?
Beide Fragen dürfen mit einem klaren Nein beantwortet werden.
Was sagt uns dies? Die Expertise von Böni nach dem Spiel der Schweizer gegen Italien war schlicht und einfach falsch. Eine Schnappatmung zum Wohle des Clickbaiting.
Die Schweizer Superstars der Fussball-Nationalmannschaft verloren das Spiel gegen Italien nicht wegen den von Böni kritisierten charakterlichen Eigenschaften, die sie ohnehin nie besassen, sondern wegen dem fussballerischen Klassenunterschied gegenüber den italienischen Spielern.
Als Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Italien, dessen Spieler sich auch ab und zu die Haare färben und Luxus-Sportwagen fahren (man erinnere sich an Mario Balotelli!) zu verlieren ist keine Schande und braucht keine an den (blonden) Haaren herbeigezogenen, moralinsäuselnde Erklärungen.
Aber genau so ist der Sieg gegen eine derart unterlegene Türkei kein «Sieg der Reife», wie Böni überschwänglich schreibt, sondern nicht mehr und nicht weniger als eine reine Selbstverständlichkeit.
So wie gewisse Luxusstandards bei den Superstars des Sport-Entertainments eine reine Selbstverständlichkeit sind. Roger Federer wird ja nach einem verlorenen Tennisspiel in Wimbledon auch nicht dafür kritisiert, dass er mit einem Bentley vorgefahren ist. Pardon, chauffiert wurde.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.6.2021 - Tag der Gretas und Petras
Frauenfeinde im Bundeshaus: Zielscheibe Petra Gössi
Am Abstimmungswochenende stand Petra Gössi mit ihrem Umweltkurs auf Seite der Verlierer. Den Parteivorsitz gibt sie aber nicht wegen dieser einen Niederlage ab. Das ständige Spiel gegen die Frau hat sie zermürbt. Ihre Demission zeugt aber auch von Charakterstärke.
Vor ein paar Monaten geigte mir Petra Gössi ihre Meinung. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt derart zusammengestaucht wurde. An jenem Samstag im März hatte sie via Twitter gemeldet, sie werde wegen eines Nachdiplomstudiums eine Woche im Parlament fehlen. Ich fand das ungewöhnlich genug, um bei der FDP-Präsidentin nachzufragen, ob sie denn die richtigen Prioritäten setze. Das Gespräch machte mir klar: Hier hat jemand ordentlich die Nase voll. Von mehr oder minder impertinenten Journalistenfragen. Aber nicht nur.
Das Café im Bundeshaus, ein Tag in der Herbstsession 2019: FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen betritt den Raum und lässt gut hörbar eine abschätzige Bemerkung über seine Parteichefin fallen. Wochen zuvor hatte Gössi die freisinnigen Delegierten von einem grüneren Kurs in Umweltfragen überzeugt – gegen den Widerstand von Wasserfallen. Auch sonst war in der Karriere des einstigen Jungstars der Berner FDP vieles nicht nach Wunsch gelaufen. Parteipräsident wurde er nicht. Regierungsrat, Fraktionschef, Präsident des ACS – alle Pläne waren geplatzt.
Gewiss, innerparteiliche Opposition gab es im Freisinn schon immer. «Zu viele Dissidenten spuckten in unsere eigene Suppe», klagte einst FDP-Präsident Fulvio Pelli. Bei seiner Nachnachfolgerin freilich hatte die Kritik oft eine frauenfeindliche Färbung. Gössi sei «ein sympathisches Aushängeschild», zitierte die «NZZ am Sonntag» vor zwei Jahren anonyme FDP-Parlamentarier. Doch sei sie «nicht die begabteste Strategin». Die Fäden ziehe der Generalsekretär. Natürlich ein Mann.
Am Abstimmungswochenende stand Petra Gössi mit ihrem Umweltkurs und ihrem Ja zum CO2-Gesetz auf Seite der Verlierer. Den Parteivorsitz gibt sie aber nicht wegen dieser einen Niederlage ab. Das ständige Spiel gegen die Frau hat sie zermürbt. Zugleich indes zeugt ihre Demission von Charakterstärke: Hier handelt eine Politikerin, die dem persönlichen Machterhalt nicht alles unterordnet. Gössi gehört zu den wenigen im Bundeshaus, die sich ein erfülltes Leben auch ausserhalb vorstellen können. Und die darum nicht bereit sind, unentwegt Ränke zu schmieden. Entsprechend gelöst wirkte sie in den Tagen nach ihrer Rücktrittserklärung.
Zu den Siegern vom Abstimmungssonntag gehörte Markus Ritter, Mitte-Nationalrat und Präsident des Bauernverbandes. Mit der teuersten Kampagne in der Verbandsgeschichte war es ihm gelungen, die beiden Landwirtschafts-Initiativen zu bodigen.
Ein Bauernhof im Bernbiet, Juli 2019: Markus Ritter hat zu einer Medienkonferenz über den Treibhauseffekt geladen. «Die Bauern müssen aktiv etwas fürs Klima tun», sagt er. Schliesslich seien sie von den Folgen der Erderwärmung besonders betroffen. Für den Bauernverband sei die Revision des CO2-Gesetzes darum zentral.
Als es in den letzten Monaten dann allerdings darum ging, für dieses CO2-Gesetz öffentlich einzustehen, hielt sich Ritter abseits. Zwar konnte er nicht verhindern, dass der Vorstand des Bauernverbandes die Ja-Parole fasste. Doch Ritter sorgte dafür, dass seine Organisation in der Pro-Kampagne nirgendwo erwähnt wurde.
Er wollte die SVP als Gegnerin des CO2-Gesetzes und Verbündete im Kampf gegen die Landwirtschaftsvorlagen nicht verärgern.
Markus Ritter liess sich den Triumph vom Sonntag also nicht nur viel Geld kosten. Er opferte dafür auch seine Überzeugungen.
Wenn Sie mich fragen, ist mir so viel Heimlifeisserei unheimlich. Da bevorzuge ich die Unverstelltheit einer Petra Gössi. Selbst wenn das bedeutet, dass sie einem zwischendurch mal gehörig den Tarif durchgibt. Schreibt SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty im Editorial von SonntagsBlick.
Ein eigenartig romantisch gefärbtes Gesäusel, das SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty um den etwas unrühmlichen Abgang von Petra «Greta» Gössi als FDP-Parteichefin am frühen Sonntagmorgen von sich gibt. In Verkennung einiger Tatsachen schwingt der Chefredaktor die Keule der «Frauenfeinde im Bundeshaus».
Dieses Totschlagargument zieht immer und lässt jede Kritik im Keim ersticken. Wer wagt es schon, sich gegen den Zeitgeist zu stellen?
Es mag ja sein, dass es im Hohen Haus von und zu Bern, genannt Bundeshaus, einige Frauenfeinde gibt. Die schiere Höhe eines Hauses sagt ja schliesslich nichts aus über die allfällige Dummheit seiner Bewohner. So ganz sicher scheint sich ja nicht einmal der Verfasser des Artikels zu sein. Der Übertitel «Frauenfeinde im Bundeshaus» erscheint nämlich nur als Aufmacher auf der fürs Clickbaiting zuständigen Frontseite von SonntagsBlick. Nicht aber im Artikel selbst. Scheint ja fast so, als ob Cavelty der Headline auch nicht so richtig traut.
Gössi, selbst eine brutale Verfechterin des neoliberalsten Gedankenguts, wurde von den Männern rund um FDP-Hardliner Wasserfallen nicht wegen Frauenfeindlichkeit vom Thron gestürzt. Wasserfallen mag vieles sein. Ein Frauenfeind oder Frauenhasser ist er definitiv nicht.
Die Wendehälsin auf dem FDP-Chefinnenstuhl hatte sich 2019 vor den National- und Ständeratswahlen mit ihrer Kehrtwendung um 180 Grad schlicht und einfach verzockt.
Ausgerechnet die Chefin der Partei, die in der Legislaturperiode vor den Wahlen jedes, aber auch wirklich jedes Gesetz bezüglich Klimaschutz bekämpfte und entsprechend im Parlament abstimmte und nicht selten zu Fall brachte, verordnete für eine Handvoll Wählerstimmen eine totale Umkehr. Aus Blau mach Grün, so lautete ihre Formel für den bevorstehenden Wahlkampf.
Schon bei der Verkündigung ihrer neuen Strategie am Parteitag 2019 wehte Gössi heftiger Gegenwind mitten ins Gesicht. Und das waren nicht nur die Männer rund um Wasserfallen herum. Auch viele FDP-Frauen wollten und konnten den neuen Kurs nicht mittragen. Nur waren sie etwas diskreter mit ihren abfälligen Äusserungen als die Wassermänner der Partei. Entsprechend wurden sie auch kaum wahrgenommen.
Die wahlberechtigten Delegierten des Parteitags stimmten mit einer Mehrheit für den von Gössi verordneten Wendehalskurs. Viele von ihnen allerdings mit der geballten Faust im Sack.
Die Medien jubelten mehrheitlich über die grüne Greta von der FDP. Wer will schon gegen den Zeitgeist schreiben? Die Wahlen 2019 wurden schliesslich nur von einem einzigen Thema beherrscht: Dem Klimaschutz.
Gössis Volte von Blau nach Grün ist deshalb absolut nachvollziehbar. Sie musste ihre Partei vor einem drohenden Absturz an den Wahlurnen retten. Schliesslich drohte durch den Höhenflug der Schweizer Grünen nicht weniger als der Untergang des Abendlandes. Doch ihr Vabanque-Spiel war ebenso verlogen wie gefährlich.
Und es kam wie es kommen musste. Die Stimmbürger*innen durchschauten Gössi und zeigten ihr die rote Karte an den Wahlurnen. Die FDP verlor 1,3 Prozent und fiel auf einen Stimmenanteil von 15,1 Prozent zurück.
Rien ne va plus; verzockt. Mit der billigen Ausrede, ohne grünen Kurswechsel hätte die FDP noch weit mehr Stimmen verloren, versuchte die Parteichefin ihr Standing innerhalb der Partei dennoch zu halten. Eine Mission impossible. Verlierer*innen werden in beinahe jeder Partei abgestraft.
Gössis Rücktritt als FDP-Präsidentin als Kampf einer Frau gegen Männer zu romantisieren, wird den Fakten nicht gerecht. Sie hatte gar keine andere Wahl als zurückzutreten. Ihr Schleuderkurs wahr nicht konsensfähig und wurde als reines Wahlkampfmanöver ohne Substanz durchschaut.GössisGlaubwürdigkeit, bei der FDP ohnehin sowas wie ein Fremdwort in der Aussenwahrnehmung, war bei der breiten Masse auf Tiefstwerte gesunken.
Das war nicht der heroische Kampf einer Frau gegen die Männer, wie der Artikel suggeriert. Die FDP verlor auch viele Stimmen von Frauen an den Wahlurnen.
Ausserdem hatte sie den unseligen Luzerner Ständerat und Pöstchenjäger (wie Blick ihn betitelt) Müller, der das Wenden an Ort wie kaum ein Zweiter beherrscht und verinnerlicht hat, stets als Unterstützung an ihrer Seite. Ein richtiger Mann also. Auch wenn es böse Zungen gibt... Doch lassen wir das.
Frau Gössi scheiterte 2019 mit ihrer Strategie, Herr Müller wurde mit der gleichen Strategie im ersten Wahlgang mehrheitlich von Frauen – der Treppenwitz schlechthin – wiedergewählt. Zwar nur mit einem hauchdünnen Vorsprung. Ein zweiter Wahlgang hätte ihm wohl das Genick gebrochen.
Lassen wir Gössi in Frieden ziehen. Sie ist eine intelligente Frau und hat möglicherweise für sich erkannt, was eigentlich der Sinn des Lebens sein könnte. Wenn auch unter Zwang. Der von ihr geprägte Neoliberalismus abartiger Prägung zum Wohle einer speziellen Klientel wird es ja wohl kaum sein. Riskante Wendehalsmanöver ebenfalls nicht.
Last but not least ist eine Partei wie die FDP beim derzeitigen Zeitgeist ohnehin vom schleichenden Untergang bedroht. Wer braucht eine rein neoliberale Wirtschaftspartei ohne soziales Gewissen mit grünem Anstrich, wenn es mit der Grünliberalen Partei der Schweiz eine viel smartere Alternative gibt, die die Wirtschaftsinteressen zusammen mit der «Mitte»-Partei und der SVP ebenso geschmeidig wie skrupellos durchsetzt? Und dies erst noch ohne störende Hintergrundgeräusche.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
19.6.2021 - Tag der genderneutralen Toiletten
«Für eine Kultur der Akzeptanz und Vielfalt»: Luzerner Traditionsfirma Schindler gibt Versprechen an Regenbogen-Community
Der Luzerner Lifthersteller Schindler hat ein Versprechen für die LGBTI-Community unterzeichnet. Das gibt die Firma demnächst in einem Inserat einer grossen Schweizer Tageszeitung bekannt. zentralplus hat nachgefragt, warum sie das tut – und was Ziel dieser Kampagne ist.
«Wir bewerten deine Arbeit nach vielen Kriterien … Doch niemals werden wir deine Arbeit danach bewerten, wer du bist oder wen du liebst. Niemals.»
Es lautet «Das LGBTIQ+-Versprechen». 24 CEOs bekannter Unternehmen haben dieses unterzeichnet. Darunter die NZZ, Swisscom und die UBS. Und das Luzerner Traditionsunternehmen Schindler. Das Statement mit dem Versprechen erscheint in der NZZ vom 19. Juni. Und es ist vom 14. bis 20. Juni auf den APG-Screens zu sehen. Also mittendrin im alljährlichen Pride Month, der weltweit gefeiert wird. Dabei wollen die Firmen ein Zeichen gegen Diskriminierung und ein Zeichen für mehr Rechte und Toleranz der Regenbogen-Community setzen.
Hinter der Aktion «Das LGBTIQ+-Versprechen» steht Daniel Kessler, Schweiz-Chef von Boston Consulting Group. Er will damit zeigen, dass sein Unternehmen für eine offene, tolerante und inklusive Firmenkultur einsteht. Die Idee, sich mit anderen Firmen zusammen zu tun, entstand nach dem Ausfall der Zurich Pride. Warum ist die Aktion nötig? «Weil wir als Wirtschaft und Gesellschaft noch nicht dort sind, wo wir sein müssten – solange LGBTIQ+-Personen nicht frei von jeglicher Diskriminierung leben können», sagte Kessler gegenüber dem Schweizer Wirtschaftsmagazin «Persönlich».
Auch die Unterschrift von Patrick Hess, CEO von Schindler Schweiz, steht unter dem Versprechen. Thomas Langenegger, Medienverantwortlicher von Schindler, sagt, weshalb sich das Unternehmen an der Kampagne beteiligt: «Wir wollen uns damit für eine Kultur der Akzeptanz einsetzen und der Vielfalt unserer Belegschaft Rechnung tragen.»
Als LGBTI-freundliches Unternehmen zertifiziert
Der Lifthersteller feiert bald seinen 150. Geburtstag. «Gleichstellung war für Schindler schon immer ein Thema», so Langenegger. Diversity und Inklusion seien wichtige Werte der Unternehmenskultur. Schindler hat 2017 die «Swiss Diversity Initiative» ins Leben gerufen, die sich für Vielfalt am Arbeitsplatz einsetzt. Der Fokus liegt auf der Erhöhung des Frauenanteils und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Alters- und Generationenvielfalt sowie Inklusionsarbeitsplätzen. Weiter setzt sich die Initiative für eine Kultur der Akzeptanz ein, so Langenegger.
Im Rahmen des offenen Netzwerkes «Pride & Friends» können sich die Mitglieder austauschen. Zudem werden «LGBTI-freundliche» Events organisiert. Beispiele dafür sind der regelmässige Pride Lunch oder der Pride & Friends Fondue Event.
Letztes Jahr hat das Traditionsunternehmen das Swiss LGBTI-Label bekommen. Eine Auszeichnung, die auch die Stadt als Arbeitgeberin anpeilt. Mit dem Zertifikat werden Arbeitgeber ausgezeichnet, die Offenheit und Inklusion leben. Auch wenn das ein Prozess ist. Um das Label zu bekommen, müssen Unternehmen und Organisationen eine Selbstdeklaration abgeben. Für grosse Organisationen mit mehr als 250 Mitarbeitenden ist das ein Fragenkatalog, bestehend aus 60 Fragen, unter anderem zum Leitbild, der externen Kommunikation und zur Personalrekrutierung. Mindestens 33 von 100 Punkten müssen erfüllt sein, um das Label zu erhalten.
Schindler setzt auf genderneutrale Toiletten
Vor einem Jahr teilte Schindler mit, dass man das Feedback der LGBTI-Kommission dafür nutzen werde, weiterhin an der Integration der LGBTI-Community zu arbeiten. Was hat sich seither bei Schindler getan?
Laut Langenegger sind mehrere Massnahmen bereits unternommen worden oder geplant. Beispielsweise die Verwendung einer inklusiven Sprache, genderneutrale Toiletten oder eben die Teilnahme am «LGBTIQ-Versprechen» der Boston Consulting Group. Schreibt ZentralPlus.
«Oh Gottchen, oh Gottchen» würde Albin seinem Partner Renato im Film «Der Tuntenkäfig» nach dem Lesen der LGBTI-Message von Schindler wohl zärtlich ins Ohr flüstern.
Michel Serrault alias «Renato» spielte den grossen Star im Film «Ein Käfig voller Narren» aus dem Jahr 1978; Originaltitel «La cage aux folles», wobei «folle» in der französischen Sprache ein Slangausdruck für den deutschen Begriff «Tunte» ist.
«Ein Käfig voller Narren» war eine italienisch-französische Filmkomödie aus dem Jahr 1978 und gilt als der erste weltweite Blockbuster-Film aus dem Drag-Queen-Milieu. Die Story basiert auf einem Theaterstück von Jean Poiret aus dem Jahr 1973 und nimmt Charaktere aufs Korn, die durchaus auch der heutigen «Keeping up with the Kardashians»-Generation entstammen könnten. Oder Fellinis Jahrhundert-Kunstwerk «E la Nave va».
Natürlich «ehrt» es Schindler, dem Zeitgeist hinterher zu hecheln.
Die Frage sei allerdings erlaubt, ob damit der seit Jahren anhaltende, rigorose Stellenabbau in Ebikon gebremst wird?
Oder ob der Luzerner Globalplayer diese von Boston Consulting Group inszenierte Message auch im Billiglohn-Land China publizieren lässt, wo der Liftbauer emsig produziert?
Oder in Saudi Arabien, wo Schwule dank der Scharia ab und zu noch am Galgen aufgehängt werden und wo Schindler fast alle Tower mit seinen Swissness-Hightech-Aufzügen «made in China» ausstattet?
Fragen über Fragen. Dabei hat es Schindler doch nur gut gemeint.
Bertolt Brecht würde diese etwas eigenartige PR-Aktion wohl wie folgt kommentieren: «Erst kommt der Lift, dann die Moral der genderneutralen Toiletten.»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
18.6.2021 - Tag der Klimaheuchler*innen
Einschlaf-Programm beginnt schon vor dem Spiel: Blick erklärt den Gähn-Auftritt der Nati
Schreiende Krieger auf der einen, leidenschaftslose Lauf-Muffel auf der anderen Seite. Ein Gähn-Auftritt unserer Nati beim 0:3 gegen Italien von A bis Z.
Das Bild, aufgenommen um 22.50 Uhr im Römer Olimpico, spricht Bände: Silvan Widmer verlässt nach der 0:3-Klatsche gegen Italien gesenkten Hauptes das Feld. Daneben umarmt Xherdan Shaqiri, kritisch beäugt von Manuel Akanji, den italienischen Co-Trainer Fausto Solsano. Und lacht dabei herzhaft! Während die meisten Schweizer vor Scham im Boden versinken, herzt «Shaq» den Ex-Arbeitskollegen von Inter Mailand.
Das schräge Bild passt zum gesamten Nati-Auftritt.
Tunnelblick geht anders
Um 19.49 Uhr, 16 Minuten nach den Italienern, betreten die Schweizer am Mittwochabend in ihren Anzügen das Terrain. Während die Juve-Altstars Giorgio Chiellini (36) und Leonardo Bonucci (34) zuvor schon hochkonzentriert scheinen, schiessen viele Schweizer erstmal Handy-Fotos und winken ihren Liebsten auf der Tribüne zu. Tunnelblick geht anders.
Als die Teams das Feld betreten, steht die komplette italienische Bank und applaudiert – die Ersatzspieler und der Staff der Schweizer bleiben sitzen.
Bei den Nationalhymnen ziehen die Schweizer erwartungsgemäss den Kürzeren. Kein Vorwurf an Xhaka, Shaqiri & Co., dass sie den Schweizer Psalm nicht singen. Schon zu Zeiten des Rekord-Nationalspielers Heinz Hermann (62) haben nicht alle mitgesungen.
«Wir sind bereit zum Tod!»
Die Hymne des Gegners, «Fratelli d’Italia» (Brüder Italiens), geht allerdings jedem unter die Haut. Mit Inbrunst brüllen die Azzurri ihre Hymne, pumpen sich dabei offensichtlich mit Adrenalin voll.
Das führt uns zur Laufbereitschaft. Ganze 6 Kilometer sind die Italiener mehr gelaufen als die Schweizer. Üblicherweise ist das Team, das dem Ball hinterherjagt, zu mehr Laufarbeit gezwungen als der Gegner. Das widerspiegelt sich dann in Mehr-Kilometern.
Petkovic: «Es war in vielen Bereichen eine Schweiz, die nicht auf hundert Prozent gekommen ist. Wir müssen auch die Laufarbeit verbessern.»
Ein vernichtendes Urteil des Coaches. Es sagt alles aus über die Einstellung, die bei vielen ungenügend war. Captain Granit Xhaka: «Wir haben zu wenig Spieler, die den Ball wollen. Und wenn man das nicht will, muss man sich überlegen, ob man überhaupt auf dem Platz stehen will.»
Eine Aussage, die er vielleicht auch auf sich selber bezogen hat. Es waren die Schlussworte nach einem durch und durch verschlafenen Auftritt des Schweizer Teams. Schreibt Blick.
Mehr oder weniger ist alles gesagt über diesen dämlichen Auftritt der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der «Brot- und Spiele»-Show der Fussball EM 2020. Man könnte das nicht unbedingt weltbewegende Entertainment-Gschichtli nun gut sein lassen und mit einem Tweet meines Freundes Res Kaderli (called «das fleischgewordene Lexikon») abschliessen und für beendet erklären: «Ein Fussballturnier als ökologischer Blödsinn! Einfach wegschauen.»
Doch so funktioniert der Boulevard nun mal nicht und schon gar nicht mitten im Sommerloch.
Dennoch kann ich Res nur beipflichten! Die Tschuttibuben der Schweizer Fussballmannschaft werden seit Tagen mit den immergleichen Argumenten kritisiert: Sei es wegen den protzigen und dekadenten Auftritten mit ihren (vermutlich) geleasten Luxuskarrossen, dem Einfliegen eines Starcoiffeurs nach Rom und die eher infantile Färbung ihrer Kopf-Federn. In den Kommentarspalten lassen die Leserinnen und Leser ihren mangelnden Deutschkenntnissen freien Lauf. Mal witzig, mal primitiv. Wer von Hardcore-Fussballfans etwas anderes erwartet, hat sie nicht alle. Ausser geistig minderbemittelten Fussballfreaks und mir liest ja wohl kaum jemand den 17. Artikel über den immer gleichen Brei.
Doch bisher habe ich keinen einzigen Kommentar Richtung Ökologie und Klimaschutz wahrgenommen. Weder redaktionell noch seitens der Leserinnen und Leser. Dass hier ein paar unbedarfte Fussballgladiatoren wegen einem einzigen Fussballspiel von der Schweiz nach Baku (Aserbeidschan) geflogen werden, von Baku nach Rom und ein paar Tage später von Rom back to Baku scheint für einmal die «basisdemokratische Graswurzelbewegung» Fridays for Future samt ihren heuchelnden Anhängern nicht zu interessieren. Handelt sich ja auch nur um eine einzige Fussballmannschaft. Doch wie viele Nationen sind denn an dieser EM vertreten? Da läppert sich einiges an CO2 zusammen durch die Hin- und Herfliegerei.
Wenn zwei das Gleiche tun ist es halt noch lange nicht das Gleiche, obschon es immer das Gleiche ist. Das Erdklima kümmert sich nicht darum, wer gerade unnötigerweise in einem Kerosinbomber sitzt. Es nimmt dies lediglich zur Kenntnis und tut das, was es gemäss naturwissenschaftlichen Regeln tun muss: Es verändert sich. Den Zeitrahmen über die Geschwindigkeit der Veränderung überlässt es grosszügigerweise uns Menschen. Was sagt uns dies? Es gibt derzeit keine verlogenere Diskussion als die um den Klimaschutz. Stellt Euch vor: Alle wollen den Klimaschutz, doch niemand will damit vor seiner Haustüre anfangen.
Ganz heftig wird es in allen redaktionellen Beiträgen und Leserkommentaren beim Thema über die Schweizer Landeshymne. Fast so, als ob wir an einem SVP-Parteitag auf dem Rütli wären und Roger Köppel von der WELTWOCHE einen Vortrag über Wilhelm Tell hält. Dass etliche Schweizer Spieler die altbackene Schweizerhymne - genannt «Schweizerpsalm» - nicht mitsingen, hat nachvollziehbare Gründe. Kein gläubiger Muslim kann je diesen Schweizerpsalm mit der Hand auf dem Herzen mitsingen, der textlich mehrheitlich von den Wörtern «Gott», «Gott, der Herr», «Gott, der Allmächtige» geprägt ist, was weder zu Allahu akbar noch zu einer modernen Schweiz passt.
Einige Spieler der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft, die sich ja vor allem aus Secondos aus dem Balkan zusammensetzt, bekennen sich denn auch offen als gläubige und praktizierende Muslime, was ihr gutes Recht ist.
Da wäre es nicht mehr als Anstand, die Reaktion der muslimischen Spieler auf die Schweizer Nationalhymne zu verstehen und zu respektieren. Auch Atheisten, wie ich zum Beispiel, würden diesen Text niemals mitsingen.
Die Schweizer Behörden bemühen sich ja nicht umsonst seit langer Zeit, einen neuen Text ohne den ganzen Pathos zu kreieren. https://sgg-ssup.ch/sozia.../nationalhymne/neuer-hymnentext/
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.6.2021 - Tag der blondierten Hochstapler
Zur 0:3-Pleite gegen Italien: Unsere Nati-«Stars»? Einfach nur enttäuschend
Der Unterschied zwischen Italien und der Schweiz ist grösser als die drei Tore beim 0:3 in Rom. Ein Kommentar von Blick-Fussballchef a.i. Michael Wegmann.
Keine Frage: Die Italiener sind richtig stark. Kein Wunder sind die schon seit nun 10 Partien ohne Gegentor, seit 29 Spielen ungeschlagen.
Aber die Nati macht es den Italienern auch viel zu einfach! Ex-Nati-Captain Alex Frei hat es bei «Gredig direkt» schön formuliert. «Wenn du mit einem Ferrari oder Lamborghini beim Nati-Zusammenzug vorfährst, musst du auch spielen wie ein Ferrari oder Lamborghini.»
Davon sind Shaqiri, Xhaka, Rodriguez und Co. aber weit entfernt! Dass die Azzurri mehrheitlich in Ballbesitz sind, war zu erwarten. Dass sie aber auch mehr laufen, ist schwer, zu verstehen. Es sieht danach aus, als hätten die Schweizer zu wenig Sprit im Tank. Die Schweiz ist chancenlos. Italien ist agiler, frecher, eingespielter. Italien ist besser. Mehr als die drei Tore Differenz.
Und es gibt noch einen anderen Unterschied zwischen den Teams: Bei Italien spielen nicht die grössten Stars. Bei Italien spielt die beste Mannschaft. Matchwinner wird Doppeltorschütze Manuel Locatelli vom kleinen Sassuolo. Kein grosser Name im Weltfussball.
Ganz anders bei der Nati: Unter Vladimir Petkovic spielen an der EM bisher die Stars. Xherdan Shaqiri von Liverpool, der kein EM-Qualispiel absolviert hat, und seine mangelnde Spielpraxis nicht kompensieren kann.
Ricardo Rodriguez, Ersatz bei Torino, holt seine Spielpraxis bei der Nati. Und Granit Xhaka von Arsenal und Haris Seferovic von Benfica sind bisher enttäuschend.
Das Gute zuletzt: Gegen die Türkei kanns nur besser werden! Schreibt Blick.
Sie fahren mit dem Ferrari vor und landen als Citroen Deux Chevaux (Döschwo) auf dem Fussballfeld.
So geschehen gestern Abend im Stadion Olimpico in Rom.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Einerseits.
Andererseits machen es uns die blondierten Diven vom Balkan auch sehr leicht, über sie zu spotten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.6.2021 - Tag der grenzenlosen Ausbeutung billiger Arbeitskräfte
Von Hilfs- bis Fachkräften: Österreichs Touristiker suchen händeringend Personal
Betriebe müssen heuer im Sommer laut WKO mit einem Viertel weniger Beschäftigten auskommen. Es gibt mehr als 50.000 offene Stellen im Tourismus.
Vier Wochen nach der Öffnung des Tourismus herrscht in der Ferienhotellerie Freude über das Wiederaufleben des Geschäfts – die Buchungen springen an. Nach über einem Jahr Pandemie und monatelangen Lockdowns mangelt es aber an allen Ecken und Enden massiv an Personal. "Diese Sommersaison wird eine ziemliche Herausforderung, was die Mitarbeiter betrifft", betonte WKÖ-Branchensprecherin Susanne Kraus-Winkler. Rund ein Viertel der Beschäftigten ist weg.
"Das ist kein Österreich-Problem, das ist sogar weltweit ein Problem", berichtete die Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich. Auch in den USA würden in den "total gut gebuchten Hotels" oft nur "limited services", also eingeschränkte Dienstleistungen, angeboten, da viele Mitarbeiter fehlten. "Dort ist das Thema aktuell sogar noch stärker als bei uns, da das hier durch die Kurzarbeit abgefedert wurde." Das Einzige, was in den US-Herbergen immer besetzt sei, sei die Rezeption. "Die großen Hotels in Las Vegas zum Beispiel haben Riesenpersonalprobleme, ich lese das in jedem Newsletter", sagte Kraus-Winkler.
Nachfrage schwächelt noch
In Österreich buchen sich die Urlauber seit der Öffnung der Branche am 19. Mai zusehends wieder in die Ferienhotels, -pensionen und -wohnungen ein, vor allem über die Wochenenden. Werktags sei die Nachfrage aktuell noch etwas schwächer. "Das wird sich erst in der Hochsaison ändern – im Juli und im August wird auch gut unter der Woche gebucht sein", ist sich die Hoteliersvertreterin sicher. Bereits jetzt alle sieben Wochentage hindurch stark gefragt seien Thermenhotels und einige beliebte Wellnesshotels.
Die Anfragen in der Ferienhotellerie für den Sommer geben insgesamt Anlass zu Optimismus. "Wir haben extrem viele Buchungen aus Österreich und Deutschland, aber auch aus der Schweiz – die sind ganz stark angelaufen, für den August noch deutlicher als für den Juli, aber das war schon immer so", meinte Kraus-Winkler. "Und einige Länder wie UK (Großbritannien und Nordirland, Anm.) fallen jetzt doch wieder weg." Ob die Niederländer diesen Sommer in großer Zahl nach Österreich kommen, sei "noch ein Fragezeichen, so wie ich das mitbekomme", so die Branchenexpertin.
Branche den Rücken gekehrt
Während die Gäste in die Ferienhotellerie zurückkommen, hat ein erheblicher Teil der Beschäftigten der Branche inzwischen den Rücken gekehrt – nach Monaten der Ungewissheit darüber, wie es mit ihrem Job weitergeht. "Das größte Problem im Moment ist das Thema Mitarbeiter – es geht nicht nur um die Fachkräfte, auch um die Hilfskräfte", strich Kraus-Winkler hervor. Das Arbeitsmarktservice (AMS) komme mit dem Vermitteln der offenen Stellen nicht mehr nach.
Nach mehr als einem halben Jahr Lockdown, von 3. November 2020 bis 19. Mai 2021, müssen die heimischen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe diesen Sommer mit rund 25 Prozent weniger Personal auskommen als vor Corona. Hotellerie und Gastro beschäftigen zu Normalzeiten rund 220.000 Mitarbeiter. Geschätzt 55 Prozent waren der Hotelierssprecherin zufolge in der schwierigen Zeit in Kurzarbeit, rund 28 Prozent waren in der Arbeitslosen und nur etwa 16 Prozent wurden voll weiterbeschäftigt.
Die Zahl der Arbeitslosen im Tourismus sei heuer von April auf Mai von rund 62.000 auf 44.600 gesunken. Anfang Juni waren den Angaben zufolge weitere rund 100.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, Ende März waren es noch rund 122.000 gewesen.
Mehr als 50.000 offene Stellen
"Die Arbeitslosen sowie grob drübergeschätzt 5 bis 10 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit springen ab, wenn diese beendet wird", sagte Kraus-Winkler. Das impliziert 50.000 bis 55.000 offene Stellen in der Branche. "Ich höre das vor allem in der Stadthotellerie, aber beispielsweise auch von einigen Betrieben in Niederösterreich", so die Hotelierssprecherin. Von dieser Entwicklung ausgenommen seien hauptsächlich Betriebe, die sehr viele Stammmitarbeiter haben.
"Deshalb auch der Schrei nach dem erhöhten Ausländerkontingent, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht", erklärte die Hotelière Kraus-Winkler. Im Rahmen des Drittstaaten-Saisonnierkontingents wurden für das Jahr 2021 laut Wirtschaftskammer österreichweit 1.263 Plätze vergeben. Zur Hochsaison könnten diese Plätze bei Bedarf um rund 20 Prozent überschritten werden. Die meisten Kräfte aus Nicht-EU-Ländern stammen aus Serbien und Bosnien-Herzegowina. Vereinzelt kommen auch Mitarbeiter aus Nepal für die Berg- und Schutzhütten sowie aus der Ukraine, dem Kosovo und Mazedonien.
Triste Lage in Stadthotellerie
Deutlich mehr Beschäftigte zum Bewältigen der anstehenden Sommerbuchungen braucht hauptsächlich die Ferienhotellerie. "Wir haben immer noch so eine unterschiedliche Betroffenheit", hielt Kraus-Winkler fest. Der Stadthotellerie geht es mangels Urlaubern aus Übersee nach wie vor schlecht. Die Situation der Kongress-, Messe- und Flughafenhotels ist tendenziell trister. "Wir haben die unterschiedliche Betroffenheit auch innerhalb der Betroffenen", strich die Branchenvertreterin hervor. Innerhalb der Stadthotellerie sei beispielsweise ein Hotel an der Messe Wien von den Folgen der Pandemie noch stärker beeinträchtigt als etwa ein Hotel im Stadtzentrum. "Die Seminarhotels haben auch noch große Probleme", ergänzte sie.
Immerhin hat die Regierung die staatlichen Corona-Wirtschaftshilfen, die jetzt Ende Juni ausgelaufen wären, diese Woche um weitere drei bzw. sechs Monate verlängert. Das hilft vielen ein Stück weiter.
Grüner Pass
Eine für die Branche insgesamt gute Entwicklung ist auch der Grüne Pass für Geimpfte, Getestete oder Genesene ("3-G-Regel"), der das Reisen zumindest innerhalb Europas erleichtern soll und den die EU zu Beginn dieser Woche besiegelt hat. Die Verordnung für dieses Covid-Zertifikat zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests bzw. überstandenen Covid-19-Erkrankungen gilt ab dem 1. Juli für zwölf Monate.
Beim Reisen in europäische Länder hinderlich sind die derzeit noch unterschiedlichen Einreisebestimmungen – Italien etwa verlangt neben einer elektronischen Vorab-Registrierung einen negativen PCR- oder Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, und erkennt noch keine Impf- oder Genesungsnachweise an. In Österreich wiederum gilt der PCR-Test 72 Stunden lang. Ein Blick auf die Homepage des Außenministeriums lohnt bei dem Wirrwarr an Vorgaben, das alleine innerhalb Europas herrscht. Auf der Website ist die jeweils gültige Reiseinformation für jedes Land unter dem Punkt "Aktuelle Hinweise" nachzulesen. Schreibt DER STANDARD.
Der STANDARD-Artikel ist gespickt mit lauter Widersprüchen, so dass man sich eigentlich wundert, warum dieser von der WKÖ in Auftrag gegebene Agenturartikel überhaupt veröffentlicht wird. Zu allem auch noch mit dem einzig und allein dem Clickbaiting geschuldeten Keulenwort «händeringend» in der Titelüberschrift, was an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Qualitätsjournalismus, wie ihn DER STANDARD für sich in Anspruch nimmt, sieht anders aus. Auftragsartikel sollten mindestens als solche gekennzeichnet werden.
Wenn die Lage aus nachvollziehbaren Gründen nicht nur in Österreichs Stadthotels doch dermassen «trist» ist, warum wird dann «händeringend» nach Personal für die Gastrobranche gesucht? Wozu brauchen leere Gasthäuser Personal? Für temporäre Einsätze dürfte es ja nicht schwierig sein, Personal über entsprechende Agenturen zu «mieten». Aber die kosten halt etwas, weil auch das Arbeitsvermittlungsbüro mitverdienen will.
Könnte es sein, dass die unregelmässigen, teilweise katastrophalen Arbeitszeiten, die nicht unbedingt berauschenden Arbeitsbedingungen und das niedrige Lohnniveau für den angeblichen «Fachkräftemangel» verantwortlich sind, die selbst den Zuzug der billigen Arbeitskräfte aus dem Ausland abschrecken? Dass der Schrei nach dem «erhöhten Ausländerkontingent» sogar auf dem Balkan bis nach Bulgarien ungehört verhallt, auch wenn das Ministerium das Kontingent bis zum geht nicht mehr hochschraubt?
Dass dieses Gejammer weltweit in allen Ländern (neo-)liberaler Wirtschaftskünste stattfindet, die alle mit einem recht hohen Sockel von Arbeitslosen zu kämpfen haben, macht die Argumente der Gastrobranche samt den Statements der bestens vernetzten Durchlauferhitzern aus der Politik auch nicht wahrer.
Wird hier eine weitere Basisweisheit der ultra-neoliberalen Lehre vom «Markt, der alles regelt» zu Grabe getragen? Denn eine alte Regel von diesem wunderbaren, alles regelnden Markt sagte früher, dass eine Verknappung eines Artikels zu höheren Preisen führt. Wäre dem so, müssten ja auch die Löhne in der Gastrobranche inzwischen ins Unermessliche gestiegen sein. Sind sie aber nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Mindestlöhne werden über Tricksereien der Arbeitgeber*innen bei Verpflegung und Unterkunft des Personals weit unter den Minimallohn gezockt. Das ist die Realität. Machen wir uns nichts vor. Wer's partout nicht glauben will, soll sich mal bei rumänischen Saisonarbeitern*innen erkundigen.
Wenn selbst die Hoteliers aus den USA den unsäglichen Fachkräftemangel-Blues bemühen, liegt das, abgesehen von ein paar Ausnahmen, die es sicherlich auch hierzulande gibt, nicht an unwilligen und arbeitsscheuen Menschen. Sondern aus der brutalstmöglichen Ausbeutung des arbeitenden Personals. Wo, wenn nicht beim Personal, lässt sich denn die Gewinnmaximierung in ungeahnte Höhen leichter vollziehen?
Von den 46 Millionen US-Bürgern*innen, die im März 2012 in «God's own Country» Lebensmittelhilfen über spezielle Debitkarten («Food Stamps») bezogen (Quelle Wikipedia), würden wohl etliche Millionen sehr gerne einer geregelten Arbeit in der Gastrobranche nachgehen. Doch bei der von den Gastrounternehmen angebotenen Entlöhnung wäre das für viele nicht nur ein Nullsummenspiel, sondern sogar ein tiefer Fall in eine Minusspirale. Sprich, der Lohn für harte Arbeit wäre wohl niedriger als die soziale Zuwendung der US-Administration über «Food Stamps».
Dass es um die Hotellerie in der Schweiz um keinen Deut besser bestellt ist, wurde hier bereits am 8.6.2021 - «Tag des Gastrogejammers» mit dem Kommentar über einen entsprechenden Blick-Artikel abgehandelt (scrollen hilft weiter). Mit dem kleinen, aber wesentlichen Unterschied zum STANDARD-Artikel, dass Blick auch Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), als Gegenpol zur Gastrobranche zu Wort kommen liess, der die Argumente der «Beizer» ebenfalls nicht nachvollziehen kann.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.6.2021 - Tag der Blondinen
«Am Ball mit Böni»: Coiffeur nach Rom eingeflogen – Das ist an Abgehobenheit schwer zu übertreffen
Lambo-Show, Tattoo-Verhalten und das Einfliegen eines Coiffeurs – diese Nati setzt unglaublich naive Zeichen, schreibt Andreas Böni, stellvertretender Chefredaktor Sport der Blick-Gruppe.
Man wird als fussballinteressierter Mensch in diesen Tagen oft gefragt, warum diese Nati bei der Bevölkerung nicht so anzukommen scheint wie früher die 94er Mannschaft von Roy Hodgson oder auch die Generation um Köbi Kuhn und Ottmar Hitzfeld.
Die Antwort haben die Spieler in nur knapp drei Wochen selber gegeben. Nachdem sie wahlweise im Lamborghini oder Ferrari zum EM-Zusammenzug vorfuhren, sich am freien Wochenende vor der EM Tattoos stechen liessen, holen sie nun auch noch den Coiffeur nach Rom.
Notabene in der Corona-Zeit. Notabene nach einem ernüchternden 1:1 gegen Wales. Das ist an Naivität schwer zu übertreffen.
Diese Generation Spieler hat sich von der Basis, von den normalen Menschen weit entfernt. Sie zeigt ein Verhalten, wie sie für den normalen Fan, für den Mensch von der Strasse nicht nachzuvollziehen ist. Das ist schade, denn diese Abgehobenheit, sie passt einfach nicht zur Schweiz.
Und die Spieler, sie haben jetzt nur eine Möglichkeit, die Menschen in der Schweiz doch noch zu überzeugen. Indem sie auf dem Platz Leistung sprechen lassen. Und erstmal das Minimalziel Achtelfinal erreichen.
Denn was die Spieler bisher nicht begriffen haben: Wenn sie Leistung gebracht und zum Beispiel einen Halbfinal erreicht haben, können sie ungestraft nackt um den Bundesplatz in Bern rennen und die Leute applaudieren. Aber nach einem 1:1 gegen Wales sind Aktionen wie das Einfliegenlassen eines Coiffeurs nur eines: peinlich. Schreibt Andreas Böni im Blick.
Oh je! Was für ein peinlicher Artikel!
Die Fussballmillionäre, von denen es in der Schweiz ja laut Bundesrätin Amherd kaum welche geben soll, können doch mit ihrem Geld machen was immer sie wollen.
Ob nun blonde oder violette Haare hebt den IQ der unbedarften Fussballer, in der Regel nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte, auch nicht wirklich in unermessliche Höhen. Nicht mal ein Kopfballtor.
Ist doch eine relativ einfache Formel: Wer nichts im Kopf hat, hat's halt auf dem Kopf.
Chefredaktor Böni, haben wir wirklich keine anderen Probleme als die Haarfarbe, die im Kosovo gerade hipp ist? Dieser ganze Fussballquatsch interessiert ohnehin nur eine Randgruppe. Wie viele Zuschauer*innen hat SRF bei der Liveübertragung eines EM-Spiels? Wenn's hoch kommt, vielleicht etwa 500'000 bis 700'000. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich zwischen 7,9 bis 8,1 Millionen Schweizer*innen kein einziges EM-Fussballspiel zu Gemüte führen. Ich gehöre zu denen.
Yes Chefredaktor Böni. Ihr Clickbaiting-Quatsch, formuliert als lächerlich moralische Entrüstung, interessiert eine vernachlässigbare Minderheit, die Ihre Schnappatmung sowieso nicht versteht. Nüd för unguet! Gällid.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.6.2021 - Tag der neoliberalen Wendehälse
FDP-Parteipräsidentin Petra «Greta» Gössi wehrt sich gegen Vorwürfe
Die FDP konnte ihre Basis nicht ausreichend für das CO2-Gesetz mobilisieren. Das setzt Parteipräsidentin Petra Gössi unter Druck.
Die FDP und die Ökologie, das ist keine einfache Beziehung. Zwei Jahre ist es her, dass Parteipräsidentin Petra Grössi den Klimaschutz zum Kernthema erkor. Er gehöre zur DNA der liberalen Partei, so die Begründung.
Ebenfalls im Wahljahr 2019 folgte eine Basisbefragung. Sie mündete in ein deutliches Ja zu einem ökologischeren Kurs. Nicht alle in der Partei wollten diesen mittragen.
Parteiinterne Kritiker sehen sich bestätigt
Der damalige FDP-Vizepräsident Christian Wasserfallen zählte 2019 zu den parteiinternen Kritikern. Nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes sieht er sich in seiner Skepsis bestätigt. Die ökologische Wende sei ein Irrtum, sagt er: «Das ist nicht die Zukunft der FDP.»
Für den Berner Nationalrat müssen die Freisinnigen die Konsequenzen aus dieser Niederlage ziehen – sicherlich auf thematischer, allenfalls auch auf personeller Ebene. «Einige, die das veranstaltet haben, müssen sich jetzt fragen, ob sie eine Kurskorrektur mittragen können», so sein Fazit.
Der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart geht weniger weit als sein Parteikollege. «Dieser Kurs und das CO2-Gesetz sind nicht allein durch Petra Gössi beeinflusst», argumentiert er. Innerhalb der Partei müsse man sich aber die Frage stellen, was man besser hätte machen können.
Kurswechsel kommt für Gössi nicht infrage
Für die Parteipräsidentin Gössi selbst kommt ein Kurswechsel dagegen nicht infrage. «Wir werden unseren ökologischen Kurs nicht einfach so zurückfahren», sagt sie. Und weist auf das von der FDP erarbeitete Umweltpapier hin. Dieses sei weitaus liberaler ausgestaltet als das CO2-Gesetz.
Die Abstimmungsniederlage ist für sie kein Grund für einen Abgang. «Ich werde meine politische Zukunft sicher nicht aufgrund einer Behördenabstimmung bestimmen», so Gössi. Es sei ihr Führungsverständnis, innerhalb der Partei auch kontroverse Diskussionen zuzulassen – z. B. zur Umweltpolitik. Nur zwei Jahre nach dem Grundsatzentscheid hin zu einer ökologischeren Politik dürften in diesen Diskussionen einige kritische Fragen auf sie zukommen. Schreibt SRF.
Die Argumente des Berner FDP-Hardliners Christian Wasserfallen wirken nicht wirklich überzeugend.
Auch wenn es zutrifft, dass ausser Parteipräsidentin Petra – oder «Greta», wie Gössi nach ihrem Wendehalsmanöver vor den National- und Ständeratswahlen 2019 selbst von Parteimitgliedern spöttisch genannt wurde – «... sich einige (von der FDP, Anmerkung) jetzt fragen müssen, die das veranstaltet haben, ob sie eine Kurskorrektur mittragen können».
Damit meint Wasserfallen vermutlich unter anderen auch und vor allem den grossen Luzerner Staatsmann und FDP-Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller, der sich 2019 aus nachvollziehbaren Gründen demonstrativ hinter Gössis politische Mogelpackung stellte und damit sogar eine Spaltung der Partei in Kauf nahm.
Irgendwie auch verständlich. Das Thema «Klimaschutz» beherrschte den Wahlkampf 2019 wie kein anderes und zwang nicht nur die FDP zu waghalsigen Täuschungsmanövern. Eine Disziplin, die Müller wie kaum ein anderer beherrscht.
Nur sein Kontrahent um den Luzerner Ständeratssitz, Franz Grüter von der SVP, zeigte (wertfrei!) klare Kante und blieb seinen Überzeugungen treu, die zwar auch nicht zu 100 Prozent mit der von der Partei vorgegebenen Hardcore-Linie übereinstimmten.
Der solariumgebräunte Schönling und Liebling aller Schwiegermütter Damian Müller hatte gar keine andere Wahl, als auf den «Klimaschutz»-Zug aufzuspringen, wollte er seinen Platz an den Futtertrögen des Schweizer Parlaments für vier weitere Jahre sichern.
Seine ersten vier Jahre als Ständerat waren entgegen seinem vollmundigen Wahlkampfslogan «Packt an. Setzt um» aus dem Jahr 2015verdächtig ruhig über die Politbühne gegangen.
So verwunderte es auch nicht, dass Müller vor den Wahlen 2019 in einem Interview von der Luzerner Zeitung gefragt wurde, was er denn in den vergangen vier Jahren eigentlich getan habe, es sei bis jetzt, also kurz vor den anstehenden Wahlen, verdächtig ruhig um ihn gewesen.
Worauf Müller sinngemäss antwortete, was heute noch nachzulesen ist, er habe die ersten drei Jahre im Ständerat dem Aufbau seines Netzwerks gewidmet. Kein Wunder wird Müller von Blick als «Pöstchenjäger» bezeichnet. Diesem Ruf wurde der ehemalige Kiosk-Verkäufer kurze Zeit nach der Wiederwahl einmal mehr gerecht.
Würde Wasserfallen seinen Worten nun Taten folgen lassen, wäre es eine einfache Angelegenheit, den verlogenen Wendehals-Kurs der FDP zu korrigieren. Es wird doch wohl in diesem Sammelsurium neoliberalsten Gedankenguts – genannt FDP-Parteiprogramm – sicherlich einen Passus geben, mit dem sich eine Urabstimmung durchführen liesse. Doch dazu fehlt Wasserfallen scheinbar der Mut.
Greta-Petra und der/die/das Damian können aufatmen. Sie können weiterhin «netzwerken». Auch und vor allem zum eigenen Wohl, wie Müller beweist.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
13.6.2021 - Tag der Schweizer-Käppis
Demonstrationen in Luzern verliefen grösstenteils friedlich – zwei Personen festgenommen
Für Samstagnachmittag wurde in den sozialen Medien zu einer Kundgebung gegen die Corona-Massnamen aufgerufen. Gleichzeitig rief die Gruppierung RESolut zu einer Gegendemo auf. Eine Konfrontation der beiden Gruppierungen konnte verhindert werden. An der Bahnhofstrasse griff ein Mann den Kundgebungszug tätlich an. Er wurde festgenommen. Ein weiterer Mann wurde vorläufig festgenommen, welcher die Einsatzkräfte tätlich anging. An der Kundgebung nahmen geschätzte 400 Personen teil. Insgesamt wurden durch die Polizei über 30 Wegweisungen ausgesprochen.
Für Samstagnachmittag, 12. Juni 2021 wurde in den Sozialen Medien zu einer Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen aufgerufen. Gleichzeitig rief die Gruppierung RESolut zu einer Gegenkundgebung auf. Zu einer Konfrontation der beiden Gruppierungen ist es nicht gekommen. Gegen 13.30 Uhr versammelten sich mehrere kleinere Gruppierungen von Gegnern der Corona-Massnahmen an der Pfistergasse und setzten sich in Richtung Bahnhofstrasse in Bewegung. In diesem Bereich griff ein Mann Teilnehmende des Kundgebungszuges tätlich an. Er wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei festgenommen. Es handelt sich um einen 36-jährigen Schweizer. Das Motiv für die Tätlichkeiten ist derzeit nicht bekannt.
Weiter wurde ein 54-jähriger Demoteilnehmer festgenommen, welcher die Einsatzkräfte tätlich anging.
An der Kundgebung der Massnahmen-Kritiker nahmen geschätzte 400 Personen teil. Diese zogen quer durch die Altstadt, Nationalquai, Haldenstrasse, Schwanenplatz, Bahnhofplatz, Inseliquai zur Ufschötti, wo sich die Kundgebung allmählich auflöste.
Im Vorfeld der Kundgebung sprach die Polizei über 30 Wegweisungen aus.
Für die Kundgebung ging bei der Stadt Luzern kein Gesuch ein, diese war somit nicht bewilligt. Das vorhandene Bildmaterial wird ausgewertet und identifizierte Personen werden durch die Stadt Luzern verzeigt.
Schreibt die Luzerner Polizei am 12.6.2021.
Wenn (vorwiegend) ältere weisse Männer in der Stadt Luzern aufmarschieren, bekleidet mit «Switzerland»-T-Shirts chinesischer Herkunft und «Schweiz»-Käppis, die vermutlich den schütteren Haarwuchs vor der brennenden Sonne schützen sollen, können bizarre Situationen entstehen. Schweizerfahnen und andere skurrile Flaggen, die im Sommerwind wehen, verstärken diesen Eindruck. Wie gestern an der Bahnhofstrasse in Luzern.
Der Lärm war schon von weitem zu vernehmen und ähnelte irgendwie der Filmmusik aus Werner Herzogs «Jeder für sich und Gott gegen alle». (Toller Film übrigens!) Je näher man der Rathausbrücke kam, umso lauter wurde der Klamauk aus Treichelklängen und Gebrüll der Demonstranten und das Aufgebot der Luzerner Polizei wandelte sich vom normalen Streifenpolizist zu einer martialisch aussehenden, schwarz gekleideten Elitetruppe. Geschützt durch Kopfhelme und Schutzschilde und schwer bewaffnet mit irgendwelchen Schnellfeuergewehren. Vermutlich Gummischrotgewehre. Rathaussteg und Bahnhofstrasse (ab Stadttheater) waren damit hermetisch abgeriegelt.
Eine junge Polizistin am Strassenrand danach gefragt, was denn hier los sei, antworte: «Das darf ich Ihnen nicht sagen.» Dabei war es ja augenfällig, dass es sich um eine Demonstration handelte. Zugegeben, eine dumme Frage. Aber wofür oder wogegen war nicht klar. Ein weiteres Nachfragen förderte auch nicht mehr als ein lächerliches «das darf ich Ihnen nicht sagen» zutage. Ein älterer Polizist brachte zumindest etwas Licht ins Dunkle, weil ihm mit grösster Wahrscheinlichkeit die Reaktion der eingeschnappten Polizistin etwas peinlich war. «Ich glaube, es handelt sich um eine Demo gegen Corona, aber ich weiss es nicht genau.» Hier lag also der Hase im Pfeffer. Die junge Dame benötigt vermutlich einen zusätzlichen Kommunikationskurs an der Polizeischule, um den Unterschied zwischen «Nichtwissen» und «Auskunftsverbot» zu lernen.
Einzelne kleine Plakate mit zwei aufgedruckten «Nein», die die demonstrierende Gruppe mit sich führte, lösten das «Geheimnis» auch nicht wirklich: Es ging bei der Demonstration mit grösster Sicherheit um die Abstimmungen vom Sonntag, 13. Juni 2021. Aber um welche? Die lautstark skandierten Rufe «Freiheit», «Freiheit», Freiheit», ausgestossen von Schweizerinnen und Schweizern im kitschigen Swissness-Dress, wirkten auf mich absonderlich und grotesk.
Sicherlich läuft auch in der Schweizer Gesellschaft einiges schräg, wofür die Politik die Verantwortung trägt. Wer denn sonst? Aber dass die Schweizer Bevölkerung ein «unfreies» Dasein fristet, habe ich so noch nie wahrgenommen. Man darf ja ruhig über Maskenpflicht, Corona-Impfung (die ja nicht einmal Pflicht ist!) und weiss der Teufel was alles diskutieren und hinterfragen, aber mit «Unfreiheit» haben die staatlich verordneten Massnahmen rein gar nichts zu tun. Und schon gar nicht die Abstimmungen an den eidgenössischen Wahlurnen. Im Gegenteil: Sie sind Ausdruck einer lebhaften Demokratie, die man allerdings wahrnehmen muss. Ob Demonstrationen mit eigenartig daher gekeuchten, nichtssagenden und im schlimmsten Fall sogar falschen Parolen wirklich den Mühseligen und Beladenen weiterhelfen, ist mehr als fraglich.
Ein Blick auf Russland oder Nordkorea und etliche andere Staaten unseres Erdballs könnte möglicherweise diese eigenartige Schar von Unzufriedenen über die Freiheiten der Schweizer Bevölkerung eines Besseren belehren. Kaum ein anderes Land verfügt auf dieser Erde über mehr Instrumente, um so ziemlich jede Verfügung des Staates zu korrigieren. Unser freies Wahlrecht lässt das zu und ist ein hohes Gut. Man muss es nur wahrnehmen. Dass dem einen oder andern nicht jeder Volksentscheid genehm ist, liegt in der Natur einer Demokratie.
Wer heute in Luzern die (mangelnde) Freiheit in der Schweiz angeprangert hat, sollte tunlichst keine EM-Fussballspiele aus der aserbeidschanischen Hauptstadt Baku mehr konsumieren, selbst wenn die Schweizer Fussballnationalmannschaft der abgehobenen kosovarischen Fussballmillionäre, von denen es in der Schweiz laut Bundesrätin Amherd fast keine gibt, dort zum 1:1 aufspielt. Denn Aserbeidschan ist ein autokratisch regierter Staat, der nur dank seiner gewaltigen Ölvorkommen Mitglied des Europarats ist. Geographisch liegt Aserbeidschan in Vorderasien und die Präsidentschaft wird inzwischen innerhalb einer einzigen Familie über geheime Wahlen weitervererbt.
Mit Demokratie und Freiheit hat das nichts zu tun. Auch wenn uns die von Aserbeidschan mit Unsummen bezahlten Lobbyistinnen und Lobbyisten das weismachen wollen. Warum eine Europameisterschaft überhaupt in Vorderasien ausserhalb Europas stattfindet, entzieht sich meinen Vorstellungen. Hängt aber vermutlich mit dem Geldsegen zusammen, den Aserbeidschan an die UEFA ausschüttete.
Alles klar? Freiheit und EM-Fussballspiele in Baku passen nicht wirklich zusammen. Ich erwarte umgehend eine Demonstration. Und zwar in Baku!
Damit auch der/die/das dümmste Alu-Hut weiss, was «Freiheit» wirklich bedeutet.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
12.6.2019 - Tag des Sündenfalls von Annalena Baerbock
Kanzlerkandidatin Baerbock: Das war's
Annalena Baerbock hat ihren Lebenslauf aufgehübscht, eine vergleichsweise kleine Sünde. Ihre Wahlchancen sind dennoch ruiniert, denn sie hat das Wichtigste verspielt, was sie hatte: ihre Glaubwürdigkeit.
Die nächste deutsche Bundeskanzlerin wird nicht Annalena Baerbock heißen. Daran besteht nach den letzten Tagen kaum ein vernünftiger Zweifel. Die grüne Spitzenkandidatin hat nur noch die Möglichkeit, selbst über Zeitpunkt und Form ihrer Niederlage – und damit über ihre politische Zukunft – zu entscheiden.
Selbstverständlich gibt es Wunder. Armin Laschet mag am Tag vor der Bundestagswahl den Grünen beitreten, zeitgleich können Markus Söder und Friedrich Merz beschließen, gemeinsam nach Fidschi auszuwandern. Vorstellbar ist alles. Aber nicht jede Absurdität muss bei einer Analyse berücksichtigt werden. Und wenn man das nicht tun will, dann bleibt übrig: Annalena Baerbock wird es nicht schaffen.
Ist der Niedergang das Ergebnis von niederträchtiger Berichterstattung? Oder eigene Schuld? Es ist eine Mischung aus beidem.
Es war vorhersehbar, dass manche Medien Kampagnenjournalismus betreiben würden. Dass sie kleine Fehler der grünen Kandidatin zu einem riesigen Ballon aufblasen und sachliche Aussagen radikalisieren würden. Derlei ist nicht schön, aber erwartbar. Und wer ganz vorn auf der politischen Bühne, sogar auf der weltpolitischen Bühne mitspielen möchte, muss damit umgehen können.
Das konnte Annalena Baerbock. Sie reagierte gelassen. Und es spricht vieles dafür, dass sich eben doch nicht jede Diskussion über ein kompliziertes Thema in eine provokante Schlagzeile pressen lässt. Beispiel: Der künftige Benzinpreis – bei dem die Regierungsparteien und die Grünen gar nicht so weit auseinanderliegen.
Es ist jedoch anzunehmen, dass manche ihr Glück nicht fassen konnten, als sie feststellen durften, wie hilfreich ihnen Annalena Baerbock selbst in die Hand spielte. Wie kann man so blöd oder so eitel oder beides sein, einen aufgehübschten Lebenslauf im Netz stehen zu lassen, bei dem sich alle Gegnerinnen und Gegner einfach bedienen können? Nehmt, was ihr wollt. Ist ja genug da. Wir korrigieren gern auch mehrfach.
Es gibt sicher viele Leute, die das Thema gar nicht interessiert oder die Kritik an Baerbock für übertrieben halten. Schließlich ist seinerzeit sogar der CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg mit dem Argument verteidigt worden, wir hätten doch alle in der Schule mal abgeschrieben. Als sei eine plagiierte Doktorarbeit dasselbe wie ein Spickzettel in der 8. Klasse.
Ist sie nicht. Und um es ganz deutlich zu sagen: Ungenaue Angaben zu Studienabschlüssen und Mitgliedschaften sind nicht vergleichbar mit Betrug bei einer Promotion. Das eine ist peinlich, das andere ist unverzeihlich. Beiseite gesprochen: Ich verstehe nicht, wie die SPD an Franziska Giffey als Spitzenkandidatin für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus festhalten kann. Der Doktortitel ist ihr nun aberkannt worden, als Ministerin ist sie untragbar – aber für Berlin genügt es? Seltsam.
Annalena Baerbock hat sich sehr viel weniger zuschulden kommen lassen als andere politische Führungskräfte. Daher ist und wäre es verständlich, wenn sie und die Grünen sich insgesamt ungerecht behandelt fühlten. Aber ihre Popularität war eben noch nicht gefestigt genug, um diese Affäre aussitzen zu können. Wenn auch nur ein paar Prozent derjenigen abspringen, die sich überlegt hatten, erstmals in ihrem Leben grün zu wählen, dann ist der mögliche Sieg verspielt.
Es ist kühn, ohne jede Regierungserfahrung ins Kanzleramt einziehen zu wollen. Aber das kann – vielleicht – gelingen, wenn ein hinreichend großer Teil der Bevölkerung sich nach einem Kurswechsel und einem politischen Neuanfang sehnt. Das war die große Chance für Annalena Baerbock. Sie musste nur etwas, ein einziges Kleinod schützen: nämlich die eigene Glaubwürdigkeit.
Dieses Kleinod ist verloren gegangen. Andere, die sich mehr vorwerfen lassen müssen, hatten und haben auch mehr in die Waagschale zu werfen als die Kandidatin der Grünen. Der Lebenslauf von Armin Laschet enthält ebenfalls – nennen wir es freundlich: Lücken. Aber er war eben jahrelang Ministerpräsident. Das beruhigt verunsicherte Wählerinnen und Wähler.
Tagelang musste jetzt Robert Habeck im Fernsehen und überall sonst das schlechte Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt und die Ungereimtheiten im Lebenslauf der Spitzenkandidatin erklären. Machte er auch brav, mal mehr, mal weniger schmallippig. Annalena Baerbock war weitgehend abgetaucht. Souverän wirkte das nicht. Heute nun äußert sie sich in der ARD, am Freitag beginnt der Parteitag. Dann gibt es kein Entrinnen mehr. Sie wird Farbe bekennen müssen.
Wenn Annalena Baerbock so klug ist, wie viele glauben, dann zieht sie sich zurück und sagt sinngemäß: Blöde, kleine Fehler von mir gefährden derzeit, dass wir das verwirklichen können, was uns allen am meisten am Herzen liegt. Nämlich unsere Politik, vor allem den Kampf gegen den Klimawandel. Um unsere Chancen zu maximieren, übergebe ich den Stab an Robert. Und wünsche ihm alles, alles Gute.
Reaktion? Stehende Ovationen. Annalena Baerbock hätte ihr Eigeninteresse hinter die Interessen der Partei, des Landes und der Welt gestellt. Sie wäre von da an eine Ikone. Und könnte alles werden, vielleicht sogar irgendwann Kanzlerin, falls Robert Habeck es nicht schaffen sollte. Die große Geste würde das, was bisher war, überstrahlen. Aber dazu müsste die Kandidatin den Schritt zurück ins Glied eben erst einmal wagen. Ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Und deshalb heißt der nächste Kanzler Armin Laschet.
Mit Frauenfeindlichkeit hat all das übrigens nichts zu tun. Wenn Robert Habeck seinen Lebenslauf geschönt hätte, müsste er sich ebenfalls Nachfragen gefallen lassen. Der Kampf für Gleichberechtigung kann nicht bedeuten, dass Frauen keinerlei Kritik aushalten müssen. Schreibt Bettina Gaus im SPIEGEL.
Der tiefe Fall einer von den Medien bis zur Hysterie hochstilisierten Ikone Annalena Baerbock: Martin Schulz (SPD, 2017) reload.
Ein gut analysierter Artikel von Bettina Gaus, obschon auch ihr Hausblatt DER SPIEGEL an der unsäglichen Heiligsprechung von Baerbock wesentlich mitbeteiligt war. Seriöser Journalismus sieht anders aus als die – dem Clickbaiting geschuldete – unerträgliche Lobhudelei fern jeglicher Realität auf diese unbedarfte Kanzlerkandidatin vor ihrem eher lächerlichen Sündenfall.
Da hätte es von allem Anfang an gravierendere Schwachstellen als die persönliche Selbsterhöhung und Hochstapelei dieser Dame gegeben, die zur Diskussion griffbereit zur Verfügung standen. Man hätte es nur tun müssen.
Doch die Medien lernten nichts aus dem Desaster im Jahr 2017, als sie den peinlichen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz medial zum Messias erklärten, der dann nach kurzer Zeit nicht mehr wie Jesus barfuss übers Wasser gehen konnte, sondern an der eigenen Hybris erstickte und zur Lachnummer mutierte – die er notabene schon immer war – bis er endgültig in der Versenkung verschwand.
Nach dem für alle einigermassen vernunftsorientierten Menschen logischen Absturz der bis ins Groteske von vielen Journalisten und Journalistinnen hochgejazzten Grünen Ikone und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hätte ich hier jetzt gerne den schlesischen Jurist und Schriftsteller Paul Winckler (1630 - 1686) zitiert: «Je höher der Affe steigt, desto mehr bleckt ihm der Hintern.»
Doch die klugen Affen haben es nicht verdient, mit Annalena Baerbock verglichen zu werden.
Festgehalten sei, dass Frau Gaus in ihrer Analyse mit einer Aussage völlig daneben liegt: «Sie (Annalena Baerbock, Anm.) musste nur etwas, ein einziges Kleinod schützen: nämlich die eigene Glaubwürdigkeit.»
Liebe Frau Gaus, bei allem Respekt: Was niemals vorhanden war, kann auch nicht geschützt werden.
Eine verlogenere Sippe als die politische Elite der Grünen, die mit aller Macht zurück an die Futtertröge der deutschen Bundesregierung drängt, ist ausserhalb von Sekten kaum zu finden.
Selbstverständlich trifft es zu, dass auch die anderen Parteien vor verlogenen Wahlkampfparolen zum reinen Machterhalt nicht zurückschrecken.
Nur hängt bei denen der moralische Kompass, der in seinem Absolutismus dem Koran oder der Bibel kaum nachsteht, nicht so hoch wie bei den Grünen.
Wenn zwei das Gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.6.2021 - Tag der Löcher
Fux über Sex: T. tuts weh – «Er behauptet, dass alle Frauen Analsex mögen»
Ich bin seit neustem auf Tinder und stelle fest, dass praktisch alle Männer auf Analsex stehen. Ich habe es aber noch nie geschafft, welchen zu haben. Es tat immer höllisch weh. Die Männer behaupten, dass praktisch alle Frauen darauf stehen. Als wir unter Freundinnen darüber geredet haben, klang das jedoch ganz anders. T. (39, w)
Liebe T.
Überzeugungsversuche im Stil von «Komm, mach mit! Alle andern finden es auch gut!» haben bei aller Liebe den Charme und das Niveau von Pausenplatzgesprächen. Davon kannst du dich getrost distanzieren, und zwar komplett unabhängig davon, ob es inhaltlich nun stimmt oder nicht. Denn das, was angeblich alle andern machen, wollen und gut finden, hat selten dazu beigetragen, persönliches Glück zu finden.
Die zentrale Frage ist, wie du zum Thema Analsex stehst. Du schreibst, dass du es noch nie geschafft hast, welchen zu haben. Diese Aussage kann man vielseitig interpretieren. Wenn sie ein Hinweis darauf ist, dass sich hier ein Leistungsdenken in deine Sexualität geschlichen hat, dann wäre es schön, wenn du das relativieren könntest. Denn guter Sex erreicht man nicht über ein langes Pflichtenheft oder eine Checkliste, von der möglichst viel abzuhaken ist.
Wenn dich Analsex fasziniert und du das gern ausleben möchtest, dann ist diese Sexpraktik lernbar. Du musst dafür deinen Körper gut kennen und ein paar Punkte beachten. Für schönen Analsex braucht es Geduld und ein Vorspiel, bei dem man den Fokus auf die Entspannung des Analbereichs legt. Das braucht Zeit, Vertrauen und etwas Übung. Auch der Einsatz von Gleitmittel ist wichtig und hilfreich. Ausführlichere Infos bekommst du in einer Beratung oder in sexologischer Literatur. Und wenn du für immer und ewig auf Analsex verzichtest, dann ist das auch in Ordnung. Selbst wenn es alle andern tun würden. Schreibt Caroline Fux im Blick.
Der Sommer 2021 hat definitiv Einzug gehalten: Das beweisen nicht die Meteorologen, sondern das alljährlich stattfindende mediale Sommerloch.
Die Corona-Pandemie ist als Thema abgehakt. Was bleibt da noch?
Das Sommerloch wird ja nicht umsonst als Sommerloch umschrieben. Ab jetzt geht's in den Medien bis zum Spätherbst im wahrsten Sinne des Wortes nur noch um Löcher.
Dabei schrecken selbst unsere medialen Opinionleader auch vor dem allerwertesten Loch der Menschheit nicht zurück: Dem Arschloch.
Frau Fux beweist dies auf ihre wie gewohnt sensible Art und Weise, die Schweizer Nati-Fussballer führen Bundesrätin Viola Amherds ebenso legendäres wie auch dümmstes Zitat aus dem Jahr 2020 «Die Schweiz hat kaum Fussballmillionäre» in einem weiteren Blick Artikel ad absurdum und 20Minuten berichtet atemlos über einen masturbierenden US-Journalist.
Wie schon Hölderlin, leicht abgewandelt, treffend bemerkte: «Da, wo die Sonne am heissesten scheint, wächst der Schatten auch.»
Das mediale Sommerloch ist eines dieser Schattengewächse.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.6.2021 - Tag der intellektuellen Hochstapeler
Gewinne der Nationalbank aus den Negativzinsen und Rentenalter 65 für Frauen zur Sanierung der AHV?
Die Bürgerlichen haben aus der letzten gescheiterten AHV-Reform ihre Konsequenzen gezogen. Die letzte Reform wurde wesentlich von der früheren CVP, der SP und den Grünen getragen. Daraus zogen die Bürgerlichen die Konsequenz, dass sie bei der aktuellen Reform den bürgerlichen Schulterschluss gegen das links-grüne Lager suchen.
Mit dem Resultat, dass die Mitte, die FDP und die SVP das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 erhöhen wollen und dafür gewisse Kompensationsmassnahmen vorsehen – gegen den Widerstand von links-grün. Die Ratslinke kritisiert die Erhöhung des Rentenalters grundsätzlich, zudem seien die Kompensationsmassnahmen viel zu tief.
Linke kritisiert «Rentenabbau»
Zur grundsätzlichen Kritik: Während die Bürgerlichen argumentieren, dass mit der Erhöhung des Rentenalters keine Rente gekürzt würde, sieht die Linke darin eine Abbaumassnahme im Vergleich zur heutigen Situation. Tatsächlich erhalten Frauen, die heute mit 64 in Rente gehen, eine normale Rente; künftig hätten diese Frauen eine Rentenkürzung, weil sie mit 64 vorzeitig in Rente gingen. Der Abbau beträfe aber auch Frauen, die mit 65 in Rente gehen. Wer künftig mit 65 in Rente geht, bekäme die normale Rente; heute hingegen können Frauen, die über das heutige Rentenalter von 64 hinaus bis 65 arbeiten ihre Rente aufbessern.
Bürgerliche mit Zuversicht an die Urne
Trotz dieser linken Kritik sind die Bürgerlichen zuversichtlich, dass sie eine Volksabstimmung gegen die SP, die Grünen, die Gewerkschaften und auch die Frauenorganisationen gewinnen dürften. Sie argumentieren, die Erhöhung des Frauenrentenalters sei ein Gebot der Stunde, entspreche den gesellschaftlichen Entwicklungen und sie verweisen auch auf die Kompensationsmassnahmen für eine Übergangsgeneration.
Zu den Kompensationsmassnahmen: Hier meldet die Ratslinke eine weitere grundsätzliche Kritik an. Sie argumentieren, die Kompensationsmassnahmen seien viel zu tief, auch im Vergleich zu früheren Rentenalterserhöhungen. Diese seien nur dann erfolgreich gewesen, wenn sie grosszügig kompensiert worden seien. Die aktuelle Reform schneidet da tatsächlich schlecht ab. Die Linke ist deshalb zuversichtlich, dass sie eine solche Vorlage «auf dem Buckel der Frauen» vor dem Volk bodigen könnten. Das Referendum ist bereits angekündigt.
Nationalbank als Zünglein an der Waage?
Nun geht die Vorlage zurück in den Ständerat. Aber an den Grundsätzen – Erhöhung des Frauenrentenalters, Kompensationsmassnahmen und Erhöhung der Mehrwertsteuer – dürfte sich nicht mehr viel ändern. Die Chancen der Linken sind dabei durchaus intakt, die Vorlage vor dem Volk bodigen zu können.
Doch hier kommt nun noch ein weiterer Punkt ins Spiel – die Frage nämlich, ob die Gewinne der Nationalbank aus den Negativzinsen in die AHV fliessen sollen. Der Nationalrat sagte gestern Ja, der Ständerat zwar nein. Aber wenn der Ständerat kippen sollte, wäre dies eine substantielle Zusatzfinanzierung. Das könnte die Chancen vor dem Volk möglicherweise verbessern. Schreibt SRF.
Unsägliche Stereotypen aus der Urzeit der Menschheit wie «Die Bürgerlichen» gehören abgeschafft und müssten in einer der «Political Correctness» bis zum geht nicht mehr huldigenden Gesellschaft unter den Diskriminierungsparagraph gestellt werden.
Bürgerlich? Was soll denn dieser Begriff bedeuten? Dass die «FDP», die «Grünliberalen», die «Mitte» und ab und zu auch die Zwitterpartei «SVP» die wahren Bürger und Bürgerinnen sind, nicht aber die Bevölkerung, die sich an der Wahlurne für andere Parteien entscheidet? Was für ein aus der Zeit gefallener Anachronismus! Der im Umkehrschluss einen Grossteil der Schweizer Bevölkerung als «unbürgerlich» diskriminiert.
Aber kommen wir zum Kern des Artikels: Dass FDP und Mitte-Gitte (es würden sich noch andere Veralberungen dieses lächerlichen Parteinamens anbieten; ich verzichte darauf) keine andere Lösung zur Sanierung der AHV als die Anhebung des Rentenalters anzubieten haben, verwundert nicht.
Das steckt in der DNA der Neoliberalen. Vorerst sind es «nur» die Frauen, die mit einem höheren Renten-Eintrittsalter den Preis für das Versagen der Politik bezahlen. Doch keine Bange: Die Apologeten der menschenverachtenden Neolippen-Kakophonie werden in einem weiteren Sanierungs-Schritt auch die «Herren der Schöpfung», also die Männer, zur finanziellen Blutspende bitten.
Auch der Vorschlag, die AHV über die Negativzinsen der Nationalbank zu sanieren, der selbst von einigen SVP-Mitgliedern*innen unterstützt wird, verursacht diesen «Bürgerlichen» nicht nur Bauchschmerzen, sondern vermutlich auch Hämorrhoiden. Die Neolippen werden ja nicht umsonst als «Wurmfortsatz des Anus» bezeichnet. Dabei sind es genau die Nullzinspolitik und der daraus entstandene Negativzins, die für die verschlechterte Anlage-Performance der AHV ebenfalls wesentlich beigetragen haben. Ganz abgesehen davon, dass die Schweizer Nationalbank – zumindest de jure – dem Schweizer Volk und nicht allein den «Bürgerlichen» gehört.
Gewisse FDP-Mitglieder*innen haben sich ja bezüglich der Thematik um die Negativzinsen der Nationalbank inzwischen mit schrillen Interview- und Social Media-Beiträgen zu Wort gemeldet. Wir dürfen also sicher sein, dass dieser Vorschlag im Ständerat keine Mehrheit findet. Spätestens an den eidgenössischen Wahlurnen dürfte es dann allerdings etwas anders aussehen. Das weiss auch die einzig und allein «wahlurnenstrategisch» denkende SVP.
Dass sich der ehemalige Kioskverkäufer und FPD-Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller, der in seinem ganzen Leben noch nie eine Universität von innen gesehen hat, inzwischen sogar mit einem Zitat von Immanuel Kant zu Wort meldet, ist nur noch eine weitere Lachnummer aus dem nebulösen Absurdistan des grossen Luzerner Staatsmannes.
Da waren die intellektuellen Absonderungen über seine Sexualität, die Müller im Wahlkampf 2019 ungefragt den Luzerner Journalisten*innen bei seinen Interviews in die Berichterstattung drückte, wesentlich amüsanter und schafften es immerhin, an der Luzerner Kanti zusammen mit Müllers Wahlslogan «Packt an» einen Müller-Running-Gag zu produzieren. Ein herrlicher Kalauer um die Frage, wo packt er an. Ja, die Luzerner Kanti hat ein paar richtig kreative Reim-Genies.
Abgesehen davon, dass sich Kant wohl im Grabe umdrehen würde, wüsste er, dass er von einem intellektuellen Tiefstflieger missbraucht wird, fragen sich inzwischen nicht wenige Luzernerinnen und Luzerner: «Wer hat diese zitatklopfende «Mehr Schein als Sein»-Karikatur aus dem Seetal nur gewählt?»
Ich jedenfalls nicht, so viel sei hier schon mal verraten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
9.6.2021 - Tag der verlogenen Versprechen
Offensive des US-Senats: 244.000.000.000 Dollar gegen Chinas Dominanz
»Unsere Tage als dominante Supermacht könnten gezählt sein«: Der US-Senat hat ein Milliarden-Paket geschnürt, das Chinas Vormachtstellung bekämpfen soll. Es sieht auch neue Sanktionen vor.
Es kommt nicht oft vor, dass sich Demokraten und Republikaner im US-Senat einig sind – und aus dieser Einigung auch noch konkrete Schlüsse ziehen. Beim Thema China allerdings gab es nun einen milliardenschweren Konsens. Der Senat stimmte in der Nacht für ein umfangreiches Gesetzespaket, das die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten gegenüber chinesischer Technologie stärken soll.
»Wenn wir nichts tun, könnten unsere Tage als dominante Supermacht gezählt sein. Wir wollen nicht, dass diese Tage unter unserer Regie enden. Wir wollen nicht, dass Amerika in diesem Jahrhundert eine mittelmäßige Nation wird«, sagte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Dienstag. Der Entwurf bezeichnet China als »größte geopolitische und geoökonomische Herausforderung« der US-Außenpolitik.
Mit 68 zu 32 Stimmen genehmigte der Senat etwa 190 Milliarden Dollar für US-Technologie und -Forschung. Aus dem demokratischen Block hatte nur der ehemalige Präsidentschaftsanwärter Bernie Sanders dagegen gestimmt. Er hatte unter anderem moniert, dass das Paket vermutlich mit mehreren Milliarden das Weltraumprogramm von Milliardär Jeff Bezos fördern würde.
Zudem sollen mit Ausgaben in Höhe von 54 Milliarden Dollar die US-Produktion und die Forschung in den Bereichen Halbleiter und Telekommunikationsausrüstung angekurbelt werden, einschließlich zwei Milliarden Dollar für Chips, die von Autoherstellern verwendet werden.
Derzeit ist die Branche von massiven Engpässen geplagt, da infolge der Coronakrise erhebliche Produktionseinschränkungen entstanden waren. Senator Todd Young, ein republikanischer Mitverfasser des Entwurfs, sagte, dass es bei dem Gesetz »nicht nur darum geht, die Kommunistische Partei Chinas zu schlagen, (es) geht darum, die Herausforderung zu nutzen, um durch Investitionen in Innovationen eine bessere Version von uns selbst zu werden.« Der Gesetzentwurf muss nun das Repräsentantenhaus passieren.
Neue Sanktionen sollen möglich werden
Das Papier enthält neben Investitionen auch konkrete Gegenschritte gegen China. So würden bei Inkrafttreten neue Sanktionen etwa bei Menschenrechtsverletzungen durch die chinesische Regierung möglich. Zudem wird darin eine neue Studie zum Ursprung des Coronavirus und ein diplomatischer Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in der Volksrepublik gefordert. Allein 300 Millionen Dollar sind laut »Washington Post« für Maßnahmen gegen den Einfluss der Kommunistischen Partei vorgesehen.
Zuletzt hatte US-Präsident Joe Biden eine Liste mit 59 chinesischen Firmen vorgestellt, in die keine US-Investitionen mehr getätigt werden dürfen. Die Sanktionen zielen den Angaben zufolge auf Unternehmen ab, denen vorgeworfen wird, an Technologien beteiligt zu sein, die »Unterdrückung oder schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen erleichtern«. Dies untergrabe »die Sicherheit oder die demokratischen Werte der Vereinigten Staaten und unserer Verbündeten«, hieß es aus Washington.
Außerdem haben die USA einen Handelspakt mit Taiwan angekündigt – ein klares Signal an China, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet. Schreibt DER SPIEGEL.
244 Milliarden tönt schon mal gut. Dazu noch das in God's own Country querbeet durch alle Bevölkerungs- Partei- und Gesellschaftsschichten populäre Schlagwort «Supermacht» und fertig ist eine konsensfähige Brühe voller Pathos fern jeglicher Realität, die selbst von der Trump-hörigen Grand Old Party (GOP) der Republikaner geschluckt wird.
Den Status der Supermacht werden die USA dank ihrer gigantischen Armee, die stets in der Lage ist, mindestens drei Kriege gleichzeitig auf verschiedenen Kontinenten zu führen, in naher Zukunft kaum verlieren. Da hat ihnen der Herausforderer China ausserhalb Asiens noch nichts entgegenzusetzen.
Doch als wirtschaftlicher Hegemon, der in den vergangenen Jahrzehnten seinen «American Way of Life» beinahe nach Belieben der gesamten Welt überstülpen konnte, wanken die USA jetzt schon gewaltig. Diese globale Dominanz hat China mit langfristigen Plänen, die ebenfalls auf nichts anderem als Ausbeutung basieren, – beispielsweise in Afrika und Asien – längst übernommen. Da ist für Uncle Sam nichts mehr zu holen.
Das amerikanische Problem ist ja nicht der Status der Supermacht, sondern die hausgemachten Tragödien im eigenen Land. Noch bestimmt Amerika mit klugen Köpfen, führenden Universitäten und entsprechend hohen Zahlen an neuen IT-Patenten weltweit den digitalen Wandel mit entsprechenden Produkten und Dienstleistungen, auch wenn ihm China in diesen drei Disziplinen gefährlich nahe auf die Pelle rückt.
Wenn aber in den Vereinigten Staaten von Amerika 40 Millionen Menschen, von denen viele sogar einen Job haben, dennoch in tiefster Armut leben und von Lebensmittelgutscheinen abhängig sind, sagt das eigentlich alles über die Niedriglohnstrategie zum Wohle der Wall Street aus.
Es gibt wohl kaum ein entwickeltes Industrieland auf der Welt, in dem die Kluft zwischen Arm und Reich derart gross ist wie in Amerika. Das ist der Zündstoff für die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die lange vor Trump und dem Sturm aufs Kapitol im Jahr 2021 ersichtlich war.
Auch wenn Trump für die Genesung des Landes der falsche Mann war, sicherte er sich das Amt des US-Präsidenten vor allem mit Tiraden gegen die verhassten Eliten und wohlklingenden, verheissungsvollen Worthülsen wie «I'm going to bring back the Jobs from China to the USA».
Dass er am Ende seiner vierjährigen Präsidentschaft keinen einzigen Job von China in die USA zurückbrachte, wird nicht nur von ihm, sondern auch von seiner Partei und seinen Fans weltweit – inklusive Ober-Hardcore-Trump-Fan Roger Köppel von der «Weltwoche» – wohlweislich verschwiegen.
Doch es waren genau die über Jahrzehnte nach China (und Taiwan) verlagerten Jobs der US-Industrie, die ehemals blühende Industrie-Regionen in den USA zu «Rostgürteln» («Rust Belt») tristester Arbeitslosigkeit, Armut und Kriminalität verkommen liessen, die für die Misere auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt zu einem grossen Teil mitverantwortlich sind. Apple hingegen, um nur ein Beispiel zu nennen, brachte die Auslagerung der Herstellung ihrer Produkte wie iPhone etc. zu Foxconn Milliardengewinne, die weit höher liegen als Bidens 244 Milliarden.
Dass Joe Biden mit seinem Milliardenpaket Jobs von China in die USA zurückholen will, steht nicht zur Diskussion. Er macht da weiter, wo Trump zum Wohle der Superreichen – in Russland Oligarchen genannt – aufgehört hat. Biden subventioniert Industriezweige, die ohnehin keine Not leiden oder gar am Hungertuch nagen. Oder glaubt wirklich jemand, die US-Chip-Hersteller hätten finanzielle Probleme?
Jobs werden diese Milliarden nicht schaffen. Dafür aber noch höhere Gewinnsprünge der amerikanischen Tech-Giganten inklusive Wall Street. Da wundert es einen auch nicht, dass die Republikaner dem Milliardenpakt grosszügig zustimmten.
Biden ist, wie jeder US-Präsident, auch nur ein Trump. Allerdings mit einer etwas gemässigteren Rhetorik. «America first» im Schafspelz sozusagen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.6.2021 - Tag des Gastrogejammers
Wirte jammern über zu wenig Personal – Bund glaubt kein Wort: Seco-Direktor schiesst gegen Gastro-Chef Platzer
Obwohl die Innenräume der Restaurants seit einer Woche wieder geöffnet sind, bekunden die Gastro-Betreiber Mühe, genug Personal zu rekrutieren. Seco-Direktor Boris Zürcher hat für die Klagen des gebeutelten Gewerbes aber kein Verständnis.
Die Restaurants und Bars haben wieder geöffnet – die Krise der Gastrobranche ist damit aber nicht behoben. «Wir haben grosse Mühe, gute Fachkräfte zu finden», sagt Casimir Platzer, Präsident des Branchenverbands Gastrosuisse, gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Die Problematik habe schon vor der Krise bestanden, sich nun aber noch akzentuiert, klagt er.
Ein Grund sei ein Mangel an Dynamik auf dem Stellenmarkt. So nutzten etwa Stadthotels, die nach wie vor nicht gut liefen, das Instrument der Kurzarbeit. «Diese Angestellten sind somit nicht auf dem Markt und nehmen keine Stellenwechsel vor», so Platzer. Zudem habe wohl der eine oder andere nach den vielen Lockdown-Monaten die Perspektive verloren und die Branche gewechselt.
Kein Pizzaiolo weit und breit
Michel Péclard (51), einer der grössten Gastronomen in Zürich, bläst ins selbe Horn. «Wir und unsere Branchenkollegen verzweifeln fast!», sagt er dem «Tages-Anzeiger». Die wenigen Bewerbungen, die einträfen, seien von Leuten mit ungeeignetem Hintergrund. Er wisse gar von Betrieben, die wegen Personalmangels nicht öffnen konnten.
Gastro-König Péclard ist nicht allein. Von einer Reihe weiterer Restaurantbetreiber sind ähnliche Klagen zu hören. Das Restaurant-Imperium der Bindella-Familie kämpft ebenfalls mit den Nachwehen der langen Zwangsschliessung. So seien vor allem Pizzaioli momentan heiss gefragt. Viele seien zurück nach Italien gegangen, weswegen der Markt momentan völlig ausgetrocknet sei, sagt Bindella-HR-Chefin Monika Farmer.
In Bern hat man für die Klagen von Gastro-Chef Casimir Platzer und seinen Kollegen wenig Verständnis. Die Arbeitslosigkeit im Bereich Gastronomie sei nach wie vor überdurchschnittlich hoch, entgegnet Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Sie habe im Mai bei rund 9 Prozent gelegen – rund 16'000 Personen aus dem Gastronomiesegment seien ohne Job gewesen. «Angesichts dieser Zahlen kann ich diese Klagen der Gastwirte nicht nachvollziehen», so Zürcher. Und schiebt nach: «Es sollte eigentlich nicht wirklich schwierig sein, Personal zu rekrutieren.»
Zürcher betont ausserdem, dass die Gastronomie ein Hauptprofiteur der Kurzarbeit gewesen sei. «Eigentlich wurde dieses Instrument so intensiv eingesetzt, damit die Leute beim Anziehen der Konjunktur verfügbar sind.» Möglicherweise hätten Betriebe, die Leute entlassen haben, nun Probleme bei der Rekrutierung von neuem Personal, sagt der Seco-Leiter weiter.
Dann folgt der letzte Giftpfeiler an die Adresse der Gastrobranche: «Wer jetzt verzweifelt nach Arbeitskräften sucht, hat vermutlich vorher Fehler begangen.» Schreibt Blick.
Diese stupide und durchschaubare Diskussion des Gastgewerbes ist in der Tat nicht nachvollziehbar.Erfreulich, dass Seco-Direktor Boris Zürcher endlich den Mut fand, dem widersinnigen Katastrophengeheule der Gastrobranche zu widersprechen.
Das SECO hat gestern die offiziellen Zahlen der Arbeitslosenstatistik vom Mai 2021 veröffentlicht: Offiziell sind 142'966 Personen (73'643 Schweizer, 69'323 Ausländer) in der Schweiz bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben. Inoffiziell dürfte die Zahl weit höher sein. Insgesamt wurden 237’367 Stellensuchende registriert.
Die Zahlen für die Kurzarbeit im Monat Mai wurden (noch) nicht veröffentlicht; im März 2021 waren 340’953 Personen von Kurzarbeit betroffen. Es ist anzunehmen, dass auch im Mai 2021 sicherlich weit mehr als 100'000 Personen Kurzarbeit leisteten, was letztendlich bei einer grossen Anzahl der Betroffenen nichts anderes als «Arbeitslosigkeit» bedeutet.
Das stets gleich perverse Gejammer der Gastrobranche ist bei diesen Zahlen der Arbeitslosenstatistikund der Stellensuchenden nicht auf mangelnde Arbeitskräfte in der Schweiz zurückzuführen, sondern auf die ultrabilligen, saisonalen Arbeitskräfte aus dem Ausland, die zur perfekten Ausbeutung im Sinne der Gewinnmaximierung momentan fehlen.
Dass ein Pizzajolo unbedingt aus Italien kommen muss, ist als Argument an Lächerlichkeit kaum zu überbieten.
Das Personalproblem der Gastrobranche ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Arbeitsbedingungen und Niedrigstlöhne. Zu viel zum Sterben und zu wenig um zu leben.
Würde die Branche ihre Angestellten zu menschenwürdigen Löhnen bei vernünftigen Arbeitsbedingungen bezahlen, würden arbeitswillige Menschen vor den Gourmet-Tempeln der Nation Schlange stehen.
So viel Wahrheit muss sein. Prosit und en Guete!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.6.2021 - Tag der falschen Propheten
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt: Das kleine Wunder an der Elbe
Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewonnen, deutlich vor der AfD. Mit überraschend großem Vorsprung zog Ministerpräsident Reiner Haseloff mit seiner Partei an den anderen vorbei. Drei Faktoren spielten dabei eine bedeutende Rolle.
Wahlen gewinnt, wer Bekanntheit in Vertrauen verwandelt oder wer eine Angstvorstellung abwenden kann. Im Fall Reiner Haseloffs kam beides zusammen. Die Angstvorstellung, die AfD könne in Magdeburg stärkste Fraktion werden, ging mit einem überwältigenden Vertrauensvorsprung des Ministerpräsidenten gegenüber dem Spitzenpersonal aller anderen Parteien einher. Haseloff hat mit dem Wahlsieg dreierlei erreicht.
Er hat die Ost-West-Balance in der CDU/CSU wiederhergestellt, er hat die Position der Linkspartei als Vertreterin des Ostens endgültig untergraben, und er hat die Formierung der AfD als neue Ostpartei gebrochen, bevor sie sich zu einem politischen Faktum verfestigen konnte. Der Kommentar des sachsen-anhaltischen AfD-Chefs zu einer letzten Umfrage, die die CDU Kopf an Kopf mit der AfD verortete („Man sieht: Es kommt auf JEDE Stimme an“), fasste die Stimmung ganz gut zusammen – nur eben ganz anders, als die AfD gedacht hat.
Haseloff hat in seinem Wahlkreis Wittenberg, wo er erstmals als Direktkandidat antrat, den Erststimmenanteil der CDU gegenüber der Landtagswahl 2016 um rekordverdächtige 20,3 Prozentpunkte auf 14.600 Stimmen und den Zweitstimmenanteil immer noch um sieben Prozentpunkte auf 11.666 Stimmen gesteigert. Die CDU nahm der AfD 14 der 15 Direktmandate von 2016 ab und gewann bis auf Zeitz sämtliche Wahlkreise. Dieser eine letzte Wahlkreis ging nur mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem Prozentpunkt, 235 Stimmen, an den AfD-Bewerber. Bei den Zweitstimmen hat die vorläufig entthronte Alternative für Deutschland auch Zeitz verloren. Die CDU wuchs dort gegenüber der Wahl 2016 um 8,3 Prozentpunkte auf 9085 Stimmen, die AfD sank um vier Prozentpunkte auf 6499 Stimmen.
Das Wunder an der Elbe war nicht wirklich ein Wunder, aber es wird als ein solches wahrgenommen, und das ist für den Bundestagswahlkampf ein Weckruf. Schon eilen manche den Siegern zu Hilfe. Christian Lindner deutet an, eine Regierung aus Union und FDP entsprächen „den Erwartungen der Wähler“; das war in dieser Klarheit bei den Liberalen zuletzt im Bundestagswahlkampf 2009 so zu hören.
Nachdem die FDP kürzlich in Frankfurt am Main ein fertig ausgehandeltes Bündnis ohne die CDU hat platzen lassen – mit sehr knapper Mehrheit zwar, aber dennoch; das ist kein bloßes kommunalpolitisches Ereignis, es ging um Deutschlands Bankenmetropole in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas –, kann man in der Andeutung einen Kurswechsel vermuten.
Bei der Weckruf-Wahl des Bundestagswahljahres 2017, dem „Wunder an der Saar“, war die grundsätzliche Konstellation von Bekanntheit, Vertrauen und Angstvorstellungen ganz ähnlich. Annegret Kramp-Karrenbauer siegte entgegen allen Erwartungen, weil die Mehrheit im Saarland eine drohende erste rot-rot-grüne Koalition verhindern wollten und „AKK“ als zuverlässig galt. Natürlich hatte die Landtagswahl damals eine Signalwirkung für den Bund.
Die CDU siegte in einer für sie scheinbar aussichtslosen Lage, sie mobilisierte Kräfte, die ihre Kritiker nicht in Rechnung gestellt hatten. Das hatte eine vernichtende Wirkung für die SPD, die Bekanntheit mit Vertrauen gleichsetzte und nun merkte, was es hieß, mit Martin Schulz einen Spitzenkandidaten zu haben, den jenseits der SPD niemand kannte – während die Merkel-CDU nun von einem Landtagswahlsieg zum anderen eilte und dann die Bundestagswahl zwar knapp, aber doch unzweifelhaft gewann.
Das ist für Annalena Baerbock und die Grünen eine womöglich schon zu späte Warnung. Auch sie verwechseln Bekanntheit mit Vertrauen und merken jetzt, wie wenig identisch diese beiden Begriffe sind. Verschwiegene Nebeneinkünfte, ein unwahrhaftig formulierter Lebenslauf und die ohne Not ins Spiel gebrachte Benzinpreiserhöhung reichen aus, um eine für die Grünen brandgefährliche Ernüchterung in der Wählerschaft loszutreten.
Mit einiger Mühe könnten die Grünen die sachsen-anhaltische Landtagswahl als eine deutsche Macron-Situation empfinden – alle wählen Haseloffs CDU, um die AfD zu verhindern, so wie in Frankreich alle Macron wählten, um Marine Le Pen zu stoppen. Das wäre aber ein Trugschluss. Im Wahlkreis Magdeburg III hat die grüne Kandidatin zwar 11,6 Prozent der Erststimmen und nur 8,8 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Aber die Verluste von SPD, Grünen, AfD und Linkspartei entsprechen in absoluten Wählerzahlen keineswegs dem Zugewinn der CDU. Im Wahlkreis Halle II wiederum, einer der wenigen Kreise mit zweistelligem Grünen-Resultat, bekam die grüne Kandidatin weniger Erststimmen (13,2 Prozent) als die Grünen Zweitstimmen (15,1 Prozent).
Oder zum Beispiel Zeitz. Auch dort gingen beileibe nicht alle SPD-, Linken- oder Grünen-Wähler zur CDU. Sie gingen auch zur FDP, die bei den Zweitstimmen um 2,9 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent wuchs, und zu den Freien Wählern, die um 2,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent wuchsen. Sie gingen nur nicht zu den Grünen, dieser selbst ernannten Zukunftsalternative gegen rechts. Die Grünen verloren 135 Wähler und kamen nur noch auf 772, ein Minus von 0,1 Prozentpunkten und in absoluten Zahlen 50 Stimmen weniger als die Freien Wähler.
Man kann es nicht oft genug andeuten: Kandidatinnen und Kandidaten für das Kanzleramt werden so genau beobachtet wie künftige Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne, und wenn in der Kennenlernphase plötzlich ein Misston aufscheint, prallt die Wählerschaft viel weiter zurück, als es der Anlass eigentlich nötig erscheinen ließe. Wer für dieses Spitzenamt antritt, darf es niemals dazu kommen lassen, sein öffentliches Bild von anderen definieren und infrage stellen zu lassen. Eine Kanzlerin, ein Kanzler sitzt in deutschen Familien immer mit am Abendbrottisch, und wehe, sie oder er ist dort angeritten, bevor der Wahlschein in die Urne fällt.
Am Tag der Landtagswahl ging die SPD noch einmal in die Offensive und pries die Einigung der G-7-Finanzminister auf eine weltweite Digital-Mindeststeuer. Der SPD-Parteivorstand feierte Olaf Scholz als Weltenretter, als habe er im Alleingang die Industriestaaten hinter sich geeint, und trommelte am Sonntag auf allen ihren Kanälen. Der Lärm verhallte folgenlos. Es hat in Sachsen-Anhalt anscheinend niemanden interessiert. Näher war dort der Streit über die Benzinpreise, Sachsen-Anhalt ist ein Flächenland, ein Autoland.
Der Streit hat den Effekt, dass SPD und Linkspartei unisono über die Grünen herfallen und ihnen vorwerfen, Großstadt-arrogant zu sein – ein Argument, das Angela Merkel und Armin Laschet schon seit Längerem verwenden. Baerbock kann nun dabei zuschauen, wie eigene Fehler rasch einen Dominoeffekt produzieren. Dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl greift die Bissigkeit, mit der sich bislang CDU und CSU behandelten, nun bei Grün-Rot-Rot um sich. Die angeblichen Alternativpartner zu einer unionsgeführten Koalition balgen sich plötzlich.
Wie seltsam wirkt da ein Tweet des SPD-Parteivorstands am Vorabend der Sachsen-Anhalt-Wahl, die CDU sei eine Partei der Lobbyisten, „wir wollen deswegen eine Regierung ohne die Union“. Ohne die Union? Mit wem denn dann?
Das ist natürlich eine Gefahr für Armin Laschet. Die deutsche Wählerschaft könnte ihre Angstvorstellung, eine Linksregierung zu bekommen, verlieren. Auf diese Angstvorstellung aber, auf einen solchen Lagerwahlkampf setzt Laschet bisher, weil er wohl gut weiß, dass frisch erworbene bundesweite Bekanntheit wahrlich nicht identisch mit bundesweitem Vertrauen ist. Laschet ist unter allen Kanzlerkandidaten der Union das am wenigsten beschriebene Blatt. Adenauer trat bei seiner ersten Bundestagswahl 1949 zwar ebenfalls ohne Kanzlerbonus an, war aber ein Name, mit dem sich am Abendbrottisch politische Haltungen und Anfangserfolge verbinden ließen, und jene Wahl fand in einer absoluten Ausnahmesituation statt.
Adenauers Nachfolger konnten sich auf den Ruf der Union als krisenfeste Kraft stützen und waren bei ihrer ersten Kandidatur schon lange genug im Geschäft, um noch als völlige Neulinge zu gelten. Bei Merkel 2005 war das schon anders, und um ein Haar hätte sie die Wahl verloren. Aber immerhin hatte Merkel seit der Parteispendenaffäre Ende 1999 und als erste aussichtsreiche Kanzlerkandidatin der deutschen Geschichte genug bundesweite Statur, um mit einem blauen Auge doch noch den Amtseid leisten zu können. Laschet hingegen ist nahezu so neu auf der Bühne wie Baerbock. Verliert er die Linkskonstellation als Gegner, verliert er das wichtigste Wahlkampfthema, denn er verliert die einzige politische Rückversicherung gegen den Absturz durch eigene Fehler oder durch unvorhergesehene Ereignisse, die der Union zu schaffen machen könnten, weil die Wähler Laschets Krisenfestigkeit nicht einschätzen können.
Reiner Haseloff hat deshalb für die Union viel mehr erreicht, als eine Staatskanzlei in deren Händen zu bewahren. Er hat dem neuen CDU-Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten einen Mehrfrontenkampf erspart – den unmöglichen Versuch, die FDP und die Grünen als denkbare Koalitionspartner im Bund bei Laune zu halten, gleichzeitig aber in Sachsen-Anhalt die eigene Partei vor Abenteuern mit der AfD zu bewahren. Eine solche Situation hätte die Union im Bundestagswahlkampf nicht durchgestanden, ohne ihre Mehrheitsfähigkeit und damit ihre Glaubwürdigkeit zu gefährden. Hans-Georg Maaßens politische Bedeutung ist mit dem 6. Juni erheblich gesunken. In „Bild-TV“ versuchte er sich am Wahlabend als loyaler Laschet-Knappe neu zu erfinden, der dem Kanzlerkandidaten eine rechte Flanke schützt, die es in der suggerierten Verletzlichkeit seit Sonntag vielleicht gar nicht mehr gibt – vorläufig jedenfalls. Nach links gibt es im Augenblick ebenfalls wenig zu schützen. Die Linkspartei ist mit sich selbst und mit den Grünen beschäftigt.
Mit Reiner Haseloff hat ein in der DDR aufgewachsener Katholik gezeigt, dass die Diktaturerfahrung in eine starke politische Mitte münden und so zu einem Rettungsanker für die West-CDU werden kann. Die merkwürdige Debatte über demokratie-unfähige Ostdeutsche endet an diesem Punkt zunächst. Schreibt DIE WELT.
Das «kleine Wunder an der Elbe» ist eher ein grosses Debakel und eine schallende Ohrfeige für die Umfrage-Institute und deren Wahl-Prognosen.
Noch vor wenigen Tagen prognostizierten die vereinigten Orakel von Delphi, allen voran das von der BILD-Zeitung beauftragte INSA-Institut, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD bis hin zum Wahlsieg der ebenso unappetitlichen wie rechts-radikalen «Alternative für Deutschland», kurz AfD. (Siehe Bild). Über 30 Prozent am Wahlergebnis traute keines der Institute der CDU zu.
Es wurden, je nach Umfrage, zwischen sieben bis elf Prozent weniger Stimmen für die CDU und zwischen zehn bis drei Prozent mehr für die AfD vorausgesagt.
Auch den Grünen, der Linkspartei und der SPD wurde querbeet durch alle Umfragen mehr zugetraut, als die Realität letztendlich an den Wahlurnen hergab.
Dass die SPD erstmals in ihrer altehrwürdigen Geschichte unter die 10-Prozent-Marke fallen und damit einstellig werden könnte, hatten die Vertreter*innen der Kristallkugel-Zunft ebenfalls nicht auf dem Radar. Obschon es voraussehbar war.
Es war auch voraussehbar, dass der AfD die bisherigen Themen, die sie zu grossen Wahlerfolgen führten, abhanden gekommen sind: Flüchtlingskrise 2015, Euro-Rettung (Griechenland) und Merkel.
Was sagt uns das? Wahlumfragen sind weder das Papier wert, auf dem sie gedruckt werden, noch die Bites und Bytes für die digitale Veröffentlichung. Anders herum jedoch für die Umfrage-Institute ein – vermutlich je nach Auftraggeber interessengesteuertes – äusserst ertragreiches Riesengeschäft. Dass mit derart falschen Prognosen das Wahlverhalten an der Urne bewusst beeinflusst werden kann, ist kaum von der Hand zu weisen. So dumm sind Umfrage-Institute nun auch wieder nicht.
Es gibt der falschen Propheten eben viele. Sehr viele sogar.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.6.2021 - Tag des Lobbyismus
G7-Einigung auf Mindeststeuer: Stolz wie Scholz
Nach drei Jahren Verhandlungen kann Finanzminister Olaf Scholz bei der globalen Mindeststeuer einen Erfolg verbuchen. Doch ohne mächtige Hilfe wäre es kaum so weit gekommen – und es gibt weitere Hürden.
Olaf Scholz ist stolz, und das sogar mit einigem Recht. Am Samstag einigten sich die Finanzminister aus den G7-Staaten in London auf die Einführung einer Mindeststeuer für international tätige Großkonzerne in Höhe von 15 Prozent. Das ist eine Idee, die der deutsche Finanzminister vor drei Jahren in Umlauf brachte. Erst überzeugte er seinen französischen Amtskollegen, anschließend weitere EU-Partner, dann große Teile vom Rest der Welt.
Den Erfolg kann der SPD-Kanzlerkandidat im Wahlkampf gut gebrauchen. Höhere Steuern, besonders wenn es Multis trifft, machen sich beim eigenen Anhang und bei großen Teilen der Wählerschaft immer gut. Es braucht keine prophetischen Gaben, um vorauszusagen, dass Scholz in den kommenden Wochen das Hohelied über seine Verdienste anstimmen wird, nach dem Motto: Große Taten brauchen großes Selbstlob. Schon jetzt schwärmt er von einer »Steuerrevolution«.
Dass es an diesem Wochenende zu einer Einigung im Kreis der etablierten Industriestaaten USA, Kanada, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland kam, ist allerdings nicht Scholz' Verdienst. Es liegt vor allem daran, dass die USA unter ihrem neuen Präsidenten Joe Biden eine Kehrtwende hinlegten. Amtsvorgänger Donald Trump hatte das Vorhaben über Jahre blockiert. Seine Wiederwahl hätte das Projekt scheitern lassen. Insofern hat Scholz auch Glück gehabt.
Auch ist die Maßnahme noch längst nicht beschlossene Sache, aber mit der Bereitschaft der großen Industriestaaten ein großes Stück vorangekommen. Als Nächstes müssen im Rahm der G20 einige widerstrebende Schwellenländer überzeugt werden. Sie locken ausländische Unternehmen mit niedrigen Steuersätzen ins Land.
Die Regierungen dieser Länder hegen große Vorbehalte gegen eine Mindeststeuer. Immerhin hätte es für sie noch weit schlimmer kommen können. Bidens neue Finanzministerin Janet Yellen hatte als Mindesttarif kürzlich eine Größenordnung von knapp über 20 Prozent ins Gespräch gebracht. Insofern haben auch die Niedrigsteuerländer noch einmal Glück gehabt.
Selbst wenn alle G20-Länder auf Kurs gebracht sind, tut sich eine weitere Hürde auf: Im Rahmen der Industrieländerorganisation OECD verhandeln derzeit 140 Länder über die Reform, darunter viele Steueroasen. Sie alle gilt es zu überzeugen, denn die Vereinbarung ergibt nur im globalen Rahmen Sinn. Die Zeit drängt. Im Juli sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein.
Befürworter der Reform versuchen, widerstrebende Regierungen mit einem begütigenden Argument zu überzeugen: Sie könnten der Vereinbarung zustimmen, müssten ihre Steuersätze aber nicht erhöhen. Die neue Vorschrift erlaube den Heimatstaaten auslagernder Unternehmen nur, die Differenz zwischen ausländischem und Mindesttarif nachzufordern. Doch die Niedrigsteuerländer befürchten einen Wettbewerbsnachteil. Viele Ansiedlungen könnten ausbleiben, wenn die Investoren später ohnehin Steuern nachzahlen müssen, argwöhnen sie.
Steht der internationale Steuerwettbewerb damit vor dem Aus? Das ist alles andere als sicher. Der Erfolg des Unterfangens hängt davon ab, wie viele Staaten die neuen Regeln auf Dauer akzeptieren. Generell gilt: Steuerwettbewerb wird es so lange geben, wie Staaten unterschiedliche ökonomische und fiskalische Interessen haben. Es braucht nur eine Handvoll Steueroasen, die nicht mitziehen und sich weiterhin mit fünf oder zehn Prozent zufriedengeben, schon bleibt das lukrative Geschäft erhalten. Solange es ein Gefälle zwischen den Steuertarifen weltweit gibt, so lange wird es Steuersparmodelle geben, die es ausnutzen. Schreibt DER SPIEGEL.
«Mindeststeuer»! Was eigentlich ein Politikversagen über Jahrzehnte offenbart, tönt zwar gut, vor allem in den Ohren des deutschen Wahlvolkes, das im Herbst eine neue Bundesregierung wählt, wird aber den globalen Grosskonzernen höchstens ein müdes Lächeln ins Gesicht zaubern.
Schätzungsweise 25'000 Lobbyisten mit einem Jahresbudget von 1,5 Milliarden Euro nehmen allein in Brüssel Einfluss auf die EU-Institutionen. Etwa 70 Prozent von ihnen arbeiten für Unternehmen und Wirtschaftsverbände.
In der Schweiz sind es lediglich 246 Personen (200 Nationalräte*innen und 46 Ständeräte*innen), die im Sinne ihrer Auftraggeber aus Industrie und Wirtschaft die Gesetzgebung des Landes beeinflussen. Hinzu kommen noch etwa geschätzte 1'000 Anwälte und Anwältinnen und sonstige Koryphäen der gezielten Interessenvertretung im Dienste der Wirtschaftseliten.
Und so wird am Schluss von der wunderbaren Steuervermehrung über geschätzte 50 Milliarden Euro, die dem Märchen aus der Bibel von der wunderbaren Verwandlung von Wasser in Wein am See Genezareth auffällig ähnelt, nichts bleiben als eine vollmundige Ankündigung.
Die Steuergesetze und Ausnahmebewilligungen für Grosskonzerne werden durch gezielte Gesetzgebungen und mit diskreter Hilfe von den vorgenannten Akteuren*innen bis zum Nullsummen-Spiel verwässert, so dass kein einziger Cent von den 50 Milliarden bei den Steuerämtern hängen bleibt.
Der einzige Profiteur ist – einmal mehr – der ungezügelte Lobbyismus im Dienste des ruinösen Steuerwettbewerbs zum Wohle der globalen Grosskonzerne.
Wetten, dass?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.6.2021 - Tag der Salonsozialisten
Wieder mehr Asylanträge in Österreich – auch für neugeborene Babys
Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sieht im aktuellen Jahr wieder mehr Flüchtlinge auf Österreich zukommen. Er gehe davon aus, dass es 2021 rund 20.000 Asylanträge geben werde, nachdem deren Zahl nach dem Hoch in den Jahren 2015 und 2016 wieder stark gesunken war – heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Presseaussendung.
Auf Basis der Zahlen von Jänner bis inklusive April 2021 rechnet der Minister ein beträchtliches Antragsplus vor. Die Steigerung in diesem Zeitraum betrage 67 Prozent. Tatsächlich wurden im ersten Jahresdrittel hierzulande 6518 Anträge auf internationalen Schutz gestellt, die meisten davon von Syrerinnen und Syrern, gefolgt von Afghaninnen und Afghanen.
Einbruch durch Lockdown
Von Jänner bis April 2020 hingegen hatten nur 3891 Menschen um Asyl ersucht, mit einem signifikanten Einbruch im März und im April. Davor hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Coronavirus-Pandemie ausgerufen, die Staatsgrenzen wurden zwecks Infektionsabwehr international stärker als davor kontrolliert.
Ab Mai 2020 waren die Antragszahlen dann wieder gestiegen, um im Sommer das Niveau der Zeit vor dem ersten Lockdown zu erreichen – und im Herbst um rund ein Drittel zuzunehmen, von rund 1000 bis 1100 auf 1500 bis 1600 pro Monat.
Zweifel an Prognose
Beim UN-Flüchtlingshochkommissariat in Wien meldet dessen Sprecherin Ruth Schöffl Zweifel an Nehammers Prognose an. Bei den Antragszahlen gebe es vielmehr ein schwer vorhersagbares "Auf und Ab".
Die nackten Zahlen würden der Realität nicht gerecht, meint wiederum Herbert Langthaler von der österreichischen Asylkoordination. So würden in der Asylantragsstatistik zum Beispiel auch in Österreich geborene Babys von anerkannten Flüchtlingen mitgezählt. Tatsächlich haben wegen des strengen Einbürgerungsrechts inzwischen nur wenige der 2015/2016 gekommenen und gebliebenen Flüchtlinge die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten.
Fluchtbewegung aus Afghanistan
Als zusätzliche Asylantragsteller gelten außerdem auch Angehörige, die aufgrund von bewilligten Familienzusammenführungen ins Land gekommen sind. Laut Innenministerium befanden sich unter den 2952 syrischen Asylantragstellern im ersten Jahresdrittel 369 Neugeborene und 313 aus familiären Gründen nachgekommene Personen.
Mit mittelfristig mehr Asylanträgen rechnet aber auch Langthaler. In Afghanistan würden nach dem Rückzug der Westmächte abertausende Menschen ihre Koffer packen, sagt er. Er spricht von einer "Welle der Angst und der Hoffnungslosigkeit" in dem Land, die nur durch Befriedung und wirtschaftliche Besserungen gestoppt werden könne. Schreibt DER STANDARD.
Professionelle Meinungsmache durchdringt die öffentliche Meinungsbildung. Mit allen Tricks der täuschenden Argumentationen und subtilen Methoden des Agenda Setting, Framing, etc. sowie mit der Beeinflussung der Medien durch die Politik und Wirtschaft wird die öffentliche Meinung von den mächtigen Interessen fast nach Belieben geformt. Schreibt WikiReal.
Genau diese Meinungsmache billigster Art zelebriert die linke Tageszeitung DER STANDARD aus Österreich in diesem Artikel für ihre Klientel aus SPÖ-Parteimitgliedern, ultralinken Salon-Sozialisten und NGO's jeder Couleur. Das beginnt schon mit der Titel-Überschrift: «... auch für neugeborene Babys». Was eigentlich selbstverständlich ist, wird als Kritik an der Asylpolitik der österreichischen Regierung gleich mal in den Titel hineingejazzt.
Wie sagte mir vor vielen Jahren der damalige «Bilder»-Chef von Blick: «Kinder, Hunde und Titten ziehen immer.» Wie wahr! Die Blick-Seite «drei» mit den halbnackten Pin-up Girls war die meistkonsumierte Seite der gedruckten Ausgabe, als Blick an den Kiosken und bei den Abo-Zahlen noch die Schweizer Medienmacht Nummer Eins war.
Der Hinweis in der Titelzeile ist die im Artikel geäusserte Meinung eines Herrn aus der österreichischen Flüchtlingsindustrie, dessen Arbeitsplatz wesentlich von der Anzahl zuströmender Flüchtlinge abhängt und ihm vermutlich ein sorgloses Leben ermöglicht.
Diesen No-Border-Apologeten zu zitieren, ist absolut korrekt. Daran gibt es auch nichts auszusetzen. Das vermittelte Bild über «neugeborene Babys» ist jedoch professionelle Meinungsmache der übelsten Art, die als tendenziöser Aufmacher in der Titelzeile nichts zu suchen hat. Dass ein neugeborenes Kind einer Flüchtlingsfamilie ebenfalls in der Asylstatistik berücksichtigt wird wie seine Eltern, ist nichts anderes als Pflicht für eine ordnungsgemässe Statistik.
Doch DER STADARD, der sich selber mit unzähligen Bettel-Push-up's beim Durchstöbern der Artikel rühmt, Qualitätsjournalismus zu produzieren und um entsprechende Spendenbeiträge buhlt, hat den Pfad der Tugend journalistischer Neutralität bei der Berichterstattung längst verlassen.
Agentur-Artikel, die mit selbst eingeholten Statements der eigenen Klientel aufgepeppt werden, sollten als «Meinungsartikel» gekennzeichnet werden, wenn man dem Begriff «Qualitätsjournalismus» tatsächlich gerecht werden will.
Doch seit geraumer Zeit exerziert DER STANDARD, der niemals müde wird, Chinas allmächtige Zensur beinahe täglich zu kritisieren, selber Massnahmen, die eher einem diktatorischen Regime denn einer «Qualitätszeitung» zuzuordnen sind.
So wird beispielsweise im «Forum» die Bewertungsfunktion («sehr lesenswert» oder «nicht lesenswert») der Leserpostings bei nicht linken, Klientelrelevanten Artikeln, über die aber trotzdem berichtet werden muss, schlicht und einfach deaktiviert. Diese österreichische Variante chinesischer Zensur wird vor allem bei Artikeln bezüglich Asyl und Islam praktiziert.
Wie zum Beipiel gestern. «Dänemark will Asylzentren im Ausland errichten» - siehe «Schlagzeile des Tages» (nach unten scrollen). Nicht aber bei Artikeln beispielsweise über Bundekanzler Sebastian Kurz. Da kann sich DER STANDARD abfälliger Kommentare über Kurz durch das auf dem linken Auge blinde Publikum sicher sein.
Diese absolut diametral den von der Zeitung gepredigten «demokratischen Werten» genüberstehenden, durch die Redaktion gesteuerten Eingriffe im Forum lösen jeweils einen mittleren Shitstorm aus. Entsprechende Leserpostings werden mit ebenso lächerlichen wie verlogenen und kindischen Begriffen wie «destruktiven Dynamiken oder Cluster-Bildung», die zu verhindern seien, weggebügelt.
In Tat und Wahrheit geht es nur darum, eine prozentuale Abbildung der überwiegenden Meinung von Foristinnen und Foristen zu verheimlichen, die der vorgegebenen Meinung von Redaktion, also der Blattlinie, SPÖ, NGO's, Salonlinken und Grüninnen und Grünen bei Themen um Asyl und Islam widersprechen.
Gelebte Demokratie sieht anders aus. Ehrlicher wäre es, gleich die Kommentarfunktion zu löschen und nicht nur die Bewertungsfunktion zu dektivieren.
Von China lernen, wie es DER STANDARD momentan mit seiner Zensur zelebriert, heisst nicht in jedem Fall siegen zu lernen. Wer sich in einer derartigen Klientelblase bewegt und die Realität weder wahrnimmt noch akzeptiert wie DER STANDARD, wird über kurz oder lang vom Markt verschwinden. Wetten, dass?
Der Mitgliederschwund bei den sozialistischen Parteien Europas, die teilweise bereits zur absoluten Bedeutungslosigkeit geschrumpft sind – (Ausnahmen wie Dänemark ausgenommen) – sollte dem Wiener Blatt eigentlich eine deutliche Warnung sein.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.6.2021 - Tag der grenzenlosen Multikultur
Dänemark will Asylzentren im Ausland errichten
Asylanträge sollen nur mehr im Ausland gestellt werden und selbst anerkannte Flüchtlinge in Zeltlagern bleiben. Kritik kommt von der EU-Kommission.
Eine Mehrheit im dänischen Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das Asylzentren in anderen Ländern möglich macht. Damit können die Behörden Asylbewerber in Drittländer fliegen, wo sie darauf warten müssen, dass ihr Antrag in Dänemark behandelt wird. Dem Gesetz zufolge sollen aber auch, wenn ihnen ein Schutzstauts zugesprochen wird in dem Drittland bleiben oder anderswo in ein Flüchtlingslager der UNO verlegt werden. Der Gesetzesvorschlag kam von den regierenden Sozialdemokraten und Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und wurde mit Hilfe der liberalen Partei Venstre verabschiedet.
Die EU-Kommission distanzierte sich von dem Vorstoß und äußerte wie zuvor das UNHCR rechtliche und humanitäre Bedenken. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) begrüßte die Pläne dagegen ausdrücklich.
EU-Kommission behält sich rechtliche Schirtte vor
Bisher habe die Regierung Gespräche mit Ruanda, Tunesien, Äthiopien und Ägypten geführt, berichtete die Zeitung "Jyllands Posten". Konkrete Absprachen für den Bau von Auffanglagern seien aber noch nicht getroffen worden. Venstre hatte durchgesetzt, dass entsprechende Verträge mit den Ländern vom Parlament gutgeheißen werden müssen.
Die EU-Kommission kritisierte das dänische Gesetzesprojekt und machte deutlich, dass sie sich rechtliche Schritte vorbehält, sollte das Land die Pläne umsetzen. "Wir teilen die Bedenken des Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen – sowohl hinsichtlich der Vereinbarkeit des Textes mit den internationalen Verpflichtungen Dänemarks als auch hinsichtlich der Gefahr, dass die Grundlagen des internationalen Schutzsystems für Flüchtlinge untergraben werden", kommentierte ein Sprecher. Die externe Bearbeitung von Asylanträgen werfe grundlegende Fragen auf. Nach den bestehenden EU-Regeln sei ein solches Vorgehen nicht möglich.
Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) hatte die Pläne bereits im Vorfeld kritisiert. "Eine Verlegung des Asylverfahrens und des Schutzes von Flüchtlingen in ein anderes Land außerhalb Europas ist keine verantwortungsvolle und nachhaltige Lösung – und widerspräche auch den Grundsätzen, auf denen die internationale Flüchtlingszusammenarbeit beruht", sagte der Vertreter der nordischen und baltischen Länder, Henrik Nordentoft. Die Dänen könnten damit einen Domino-Effekt auslösen, betonte Nordentoft.
Positiv reagierte dagegen Innenminister Karl Nehammer. "Die von der sozialdemokratischen dänischen Regierung im Parlament verabschiedeten Pläne zeigen einen spannenden Ansatz, wie Migrationspolitik nachhaltig bewältigt werden kann", erklärte Nehammer in einer Stellungnahme am Donnerstag. Der Innenminister werde noch im Juni nach Dänemark reisen, um sich die Pläne im Detail anzusehen, hieß es. Schreibt DER STANDARD.
Könnte es sein, dass die dänische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der «Socialdemokraterne» Mette Frederiksen im Gegensatz zu den immer mehr zur Bedeutungslosigkeit schrumpfenden sozialdemokratischen Parteien Europas die Zeichen der Zeit erkannt hat?
Der Parteichef der SP Schweiz, Cédric Wermutspfropfen, könnte bei Mette Frederiksen jedenfalls lernen, wie man ehemalige Stamm-Wähler*innen zurückholt, die aus Frust über die grenzenlose Flüchtlingspolitik von der linken auf die rechte Seite gewechselt haben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.6.2021 - Tag der Körpergrösse
Wie Huawei das »Supergerät« erschaffen will
Mit einem eigenen Betriebssystem will Huawei sich von Googles Android befreien und Hunderte Millionen Geräte verkaufen. Softwarechef Chenglu Wang erklärt im Interview, wie das gelingen soll.
Seit Jahren kämpft der chinesische Elektronikhersteller Huawei mit der Krise. Nachdem die USA den gigantischen Konzern auf eine schwarze Liste gesetzt hat, die es US-Firmen verbietet, mit ihm Handel zu treiben, wird es für das Unternehmen immer schwieriger, seine Produkte herzustellen. Zum einen fehlen wichtige Chips, die nur mit US-Technologie produziert werden können. Zum anderen fehlt der früher enorm erfolgreichen Smartphone-Sparte der Zugang zu Google-Diensten wie dem Play Store und Google Maps. Doch ohne die lassen sich moderne Handy kaum verkaufen, zumindest im Westen.
Der Hintergrund: Die USA werfen dem Unternehmen vor, mit der chinesischen Regierung zusammenzuarbeiten und auf deren Befehl Hintertüren in seine Produkte einzubauen, die China Spionage im Westen ermöglichen würden. Beweise dafür haben US-Geheimdienste bisher nicht vorgelegt.
Den Ausweg soll Huawei nun ein eigenes Betriebssystem bringen, HarmonyOS, dessen neue Version 2.0 das Unternehmen am Mittwoch vorgestellt hat. Zum Start wird die Software auf zwei neuen Tablet-Modellen sowie einer Smartwatch auf den Markt kommen. Smartphones mit HarmonyOS dürften etwas später vorgestellt werden.
Im Interview erklärt Huaweis Softwarechef Dr. Chenglu Wang, warum der Konzern ein eigenes Betriebssystem entwickelt hat, was die Software anders macht als etwa Android und iOS und wie sie mehrere Gadgets zu einem »Supergerät« verschmelzen soll:
SPIEGEL: Wie wichtig ist HarmonyOS, um die US-Sanktionen zu überwinden, unter denen Huawei leidet?
Wang: Wir haben HarmonyOS nicht entwickelt, um mit den US-Sanktionen fertig zu werden. Wir hätten ohnehin ein solches Betriebssystem entwickelt, da Smartphones die Anforderungen der Verbraucher nicht vollständig erfüllen können. Wenn Sie zum Beispiel Musik von Ihrem Smartphone auf Ihrem Autoradio abspielen wollen, ist es ziemlich schwierig, diese beiden Geräte zu koppeln. Unser Hauptziel ist es, mit HarmonyOS solche Kundenbedürfnisse zu adressieren und nicht, uns mit den US-Sanktionen auseinanderzusetzen.
SPIEGEL: Die Arbeit an dem neuen Betriebssystem begann also schon vor den Sanktionen?
Wang: Wir haben mit dem Projekt im Mai 2016 begonnen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir drei wesentliche Punkte identifiziert: Erstens wollten wir kein weiteres Betriebssystem nur für Smartphones entwickeln. HarmonyOS sollte nicht ein weiteres Android oder iOS sein, wir wollten ein Betriebssystem für verschiedene Arten von smarten Geräten entwickeln. Zweitens hoffen wir, dass die verschiedenen Geräte nicht mehr voneinander isoliert bleiben. Stattdessen sollten sie ihre Fähigkeiten gemeinsam nutzen. Und der letzte Punkt ist, dass App-Entwickler und Serviceanbieter ihre Apps damit nicht mehr für verschiedene Geräte anpassen, sondern nur noch einen Satz Code entwickeln müssen, der auf unterschiedlichen Geräten eingesetzt werden kann.
SPIEGEL: Was war damals die ursprüngliche Motivation, ein solches Projekt zu starten?
Wang: Wir waren uns sicher, dass das Wachstum des Smartphone-Marktes eines Tages abflachen wird. Also mussten wir uns Gedanken über die weitere Entwicklung des Smartphone-Geschäfts machen. Damals kamen neben den Smartphones auch andere smarte Geräte auf, etwa Fitness-Armbänder und Saugroboter. Es gab immer mehr smarte Geräte und die darin verwendeten Sensoren wurden immer kleiner. Wir waren überzeugt, dass dieser Teil des Marktes weitaus größer sein würde als der für Smartphones.
SPIEGEL: Aber all diese Geräte hatten bereits Betriebssysteme. Warum noch eines bauen?
Wang: Wenn all diese Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen laufen, sind sie isoliert, und es wird schwierig, ein gutes Gesamterlebnis zu ermöglichen. Es ist, als sprächen sie verschiedene Sprachen. Wenn sie aber eine gemeinsame Sprache sprechen, können sie miteinander kommunizieren. Also haben wir über ein konsistentes oder einheitliches Betriebssystem für diese Geräte nachgedacht. Für Huawei ist das eine riesige Geschäftsmöglichkeit.
SPIEGEL: Kann ein solches vereinheitlichtes Betriebssystem wirklich mit Systemen konkurrieren, die speziell auf die Hardware zugeschnitten sind, auf der sie laufen?
Wang: Es ist für uns nicht möglich, das komplette Betriebssystem in alle Geräte einzubetten, weil die Rechenleistung und die Arbeitsspeicher-Kapazitäten von Gerät zu Gerät sehr unterschiedlich sind. Wir teilen HarmonyOS deshalb in sogenannte tagged modules auf. Wenn zum Beispiel ein Treiber auf einem Gerät mit 128 Kilobyte bis 128 Megabyte Arbeitsspeicher laufen kann, würden wir ihn mit, sagen wir, 1 taggen. Und wenn ein anderer Treiber Geräte mit 5 bis 6 Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt, würden wir ihn mit 2 taggen. Auf diese Weise wird das gesamte System getaggt und wir können Module entsprechend dem Profil der Hardware, auf der sie laufen sollen, kombinieren.
SPIEGEL: In der Theorie klingt das sehr schön, aber wie funktioniert das im Alltag?
Wang: Mit diesem Ansatz sind wir tatsächlich in der Lage, die Grenzen einzelner Geräte zu durchbrechen oder zu überschreiten. Denn deren Ressourcen sind begrenzt, sodass man nicht so viele Fähigkeiten und Funktionen einbauen kann, wie man möchte. Mit HarmonyOS sind wir jedoch in der Lage, viele verschiedene Geräte drahtlos miteinander zu verbinden und so ein leistungsfähiges Supergerät zu schaffen. Die Funktionen und Fähigkeiten dieses kombinierten Supergeräts werden viel größer sein als die Fähigkeiten der isoliert arbeitenden Geräte.
SPIEGEL: Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Wang: Die verschiedenen Geräte wären wie Lego-Bausteine, mit denen man beliebige »Gebäude« aufbauen kann. So könnten Sie zum Beispiel Ihr Smartphone mit mehreren externen Kameras kombinieren, um ein Supergerät zu bauen, das Schnappschüsse aus verschiedenen Blickwinkeln gleichzeitig machen kann. Oder Ihr Smartphone und Ihr Tablet könnten ein Supergerät sein, wenn Sie Ihr Telefon verwenden, um Apps zu steuern, die eigentlich auf Ihrem Tablet laufen. Ihre Smartwatch und Ihr Smartphone könnten ein Supergerät sein und Daten teilen.
SPIEGEL: In welchen Situationen könnte so etwas praktisch sein?
Wang: Wenn Sie mit Ihrem Smartphone versuchen, mit einer Fahrdienst-App ein Auto zu rufen, können die Daten zu dieser Anfrage an Ihre Uhr übertragen werden. Auf diese Weise können Sie Informationen wie die Entfernung des Fahrers zu Ihnen sowie das Kennzeichen und die Farbe des Autos, das Sie gerufen haben, über Ihre Uhr abrufen.
SPIEGEL: Das sieht sehr nach der Art und Weise aus, wie Apple seine iPhones, iMacs und andere Geräte über seinen iCloud-Dienst verbindet.
Wang: Die technische Lösung von Huawei ist völlig anders als die von Apple. Wir verlassen uns nicht auf eine Cloud, um die Verbindung zwischen den Geräten herzustellen. Mit HarmonyOS verbinden sich die Geräte direkt miteinander. Sobald das erledigt ist, werden sie vom Betriebssystem wie ein einziges Gerät betrachtet.
SPIEGEL: Sie behandeln die verschiedenen Geräte also so, als wären sie Bestandteile eines »Supergeräts«, wie Sie es nennen?
Wang: Ganz genau. Bei einem physischen Gerät sind die verschiedenen Module innerhalb des Geräts mit Kabeln oder Leiterbahnen verbunden, in der Fachsprache bezechnet man das als einen Bus. Zum Beispiel müssen die Kamera und der Chipsatz in einem Smartphone über diesen physikalischen Bus miteinander kommunizieren. Wir versuchen, eine Verbindung, die fast so gut ist wie die, die durch einen physikalischen Bus erreicht werden kann, drahtlos herzustellen. Wir nennen das den Soft-Bus oder virtuellen Bus und verwenden dafür WiFi- und Bluetooth-Technologie.
SPIEGEL: Würde diese Technologie auch bei Smartphones von Firmen wie Xiaomi oder Samsung, die Qualcomm-Chips benutzen, und PCs mit Intel-Prozessoren funktionieren?
Wang: Bislang unterstützen wir mit HarmonyOS die Chips von Qualcomm und Intels X86-Architektur nicht. Daher wird HarmonyOS derzeit nur auf Huawei-eigenen Produkten und Geräten eingesetzt. Aber wir haben bereits den Großteil des Codes von HarmonyOS in die OpenAtom Foundation eingebracht. Wenn andere Hersteller das Betriebssystem mögen, können sie den Code von der OpenHarmony-Open-Source-Community bekommen und ihn an ihre Hardware anpassen.
SPIEGEL: Kürzlich sagten Sie, Huaweis Ziel sei es, in diesem Jahr 300 Millionen Geräte mit HarmonyOS zu verkaufen. Wie wollen Sie das schaffen?
Wang: Von diesen 300 Millionen Geräten werden 200 Millionen von Huawei kommen, 100 Millionen von Partnerfirmen. Derzeit sind die meisten dieser Partner chinesische Unternehmen. Aber wir heißen neue Partner aus der ganzen Welt willkommen, sich dem HarmonyOS-Ökosystem anzuschließen. In Europa haben wir bereits einige Kooperationen. Zum Beispiel haben wir mit der Swatch Group in der Schweiz zusammengearbeitet, um einige der verteilten HarmonyOS-Funktionen in ihre Tissot T-Touch Connect Solar-Uhr zu integrieren. Sie kann mit bestehenden Huawei-Smartphones mit EMUI 11 und den kommenden HarmonyOS-Geräten verbunden werden. Schreibt DER SPIEGEL.
So verschmitzt wie Chenglu Wang auf dem Foto lächelt, was in dieser harmonischen Art nur siegessichere Asiaten mit einer Körpergrösse von 152 cm beherrschen, ist anzunehmen, dass er sich des Erfolgs von HarmonyOS ziemlich sicher ist.
Körpergrösse ist eben nur eine Seite der Medaille. Hirnleistung die andere. Damit sind unsere Freundinnen und Freunde aus Fernost in der Regel reichlich gesegnet.
Wie sagte Konfuzius so treffend: «Leuchtende Tage - nicht weinen, dass sie vorüber, lächeln, dass sie gewesen!» Funktioniert scheinbar auch umgekehrt. «Leuchtende Tage - nicht weinen, dass sie noch nicht da sind, lächeln, dass sie kommen!»
Letztendlich spielt es für uns ohnehin keine Rolle, ob wir nun von den Amerikanern oder den Chinesen ausspioniert werden. Hauptsache, der Plunder ist dreckbillig.
Ob die Welt tatsächlich ein weiteres Betriebssystem braucht, sei dahingestellt. Gescheitert mit neuen Betriebssystem-Entwicklungen sind jedenfalls schon ganz andere Tech-Giganten als Huawei.
Doch die Söhne und Töchter aus dem Reich der Mitte haben mit Sicherheit einen langfristigen Plan. Und mit China erst noch den grössten Smartphone-Markt der Erde. Das müsste eigentlich reichen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.6.2021 - Tag der vrlogenen Klimadiskussion
Zweite SRG-Trendumfrage zu den Abstimmungen vom 13. Juni: Das CO₂-Gesetz steht auf der Kippe
Für das CO₂-Gesetz könnte es bis zum 13. Juni eng werden: Die Zustimmung schmilzt wie ein Gletscher unter der Sonne. Das zeigt die neuste SRG-Trendumfrage. Für die beiden Agrar-Initiativen sieht es wirklich schlecht aus.
Und plötzlich könnte es eng werden. Das CO₂-Gesetz steht auf der Kippe. Das zeigt die zweite Trendumfrage des Meinungsforschungsinstituts GfS.Bern im Auftrag der SRG. Zwar liegen die Befürworter mit einem Ja-Anteil von 54 Prozent nach wie vor in Front. Das Nein-Lager kommt lediglich auf 43 Prozent. 3 Prozent sind noch unentschlossen.
Bei der ersten Umfrage von Ende April kam das Pro-Lager aber noch auf satte 60 Prozent. Die Gegner hatten nur 35 Prozent erreicht. Das zeigt: Die Zustimmung hat abgenommen. Setzt sich der Trend bis zum Abstimmungssonntag vom 13. Juni fort, wird es eng. Nach wie vor massiv ist die Zustimmung bei den Anhängern der Grünen (94 Prozent), GLP (92 Prozent) und SP (85 Prozent). Deutlich ist das Ja mit 63 Prozent auch in der Mitte.
Ganz anders sieht es bei den Freisinnigen aus. Obwohl FDP-Präsidentin Petra Gössi (45) einen Öko-Kurs ausgerufen hat und die Ja-Kampagne anführt, zeigt sich die Parteibasis tief gespalten: 49 Prozent sind dafür, 48 Prozent dagegen.
Klar ist dagegen die Haltung in der SVP, die das Referendum ergriffen hat – 85 Prozent der Parteibasis lehnen das Gesetz ab, nur 15 Prozent stimmen zu.
Geld spielt eine Rolle
Und: Die Kostenfrage, die das Referendumskomittee ins Feld führt, scheint tatsächlich zu verfangen. Bei Haushalten mit einem Einkommen bis 3000 Franken erreicht der Ja-Anteil nur 48 Prozent. Bei Haushalten mit einem Einkommen von 9000 bis 11'000 Franken liegt die Zustimmung bei 66 Prozent.
Die Kostenfrage gehört denn auch auf beiden Seiten zu den Hauptargumenten. Das Nein-Lager denkt dabei an die unmittelbaren Kosten mit teurerem Benzin und Heizöl. Das Pro-Lager hingegen blickt stärker in die Zukunft und befürchtet grosse Schäden und damit hohe Kosten durch den Klimawandel, wenn nicht entschieden dagegen vorgegangen wird.
Stadt-Land-Graben bei den Agrar-Initiativen
Auch für die beiden Agrar-Initiativen sieht es nicht gut aus. Die Trinkwasser-Initiative, die Direktzahlungen nur noch jenen Landwirten zukommen lassen will, die auf Pestizide verzichten, befürworten nur noch 44 Prozent. Mittlerweile ist eine Mehrheit von 53 Prozent dagegen. 3 Prozent sind noch unentschlossen. Bei der ersten Umfrage waren noch 54 Prozent für die Initiative gewesen, 40 Prozent dagegen.
Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Pestizid-Initiative zu beobachten, die den Einsatz synthetischer Pestizide schweizweit verbieten will. Auch sie würde derzeit abgelehnt – und zwar mit 51 Prozent. Nur noch 47 Prozent der Befragten sind dafür, der Rest ist unentschlossen. Ende April war die Initiative noch auf eine Zustimmung von 55 Prozent gekommen, 42 Prozent waren damals dagegen.
Bei den beiden Initiativen zeigt sich ein klarer Links-rechts-Graben. Am höchsten ist die Zustimmung für die Trinkwasser-Initiative bei den Grünen (91 Prozent). Auch bei der GLP (74 Prozent) und SP (70 Prozent) sprechen sich deutliche Mehrheiten für die Vorlage aus.
Deutlich dagegen stellen sich die SVP-Anhänger mit 81 Prozent Nein. Auch die FDP mit 71 Prozent Nein und die Mitte mit 65 Prozent Nein lehnen die Initiative ab.
Parallel dazu ist ein Stadt-Land-Graben feststellbar. Befürworten in den grossen Agglomerationen 53 Prozent die Initiative, sind es auf dem Land nur 31 Prozent. Ein Unterschied ist aber auch in den Sprachregionen zu beobachten. In der Deutschschweiz erreicht die Vorlage nur einen Ja-Anteil von 44 Prozent, in der Romandie sind es sogar nur 42 Prozent. Anders im Tessin, das mit satten 59 Prozent zustimmt.
Dass die Landwirtschaft hierzulande zu intensiv produziert und damit Gewässer, Trinkwasser und Böden belastet, ist das Hauptargument der Befürworter. Die Gegner hingegen befürchten, dass die Umweltbelastung einfach ins Ausland verlagert wird.
Nur SVP-Basis gegen Covid-19-Gesetz
Bereits entschieden ist das Rennen bei den beiden verbleibenden Gesetzesvorlagen. Das Covid-19-Gesetz erhält mit 64 Prozent Ja zu 32 Prozent Nein ähnlich breite Unterstützung wie bei der ersten Umfrage.
Bei den Parteien sind die Ja-Anteile von SP (86 Prozent) bis zur Mitte (75 Prozent) durchgängig hoch. Der einzige Ausreisser ist die SVP: Deren Anhänger lehnen das Gesetz mit 63 Prozent Nein zu 34 Prozent Ja als einzige grosse Partei ab.
Für die Befürworter ist klar, dass es das Gesetz braucht, um im weiteren Verlauf der Pandemie gezielt und schnell handeln zu können – und um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Die Gegner erachten das Pandemie-Management als Angstmacherei und sehen die direkt-demokratische Ordnung auf den Kopf gestellt.
Sogar links-grüne Basis ist für Anti-Terror-Gesetz
Ähnlich deutlich ist mit 62 Prozent das Ja zum Anti-Terror-Gesetz. Nur knapp jeder Dritte stellt sich derzeit dagegen. 6 Prozent haben sich noch nicht entschieden. Obwohl SP, Grüne und Grünliberale die Vorlage vehement bekämpfen, sind ihre Anhänger teilweise tief gespalten. Bei SP und Grünen finden sich derzeit sogar relative Mehrheiten.
Das Trumpf-Argument, dass mit dem Gesetz terroristische Anschläge verhindert werden können, sticht auch im links-grünen Lager. Schreibt Daniel Ballmer in Blick.
Eine derart verlogene Diskussion wie die um das CO2-Gesetz erlebt man nicht aller Tage. Und dies nicht erst seit heute.
Die schamlose Okkupierung des Klima-Themas begann im Jahr 2019 vor den Schweizer Parlamentswahlen. Der Klimawandel – von den handelnden Personen in der Politik, den Medien und nicht zuletzt von den Aktivitäten der «Graswurzelbewegung» Fridays for Future (FFF) zum wichtigsten Wahlthema hochgejazzt wie kaum ein anderes Thema je zuvor, – liess das staunende Wahlvolk mit offenem Mund zurück.
Ein Wendehals nach dem andern besetzte das Thema mit einer Chuzpe, die nur noch verblüffte. Allen voran die selbsternannte «Greta» Petra Gössi von der brachialen Neolippen-Partei FDP. Ausgerechnet die Gralshüterin des pervers neoliberalsten Gedankenguts und ihr treuer Vasall Damian «ich bin nicht schwul» Müller, die im Jahr 2019 laut einem Bericht von Watson noch gegen sämtliche Vorlagen des Parlaments bezüglich Klima-Massnahmen abstimmten, spielten sich für ein paar Wählerstimmen zu Weltenrettern*in auf. Ich weiss wovon ich spreche. Ein eher tragikomisches Interview mit dem solariumgebräunten Liebling aller Schwiegermütter über 70 deckte nicht nur den wahren Charakter des Luzerner FDP-Ständerats schonungslos auf, sondern auch sein intellektuelles Standing.
Doch beide, sowohl Gössi wie auch Müller, konnten ihren Hals gefahrlos wenden. Wussten sie doch, dass mit der «bürgerlichen» Mehrheit ihr «Geschwätz von gestern» spätestens im Parlament undvor allem im Ständerat jederzeit den Bach runter geschickt werden kann.
Da braucht sich deren Klientel nun wirklich keine Sorgen zu machen. Selbst wenn das jetzt zur Abstimmung vorliegende CO2-Gesetz wider allen Erwartungen vom Wahlvolk angenommen werden sollte. Der «bürgerliche» Parteienblock besitzt die notwendigen Instrumente und Mittel, jedes Gesetz derart zu verwässern, dass es letztendlich ihrer Klientel auf keinen Fall mehr weh tut.
«You get what u voting for» ist eben nur begrenzt richtig. Wie so viele Zitate.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.6.2021 - Tag der Diktatur
China reagiert rigoros auf lokalen Corona-Anstieg
China hat einen plötzlichen Anstieg der Covid-19-Infektionen im Süden des Landes gemeldet, mit 18 neuen lokalen Fällen in der Stadt Guangzhou. Dieser für die Region abrupte Anstieg hat eine Reihe von Flugstornierungen nach sich gezogen.
Bis 11:40 Uhr Ortszeit wurden insgesamt 519 Flüge am Guangzhou Baiyun Flughafen storniert. Das sind laut dem Luftfahrtdatenanbieter Variflight 37 Prozent der gesamten Flüge vom Montag.
Menschen, die die Stadt über Flughäfen, Bahnhöfe und Busstationen verlassen, müssen zudem einen negativen Covid-19-Test vorweisen, es sei denn, sie sind auf der Durchreise. Dies teilte die Stadt in einer Erklärung am späten Sonntag mit.
Am Samstag wies die Regierung von Guangzhou überdies die Bewohner von fünf Strassen im Bezirk Liwan an, zu Hause zu bleiben und nicht lebensnotwendige Aktivitäten auszusetzen. Alle Märkte und Läden wurden geschlossen. Schreibt SRF im Corona-Liveticker.
So geht das in China: Da wird nicht lange gefackelt.18 neue Coronafälle in der Stadt Guangzhou und schon wird der Flughafen (beinahe) geschlossen, Strassen, Märkte und Läden der betroffenen Bezirke gesperrt und Ausreisende müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.
Da wundert es einen nicht, dass China die Fallzahlen und damit die Pandemie im eigenen Land mehr oder weniger im Griff hat. Selbst wenn die Zahlen möglicherweise geschönt sind. Ob nun 18 oder 1'800 Personen spielt bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen keine grosse Rolle.
Man nennt dies effizientes Regierungshandeln, das aber nur in einer totalitären Diktatur durchsetzbar ist.
Für alle, die sich ein solch diktatorisches Durchregieren bis hinunter zur lokalen Ebene auch hierzulande wünschen: Die chinesische Bevölkerung bezahlt dafür mit dem Verlust der persönlichen Freiheiten einen hohen Preis.
Alles hängt mit allem zusammen. Das Eine gibt's nicht ohne das Andere.
«Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen - abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind», soll Churchill gemäss einem Sitzungsprotokoll in einer Rede vor dem Unterhaus am 11. November 1947 gesagt haben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
31.5.2021 - Tag der Ballermänner und Ballermännerinnen
Junge Vielflieger wehren sich wegen Flugticketabgabe gegen CO2-Gesetz
Wird das CO2-Gesetz angenommen, wird Fliegen teurer. Vier junge Wählerinnen und Wähler erklären, wieso sie das ablehnen – obwohl ihnen der Klimaschutz am Herzen liegt.
Für das revidierte CO2-Gesetz, das am 13. Juni zur Abstimmung kommt, dürfte es knapp werden. Den jüngsten Umfrageresultaten zufolge unterstützt nur noch eine hauchdünne Mehrheit das Gesetz. Es sieht unter anderem höhere Abgaben auf Flugtickets und Benzin vor. Das so erwirtschaftete Geld soll in einen Klimafonds fliessen, durch den innovative und nachhaltige Projekte gefördert werden sollen.
Selbst die Klimastreik-Bewegung ist in der Frage gespalten. Einigen geht das Gesetz zu wenig weit, sie wollen es aus Protest ablehnen. Gemäss der Umfrage hat das Argument, dass die Flugtickets teurer werden, aber deutlich mehr Gewicht: 21 Prozent derjenigen, die das revidierte CO2-Gesetz ablehnen wollen, gaben die Aufpreise auf Benzin und Flugtickets als Hauptgrund dafür an. Für einen Kurzstreckenflug zahle man zukünftig 30 Franken zusätzlich, schreibt das Bundesamt für Umwelt. Wer eine mittlere oder lange Strecke fliegt, zahlt mehr. Das Maximum liegt bei 120 Franken Zuschlag.
Fabio, 24: «Ich fühle mich vom Gesetz benachteiligt: Ich fliege mehrmals pro Jahr in die USA, da ich dort Familie habe. Das Gesetz trifft einzelne Vielflieger, doch die Luftfahrt hat global nur einen Anteil von zwei Prozent an den gesamten CO2-Emissionen. Ich unterstütze den Klimastreik. Anstatt ärmere Familien zu bestrafen, könnte der Bundesrat aber etwa Elektrofahrzeuge subventionieren. So wird die Mittelschicht nicht zusätzlich bestraft.»
Jana (21; Name geändert): «Ich bin nicht bereit, fürs Fliegen mehr zu bezahlen. Ich verdiene als Fachfrau Betreuung lediglich knapp 4100 Franken brutto. Meine Kolleginnen verdienen alle mehr und ständig muss ich mir anhören, dass sie in England waren am Wochenende oder ein paar Tage in Dubai. Ich möchte auch gerne reisen, ohne dass ich mir dann nichts mehr zu essen leisten kann. Die, die viel verdienen, werden mit ihrem Lifestyle weitermachen können wie bisher, nur ich muss dann ab und zu mal verzichten, weil ich schlechter bezahlt werde für meine Arbeit. Das ist einfach nicht fair.»
Alex (23): «Ich wünsche mir ein gutes CO2-Gesetz, das die Emissionen auf sinnvolle Weise reduziert. Die Flugticketabgabe ist aber reine Geldmacherei. Ich fliege gerne ins Ausland. Doch mich stört es, wie mein Geld, das ich extra zahle, eingesetzt wird. Wenn schon, sollte man das Geld zu 100 Prozent in den Klimafonds und in die Forschung über alternative Transportmöglichkeiten investieren. Dass ein Teil des Geldes als Scheinverbilligung der Krankenkassenprämien genutzt wird, ärgert mich.»
Robin McKeown (22): «Mich würde es sehr stören, wenn die Flugtickets plötzlich teurer würden. Ich fliege zwischen zwei und vier Mal pro Jahr in die Ferien, hauptsächlich nach Mallorca zum Ballermann. Ich arbeite das ganze Jahr und brauche diese Ferien, um abschalten und Spass haben zu können. Wenn die Flugtickets teurer würden, könnte ich mir das vielleicht nicht mehr leisten und müsste meine Ferien umplanen.»
McKeown wehrt sich nicht gegen Umweltschutz: «Ich finde das wichtig und wohne selber in einer Mietwohnung in einem Haus mit Solarzellen auf dem Dach. Ich bin aber der Meinung, dass Benzinpreise und Flugtickets der falsche Ort sind, um anzusetzen. Wenn jeder etwas achtsamer wäre, weniger Müll produzieren und diesen sauber trennen würde und wenn die Schweiz stärker auf erneuerbare Energien setzen würde, würde es schon viel ausmachen. Ohne dass meine Ferien versaut werden, weil ich mir die Flüge nicht mehr leisten kann.»
Das sieht das revidierte CO2-Gesetz vor
Am 13. Juni entscheidet das Stimmvolk über das revidierte CO2-Gesetz. Damit setzt sich die Schweiz zum Ziel, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 50 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Denn die heutigen Massnahmen genügten nicht, um dieses Klimaziel zu erreichen, heisst es beim Bundesamt für Umwelt (BAFU). Erreicht werden soll das mit verschiedensten Massnahmen. Geplant wären unter anderem höhere Abgaben auf fossile Brennstoffe wie Heizöl und eine Flugticketabgabe bis maximal 120 Franken pro Flug. Das revidierte CO2-Gesetz belohne klimafreundliches Verhalten, schreibt das BAFU weiter. Wer wenig klimaschädliches CO2 verursache, profitiere finanziell. Wer viel verursache, bezahle mehr. Schreibt 20Minuten.
Jetzt sämtliche jungen Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren, in einen Topf mit unsäglichen «Ballermann»-Typen*innen und «Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass»-Heuchlern und Heuchlerinnen zu werfen, wäre grundfalsch.
Ich kenne selbst viele junge Leute, die sich mit grosser Ernsthaftigkeit mit dem Problem der Erderwärmung auseinandersetzen und sogar ihre Eltern positiv beeinflussen – selbst in der Wahl des gemeinsamen Ferienziels.
Wer sich aber das Publikum bei den Klimademonstrationen etwas genauer anschaut und mit ihnen diskutiert, kommt leider zur erschütternden Schlussfolgerung, dass sich eine grosse Mehrheit der Mitmarschierenden genau aus solch verlogenen «Party-Löwen und Löwinnen» einer jungen und perversen Konsumgesellschaft zusammensetzt, wie sie 20Minuten in seinem Artikel aus dem Hut zaubert und zu Wort kommen lässt. Wenn auch wie bei «Jana» mit geändertem Namen, was vermutlich dafür spricht, dass es sich bei ihr um eine Aktivistin handelt.
Wer sich allerdings wie der zitierte Robin McKeown 120 Franken für seine zugedröhnten «Ballermann»-Partys – zwei bis vier Mal pro Jahr, was auf eine beinahe schon pathologische Einfalt hinweist – nicht leisten kann und dieses peinlich persönliche Befinden auch noch als Argument gegen den Flugticketzuschlag ins Feld führt, sollte das Wort «Klimaschutz» definitiv nicht mehr in den Mund nehmen.
Ohne persönlichen Verzicht läuft nämlich beim Klimaschutz rein gar nichts. Wer das nicht als erstes Gebot akzeptiert, sollte an keiner Klimademonstration oder Diskussion über die Erderwärmung teilnehmen.
Den Klimaschutz nur als hippen Trend abzufeiern und als Party-Gag zu vergewaltigen, wird den Kilmaschutz letztendlich nicht nur verunmöglichen, sondern sogar zerstören.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.5.2021 - Tag der Hosenscheisser
Marco Rima lag drei Tage auf der Corona-Station
Marco Rima ist einer der bekanntesten Kritiker der Corona-Politik – dann erkrankte seine ganze Familie an Covid. Das hat seine Meinung aber nicht beeinflusst.
Komiker Marco Rima gehört zu den prominentesten Kritikern der Corona-Massnahmen. Normalerweise füllt er grosse Theater – nun steht er aber seit über einem Jahr unter einem virusbedingten Arbeitsverbot. Die viele freie Zeit nutzte der Komiker unter anderem für den Kampf gegen Corona-Massnahmen. Seine kritisch-ironischen Facebook-Videos werden hunderttausendfach angeklickt und geteilt. Die Skeptikerbewegung hat ihn zur Ikone erhoben, von der anderen Seite werden er und seine Familie mit Anfeindungen und Häme eingedeckt.
An Weihnachten erkrankte seine ganze Familie an Covid-19, auch seine 82-jährige Mutter. Im Interview mit der «SonntagsZeitung» erzählt Rima, wie er die Infektion erlebte: Drei Tage lang verbrachte er im Spital Zug auf der Corona-Station, dann durfte er wieder nach Hause. «Es ging mir danach zwei, drei Wochen schlecht, ich hatte Fieber und Übelkeit.» Seine Mutter sei bereits nach einer Woche wieder fit gewesen.
«Verschwörungszeugs interessiert mich nicht»
Dieses Erlebnis hat seine Meinung zur Corona-Politik aber nicht beeinflusst: «Wir leben in einer freien Gesellschaft, wo wir als mündige Bürger angehalten sind, selber auf unsere Gesundheit zu achten und respektvoll und liebenswürdig miteinander umzugehen. Dafür braucht es keine Zwangsmassnahmen.»
In der Anfangsphase sei er noch voll hinter den Massnahmen des Bundesrates gestanden, sagt der Komiker weiter. «Als die prophezeiten Todeszahlen nicht eintrafen, wollte ich genau wissen, weshalb dem so ist.» All das Verschwörungszeugs interessiere ihn nicht, sagt Rima. «Aber da waren viele Mediziner und Virologen, die zu anderen Erkenntnissen kamen als jene, die in den etablierten Medien zu Wort kamen.» Ihnen habe er zugehört.
Heftige Reaktionen
Marco Rima fasste seine Gedanken in Videos zusammen, die bis zu zwei Millionen Mal angeschaut wurden. Diese Reaktionen hätten ihn überrascht. «Ich hatte einfach meinen Gedanken Luft gemacht, mit dem Ziel, meine Follower zu motivieren», sagt er der «SonntagsZeitung» weiter. Es sei dann gesagt worden, er würde Corona «leugnen». «So ein Blödsinn, ich habe die Existenz des Virus nie infrage gestellt.»
Marco Rima hat dann seinen Facebook-Account gelöscht und ist abgetaucht. Die Pause sei wichtig gewesen, vor allem für die Familie. «Meine Frau sagte irgendwann, sie könne nicht mehr. Ständig riefen Journalisten an, vor dem Haus lauerte ein Reporter auf. Wir haben uns irgendwann vorgenommen, am Esstisch nicht mehr über das Thema zu sprechen.» Dass er seinen Account mit 75’000 Followern gelöscht hat, findet Rima heute schade.
«Wir leben vom Ersparten»
Im Gespräch erklärt er auch, dass er vom Bund Unterstützungsgelder für abgesagte Vorstellungen erhalten habe. Diese deckten die Ausgaben aber bei Weitem nicht: «Wir leben vom Ersparten.» Schreibt 20Minuten.
Schadenfreude und Häme sind bei einer lebensgefährlichen Erkrankung nicht angebracht. Egal, um wen es sich handelt. Damit stellt man sich nur auf die gleiche Stufe mit dem unsäglichen Komödianten aus dem Zugerland.
Dafür aber gewinnen wir die Erkenntnis, dass das Corona-Virus auch nicht vor einem abgehalfterten Vollpfosten Halt macht. Und dass Rima ein Feigling ist. Erst den grössten Bullshit auf Facebook absondern und dann die Seite löschen, statt sich sich der Diskussion zu stellen, ist die feige und verantwortungslose Reaktion eines infantilen Hosenscheissers.
Dieses Verhalten erinnert stark an den Aargauer SVP-Präsidenten Andreas Glarner, der seine Hetz-Nachrichten erst auf Facebook veröffentlicht, um sie nach dem logischerweise folgenden Shitstorm über Nacht zu löschen. So als ob nichts gewesen sei. Dafür darf man ihn laut Gerichtsurteil ungestraft einen «Dummschwätzer» nennen. Was immerhin der Realität entspricht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.5.2021 – Tag der schwedischen Campingplätze
250 Prozent mehr Buchungen – Blick schnuppert in Murg SG an der grossen Freiheit: Campingplätze freuen sich auf Rekordsommer
Ob mit Wohnmobil, Wohnwagen oder mit dem Zelt: Der Campingplatz gehört seit jeher zu den beliebtesten Ferienorten der Schweizer. Dieser Pandemie-Sommer könnte aber alle Buchungsrekorde sprengen.
Toni Böller (67) und Ruth Luppi (61) sitzen auf ihren Campingstühlen direkt am Walensee. Vor ihnen ein Glas Riserva und der leere Teller vom Mittagessen. Es gab Spaghetti mit Crevetten. «Wir geniessen die Ruhe vor dem Sturm», sagt Luppi. Der Campingplatz in Murg SG ist für das Wochenende nämlich komplett ausgebucht. «Für so schöne Plätze muss man weit im Voraus reservieren», weiss Böller, der seit vielen Jahren campiert.
Tatsächlich: Die Schweiz ist im Campingfieber. Campingbetreiber werden mit Buchungsanfragen für den Sommer regelrecht eingedeckt. Zum Beispiel der TCS: Auf seinen 24 Campingplätzen verzeichnet der Touringclub satte 250 Prozent mehr Buchungen als 2019.
Schon letztes Jahr verbrachten Hunderttausende Schweizer ihre Ferien auf hiesigen Campingplätzen. Die Corona-Pandemie nahm den meisten die Lust auf Auslandreisen. Nun zeigt sich: Die Schweizer halten ihren Campingplätzen auch dieses Jahr die Treue.
Rappelvolles Reservationsbuch
Das freut Philippe Blindenbacher (53). Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau Ruth (50) den Campingplatz in Murg. Am Freitagnachmittag ist Check-in-Zeit fürs Wochenende. Ein Camper nach dem anderen fährt auf den schmucken Platz direkt am See ein. Zwei Wohnmobile muss Blindenbacher abweisen. Die Stellplätze sind alle reserviert.
«Für die Sommermonate sind wir fast komplett ausgebucht», sagt der Campingplatz-Chef. Er zählt 35 Prozent mehr Buchungsanfragen als in anderen Jahren. Da und dort hat Blindenbacher aber noch ein Plätzchen frei, besonders für Zeltgäste.
Freie Plätze in den Bergen
Ein Einzelfall am Walensee? Keineswegs! Der Ansturm erstreckt sich über die gesamte Schweiz. Marcel Zysset (54) betreibt einen Campingplatz direkt am Brienzersee. «Für die Sommerferien können wir keine Reservationen mehr annehmen», sagt er. Zysset kennt als Präsident des Verbands Schweizerischer Campings auch die nationalen Zahlen: «Plätze direkt an Gewässern sind mehrheitlich ausgebucht.» Wer noch einen Campingplatz sucht, sollte sich in den Bergen oder in Stadtnähe umschauen.
«Seit Corona ist Campen voll im Trend», sagt Pascal Schneckenburger (37), ein eingefleischter Camper. Sein Wagen fällt sofort auf: Er schläft in einem aufklappbaren Zelt auf dem Dach seines VW-Busses. Wenn er aufwacht, sieht er als Erstes auf den Walensee. «Das ist Lebensqualität», schwärmt Schneckenburger.
Schweizer gehen auf Nummer sicher
Wieso machen Schweizer trotz erleichterter Reisebedingungen wieder Ferien in der Heimat? «Letztes Jahr haben viele gemerkt, wie schön unser Land ist», sagt Campingbetreiber Blindenbacher. Besonders Westschweizer übernachten zunehmend auf seinem Campingplatz mit Blick auf die Churfirsten.
Für Toni Böller und Ruth Luppi kommen Ferien im Ausland momentan noch gar nicht in Frage. «Wieso weit wegfahren, wenn es so nahe so schön ist?», fragt Böller und blickt über den See auf die noch schneebedeckten Churfirsten. «Dieser Platz ist uns richtig ans Herz gewachsen», sagt Luppi. Die beiden Vollblutcamper haben ihren Stellplatz in Murg bereits für ihre nächsten Ferientage reserviert. Denn sie wissen: «Einfach hinfahren und Platz haben, das war gestern.» Schreibt Blick.
Und sollten alle Stricke reissen, weil die Schweizer Campingplätze im Sommer ausgebucht sind, gibt es genügend Alternativen im europäischen Umfeld.
Wie zum Beispiel «Kattisavan Livscamping», einen der tollsten Campingplätze Schwedens zu erschwinglichen Preisen in Kattisavan.
Kattisavan ist ein Ort (småort) in der schwedischen Provinz Västerbottens län, in der historischen Provinz (landskap) Lappland in der Gemeinde Lycksele. Der Ort liegt etwa 30 km Luftlinie nordwestlich des Hauptortes der Gemeinde, Lycksele am Fluss Ume älv.
Kattisavan hat einen Bahnhof an der Bahnstrecke Hällnäs-Storuman. Regelmässiger Personenverkehr findet hier allerdings nicht mehr statt. Durch den Ort führt die Europastraße 12. Schreibt Wikipedia.
Geniessen Sie die Sauberkeit Schwedens, die in der Schweiz längst verloren gegangen ist, und die schwedischen Spezialitäten für Gaumen, Bauch (und Darm) von Blåbärssoppa über Smørrebrød (aus der dänischen Küche) bis Surströmming.
Dabei gilt es allerdings, eine alte Lebensweisheit der Wikinger zu bedenken: «Mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt.» Greifen Sie zu, aber nicht zu heftig.
Frühbuchen lohnt sich. Auch die schwedischen Campingperlen werden sehr schnell ausgebucht sein. Die Informationen zu «Kattisavan Livscamping» finden Sie hier: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064872876503
Smörebröd und happy Camping-Urlaub!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
28.5.2021 - Tag der Vormundschaft
Spielsüchtige Betrügerin steht in Luzern vor Gericht
Ein Rentner soll über Jahre von einer jüngeren Frau angeschwindelt und finanziell ausgenommen worden sein. Mit dem Geld des gutgläubigen Rentners finanzierte sie im Casino ihre Spielsucht. Nun muss sich die Zürcherin in Luzern vor Gericht verantworten.
Das Konstrukt an angeblichen Lügen mit der eine heute 36-jährige Frau einen Rentner manipuliert haben soll, ist beeindruckend. Nachdem die Frau als angebliche Telefonverkäuferin ein Vertrauensverhältnis zum heute 80-jährigen Mann aufgebaut hatte, soll sie ihm immer neue Lügen aufgetischt haben, um an sein Geld zu kommen.
Wie «Pilatus Today» berichtet, reichten die Geschichten von notwendigen Operationen bis hin zu kleineren Wasserschäden gereicht haben. Auch für angebliche Versicherungs- und Arztrechnungen sowie Mieten, soll der Rentner ins Portemonnaie gegriffen haben.
Alleine zwischen 2016 und 2017 soll sie dem gutgläubigen Senior so rund 280’000 Franken abgeknöpft haben. Das Geld soll derweil direkt zur Auslebung ihrer Spielsucht verprasst worden sein. Auch das Geld vom Sozialamt zum Lebensunterhalt ihrer Familie verspielte sie.
An diesem Donnerstag steht die Frau dafür nun vor dem Luzerner Kriminalgericht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, davon zwei Jahre auf Bewährung. Um ihre Spielsucht zu Behandeln, soll sie zudem an durch eine ausgewiesene Fachstelle betreut werden. Es gilt die Unschuldsvermutung. Schreibt ZentralPlus.
IT TAKES TWO TO TANGO! Das Mitleid mit dem 80-jährigen Rentner hält sich in überschaubaren Grenzen. So wie die Angeklagte durch eine ausgewiesene Fachstelle beraten werden soll, wäre eine ausgewiesene Beratung des Rentners ebenfalls angebracht, um ihn vor der Vormundschaftsbehörde zu schützen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
27.5.2021 - Tag der unwahren Wahrheiten
Rahmenabkommen Schweiz-EU: Cassis: «Lieber eine Verstimmung und dann einen neuen Weg gehen»
Ein Institutionelles Rahmenabkommen mit der EU ist nach vielen Jahren Verhandlungen gescheitert. Aussenminister Ignazio Cassis sprach an der Medienkonferenz von grundsätzlichen Differenzen zwischen der EU und der Schweiz. Im Interview erklärt er, auf welchem Weg es nun weitergehen soll.
Herr Bundesrat Cassis, Sie sind 2017 angetreten, dem Rahmenabkommen neues Leben einzuhauchen. Heute sind Sie damit gescheitert.
Ignazio Cassis: Ich habe mich stark dafür eingesetzt, dann einen Entwurf auf den Tisch gebracht und weiterverhandelt. Aber am Ende ist das Resultat nicht ausgewogen und der Bundesrat hat heute diesen Entscheid getroffen.
In einem «Geheim-Bericht» steht, dass die Auswirkungen gravierend sind bei einem Nicht-Unterzeichnen des Abkommens. Kann sich die Schweiz das leisten?
Ja, man muss sich immer fragen: Welche Alternative haben wir? Die Alternative war, diesen Entwurf zu unterschreiben. Und da wären die Auswirkungen noch gravierender? Also, es war eine Interessenabwägung.
Die Schweiz möchte mit der EU zusammenarbeiten. Sie möchte die aktuellen Abkommen aufdatieren, damit sie auch weiterhin gelten. Das kann nach dem heutigen Entscheid vergessen.
Gewisse Dinge werden jetzt kurzfristig sicher nicht erreicht. Ein neues Abkommen oder eine Aufdatierung eines bestehenden Abkommens, das ist in Kauf genommen. Das wussten wir. Aber auf der anderen Seite wäre ein Ja zu diesem Entwurf des Abkommens auch nicht der richtige Weg. Also, wir nehmen lieber eine Verstimmung in Kauf, um dann wieder einen neuen Weg zu beginnen.
Sie haben von Auffangmassnahmen gesprochen. Sie möchten die EU milde stimmen und haben auch vorgeschlagen, dass man die Kohäsions-Milliarde auszahlt. Das tönt nach Prinzip Hoffnung und weniger nach einem klaren Plan B.
Dieser Entscheid von heute, den Kohäsions-Beitrag deblockieren zu wollen, ist ein gutes, klares Signal gegenüber der EU. Schauen Sie, wir sind im Herzen des Kontinents. Wir wollen weiterhin gute Beziehungen.
Aber warum soll die EU da mitmachen?
Weil es in ihrem Interesse liegt. Die EU hat einen Handelsaustausch von einer Milliarde Schweizer Franken pro Werktag und das ist in ihrem Interesse, diesen Handelsaustausch zu haben.
Und was macht sie hoffnungsfroh, dass man mit der EU auf derselben Basis weiterarbeiten kann wie vor diesem Verhandlungsabbruch?
Dass heute Hunderte von gemischten Arbeitsgruppen Schweiz-EU stattgefunden haben und morgen noch einmal Hunderte solcher Arbeitsgruppen stattfinden. Unsere Beziehungen sind so solid, dass das jetzt eine Hürde auf dem Weg ist, aber der Weg ist gegeben.
Spielen Sie dieses heutige Verhandlungsende nicht ein bisschen zu sehr herunter?
Nein, es ist natürlich nicht erfreulich, dass wir hier keine Lösung gefunden haben. Auf der andern Seite, wenn Sie Grundprinzipien auf der einen und auf der anderen Seite haben, die nicht kompatibel sind, muss man irgendwann auch sagen: Okay, dieser Weg ist nicht der Richtige. Wir machen hier jetzt einen Stopp und gehen weiter auf einem anderen Weg.
Hätte nicht das Volk am Schluss mitreden sollen oder mindestens das Parlament?
Das wäre nicht verfassungskonform. Die Verfassung sagt, es ist eine Pflicht des Bundesrats, seine Verantwortung wahrzunehmen und zu entscheiden. Und wenn er überzeugt ist, dann kommt das Parlament und schliesslich das Volk dran. Wenn der Bundesrat nicht überzeugt ist, dann endet der Weg dort.
Das Gespräch führte Gion-Duri Vincenz.
Schreibt SRF.
In der Bundespressekonferenz von gestern sagte Bundesrat Cassis: Die grundsätzliche Differenz zwischen EU und Schweiz sei das Verständnis des Begriffs Freizügigkeit. «Für uns müssen zuziehende EU-Bürger ausreichende Mittel aufweisen. Die EU sieht das anders, mit der Unionsbürgerrichtlinie geht sie weiter als die Arbeitnehmerfreizügigkeit.» Dieses erweiterte Verständnis der Freizügigkeit verunmögliche es der Schweiz, darauf einzutreten. Etwa das Recht auf Daueraufenthalt oder Sozialhilfe für nicht Erwerbstätige käme einem Paradigmenwechsel gleich, was die Zuwanderungspolitik angehe.
Ob man nun dem Bundesrat nach den jahrelangen Verhandlungen mit der EU über das Rahmenabkommen gratulieren soll, wie's Blick in der heutige Onlineausgabe macht, sei dahingestellt. Wenn selbst die Schweizer SP über das geplatzte Rahmenabkommen jubelt, die ja eher mit einem Vollbeitritt der Schweiz zur EU liebäugelt, ist Misstrauen angebracht. Man könnte das Ergebnis der Verhandlungen über diesen gewaltigen Zeitraum durchaus auch als Versagen der Verhandlungsführer*innen bezeichnen. Sei's drum. Letztendlich hatte der Bundesrat gar keine andere Wahl.
Denn dieser Passus im Rahmenabkommen über die «Unionsbürgerrichtlinie», der Nota bene bisher den meisten Schweizerinnen und Schweizern aus welchen Gründen auch immer kaum bekannt war, hätte spätestens an der Wahlurne mit der Ablehnung durch das Schweizer Volk das gleiche Resultat erzeugt. Und die SVP hätte einmal mehr mächtig zugelegt.
Wie sagte Bundesrat Ueli Maurer vor den National- und Ständeratswahlen 2019 treffend: «Die SVP gewinnt die Wahlen mit den Themen "Flüchtlinge" und "EU" und nicht mit dem Klimawandel.» Wo Maurer mit seiner Expertise recht hat, hat er recht. Er vergass allerdings zu erwähnen, dass die «Schweizer Sozialhilfe für Ausländer» bei Schweizer Wahlen ein ebenso beliebtes Thema für die SVP ist wie die von ihm genannten.
Sich nun gegenseitig auf die Schultern zu klopfen und einen Sieg zu feiern, weil «wir es der EU wieder einmal gezeigt haben», könnte sich schon bald als Pyrrhussieg erweisen. Als mächtige globale Wirtschaftsunion dürfte die EU in ihrer Folterkammer einige Folterinstrumente besitzen, die der Schweizer Wirtschaft grosse Schmerzen verursachen könnten.
Ein weiterer Fakt könnte möglicherweise als Spassbremse die Euphorie des medialen Jubelchors etwas beeinträchtigen: Die immer wieder zitierte Balkanisierung der Schweiz hat mit der EU und dem mit der EU ausgehandelten Freizügigkeitsabkommen rein gar nichts zu tun. Albanien, Serbien, Kosovo und Mazedonien sind nicht EU-Mitgliedsstaaten.
Ebenso wenig wie die schleichende Islamisierung in der Schweiz auf eine EU-Massnahme zurückzuführen ist. Kein arabischer Staat und auch nicht die Türkei sind Mitglied der EU.
Die Ghettoisierung gewisser Schweizer Stadtquartiere darf ebenfalls nicht der EU zum Vorwurf gemacht werden: Eritrea und Kurdistan gehören meines Wissens nicht zur Europäischen Union.
Es sind aber vorwiegend Bürgerinnen und Bürger der vorgenannten «Problem»-Staaten, die in der Schweiz leben und seit Jahren sowohl als Arbeitslose wie auch Sozialhilfe-Empfänger*innen die Arbeitslosen- und Sozialhilfe-Kassen überproportional zu Hunderttausenden fluten. Falls Sie jetzt das Gefühl nicht los werden, dass dies eine masslose Übertreibung sei: ein Blick in die Statistiken der zuständigen Bundesämter hilft weiter.
Diese Entwicklung über Jahrzehnte hinweg geht ganz allein auf das Konto der Verantwortlichen der Schweizer Politik – inklusive der kreidefressenden SVP – und einer Industrie, die stets nach immer noch günstigeren Arbeitskräften giert. Die Verantwortung für diese gravierenden Missstände nun der EU in die Schuhe zu schieben, wie es an SVP-Stammtischen bis hinauf zu den hohen Kadern und den Alu-Hüten von der WELTWOCHE gang und gäbe ist, hat mit realen Fakten rein gar nichts zu tun. Mit billigem Populismus hingegen schon.
Nicht einmal die Flutwelle der Flüchtlingskrise 2015 kann auf die EU abgeschoben werden. Die Schweiz ist Mitglied des Dublin-Abkommens, das erst durch die Corona-Pandemie ausser Kraft gesetzt wurde.
Das Dublin-Abkommen gibt dem geografisch mitten in Europa liegenden Binnenstaat Schweiz die vertraglich abgesicherte Möglichkeit, Asylbewerber*innen in den Erstaufnahmestaat zurückzuführen. Man hätte es nur tun müssen.
Dass die Schweiz 2015 darauf verzichtete, hat zwar gute Gründe, die aber mit der EU nichts zu tun haben. Dafür umso mehr mit Solidarität gegenüber Nachbarsländern wie Italien, Deutschland oder Österreich zum Beispiel.
Die EU zu kritisieren ist nicht nur notwendig, sondern auch legitim. Sie aber für alle Übel dieser Welt zu instrumentalisieren und verantwortlich zu machen, wie es selbst die Staatschefs*innen der EU vor ihren nationalen Parlamenten gerne und oft praktizieren, lenkt nur vom eigenen Versagen ab. Boris Johnson, für den Roger Köppel vor lauter Überschwänglichkeit gegenüber dem Helden des Brexit einen Altar samt stets brennender Kerze aufgestellt hat, lässt grüssen.
Ob sich der Brexit tatsächlich zum Erfolgsmodell der Briten mausert, wird erst die Zukunft zeigen. Köppel könnte sich gewaltig irren. Die britische Industrie geht derzeit jedenfalls nicht nur wegen Corona sondern auch und vor allem wegen dem Brexit einen ungemütlichen, äusserst steinigen Weg.
Das könnte der Schweiz bei einem «Schwexit» ebenfalls blühen. So viel Wahrheit muss sein. Auch wenn die WELTWOCHE, das selbsternannte Verfassungsorgan der Schweiz, anderer Meinung ist.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
26.5.2021 - Tag der Umfragehure
In Deutschland wird der Glanz der Grünen blasser
Am 26. September, also in genau vier Monaten, wird in Deutschland gewählt. Die Spitzenkandidaten aller Parteien stehen nun fest. Zu kämpfen haben – überraschend – nun doch auch stark die Grünen.
Natürlich bemühen sich Tino Chrupalla und Alice Weidel am Dienstag, Freude zu zeigen. Sie sind per Mitgliedervotum zu den AfD-Spitzenkandidaten für die deutsche Bundestagswahl gekürt worden. Doch so ganz gelingen will es nicht. Die beiden Promis – sie Fraktionschefin, er Parteichef – bekamen nur 71 Prozent. 27,4 Prozent entfielen auf die weithin unbekannte Konkurrenz: Joana Cotar und Joachim Wundrak, die zum eher gemäßigten Lager der Partei zählen.
Überhaupt haben nur 48 Prozent der 32.000 AfD-Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen. "Wir müssen jetzt die Reihen schließen", mahnt Chrupalla eindringlich. Er sieht einen "schweren Wahlkampf, der vor uns liegt". Vermutlich ahnt er, dass der Kampf zwischen dem rechtsnationalen Lager und den Gemäßigteren nicht enden wird.
Die AfD war die letzte der bereits im Bundestag vertretenen Parteien, die ihr Spitzenpersonal bestimmte. Nun – vier Monate vor der Wahl am 26. September – ist die Riege komplett. Und das Rennen offen.
Eine Siegerin gibt es jedenfalls schon: Annalena Baerbock, die Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin der Grünen. Der 40-jährigen Niedersächsin wurde bei der Nominierung am 19. April so viel Aufmerksamkeit zuteil wie sonst keinem grünen Spitzenvertreter in den vergangenen Jahren.
Erste grüne Kanzlerkandidatin
Die Grünen liefern aber auch ein Novum: Zum ersten Mal bieten sie bei dieser Bundestagswahl eine Kanzlerkandidatin auf. Erstmals haben sie auch reale Chancen auf den Einzug ins Kanzleramt, das Angela Merkel im Herbst nach 16 Jahren verlassen wird. "Ich trete an für Erneuerung, für den Status quo stehen andere", erklärte Baerbock bei ihrer Nominierung selbstbewusst – auch um ein Manko an Erfahrung zu überspielen. Sie ist zwar im Bundestag vertreten, hatte aber noch nie ein Regierungsamt inne.
Es setzte ein Hype ein, der an die anfängliche Begeisterung für den SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz im Wahlkampf 2017 erinnerte. Nicht nur ein Umfrageinstitut vermeldete: Die Grünen liegen nun vor der Union, bei der sich CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder einen beispiellosen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur geliefert hatten.
Doch mittlerweile ist der grüne Glanz etwas verblasst, der Höhenflug der Spitzenkandidatin gebremst, und Baerbock hat viel Ärger. Ihren Wahlkampf belastet das Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Dieser hatte sich in einem Tweet rassistisch über den Fußballspieler Dennis Aogo geäußert, wollte dies aber als Satire verstanden haben. Baerbock trieb dennoch den Rausschmiss Palmers voran, der wehrt sich gegen "Ausgrenzung und Denunziation".
Debatte über Studium
Missverständlich fanden viele auch Baerbocks Lebenslauf im Internet. Wie könne es sein, dass die Grüne in England einen Master in Völkerrecht gemacht habe, zuvor in Hamburg aber keinen Bachelor, auf dem der Master aufbaut? Sie erinnerten sich auch an eine Veröffentlichung der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung 2011. Darin war von einem Bachelor die Rede gewesen.
Die grüne Pressestelle sah sich zu einer Klarstellung und der Veröffentlichung von Baerbocks Zeugnissen gezwungen, um zu zeigen, dass alles korrekt sei. Baerbock habe tatsächlich keinen Bachelor, sie habe die Voraussetzungen für das Studium in England aber mit dem Hamburger Vordiplom erfüllt.
Doch es kam noch größeres Ungemach, als bekannt wurde, dass Baerbock vergessen hatte, der Bundestagsverwaltung Sonderzahlungen in Höhe von 25.000 Euro aus den Jahren 2018, 2019 und 2020 zu melden. Diese waren ihr von den Grünen überwiesen worden.
"Blödes Versäumnis"
Nicht die Summe an sich wurde beanstandet, sondern die vergessene Meldung. Und dass Baerbock die Nachmeldung erst veröffentlichte, als die Bild-Zeitung nachfragte.
"Das war ein blödes Versäumnis. Ich habe mich darüber selbst wahrscheinlich am meisten geärgert. Als es mir bewusst wurde, habe ich es sofort nachgemeldet", sagte Baerbock danach.
Doch es blieb ein schaler Nachgeschmack. Die Grünen schreiben sich Transparenz auf die Fahnen und hatten im Frühjahr, als diverse Maskenaffären die Union erschütterten, die hohen Provisionszahlungen an Unionspolitiker scharf kritisiert.
Dass Baerbock dann auch noch bei einer Rede im Bundestag die soziale Marktwirtschaft der SPD zuschrieb und nicht korrekterweise der CDU und ihrem ersten Wirtschaftsminister und späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard, trug ebenso wenig zur Hebung der Stimmung bei wie die Debatte über Kurzstreckenflüge.
Diesbezüglich hatte Baerbock erklärt, sie wolle diese so verteuern, dass es auf eine komplette Abschaffung hinauslaufe. Es folgte der Vorwurf der "Verbotspartei" von allen Seiten, selbst Baerbocks grüner Co-Chef Robert Habeck ätzte, die Abschaffung von Kurzstreckenflügen sei eher ein Symbol, der Gewinn für das Klima dabei "nicht so besonders hoch".
Der "Schulz-Zug"
Mittlerweile verweisen viele in Berlin wieder auf den "Schulz-Zug". Mit einer Eisenbahn, die volle Fahrt aufs Kanzleramt nimmt, war der anfängliche Hype um den SPD-Kanzlerkandidaten 2017 verglichen worden. Doch dann warf es den Zug aus den Schienen, unter Schulz erzielte die SPD ihr bis dato schlechtestes Ergebnis von 20,5 Prozent, Merkel blieb Kanzlerin.
Vier Jahre später geht es den Sozialdemokraten auch nicht besonders gut. Schon im Sommer 2020 haben sie Finanzminister Olaf Scholz als Spitzenkandidaten präsentiert, auch ein Wahlprogramm mit der Forderung nach einer Vermögenssteuer und einem höheren Mindestlohn liegt seit langem vor.
Union wieder vorne
Doch in Umfragen kommt die SPD nicht vom Fleck, sie verharrt bei maximal 16 Prozent, auch wenn Scholz den Beginn der Aufholjagd ausgerufen hat.
An erster Stelle sehen manche Institute in Umfragen nun wieder die Union – wenngleich auf schwachem Niveau. 32,9 Prozent hatte sie bei der Bundestagswahl 2017 erreicht, nun bewegt sie sich zwischen 24 und 26 Prozent.
Auch Laschet als Spitzenkandidat zündet (noch) nicht richtig. Er muss erst einmal ein Wahlprogramm vorlegen und hat auch noch Druck aus Bayern. Der bei der Kanzlerkandidatur unterlegene CSU-Chef Söder legte die Latte für Laschet gerade hoch, indem er erklärte, die Union dürfe nicht als Juniorpartnerin in eine grün-schwarze Bundesregierung gehen: "Wenn die Union nicht mehr den Kanzler stellt, dann ist sie faktisch abgewählt." In dem Fall müsse sie in Opposition.
Die meisten Deutschen können damit offenbar gut leben. Laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts wünschen sich 61,5 Prozent einen Wechsel in der Bundesregierung. Das ist der höchste Wert seit 1990.
Vier Monate vor der Bundestagswahl stehen nun die Spitzenkandidaten aller Parteien fest. Zu kämpfen haben vor allem die Grünen. Ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zeigt Schwächen, der Hype flaut ab. Schreibt DER STANDARD.
So kommt es halt, wenn Journalisten*innen die Kanzler-Kandidatin «ihrer Herzen» kritiklos hochjazzen bis zum Gehtnichtmehr. Der menschliche Herdentrieb sorgt in solchen Momenten für kurzfristige Umfrageergebnisse, die nur eine Richtung kennen: Nach oben bis hin zum utopischen Wahlsieg.
Doch die öffentliche Wahrnehmung, gesteuert durch die nichtssagenden Clickbaiting-Artikel von Agenturen und übernommen von notleidenden Medien, ist und war schon immer eine verblödete und unzuverlässige Hure.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Grüne Kanzlerkandidatin Baerbock durch irgendeinen – in diesem Fall lächerlichen und aufgebauschten – Sündenfall vom Umfragethron gestossen wird.
Das ist nun eingetroffen. Doch da wird noch mehr kommen, wenn sich das Wahlvolk eingehend mit dem Wahlprogramm der Grünen beschäftigt, das mehr oder weniger von experimentellen Utopien geprägt ist und jeder, aber auch wirklich jeder Klientel ein ebenso verlogenes wie süsses Zückerchen anbietet, das im Endeffekt niemals durchgesetzt werden kann. Es sei denn, Deutschland schafft sich frei nach Thilo Sarrazin tatsächlich ab.
Keine Bange; das wird nicht eintreten. Was immer die Grünen im Wahlkampf versprechen ist nach der Wahl Geplapper von gestern. Denn sie werden höchstens als Koalitionspartner mitregieren. Damit lassen sich die gebrochenen Verheissungen aus dem Wahlkampf auf den Koalitionspartner abschieben. Das praktizierten die Grünen schon als Regierungsmitglied unter Kanzler Schröder recht erfolgreich. Wendehals Joschka Fischer lässt grüssen.
Dass nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Merkel eine gewisse Wechselstimmung bei den Deutschen vorherrscht, ist anzunehmen. Das war schon nach der 16-jährigen Kanzlerschaft vom «ewigen» Kanzler Helmut Kohl so. Doch damals gab es mit Gerhard Schröder von der SPD eine ernstzunehmende Alternative jenseits der seit ewigen Zeiten regierenden CDU/CSU für das Kanzleramt. Entsprechend wurde Schröder denn auch gewählt.
Doch diesmal fehlt eine adäquate Alternative für die deutsche Bundestagswahl im Herbst 2021 querbeet durch alle deutschen Parteien. Die ehemals stolze SPD präsentiert mit Olaf Scholz gar eine Lachnummer sondergleichen als Kanzlerkandidat.
Und so wird sich das deutsche Wahlvolk für das kleinste aller Übel entscheiden: Armin Laschet von der CDU. Die Partei der Grünen wird den zweiten Platz holen und damit an den Futtertrögen der Regierung Platz nehmen. Und allein darum geht es den Grünen: Endlich wieder mitregieren und abkassieren, was die Bundesschatulle hergibt.
Wetten, dass?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.5.2021 - Tag der Clickbaiting-Artikel von Blick
Anonym – zuverlässig – illegal: So funktioniert der Schweizer Online-Drogenhandel
Auf dem Messenger Telegram bestellt. Mit Bitcoins bezahlt. Per Post geliefert. Was früher an schummrigen Strassenecken geschah, läuft heute digital. Insider erklären bei «Blick TV: Undercover» das ebenso perfide wie geniale System des Online-Drogenhandels.
Am Bahnhof bezahlt - Per Post geliefert: Wie Drogen-Netzwerke Schweizer Staatsbetriebe missbrauchen / 100 Stutz sind schnell futsch: Die Gefahren im Online-Drogenhandel / «Alle hinter Gitter zu bringen wäre illusorisch»: So machtlos kämpft die Polizei gegen den Online-Drogenhandel (Erklärvideos).
Ab Dienstag, 25. Mai 2021 geht das Rechercheformat «Undercover» von Blick TV in die zweite Runde. Während sieben Folgen deckt Reporter Benjamin Fisch auf, wie die grossen Schweizer Online-Drogen-Netzwerke funktionieren und wie sie die SBB, die Post oder den Messenger-Dienst Telegram für ihre illegalen Geschäfte missbrauchen.
Ein Selbstversuch des Reporters macht deutlich, wie einfach man heutzutage mit einem Smartphone an gefährliche Substanzen kommt. Zudem dokumentiert Blick, wie skrupellose Internetbetrüger die Sucht von Menschen ausnutzen, um an Geld zu kommen, und spricht mit Polizisten und Zollbeamten über die neuen Herausforderungen im Kampf gegen das Drogen-Onlineshopping.
Probleme mit Drogen? Hier gibt es Hilfe!
Handel und Besitz von Betäubungsmitteln sind in der Schweiz illegal und können mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden. Für Menschen, die Drogenprobleme haben, bietet Sucht Schweiz Hilfe: www.suchtschweiz.ch. Schreibt Blick.
Gut gebrüllt Löwe? Nein, der Artikel erweist sich als reiner Clickbaiting-Artikel. «Undercover» tönt zwar gut; so richtig nach investigativem Journalismus. Doch dem ist leider nicht so.
Die als «undercover» von Blick vermarktete «Rechercheaktion» liefert nur längst bekannte Tatsachen und strotzt zu allem auch noch von falschen Schlüssen, die Blick teilweise zieht. At example: Dass Drogen mit Bitcoin bezahlt werden, setzt voraus, dass er/die/das Konsument*in ein Bitcoin-Konto besitzt.
Diese Bitcoin-Klientel ist allerdings überschaubar und setzt sich nebst erfolgreichen, risikofreudigen Spekulanten, umsatzstarken Drogenhändlern und mafiösen Kriminellen vor allem aus gutverdienenden Erwachsenen aus der Mitte der Gesellschaft zusammen, bei denen die modischen Hardcore-Drogen aller Art längst angekommen sind.
Bei denen aber auch Hopfen und Malz längst verloren ist und die deshalb auch vernachlässigbar sind. Fällt ein Mitglied dieser Gruppe doch noch durch die Maschen und mutiert im Laufe der Zeit zum gesellschaftlich verpönten Junkie, wird ihm eine absurde Entwöhnungskur verpasst: Die eine Droge (Kokain, Heroin, Crystal Meth, Extasy, LSD usw.) wird durch eine andere Droge (Methadon) ersetzt.
Unser wirkliches Drogenproblem ist der Konsum von harten Drogen jugendlicher Kids bis hinunter zum Alter von 13-Jährigen, wie die Luzerner Vorortgemeinde Ebikon in einem tragischen Hilferuf, getarnt als Newsletter, anfangs dieses Jahres schrieb. Minderjährige und die üblichen Strassendealer besitzen kein Bitcoin-Konto.
Richtig ist, dass die «Kinder vom Bahnhof Luzern» (in Anlehnung an einen berühmten Film aus den 70-er Jahren) und deren Kleindealer alle mindestens einen, viele sogar zwei Messenger (WhatsApp und Telegram) mit ihrem Smartphone benutzen, mit dem sie Kauf und Übergabeort vereinbaren. Nur die dümmsten und verzweifelte Drogenkonsumenten*innen kurz vor dem «Cold Turkey» und Kleindealer lassen sich noch auf den einschlägig bekannten Plätzen von Polizeipatrouillen bei der Drogenübergabe erwischen.
Das weiss auch die Polizei, doch ihr sind die Hände gebunden. WhatsApp- oder Telegram-Messenger zu überwachen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Der gesetzlich vorgeschriebene Datenschutz setzt hohe Hürden. Und das ist gut so!
Eltern minderjähriger Kinder hingegen dürfen das Smartphone ihrer Kinder kontrollieren, sofern es nicht heimlich vonstatten geht sondern zusammen im Teamwork.
Was lernen wir daraus? Zu Hause beginnt die Zukunft über Hit oder Shit*! Alles nur der Polizei in die Schuhe zu schieben, ist zu einfach.
* «Shit» war früher ein Gossenwort für Marihuana; ob das heute noch zutrifft, weiss ich nicht. Ich ziehe ja schliesslich ein Kirschstängeli einem überdosierten Joint vor.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.5.2021 - Tag der Abgehalfterten
Zuger Komiker spottet über Coronapolitik: Marco Rima startet eigene Show beim «Nebelspalter»
Der Zuger Komiker hat diesen Sonntag das erste Video seiner neuen Show «Rima-Spalter» lanciert. Das Thema überrascht kaum: Es geht um Corona.
«Corona unser» lautet der Titel des ersten Beitrags, den Marco Rima für den «Nebelspalter» produziert hat. Im Video äussert sich der Zuger Comedian über die Coronapolitik des Bundesrates und die öffentliche Debatte zum Thema. Das dürfte kaum jemanden erstaunen, Rima hatte in der Vergangenheit öfters die Coronamassnahmen kritisiert, was wiederum ihm selber Kritik einbrachte.
Das Video bildet den Auftakt seiner eigenen Show «Rima-Spalter» beim traditionsreichen Satiremagazin, das seit Mitte März ein Onlineportal betreibt. «Jede Woche neu wird Rima über den Wahnsinn unserer Zeit in Zukunft und Vergangenheit berichten, lästern, spotten, um Vergebung beten und ihn rezitieren, – zum Lachen und zum Nachdenken», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.
Chefredaktor Markus Somm zeigt sich darin erfreut über das Engagement von Marco Rima. «Sein Mut, sein Witz, seine Intelligenz werden den Nebelspalter bereichern und prägen. Ein grosser Name für eine grosse Marke», lässt sich Somm zitieren. Die Sendung des Zugers wird jeweils montags auf dem Onlineportal aufgeschaltet – wegen Pfingsten zum Start bereits am Sonntag. Schreibt ZentralPlus.
Rima und the good old Nebelspalter: Beide nur noch ein Schatten ihrer selbst. Nebelspalter-Besitzer und Rechtsaussen Markus Somm, ehemaliger und kolossal gescheiterter Chef (von Blochers Gnaden) der «Basler Zeitung», der 2009 ein Buch, besser ausgedrückt eine Lobhudelei über seinen Messias vom Herrliberg mit dem Titel «Christoph Blocher: Der konservative Revolutionär» veröffentlichte und seither als «Wurmfortsatz» seines Meisters gilt, lobt Rima in den höchsten Tönen: «Sein Mut, sein Witz, seine Intelligenz werden den Nebelspalter bereichern und prägen.»
Tempi passati. Rimas «Mut» ist inzwischen sowas wie ein Markenkern für den Begriff «Alu-Hut» rund um Verschwörungstheorien, sein «Witz» begrenzt sich nicht selten auf billigste, rassistische Pöbeleien um Andersdenkende und Andersfarbige – seine «Negerwitze» geniessen in gewissen Kreisen Kultstatus – und ob die «Intelligenz» beim abgehalfterten Grundschullehrer und Comedian je vorhanden war, durfte – nicht erst seit heute – schon immer bezweifelt werden.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.5.2021 - Tag des Frauenbarts
Italo-Rocker gewinnen, Fast-Sensation für die Schweiz: Gjon's Tears holt den 3. Rang am Eurovision Song Contest
Es war eine Zitterpartie: Gjon's Tears stand heute im Finale vom Eurovision Song Contest und zählte zu den Favoriten. Den Erwartungen wurde er bei weitem gerecht.
Die Schweiz spielte bis zur letzten Sekunde um den Sieg mit: Gjon's Tears (22) holt im Finale vom Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam (Niederlande) den dritten Platz. Mit seiner Ballade «Tout l'univers» berührte er über 180 Millionen Fernsehzuschauer und holte insgesamt acht Mal während der Vergabe der Jury-Punkte die legendären «12 Points».
«Heute gibts eine riesen Party. Schlummi, Schlummi Schlummi!», freut sich die Schweizer ESC-Hoffnung nach dem Finale. «Ich wollte eine Bestätigung für die Qualität meiner Arbeit erhalten. Mit dem dritten Platz und dem ersten Rang bei der professionellen Jury habe ich das geschafft. Das ist ein wunderschönes Gefühl für mich.»
Erster Platz bei der Jury, dritter Platz insgesamt
Schlussendlich seie es Geschmacksache, meint Gjon's Tears weiter: «Der Gewinner zu sein, heisst nicht, der beste zu sein. Es heisst, der beliebteste zu sein.» Sein Ziel sei es stets gewesen, unter die besten fünf zu kommen. Das habe er nun geschafft. «Ich bin super stolz auf mich. Ich habe davon geträumt, aber das überhaupt nicht erwartet.»
Mit seinem Lied triumphierte der Musiker aus Broc FR 2021 in der Abstimmung der professionellen Jury vor Frankreich und Malta. Kombiniert mit den Zuschauerstimmen holte er beim Endresultat damit das beste Schweizer Resultat seit 1993. Damals erreichte auch Annie Cotton (45) mit dem Lied «Moi, tout simplement» den dritten Rang.
Italiener holen ersten Sieg seit 1990
Grosser Sieger des Abends war die italienische Rock-Band Maneskin: Mit ihrem Lied «Zitti e buoni» gewannen sie das Zuschauervoting und überholten damit den Schweizer Gjon's Tears. Zuletzt gewann Italien den ESC im Jahr 1990, damals siegte Toto Cotugno (77) mit «Insieme 1992». Måneskin sorgten während der Punktevergabe für Aufsehen: Es schien, als würde der Sänger Damiano David (22) mitten im Green Rom Drogen konsumieren.
Bitter waren die Zuschauervotings für die Niederlande, Deutschland, Grossbritannien und Spanien. Die vier Länder holten in der Gunst des Publikums die gefürchteten «Zero Points», also überhaupt keine Punkte. Das Vereinigte Königreich bekam zusätzlich keine Punkte von der professionellen Jury, was sie zum ersten Land überhaupt macht, das seit der Einführung des neuen Wertungsmodus 2016 weder von den Zuschauer, noch von der Jury Punkte erhielt.
Luca Hänni landete 2019 auf dem vierten Rang
Die Erwartungen an den heutigen Abend waren für Gjon's Tears hoch: Wettbüros sahen ihn bis zuletzt unter den besten fünf Beiträgen der diesjährigen Ausgabe. Mit den Prognosen wollte sich der Sänger aber nicht beschäftigen: «Das zehrt nur an der Energie, die ich voll und ganz in meinen Auftritt investieren will.»
2019 hatte Luca Hänni mit seinem Beitrag «She Got Me» für einen Achtungserfolg der Schweiz gesorgt. Er landete damals auf dem vierten Platz. Nun hat Gjon's Tears sein Resultat sogar übertrumpft.
Gjon's Tears sollte 2020 schon für die Schweiz zum ESC
Mit dem ESC-Finale in Rotterdam geht für Gjon's Tears eine lange Reise zu Ende. Schon 2020 sollte er die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt vertreten, wegen der Corona-Pandemie wurde die damalige Ausgabe abgesagt. Das Schweizer Fernsehen nominierte ihn erneut für die nächste Ausgabe, ein neues Lied musste allerdings noch gefunden werden. Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben. Schreibt SontagsBlick.
Gibt es tatsächlich noch Masochisten*innen ausser Sven Epiney, die sich dieses Dinosaurier-Format des musikalisch dargebotenen Schwachsinns antun, an dessen Sieger*innen sich nicht einmal die Hardcorefans der ultimativen Verblödung zwei Tage später erinnern können. Es sei denn, der/die/das Gewinner*in tritt als Frau auf und trägt einen Männerbart.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.5.2021 - Tag der Pfingsaffären
Fux über Sex: «Wir haben keinen Sex. Hat er eine Affäre?»
Mein Mann (38) und ich sind gut zehn Jahre zusammen. Wir leben nur noch wie Bruder und Schwester. Er sagt, er brauche keinen Sex. Ich finde das komisch. Hat er vielleicht eine Affäre? Ich hätte gerne Tipps, wie ich unser Sexleben auffrischen und seine Lust wieder entfachen kann. S. (42, w)
Liebe S.
Wenn sich jemand aus der gemeinsamen Sexualität zurückzieht, kann das für das Gegenüber äusserst schmerzlich sein. Denn beim Paarsex geht es praktisch nie nur um das Ausleben von Lust, sondern es sind auch ganz viele andere Bedürfnisse und Themen damit verknüpft. Für dich scheint unter anderem die Bestätigung daran zu hängen, dass ihr nach wie vor als exklusives Zweiergespann unterwegs seid.
Es ist verständlich, dass du dir Tipps wünschst, wie du eure Sexualität wieder beleben könntest. Gerade wenn zwei Partner beim Sex aktuell nicht das Gleiche wollen, braucht es aber mehr als ein paar knackige, hastig verordnete Massnahmen. Es braucht eine sorgfältige Analyse der Situation und der Bedürfnisse, sonst können vermeintlich tolle Tipps zu einem Bumerang werden.
Um Impulse zu finden, die wirklich zu euch passen, werdet ihr darüber sprechen müssen, was genau euch im Alltag durch die eingeschlafene Sexualität fehlt und welche Bedürfnisse ihr durch Sex befriedigen wollt. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, welchen Platz Sinnlichkeit in eurem offenbar eingespielten Alltag hat und wo und wie ihr bereit seid, Routinen zu durchbrechen.
Deine Angst, dass dein Mann eine Affäre hat, ist menschlich. Es ist jedoch wichtig, dass du ihn nicht von vornherein in eine Täterrolle drängst oder seine Sexualität zu stark reduzierst. Denn hinter der Erwartung, dass dein Mann eine Affäre hat, weil er nicht mit dir schläft, könnte ein Bild von männlicher Sexualität stecken, das viel zu eindimensional ist. Schreibt Caroline Fux im Blick.
Liebe, 42-jährige S. Frau Fux belügt Dich. Natürlich hat Dein Mann eine Affäre. Die männliche DNA besteht nur aus Affären, wir Männer sind sowas wie die fleischgewordene Affäre.
Glücklicherweise herrscht ja inzwischen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Niemand hindert Dich, liebe 42-jährige S., ebenfalls ausserhalb des Gartenhags zu grasen.
Just do it! Meine Telefonnummer steht im Telefonbuch.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.5.2021 - Tag der asiatischen Mathe-Genies
Warnung von Ökonomen: USA und China hängen Europa ab
Eine neue Studie für die EU-Finanzminister schlägt Alarm: Europa falle im internationalen Wettbewerb zurück. Die Autoren fordern deshalb neue Ausgabenprogramme – und damit mehr Schulden.
Für die 750 Milliarden Euro des EU-Wiederaufbaufonds sind noch nicht einmal die Pläne fertig, da wird in der Gemeinschaft schon über weitere Kreditprogramme diskutiert. Die EU sollte zusätzliche Schulden aufnehmen, um die Konjunktur anzukurbeln und den klimagerechten Umbau der Industrie voranzutreiben, empfiehlt eine Studie, die die Brüsseler Denkfabrik Bruegel für das Treffen der EU-Finanzminister an diesem Freitag in Lissabon erstellt hat. »In Europa besteht Aufholbedarf«, sagt Bruegel-Chef Guntram Wolff. »Ein gezielter Impuls aus den nationalen Haushalten könnte zu einer schnelleren konjunkturellen Erholung beitragen.«
Wie schwach die Staatengemeinschaft in die Nach-Corona-Ära startet, können die Minister den Tabellen des Bruegel-Papiers entnehmen. Demnach wird Chinas Wirtschaft zwischen 2019 und 2023 um mehr als 23 Prozent wachsen und die der USA um immerhin fast acht Prozent. Die Wirtschaft in Europa wird im selben Zeitraum dagegen nur gut halb so schnell zulegen, mit großen regionalen Unterschieden. Während Länder wie Polen oder Rumänien ähnliche Wachstumsraten ausweisen wie die USA, kommt der Süden des Kontinents wirtschaftlich kaum voran. Italien zum Beispiel wird nach den Bruegel-Daten erst im Jahre 2023 wieder das Vorkrisen-Niveau erreichen.
Grund ist nicht nur die Seuche, die im Süden der EU weit schlimmer gewütet hat als im Norden. Die schwache Entwicklung hängt der Studie zufolge auch mit der vergleichsweise zurückhaltenden europäischen Finanzpolitik zusammen. Die EU-Staaten haben im Krisenjahr 2020 im Schnitt nur Haushaltsdefizite ohne Zinszahlungen in Höhe von rund sechs Prozent der Wirtschaftsleistung aufgewiesen. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten lag das Etatminus dagegen bei zehn bis zwölf Prozent. Hinzu kommt, dass der EU-Aufbaufonds »auch erst 2022 richtig greifen« werde, sagt Wolff.
Die Bruegel-Forscher empfehlen den EU-Finanzministern deshalb eine Doppelstrategie:
Zum einen gebe es in der Gemeinschaft »Grund für einen zusätzlichen kurzfristigen Fiskalimpuls«, heißt es in der Studie, um das Vorkrisenniveau »rascher wieder zu erreichen«. Gemeint ist also ein neues Konjunkturprogramm.
Darüber hinaus plädieren die Bruegel-Forscher für ein zusätzliches mittelfristig angelegtes Programm zum klimagerechten Umbau der europäischen Wirtschaft.
Schon im vergangenen Jahrzehnt lagen die staatlichen Investitionen in der EU deutlich unter dem Niveau der Vergleichsländer. Dabei werde es auch im nächsten Jahr bleiben, so die Studie. Deshalb müssten die Euro-Länder mehr Spielraum für staatliche Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur bekommen.
Aufweichen des Fiskalpakts
Dass die europäischen Finanzminister in Lissabon entsprechende Beschlüsse fassen, ist nicht zu erwarten. Zu groß sind die Differenzen: Auf der einen Seite der Süden des Kontinents, der auf weitere Schuldenprogramme drängt. Und auf der anderen Seite viele Länder im Norden, denen schon der gemeinsame Aufbaufonds zu weit ging. Aber darauf kommt es der portugiesischen Regierung, die das Papier in Auftrag gegeben hat, auch nicht an. Sie will den Boden für jene Debatte bereiten, die in Europa im Herbst beginnen wird. Sollen die EU-Fiskalkriterien mit ihren strikten Grenzen für Kreditaufnahme und Schuldenstand gelockert werden?
Derzeit gibt es dazu in der EU keine Antwort, sondern ein politisches Patt. Doch das könnte sich nach den Bundestagswahlen ändern. Die Grünen plädieren dafür, die EU-Regeln genauso aufzuweichen wie die Schuldenbremse des Grundgesetzes. Und auch bei Union und SPD gibt es entsprechende Forderungen, für die das Bruegel-Papier nun zusätzliche Argumente liefert. Eine »Überarbeitung der Fiskalregeln ist wünschenswert«, heißt es in der Studie, »um staatliche grüne Investitionen zu befördern«. Schreibt DER SPIEGEL.
Oh heilige Maria Mutter Gottes! Das ist doch mal eine Neuigkeit: Die USA und China hängen die hehre Wertegemeinschaft EU (Europa) ab! Wer hätte das gedacht, was schon lange voraussehbar war und nicht erst seit heute längst eine Tatsache ist?
Gunnar Heinsohn zum Beispiel. So schrieb er bereits am 31.12.2019 in der WELT einen Gastartikel mit dem Titel «Deutschland muss endlich asiatische Mathe-Talente abwerben».
Was allerdings nur ein Aspekt dieses komplexen Themas ist. Das sei hier festgehalten. Aber diesem Aspekt wollen wir für heute dennoch nachgehen.
Ich bin kein grosser Fan des deutschen Wirtschaftswissenschaftlers, Soziologen und freien Publizisten Gunnar Heinsohn und seinen Büchern und Essays. Dafür liegt mir der emeritierte Professor für Sozialpädagogik an der Universität Bremen mit seinem oft und gerne vorgetragen «autochthonen» Bullshit doch etwas zu nahe beim deutschen Enfant terrible Thilo Sarrazin. Wer je ein Buch der beiden Publizisten gelesen hat, weiss, was ich meine.
Beide geben sich als Korinthenkacker redlich Mühe, in ihren Büchern und Publikationen («Söhne und Weltmacht» von Heinsohn z.B., oder «Deutschland schafft sich ab» von Sarrazin) das lesende Publikum mit einer Flut von Zahlen bis ins kleinste Detail und unzähligen Studien zu vergraulen, die sie auch noch – um jede Kritik schon im Vorfeld abzuschmettern – mit unzähligen Fussnoten versehen, die für sich allein schon beinahe ein Buch füllen würden.
Kommt noch hinzu, dass bei beiden nicht selten ein latenter Rassismus durchschimmert. Die Grenze zwischen einer faktischen Behauptung und Rassismus ist fliessend und obliegt letzten Endes den Leserinnen und Lesern. Was bei mir möglicherweise ein Kopfschütteln hervorruft, kann bei einem/einer SVP- oder AfD-Leser/Leserin und durchgeknallten Alu-Hüten dazu führen, dass er/sie/es sich vor lauter Begeisterung die Kleider vom Leib reissen.
Doch wo die beiden Apologeten des Untergangs von Deutschland, Europa und ab und zu sogar der ganzen Welt recht haben, haben sie recht. Das kann ihren schwer lesbaren Schriften niemand aberkennen.
Während sich die Asiaten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für die Bildung ihrer Kinder einsetzen und demzufolge seit Jahren die PISA-Statistiken auf den vordersten Plätzen anführen, kümmert sich die hehre westliche Wertegemeinschaft (inklusive USA) um Genderismus bis hin zur gendergerechten Toilette und gendergerechter Rechtschreibung. Hinzu kommt noch ein von gewissen Parteien des linken Spektrums verordneter Werte-Kanon zur Identitätsfindung.
Vor Gott und den Grünen inklusive SP sind alle Menschen gleich. Doch einige sind etwas gleicher. Wie schon George Orwell in «Animal Farm» schreibt; allerdings mit Blick auf die Schweine, die sich in seinem Buch über die andern Tiere erheben.
Je nach Situation und Präsident praktizieren die USA ein knallhartes oder eher softes, aber stets den Umständen angepasstes Migrationssystem. Die asiatischen Mathe-Genies brauchen sie gar nicht erst zu importieren. Da gibt es bereits genügend gut ausgebildete junge Menschen aus der zweiten Generation der asiatischen Migranten, die vor vielen Jahren in God's own Country eingewandert sind.
Europa hingegen übernimmt planlos die vom Hegemon USA in den Nahostkriegen hinterlassen Kollateralschäden und lässt sich von Flüchtlingswellen überfluten. In Anlehnung an Peter Scholl-Latour, leicht abgewandelt: «Wer halb Arabien aufnimmt, hilft nicht Arabien, sondern wird selbst zu Arabien.»
In gewissen No-go-Areas europäischer Staaten ist dies inzwischen leider bereits brutale Wirklichkeit.
Seien wir doch ehrlich und machen wir uns kein X für ein U vor: Etliche Migranten und Migrantinnen aus Nahost sind zwar gekommen um zu bleiben. Aber nicht unbedingt um zu arbeiten. Es gibt ja Gründe, weshalb die reichen arabische Staaten wie Saudi Arabien und die Golf-Emirateso gut wie keine arabischen Flüchtlinge in ihren Ländern aufnehmen, sich dafür aber mit Arbeitskräften vorwiegend aus Asien eindecken.
Deutschland durfte dies bereits feststellen, deren Hartz 4-Empfäger*innen seit 2015 bis 2020 um über eine Million Personen zugenommen haben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.5.2021 - Tag der Infantilen
Fifa-Affäre: Ausserordentlicher Bundesanwalt legt Mandat nieder
Der ausserordentliche Bundesanwalt Stefan Keller tritt von seinem Amt zurück. Vor zwei Wochen hat das Bundesstrafgericht Keller wegen Befangenheit gegenüber dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino in den Ausstand versetzt. Den Antrag auf Disqualifikation von Keller hatte Infantino gestellt. Grund waren öffentliche Äusserungen von Keller zum Verfahren. Damit habe er gegen die Unschuldsvermutung verstossen, so das Bundesstrafgericht.
Keller kritisiert Urteil des Bundesstrafgerichts
Keller habe der Gerichtskommission mitgeteilt, dass er sein Mandat an die Bundesversammlung zurückgeben werde, teilte sein Sekretariat am Mittwochabend mit. Zuvor habe er der Gerichtskommission aufgezeigt, dass das Urteil des Bundesstrafgerichts «weder schlüssig begründet ist, noch die Rechtssprechung zur Befangenheit von Staatsanwälten berücksichtigt».
Es sei davon auszugehen, dass das Urteil «ergebnisorientiert und nicht mit der erforderlichen Unabhängigkeit gefällt worden ist». Angesichts der derzeitigen personellen Besetzung des Bundesstrafgerichts sehe er sich nicht mehr in der Lage, seine Ermittlungen «zielführend und innert nützlicher Frist zu Ende zu führen».
Suche nach Nachfolger wird vorbereitet
Andrea Caroni, Präsident der Gerichtskommission, erklärte, dass die Kommission von der Niederlegung des Mandats Kenntnis genommen und mit Keller vereinbart habe, sein Mandat per 31. Mai zu beenden. Die Kommission habe in Absprache mit der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) begonnen, die Wahl eines neuen ausserordentlichen Bundesanwaltes respektive einer Bundesanwältin vorzubereiten.
Als ausserordentlicher Bundesanwalt wurde Keller gewählt, um das Strafverfahren gegen Michael Lauber sowie allfällige Mittäter und Teilnehmer wegen Verdacht auf Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses und Begünstigung durch das Abhalten von mehreren nicht protokollierten Treffen mit FIFA-Präsident Infantino, Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold und weiteren Personen durchzuführen.
Infantino will mit Justizbehörden kooperieren
Gianni Infantino und die Fifa hatten den Entscheid des Bundesstrafgerichts begrüsst. Ein Festhalten an Keller hätte einen fairen Prozess infrage gestellt. Keller habe mit seinem Verhalten nicht einmal juristischen Basisstandards genügt.
Die Fifa und ihr Präsident wiederholten zudem ihre Bereitschaft zur vollumfänglichen Kooperation mit den Justizbehörden. Schreibt SRF.
Für viele Journalisten – wie zum Beispiel vom SPIEGEL – sind die FIFA und deren Präsident Infantilo wie auch dessen Vorgänger Sepp Blatter der Inbegriff für Korruption. In der Schweiz geniessen sowohl die Institution wie auch deren Präsidenten seit jeher Narrenfreiheit. Die FIFA bezahlt ja nicht mal nennenswerte Steuern. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20141044
Ausser dem Schweizer Gesundheitswesen gibt es wohl kaum einen anderen Wirtschaftsbereich, der besser mit der Politik bis hinauf in die allerhöchsten Kreise vernetzt ist als der Fussball. Die A-fonds-perdu-Corona-Beiträge an Fussballclubs sprechen Bände. Ebenso die unselige Ansage von Bundesrätin Amherd, die Schweiz habe ja kaum Fussballmillionäre, mit der sie die Zahlungen rechtfertigte. Frau Amherd war scheinbar noch nie in der Tiefgarage vom FC Luzern, um sich den privaten Fuhrpark der Luzern Spieler anzusehen.
Man ist weder ein Weltverbesserer noch ein Ketzer oder Hetzer, wenn man der Meinung ist, dass die Corona-Hilfe eigentlich Aufgabe des wohl reichsten Sportverbands der Welt mit einem geschätzten Milliardenvermögen von gegen fünf Milliarden Franken gewesen wäre.
So funktioniert nun mal die totale Vernetzung zwischen Politik und Fussball: Gewinne werden privatisiert und Verluste sozialisiert.
Das gilt auch für die wohl ertragreichste Einnahmequelle der Schweizer Fussballclubs: Die TV-Übertragungen von SRF. Mehr als 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung (siehe Quoten SRF / Fussballübertragungen) sehen sich kein einziges Fussballspiel auf SRF an. Doch die horrenden Kosten von SRF für die Übertragungsrechte, die über die TV-Werbung nicht gedeckt sind, trägt die gesamte Bevölkerung über die TV-Zwangsgebühren. Wie auch für die Tennis- und Formel-1-Übertragungen von SRF.
Die Narrenzunft der Herren und Damen von der «classe politique», wie sie etwas despektierlich von Napoleon Bonaparte Blocher vom Feldherrenhügel auf dem Herrliberg genannt werden, sind sich bewusst, welchen Wert die Dekadenz von «Brot und Spiele» fürs gemeine und in der Regel nicht sonderlich mit überragender Intelligenz gesegnete Fussvolk darstellt.
Damit gegen den in der englischen Presse als «Godfather» benannten ehemaligen Präsidenten Sepp Blatter von der FIFA überhaupt von Schweizer Behörden ermittelt wurde und noch immer wird, brauchte es die gütige Mithilfe und Intervention der USA, genauer gesagt vom FBI. https://www.zeit.de/politik/2015-06/fifa-joseph-blatter-fbi-ermittlungen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Wenn der Hegemon der «hehren westlichen Wertegemeinschaft» ruft, steht selbst die Schweizer Justiz mit zusammengekniffenen Arschbacken «Gewehr bei Fuss» und lässt beispielsweise das Schweizer Bankengeheimnis innert Wochenfrist fallen. Frau Widmer-Schlumpf und das Jahr 2015 lassen grüssen.
So geht Weltmacht. Beim Verfahren gegen den unsäglichen Blatter muss man den USA allerdings dafür dankbar sein.
Beim derzeitigen Justiz-Verfahren, in das FIFA-Präsident Infantilo involviert ist, sollte Bundesanwalt Stefan Keller Licht ins Dunkel bringen.
Doch ihm erging es nach ein paar törichten Presse-Statements wie dem Prediger vom See Genezareth: «Jesus sprach, es werde Licht. Doch Jesus fand den Schalter nicht.»
Infantilo wird sich die Hände reiben. Ziel erreicht!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.5.2021 - Tag der Datenkraken
Überwachung von Metadaten: Threema muss Behörden keine Daten bereitstellen
Der Schweizer Messenger-Dienst siegt gegen die Strafverfolgungsbehörden vor Bundesgericht. Er muss keine Daten liefern. Den Datenaustausch hatte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD gefordert. Das Bundesgericht bestätigt damit einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts von 2020. Die Schweizer App Threema verspricht anonymen Austausch mit anderen Personen, ob per Nachricht oder Internet-Anruf. Den Behörden passt das aber nicht. Der Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF) forderte 2018 eine Echtzeitüberwachung der Metadaten und die Aufhebung der Transportverschlüsselung.
Privatsphäre gegen Sicherheit
Für Martin Blatter, CEO und Mitgründer von Threema, handelt es sich dabei um ein «populistisches Mittel, um von Behördenversagen abzulenken.» Immerhin seien den Behörden bei allen grossen Anschlägen der letzten Jahre die Täter ja ohnehin schon bekannt gewesen.
Der ÜPF wiederum stützt sich aufs Fernmeldegesetz. Dieses besagt, dass «Fernmeldedienstanbieter» wie Swisscom und Sunrise den Strafverfolgungsbehörden auf Anfrage gespeicherte Daten aushändigen müssen. Dasselbe gelte für Threema.
Lauf durch die Instanzen
Threema ging vors Bundesverwaltungsgericht und bekam recht. Das EJPD zog den Fall weiter ans Bundesgericht – das den Entscheid am 29. April bestätigte. Die Begründung: Apps wie Threema würden keine Leitungs- oder Funkinfrastruktur bieten, sondern lediglich Informationen in bestehende einspeisen.
CEO Blatter spricht von einem «Sieg über den überschiessenden Schnüffelstaat». Hätte das Gericht anders entschieden, wäre Threema wohl ins Ausland gezogen.
Beim EJPD und beim ÜPF nimmt man das Urteil lediglich zur Kenntnis. Gegenüber SRF wolle man noch keinen Kommentar abgeben.
Threema als Sicherheitslücke
Digitalexperte Jean-Claude Frick begrüsst den Entscheid. Um die öffentliche Sicherheit macht er sich keine Sorgen. Vom Datenaustausch wären nicht etwa Terroristinnen betroffen, sondern die breite Masse an Benutzern. «Wer nicht gefunden werden will, findet ohnehin einen Weg», sagt Frick.
Gefährliche Sicherheitslücken gebe es erst, wenn Apps wie Threema Verschlüsselungen aufheben und Daten speichern würden: «Vorhandene Daten bleiben nie geheim. Sie werden immer irgendwann geleakt und fallen Hackern in die Hände», so der Digitalexperte. Schreibt SRF.
Ein kluger Entscheid des Bundesgerichts. Schweizer Amtsstellen sind Datenkraken; was sie einmal gesammelt haben, führt irgendwann beinahe unweigerlich zur nächsten Fichenaffäre.
Frei nach dem Motto «wo gehobelt wird, fallen Späne» werden mit dem hehren Argument der «Terror- und Kriminalitätsprävention» Unmengen von Daten unbeteiligter Bürgerinnen und Bürger gesammelt. Das muss nicht sein.
Seien wir doch ehrlich zueinander: Was haben denn die Zugriffe der Strafbehörden auf andere Messenger- und Kommunikationsdienste bisher gebracht?
Terroranschläge in der Schweiz wurden in der Regel meistens im Vorfeld dank gütiger Mithilfe ausländischer Geheimdiente aufgedeckt und damit vereitelt. Und nicht durch Zugriffsrechte auf Kommunikationsdienste.
Wären die Zugriffe der Schweizer Strafbehörden auf die Kommunikationsdienste von erfolgreicher Effizienz gekrönt, hätten wir beispielsweise das virulente Problem der Drogenkriminalität längst im Griff.
Dem ist aber nicht so. Wurde hierzulande je ein namhafter Rauschgift-Grossdealer vor Gericht gestellt? Oder wurde je ein Amtshilfegesuch wegen einem der den zuständigen Schweizer Behörden längst bekannten Drogenfürsten mit Wohnsitz im Kosovo oder Albanien an diese beiden dominierenden Grossmächte der europäischen Drogenszene gestellt?
Wenn Sie diese Frage mit JA beantworten können, dürfen Sie das Urteil des Bundesgerichts kritisieren.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
18.5.2021 - Tag der arabischen Staatenlenker
Mehr als 5000 Menschen schwimmen in die spanische Exklave Ceuta
Die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta erlebt derzeit einen Rekordansturm von geflüchteten Menschen aus Marokko. Binnen 24 Stunden seien dort mehr als 5000 Menschen angekommen, berichtet der spanische Radiosender «Cadena Ser». Etwa 1500 von ihnen seien Minderjährige, schrieb die in Ceuta erscheinende Zeitung «El Faro».
Die Menschen schwammen von der marokkanischen Stadt Fnideq aus durch das Mittelmeer oder liefen bei Ebbe auch am Strand entlang, wie spanische Medien berichteten. Mindestens ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen.
Das Aufnahmelager der Exklave sei völlig überfüllt und viele der flüchtenden Menschen irrten in der Stadt mit rund 85'000 Einwohnerinnen und Einwohnern herum, hiess es in den Berichten.
Die spanische Militärbasis in Ceuta hat zudem logistische Hilfe angeboten und den Schutz ihrer eigenen Einrichtungen verstärkt. Die Zentralregierung in Madrid kündigte die Entsendung von 200 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten an.
Marokko setzte Grenzkontrollen aus
Marokko hatte am Montag offenbar die Grenzkontrollen zu dem spanischen Gebiet auf nordafrikanischem Boden ausgesetzt. Hintergrund dürfte nach Angaben spanischer Medien die Verärgerung der Regierung in Rabat über die Tatsache sein, dass Spanien die medizinische Behandlung des Chefs der Unabhängigkeitsbewegung Polisario für Westsahara, Brahim Ghali, erlaubt hat.
Brahim Ghali wird seit April in einem spanischen Krankenhaus wegen einer Corona-Erkrankung behandelt. Die Polisario kämpft für die Unabhängigkeit von Westsahara, das von Marokko beansprucht wird. Schreibt SRF.
Eine neue Qualität der Erpressung in der Zusammenarbeit zwischen den arabischen Staaten und der zahnlosen westlichen Wertegemeinschaft, genannt EU, wie sie bisher äusserst erfolgreich durch den türkischen Präsidenten Recep Erdogan über Jahre hinweg praktiziert wurde. Von Erdogan lernen heisst scheinbar siegen lernen.
Verzweifelte Menschen, darunter über 1'000 Jugendliche und Kinder, als Verhandlungsmasse zu missbrauchen und gezielt als Erpressungsmittel einzusetzen, sagt eigentlich alles über Ethik und Moral der arabischen Staatenlenker aus.
Ihre eigenen Mitbürgerinnen und Mitbürger muslimischen Glaubens ausgerechnet in die «dekadenten» Länder von «Ungläubigen» zu «deportieren», hat möglicherweise sogar mit Kalkül zu tun und ist erst noch wesentlich einfacher als vernünftige Lebensbedingungen für das eigene Volk zu schaffen, während sich die herrschenden Potentaten unvorstellbarem Luxus hingeben.
Erdogan zitierte 1998 in einer Rede ja nicht umsonst aus einem Gedicht des Vordenkers des türkischen Nationalismus Ziya Gökalp aus dem Jahr 1912 folgende Passage: «Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
17.5.2021 - Tag der olympischen Geldmaschine
Vier von fünf Japanern wollen die Olympischen Spiele nicht: Über 80 Prozent der Japaner gegen Olympische Spiele im Sommer
Mehr als 80 Prozent der Japaner sind gegen eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Das ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage weniger als zehn Wochen vor dem Start der wegen der Corona-Pandemie verschobenen Spiele. Derzeit kämpft Japan mit einer vierten Infektionswelle, am Freitag hatte die Regierung den Ausnahmezustand verlängert.
Die Umfrage der Tageszeitung Asahi Shimbun ergab, dass 43 Prozent der Befragten für eine Absage der Spiele in diesem Jahr sind, 40 Prozent befürworten eine erneute Verschiebung. Im vorigen Monat lagen die Werte noch bei 35 beziehungsweise 34 Prozent. Nur 14 Prozent der 1527 Befragten befürworten die geplante Austragung.
Regierungssprecher Katsunobu Kato versicherte derweil, dass die Regierung «Anstrengungen unternehmen» werde, damit die japanische Bevölkerung verstehe, «dass die Spiele in einer sicheren Art und Weise stattfinden» werden. «Wir müssen mehr Erklärungen zu den Details der konkreten (Corona-)Massnahmen geben», sagte er.
Seit Monaten zeigen Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Gastgeberland den Spielen gegenüber negativ gestimmt ist. Die Organisatoren wollen mit strengen Massnahmen wie regelmässigen Tests und einem Verbot ausländischer Fans sichere Spiele garantieren. Schreibt SRF im täglichen Corona-Ticker.
Und wenn 100 Prozent der japanischen Bevölkerung die Durchführung der Olympischen Spiele in Tokio aus nachvollziehbaren Gründen ablehnen würden, wird das die «Bonzen» vom Olympischen Komitee nicht wirklich interessieren.
Da sind die finanziellen Verlockungen der globalen Geldmaschine «Olympische Spiele» denn doch etwas wichtiger als die Bedenken der japanischen Bevölkerung.
Was sind schon 126,3 Millionen Japaner*innen gegen die Milliarden von Dollars, die in den Kassen vom OK landen?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.5.2021 - Tag der neuen Weltmacht aus dem Reich der Mitte
China landet auf dem Mars
China ist erstmals eine Landung auf dem Mars gelungen. Der Rover namens Zhurong soll nun während dreier Monaten die Oberfläche des Roten Planeten erkunden.
Die chinesische Mission ist eine von drei Flügen zum Mars, die im vergangenen Sommer von der Erde gestartet waren. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA haben schon Raketen Richtung Mars geschickt. Der US-Rover Perseverance war bereits im Februar gelandet. Schreibt SRF und zeigt ein tolles, animiertes Video.
Ni Hao!
Liebe neue Weltmacht, liebe Eroberer des Universums, liebe Mama Li. Ich bin wirklich beeindruckt von der gigantischen Leistung aus dem Reich der Mitte. Aber eine Frage brennt mir auf der Zunge:
Was sucht Ihr eigentlich da oben auf dem Mars?
Der Hauptbestandteil der Marsatmosphäre ist Kohlenstoffdioxid, besser bekannt als CO2. Das Gas macht rund 95,9 % der Lufthülle des Planeten aus. Während des Winters (der jeweiligen Hemisphäre) befinden sich die Pole des Mars vollständig im Dunkeln und die Temperaturen sinken so stark, dass bis zu 25 % des in der Atmosphäre enthaltenen CO2 zu Trockeneis gefrieren. Sind die Polkappen des Mars wieder dem Sonnenlicht ausgesetzt, sublimiert das CO2 wieder und wird in die Atmosphäre abgegeben. Schreibt Wikipedia (im Reich der Mitte gesperrt).
Viel mehr als CO2 findet Ihr auf dem Mars somit auch nicht. Ausgerechnet CO2, wovon Ihr bereits mehr als genug in China produziert, was dem Klima der Erde alles andere als gut tut. Anders als Nashornstaub wirkt Kohlenstoffdioxid noch nicht einmal als Aphrodisiakum, von dem es Euch an allen Ecken und Bettkanten scheinbar fehlt. Nichts in der Hose aber Weltmacht spielen? Geht's noch?
CO2 kann also kaum das Objekt Eurer Begierde sein.
Nun sagt mir schon, verdammt noch mal, was Ihr da oben zu finden glaubt! Wozu dient der milliardenschwere Aufwand für die Mars-Mission? Milliarden, die auf der Erde zur Rettung des auch und vor allem von Euch gebeutelten Erdklimas wesentlich besser angelegt wären als diese Kraftmeierei auf einem fernen Planeten, dessen Zustand der Atmosphäre wir schon bald auf unserem Heimatplaneten live und wahrhaftig erleben können. Dank Eurer gnädigen Mithilfe.
Wenn Ihr mir schon nicht glaubt, dann vertraut wenigstens Eurem Konfuzius: "Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen weiteren Fehler."
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
15.5.2021 - Tag des Fegefeuers der Eitelkeit
SVP-Nationalrat teilt in der «Arena» gegen Bundesrätin Sommaruga aus
In der SRF-«Arena» wurde hitzig über das neue CO2-Gesetz debattiert. Neben der emotionsgeladenen Diskussion zum Thema kam es auch zu Seitenhieben und Gehässigkeiten.
Am 13. Juni stimmt die Schweiz über die Revision des CO2-Gesetzes ab. Um die Ziele des Pariser Klima-Abkommens zu erreichen, wollen Bundesrat und Parlament die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe erhöhen und eine Flugticket-Abgabe einführen. Das so eingenommene Geld soll teils wieder an die Bevölkerung und teils in einen Klimafonds fliessen, über den klimafreundliche Investitionen und Innovationen gefördert werden sollen.
In der «Arena» vom Freitag diskutierten die SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga und FDP-Ständerat Damian Müller für die Pro- und die SVP-Nationalräte Christian Imark und Thomas Hurter für die Contra-Seite. Ihre Positionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Für die Befürworter ist die Revision des CO2-Gesetzes ein zwingend nötiger Schritt in die Zukunft und eine Chance für die Schweiz.
«Das Gesetz ändert am Klimawandel nichts»
Ganz anders sehen es die Gegner. Für sie ist das Gesetz ein Bürokratiemonster, mit dem der Bevölkerung das Geld aus der Tasche gezogen werden soll. Sie sind überzeugt, dass lediglich Geld umverteilt werde. «Das CO2-Gesetz ändert am Klimawandel gar nichts», sagt Christian Imark.
Gleich zu Beginn der Sendung warf er Sommaruga vor, sich als Bundesrätin zu stark für das Gesetz zu engagieren. «Sie rennt von einer PR-Aktion zur nächsten. Die linke Seite kann machen, was sie will, und muss sich nicht an die Regeln halten. Das ist einfach unfair», sagte er. Sommaruga hatte ihr Engagement auf eine Frage von Moderator Sandro Brotz zuvor damit gerechtfertigt, dass auch eine Bundesrätin «ein Herz für unser Land haben und sich engagieren» dürfe.
«Das Bundesamt hat überhaupt keine Ahnung»
Es blieb nicht der einzige Angriff auf Sommaruga während der Sendung. So warf Imark Sommarugas Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) später vor, es habe «überhaupt keine Ahnung» von CO2-Rückgewinnungsanlagen, was diese mit Kopfschütteln quittierte.
Doch auch die Befürworter hielten sich mit Kritik nicht zurück. Damian Müller warf SVP-Nationalrat Imark «Lug und Trug» vor, worauf dieser erwiderte, Müller selber sei ja das Paradebeispiel, wenn es darum gehe, nicht die Wahrheit zu sagen. «Arena»-Moderator Brotz mahnte zur Vorsicht und kam etwa bei der Kostenrechnung zum Schluss, dass es wohl verschiedene Wahrheiten gebe, weil die beiden Lager unterschiedliche Rechnungen anstellten.
Auch gegen Behörden und Beamte sowie die ganze SP teilte Imark aus. «Alleine der Klimafonds braucht 20 neue Beamtenstellen und kostet 30 Millionen Franken. Und am Schluss wird wahrscheinlich Tamara Funiciello noch Präsidentin des Fonds. Denn in diesem Departement wird jedes Mal, wenn ein Ämtchen zu besetzen ist, eine Parteiveranstaltung daraus gemacht. Das ist die Realität», so Imark.
Imark attackiert auch Wissenschaftler
Brotz musste mehrfach mässigend eingreifen und einmal auch klar sagen, was zu weit geht. Er konfrontierte Imark mit der Tatsache, dass fast drei Erden benötigt würden, wenn alle Menschen auf der Welt so viele Ressourcen verbrauchen würden wie die Schweizerinnen und Schweizer. «Besteht nun Handlungsbedarf oder nicht?», wollte Brotz wissen. Imarks Antwort: «Es kommt darauf an, wie ihr diese Statistik gefälscht habt.» Brotz stellte klar, dass er das nicht mehr lustig finde, das SRF habe die Statistik selbstverständlich nicht gefälscht. Zweimal fragte er Imark, ob er seine Aussage zurücknehmen wolle, was dieser nicht tat.
Mit Reto Knutti von der ETH nahm auch ein Klimaforscher an der Debatte teil, der sich für die Revision des Gesetzes ausspricht. Auch er geriet an Christian Imark, warf diesem vor, eine Statistik falsch zu interpretieren. Imark konterte: «Herr Knutti müsste eigentlich für den Nationalrat kandidieren und Politik machen. Denn genau das machen die Klimawissenschaftler. Sie sind unglaubwürdig, wenn sie aktiv für ein CO2-Gesetz werben und sich in die Politik einmischen, obwohl sie ganz genau wissen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, um den CO2-Ausstoss zu reduzieren, als den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.» Schreibt 20Minuten.
Es ist erstaunlich, dass die SRF-Sendung «Arena» überhaupt noch im Programm des Zwangsgebührensenders stattfindet. Mit gerade mal 149'000 unverbesserlichen Zuschauern*innen (2019 https://www.persoenlich.com/.../die-tv-zuschauerzahlen-im...) ist das Quatschformat, das die (meistens) immergleichen Schweizer Politiker*innen im Fegefeuer der Eitelkeiten präsentiert, nur noch ein grausamer Abklatsch früherer Zeiten mit 800'000 und mehr Zuschauern*innen pro Sendung.
Wäre die Sendung nicht politisch von höchster Ebene gewollt, wäre sie vermutlich bei diesem eklatant grassierenden Zuschauerschwund längst abgesetzt worden. Rein marktwirtschaftlich betrachtet hat sie jedenfalls keine Berechtigung mehr.
Auch zur politischen Meinungsbildung über komplexe Wahlthemen trägt die «Arena» längst rein gar nichts mehr bei. Eher zur Verunsicherung. Jede und jeder der oft kuriosen Teilnehmenden schnorren buchstäblich ihre vorgestanzten Partei- und NGO-Parolen herunter, lassen jeden Intellekt vermissen und fallen sich gegenseitig so oft ins Wort, dass kaum ein stimmiger Satz zustande kommt.
Immerhin hat die «Arena» ab und zu einen gewissen Unterhaltungswert. Vor allem dann, wenn ein «Esel dem andern Esel vorwirft, ein Esel zu sein». Wie in der gestrigen Sendung geschehen: «Damian Müller warf SVP-Nationalrat Imark «Lug und Trug» vor, worauf dieser erwiderte, Müller selber sei ja das Paradebeispiel, wenn es darum gehe, nicht die Wahrheit zu sagen.»
Was meinte SVP-Nationalrat Imark mit dieser Spitze gegen den Luzerner Staatsmann, FDP-Ständerat und Pöstchenjäger Damian «ich bin nicht schwul» Müller?
Der solariumgebräunte Liebling aller Schwiegermütter der Zentralschweiz hat uns doch hoffentlich nicht angelogen bei seinen unzähligen Interviews in den Zentralschweizer Medien im Wahlkampf 2019 bezüglich seiner Sexualität, über die er, ungefragt wohlverstanden (sic!), gerne und oft fabulierte.
Die Journalisten wunderten sich über den scheinbar etwas aus der Zeit gefallenen Politiker und die Gerüchteküche über Müllers Sexualität, die laut einem SVP-Nationalrat im Hohen Haus von und zu Bern längst kein Geheimnis mehr sein soll, brodelte erst recht.
Proaktive Schadensbegrenzung für das bäuerliche Wahlvolk rund um die katholischen Miststöcke des Entlebuchs, wo gewisse sexuelle Präferenzen eventuell noch als «Krankheit» beurteilt werden, geht anders. Das muss der laut NZZ «eloquente» Ständerat Müller, der noch nie eine Universität von innen gesehen hat, noch lernen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
14.5.2021 - Tag der albanischen Community
Luzerner Polizei nimmt albanischen Drogendealer fest
Die Luzerner Polizei hat am Montag in der Stadt Luzern einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden diverse Drogen sichergestellt.
Der 46-jährige Mann aus Albanien wurde am Montagmorgen (10. Mai 2021) in einer Wohnung in der Stadt Luzern festgenommen. Die Luzerner Polizei hat in der Wohnung Kokain und Heroin sichergestellt. Zudem hat die Polizei Drogenutensilien, Verpackungsmaterial und mutmassliches Drogengeld aufgefunden. Der Mann wurde festgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. Schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in ihrer Medienmitteilung.
Und täglich grüsst das zugedröhnte Murmeltier aus dem Balkan.
Laut World Drug Report 2019 der UNODC liegt Albanien in der «Liste der Länder nach Kokainkonsum» an dritter Stelle, die Schweiz mit 0,81 Prozent der Bevölkerung der 15- 64-Jährigen irgendwo in der Mitte und Japan mit Null Prozent an letzter Stelle. Quelle Wikipedia.
Was macht Japan besser als die Schweiz? Japan hat keine Zuwanderung aus Albanien.
Die gesamte Zahl der in der Schweiz lebenden Personen albanischer Abstammung inklusiver Eingebürgerter und Doppelbürger wird aktuell auf rund 200'000 geschätzt. 3,1 % der ständigen Bevölkerung in der Schweiz im Jahr 2016 gab an, Albanisch als Hauptsprache zu benutzen, was 258'415 (Menschen) entspricht. Damit gehören die Albaner nebst den 316'525 Italienern, den 303'525 Deutschen und den 268'660 Portugiesen zu den grössten Ausländergruppen in der Schweiz. Schreibt WIKI.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.5.2021 - Tag der Risiken und Nebenwirkungen
Adlerrunde, Media Markt, Café Landtmann und Co: Auf der Spur der Corona-Hilfen
Neue Zahlen aus der EU-Transparenzdatenbank werfen Fragen nach der Verteilung der staatlichen Hilfen auf. Ausbezahlt wurde nicht selten mit der Gießkanne, auch in Sektoren, die alles andere als Verluste machten.
Lässt der Staat Unternehmen im Regen stehen? Rund um diese Frage ist im vergangenen Juni eine hitzige Debatte ausgebrochen, nachdem der Unternehmer Berndt Querfeld, der unter anderem das Café Landtmann betreibt, in einem STANDARD-Interview davon gesprochen hatte, dass die staatlichen Hilfspakete nichts als zerplatze Luftballons seien.
Sein Unternehmen, die Familie betreibt immerhin zehn Wiener Kaffeehäuser und Restaurants, habe keinen Euro an Hilfen bekommen, sagte Querfeld damals. Das Tourismusministerium schaltete sich danach prompt ein und widersprach. Querfeld habe mehrere Hilfen beantragt und auch bekommen. Der Gastronom meldete sich daraufhin wieder zu Wort und gab an, dass er abseits der Kurzarbeit einen Antrag für Fixkostenzuschuss stellen werde, aber mit nicht mehr als maximal 30.000 Euro rechne. "Letztlich werden wir damit nicht einmal die neue Markise bezahlen können", so Querfeld.
Datenbank der EU-Kommission
Nun, ein bisschen mehr ist es dann doch geworden. Die EU-Kommission hat vergangene Woche in einer Transparenzdatenbank die österreichischen Corona-Hilfen, die an Unternehmen ausbezahlt worden sind, veröffentlicht.
Daraus geht hervor, dass der Familie Querfeld zurechenbare Gesellschaften im vergangenen Jahr insgesamt 1,98 Millionen Euro an nicht rückzahlbaren Corona-Zuschüssen bekommen haben. Neben dem Fixkostenzuschuss bekamen die Gesellschaften vor allem Geld über den Umsatzersatz, der als Entschädigung für geschlossene Betriebe gedacht war. Allein das Unternehmen hinter dem Café Landtmann erhielt demnach insgesamt 637.000 Euro.
Vom Umsatzersatz für den Herbst konnte Querfeld, als er den Markisen-Vergleich wählte, noch nichts wissen, dieser wurde erst später fixiert.
Mit diesen Summen sticht der Unternehmer freilich aus der stetig länger werdenden Transparenzliste nicht einmal besonders hervor.
Die EU-Kommission hat ja auf der Website die Namen der Unternehmen veröffentlicht, die Zuschüsse und Kreditgarantien als Corona-Hilfen erhalten haben, sofern diese über 100.000 Euro lagen. Nicht inkludiert sind die Kurzarbeithilfen, diese Zahlen wurden bisher nicht veröffentlicht.
Eine Frage der Verteilung
Die Liste wirft inzwischen eine Reihe interessanter Fragen zur Verteilungsaspekten der Gelder auf. Jüngstes Beispiel: Media Markt. Wie die "ZiB 2" zuerst berichtet hatte, haben knapp über 40 Media-Markt-Filialen in Österreich jeweils separat um Corona-Hilfen ansuchen können und diese Unterstützung auch erhalten. So sind im vergangenen Jahr mehr als 11,7 Millionen Euro an Zuschüssen von der Cofag an die Media-Markt-Gesellschaften ausbezahlt worden. Die Cofag wickelt die Hilfen für den Bund ab.
Dabei gibt es gleich zwei interessante Aspekte: Der Elektronikkonzern profitierte davon, dass die einzelnen Filialen alle als selbstständige Unternehmen aufgestellt sind: 90 Prozent davon hält immer die Media-Saturn Beteiligungsges.m.b.H., eine Dachgesellschaft, also der eigentliche Konzern, zehn Prozent die jeweils lokalen Geschäftsführer. Im Gegensatz zu Deutschland war in Österreich nicht eine konzerneinheitliche Betrachtung beim Umsatzersatz gewählt worden. Die Hilfen waren also so ausgestaltet, dass jedes Unternehmen selbstständig um Corona-Hilfen ansuchen konnte. Deshalb haben sämtliche Filialen den Umsatzersatz bekommen.
Fairer Wettbewerb
Es stellen sich zunächst einmal Fragen nach dem fairen Wettbewerb. Denn Konzerne, die eine einheitliche Firmenstruktur als Rechtsform gewählt haben, hatten Anspruch auf weniger Unterstützung, auch wenn sie vom Lockdown gleich stark betroffen waren. Pro Unternehmen lag die Höchstgrenze bei dem Umsatzersatz, um den es hier allen voran geht, bei 800.000 Euro.
Die Verzerrung wird deutlich, wenn man bedenkt, dass die Handelsgesellschaft Hartlauer, wo die Filialen keine selbstständige Rechtsform haben, "bloß" 1,2 Millionen Euro an Corona-Hilfen (Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss) im vergangenen Jahr bekam.
Doch die Art der Hilfeleistung wirft noch mehr Fragen auf. Ebenfalls interessant ist nämlich, dass sich Media Markt in Österreich trotz der Krise ganz gut halten konnte. Ceconomy, der Konzern hinter der Media-Markt-Gruppe, hat diese Woche die Halbjahresbilanz für den Zeitraum Oktober 2020 bis März 2021 präsentiert. Trotz Lockdowns konnte das Geschäftsergebnis im Vergleich zum selben Zeitraum der Vorperiode sogar verbessert werden, insgesamt weist Ceconomy einen Gewinn für die Periode von 199 Millionen Euro (Ebit) aus.
Gutes Geschäftsumfeld
Aktuelle Zahlen zu dem Geschäft in Österreich publizierte Ceconomy nicht, auch im Firmenbuch finden sich noch keine Einträge. Doch in der Halbjahrespräsentation des Konzerns wird betont, dass der Markt in Österreich erstaunlich robust war. So wird etwa darauf verwiesen, dass es in Österreich trotz Lockdowns im vergangenen halben Jahr einen "signifikanten Umsatzanstieg" im Consumer-Electronics-Fachhandel gegeben hat.
Und weiter im Geschäftsbericht heißt es zum zweiten Quartal: "In Österreich stieg der Umsatz im zweistelligen Prozentbereich, getrieben durch starke Nachholeffekte nach Wiedereröffnung der Märkte im Februar 2021, erfolgreiche Marketingkampagnen und ein außerordentlich starkes Online-Wachstum."
Ähnliches zeigen auch Zahlen der Marktforscher von Gfk: Bei technischen Konsumgütern zogen die Umsätze in Österreich im vergangenen Jahr um elf Prozent an, bei Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen sogar um 21 Prozent, bei IT-Produkten um 15 Prozent. All das gehört zum Kernsortiment im Elektrohandel.
Dass Unternehmen Verluste gemacht haben, war jedenfalls nicht Voraussetzung dafür, dass ihnen Unternehmenshilfen gewährt wurden. Den Umsatzersatz gab es im Gegenzug für behördliche Schließungen im Handel, auch wenn Umsätze nachgeholt wurden. Einnahmen aus dem Onlinehandel wurden übrigens im österreichischen System nicht berücksichtigt, schmälerten also die Zuschüsse nicht. Media Markt wickelt sein Onlinegeschäft laut "ZiB 2" ohnehin über eine eigene Gesellschaft ab, das hätte also in diesem Fall nichts geändert.
Do & Co, Landzeit und die Adlerrunde
In der EU-Datenbank finden sich jedenfalls mehrere Beispiele dafür, dass Firmengruppen davon profitieren konnten, wenn sie aus mehreren selbstständigen Unternehmen bestehen.
So schien es Ende vergangener Woche noch, als hätte Szene-Gastronom Martin Ho über zwei seiner Betriebe (Dots City und Dots Prater) 855.000 Euro an Hilfen bekommen. Inzwischen wurde die Datenbank aktualisiert. Genauer gesagt wurden zwischenzeitlich eingerechnete Hilfen für das Jahr 2021 wieder aus der Datenbank entfernt.
Sichtbar sind nun nur noch die 2020 geflossenen Hilfen. Nun zeigt sich, dass für insgesamt fünf Betriebe der Dots-Gruppe nicht ganz 1,1 Millionen Euro an Zuschüssen bezahlt wurden. Mit ebenfalls fünf Betrieben scheint Do & Co rund um Attila Doğudan auf. Der Caterer bekam mit knapp 2,8 Millionen Euro mehr als zweieinhalbmal so viel wie Martin Ho. Ebenfalls davon profitiert hat Landzeit: Die Landzeit-Autobahn-Restaurants sind noch bis kommende Woche geschlossen. 3,4 Millionen Euro flossen an zehn Landzeit-Gesellschaften.
Angeschlagene Hotellerie
Neben der Gastronomie leidet die Hotellerie schwer unter dem Ausbleiben der Gäste. Glück im Unglück hatte auch hier, wer mehrere Gesellschaften betreibt. Insgesamt gingen rund 1,5 Millionen Euro an acht Gesellschaften der Meininger-Hotels.
Ein Blick nach Tirol: In Wattens beim Glitzerkonzern Swarovski hätten nach 1.200 Stellen auch heuer 600 abgebaut werden sollen, es dürften jetzt doch nur 250 werden. Laut EU-Datenbank bekam Swarovski jedenfalls Hilfen in der Höhe von 553.000 Euro.
Neben Hotelier Christian Harisch taucht auch ein weiteres Mitglied der Adlerrunde, eines 2003 gegründeten "losen" Zusammenschlusses von Tiroler Unternehmer, mehrmals in der Liste auf: Fritz Unterberger. Er ist mit seiner Unterberger-Gruppe im Automobil- und Immobilienbereich tätig. Unterberger zählt zu den größten BMW- und Mini-Händlern des Landes und vertreibt über Mehrmarken-Autohäuser auch Hyundai, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover und Volvo. Knapp 1,9 Millionen Euro gingen an neun Firmen.
Zum Schluss noch ein Blick in die Steiermark. In der Cofag-Liste taucht neben vielen Unternehmen überraschend auch die Landwirtschafskammer Steiermark auf, die 400.000 Euro an Umsatzersatz erhielt. Auf Nachfrage heißt es dort, das Geld habe es für den Steiermarkhof, ein Hotel, das die Kammer betreibt, gegeben. Schreibt DER STANDARD.
Ist wie bei den Medikamenten und sonstigen Pillen fürs Volk: Gewisse Systeme bergen Risiken und Nebenwirkungen in sich. Das Giesskannenprinzip ist eines davon.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.5.2021 - Tag der chinesischen Bettfedern
Volkszählung in China: Chinesen wollen weniger Kinder – Bevölkerung wächst langsamer
Die Einwohnerzahl von China wächst so langsam wie seit den 50er Jahren nicht mehr. Sie nahm im vergangenen Jahrzehnt um 5.38 Prozent auf 1.41 Milliarden zu, wie die alle zehn Jahre erhobene Volkszählung ergab. Grund für die Verlangsamung ist die sinkende Geburtenrate.
Statistisch bekommt eine Frau in China 1.3 Kinder. Sie liegt damit auf dem Niveau von alternden Gesellschaften wie die grossen Industrieländer Japan und Italien. Das dürfte in der politischen Führung die Alarmglocken schrillen lassen, dürfte doch die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt ein unumkehrbarer Bevölkerungsrückgang bevorstehen – ohne dass die privaten Haushalte dort so grosse Vermögen anhäufen konnten wie die in westlichen Industrienationen.
Bevölkerung laut UNO 2030 am Höhepunkt
«Das Bevölkerungswachstum wird sich in Zukunft weiter verlangsamen», sagte Ning Jizhe, Leiter des Nationalen Statistikamtes, bei der Vorstellung der Ergebnisse am Dienstag. «Chinas Bevölkerungszahl wird in der Zukunft einen Höhepunkt erreichen, aber der genaue Zeitpunkt ist noch ungewiss.» 2020 wurden nur noch zwölf Millionen Geburten registriert, nachdem es 2019 noch 14.65 Millionen waren.
Die Vereinten Nationen sagen voraus, dass die Zahl der Menschen auf dem chinesischen Festland 2030 ihren Höchststand erreichen wird, bevor sie zurückgeht.
Damit wächst der Druck auf Peking, Massnahmen zu ergreifen, um Paare zu ermutigen, mehr Kinder zu bekommen. Erst 2016 hatte China die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik abgeschafft – in der Hoffnung, die Zahl der Babys zu erhöhen. Seither wird offiziell eine Zwei-Kind-Politik vertreten. Damals wurde auch das Ziel gesetzt, die Bevölkerung bis 2020 auf etwa 1.42 Milliarden zu erhöhen – was nun verfehlt wurde.
Es «droht» weniger Wachstum und Produktivität
Sinkende Geburtenraten und eine schnell alternde Gesellschaft erhöhen den Druck auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und könnten die Produktivität beeinträchtigen. «Unsere Projektionen, die auf den Zahlen vor der Volkszählung basieren, deuteten bereits darauf hin, dass die Erwerbsbevölkerung bis 2030 jährlich um 0.5 Prozent schrumpfen würde, mit ähnlichen Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt», schrieben die Analysten von Capital Economics kürzlich.
«Ein langsameres Wachstum würde es schwieriger machen, die Vereinigten Staaten wirtschaftlich einzuholen. Und es könnte auch einen Einfluss auf Chinas globales Ansehen haben.» Auch die chinesische Zentralbank warnte: «Bildung und technologischer Fortschritt können den Rückgang der Bevölkerung nicht kompensieren.» Schreibt SRF.
Wo liegt das Problem jenseits der üblichen «akademischen» Bedenkenträgern des nie versiegenden, endlosen Wachstums und den nach billigen Arbeitskräften lechzenden Migrations-Apologeten? Dass steigender Wohlstand den Kindersegen dahinschmelzen lässt wie Schnee an der Frühlingssonne ist eine uralte Tatsache und müsste auch dem SRF bekannt sein.
Die Absatz-Headline «Es droht weniger Wachstum und Produktivität» ist an ökonomischer Dummheit kaum mehr zu überbieten: Höhere Produktivität entsteht (unter anderem), wenn weniger Menschen für die Herstellung eines Produktes benötigt werden. Die Arbeitslosigkeit der industrialisierten, westlichen Staaten seit Mitte der 70-er Jahre ist ja nichts anderes als eine Folge der Produktivitätssteigerungen. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg mussten bis Mitte der 70-er Jahre in diesen Ländern, auch in der Schweiz, Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutiert werden. Weil wir sie damals brauchten. Heute holen wir sie immer noch; allerdings «miss»-brauchen wir sie als «Billiglöhner».
Ob das Wachstum bei einer schrumpfenden Bevölkerung tatsächlich schwindet, ist – vor allem bei jüngeren – Ökonomen ebenfalls umstritten, sofern sie nicht die HSG, die Gralshüterin des brachialen Neoliberalismus, besucht haben. Wachstum hängt ja nicht nur von der Anzahl Menschen ab, sondern vor allem von deren Kaufkraft, die sich unter dem Aspekt schwindender Menschenmassen und gerechter Entlöhnung durchaus auch positiv verändern könnte.
Fehlt eigentlich nur noch die «Japan»-Keule, die bei Artikeln um das Thema Bevölkerungswachstum stets geschwungen wird. Japan soll sich wegen seiner Überalterung der Bevölkerung und dem Geburtenrückgang laut neoliberalen Blättern wie «Handelszeitung» & Konsorten mit rasender Geschwindigkeit dem wirtschaftlichen Zustand eines Dritte-Welt-Landes nähern. Scheinbar lesen diese Schreiberlinge keine Wirtschaftsdaten aus Fernost und haben Japan vermutlich entweder noch nie oder schon lange nicht mehr besucht.
Dass die Erde und mit ihr das Klima die Bevölkerungsentwicklung Chinas etwas positiver sehen als die üblichen Verdächtigen von der neoliberalen Wachstumsfront, dürfte auf der Hand liegen.
Egal, welche Warnungen die chinesische Zentralbank veröffentlicht: Wenn China den Bevölkerungsschwund nicht will oder darin ein Problem sieht, genügt ein einziger Befehl von Chinas Präsident Xi Jinping. Und schon wird zum Wohle der Partei drauflosgefiedelt, bis die chinesischen Bettfedern kollabieren.
Was chinesische Bettfedern, soviel Wahrheit muss sein, auch ohne Fiedeln tun. Zum Preis von einem VW gibt es nun mal keinen Rolls Royce.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.5.2021 - Tag der teuren Vektorgrafikn der Stadt Luzern
Stadt Luzern überarbeitet ihr Logo – für 80’000 Franken
Die Stadt Luzern hat zusammen mit einem externen Büro ihr Logo überarbeitet. Grund ist in erster Linie die Digitalisierung. Zudem soll der Auftritt der Stadt etwas zeitgemässer daherkommen. Kostenpunkt: 80’000 Franken. Kommunikationschef Simon Rimle begründet den Schritt.
Das Logo der Stadt Luzern ist wohl jeder Einwohnerin bestens bekannt. Nicht nur auf den Couverts und dem Briefpapier ist es zu sehen, sondern auch auf Fahrzeugen und der Kleidung von Mitarbeitern der Stadt. Nun wird es angepasst, wie die Stadt am Montag mitteilte. Damit solle das «visuelle Erscheinungsbild geschärft werden».
Das Erscheinungsbild der Stadt Luzern wurde im Jahr 1996 entwickelt. Die Verwaltungsarbeit, die Kommunikationskanäle und das Informationsbedürfnis der Bevölkerung haben sich seither gewandelt», begründet die Stadt den Entscheid.
Einführung geschieht fliessend
Konkret wird das Logo aufgefrischt und es wird künftig nicht mehr in der Mitte eines Briefes, sondern links oben zu sehen sein. Zudem wird auf den Verweis auf die Dienstabteilung verzichtet, von der das Schreiben ausgestellt wurde. Für repräsentative Druckerzeugnisse wird ab 2022 die Schriftart «Neue Haas Unica» eingesetzt.
«Bis das überarbeitete Corporate Design zur Anwendung kommt, dauert es noch etwas. In den nächsten Monaten erfolgt in einer ersten Etappe die Umstellung der digitalen Anwendungen, der schriftlichen Korrespondenz sowie der repräsentativen Druckerzeugnisse», heisst es aus dem Stadthaus. Bis 2022 soll das überarbeitete Corporate Design zum Einsatz kommen. Einige wenige Anwendungen würden allerdings bereits ab Sommer 2021 sichtbar.
Gemäss der Stadt will man Broschüren und ähnliches aber nicht anpassen, nur weil sich das Logo etwas verändert, sondern nur, wenn der Inhalt überarbeitet werden muss. Auch bei der Arbeitskleidung, Fahrzeugen oder Gebäuden werde das neue Logo erst verwendet, wenn sie ersetzt werden müssen, beziehungsweise neu oder umgebaut werden. Das parallele Auftreten des bisherigen und des überarbeiteten CD werde dabei bewusst in Kauf genommen.
Laut Simon Rimle, Kommunikationschef bei der Stadt, wurde das Logo vom Luzerner Designstudio C2F überarbeitet. Inklusive der genannten Anpassungen belaufen sich die Kosten auf rund 80’000 Franken. «Ziel der aktuellen Überarbeitung ist es, das bisherige Corporate Design in die heutige Zeit zu transformieren, ohne dabei den grundsätzlichen Charakter zu verlassen. Die Bürgerinnen und Bürger profitieren zudem von einem zeitgemässen Erscheinungsbild ihrer Stadt», so Rimle.
Altes Logo hielt nicht mit Digitalisierung mit
Die Anpassung des Logos sei aber auch wegen der Digitalisierung nötig geworden. «Es gibt Computeranwendungen, bei denen wir mit dem bisherigen Corporate Design an technische Grenzen gestossen sind. Es geht dabei nicht nur um das Logo, sondern auch um die Schrift.»
So habe der bisherige Schriftzug in einzelnen Anwendungen bereits angepasst werden müssen, weil sich das alte Logo technisch nicht in die neuen digitalen Anwendungen habe überführen lassen. «Sie sehen dies zum Beispiel beim Twitter-Account der Stadt, bei dem der Schriftzug hoch statt quer verwendet werden musste», erklärt Rimle.
Das überarbeitete Logo ermögliche nun eine gleiche Handhabung in allen Grössen und bei allen Verwendungen. Wichtig sei dies, da sich das Informationsbedürfnis der Bevölkerung verändert habe und man folglich die modernen Kommunikationskanäle bedienen müsse. Schreibt ZentralPlus.
Marcus Tullius Cicero: «Die Menschen verstehen nicht, welch grosse Einnahmequelle in der Sparsamkeit liegt.»
80'000 Franken für die Überarbeitung eines Logos ist eine Menge Holz. Einerseits. Andererseits sind die 80'000 Franken für eine Vektorgrafik ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, welche Summen die Luzerner Stadtregierung normalerweise für «Sensibilisierungskampagnen» oder Broschüren («Informationskampagnen») zu Wahlentscheidungen ausgibt.
Da wird mit der ganz grossen Kelle angerichtet und Beträge von mehreren Hunderttausend Franken sind keine Seltenheit. Beispiel «Informationskampagne» zur autofreien Bahnhofstrasse in Luzern.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
9.5.2021 - Tag der fruchtbaren Velotouren
Im Hotel Waldegg: Versteckt der Thai-König unehelichen Sohn in der Schweiz?
Thai-König Maha Vajiralongkorn (68) ist bekannt dafür, viele Geliebte zu haben. Hat er mit einer von ihnen einen unehelichen Sohn gezeugt und diesen in der Schweiz versteckt? Diese Behauptung stellt die deutsche «Bild» auf.
Erst kürzlich kam heraus, dass Thai-König Maha Vajiralongkorn (68) seine ehemalige Geliebte und aktuelle Ehegattin Suthida (42) jahrelang im Hotel Waldegg in Engelberg OW versteckt hielt. Nun kommt ein neuer Skandal ans Licht: Angeblich soll er dort auch einen heimlichen Sohn einquartiert haben.
Wie die «Bild» berichtet, soll es sich dabei um ein uneheliches Kind handeln. Um nicht noch mehr Aufsehen zu erregen, verstecke der König den Jungen und dessen Mutter seit gut drei Jahren in dem Hotel, zitiert das Blatt Quellen aus dem Palast.
Unehelicher Sohn in der Schweiz
Der schottische Journalist und Thai-Kenner Andrew MacGregor Marshall (50) betreibt die regierungskritische Newsseite «Secret Siam». Er sagt: «Die Gefolgsleute der Königin sind überzeugt, dass der König der Vater des kleinen Jungen ist», so die «Bild».
Der Kleine wäre damit das siebte Kind des Skandal-Königs, auch Rama X. genannt. Drei seiner Söhne leben gemeinsam mit der Mutter im Exil in den USA, seine Tochter Prinzessin Sirivannavari (34) arbeitet als Designerin in Paris, ihre Halbschwester Bajrakitiyabha (42) ist Juristin und der bisherige Thronfolger Dipangkorn (16), der autistisch sein soll, lebt in der Millionen-Villa seines Vaters in Bayern.
Der jüngste Nachwuchs – gezeugt vom König mit einer Geliebten – soll gesund und munter sein, aber nicht gewollt. Offiziell heisst es, der Vater des Dreijährigen sei ein Soldat.
Rama X geniesst das Leben in vollen Zügen
Der thailändische König ist bekannt dafür, das Leben in vollen Zügen zu geniessen. Er vergnügt sich mit einem Harem von über 20 «Soldatinnen» in seinem Liebesnest bei München (D), jettet nach Lust und Laune durch Europa und macht zwischendurch auch Veloausflüge in der Region Luzern.
Zurzeit befindet er sich aufgrund der Corona-Krise in Bangkok. Angeblich plant er im Sommer, samt Gefolge wieder nach Europa zu kommen. Auch, um seinen Sohn zu besuchen? Schreibt SonntagsBlick.
Auf einer Velotour in der wunderschönen Innerschweiz kann nun mal viel passieren. In der gesunden Bergluft von Engelberg ist schnell mal ein uneheliches Kind gezeugt. Who cares? Ausser BILD und Blick niemand, schon gar nicht die Innerschweizer*innen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.5.2021 - Tag der Historiker und Hysteriker
Agrar-Initiativen: Der mächtige Bauernverband ist nur schwer zu schlagen
Die Trinkwasser-Initiative und die Initiative Pestizidverbot starten in der ersten SRG-Umfrage mit einem Ja-Vorsprung. Viele politische Beobachter in Bundesbern und im Parlament sind aber überrascht, dass der Zuspruch zu diesen beiden Umwelt-Initiativen nicht deutlicher ausfällt.
Andere Initiativen starteten besser
Denn die letzten Öko-Vorlagen hatten jeweils sehr hohe Sympathiewerte in der ersten Umfrage genossen, bevor der Ja-Anteil dann jeweils einbrach, je näher der Abstimmungstermin rückte.
Eine solche Entwicklung ist gerade bei Volksinitiativen typisch. So war es bei der Fairfood- oder bei der Hornkuh-Initiative. Auch bei den beiden Agrar-Initiativen ist es wahrscheinlich, dass der Ja-Anteil zurückgehen wird. Aber eben, sie starten nicht aus einer komfortablen Lage heraus.
Nein-Kampagne rollt übers Land
Die massive Nein-Kampagne des Bauernverbands ist sehr früh gestartet und dürfte bereits jetzt ihre Spuren hinterlassen haben. Wer übers Land fährt oder auf dem Land wohnt, kann ihnen nicht mehr ausweichen, den «2x Nein»-Fahnen. Der Bauernverband spricht von der grössten Kampagne aller Zeiten.
Bergbauern, die möglicherweise nicht mehr genug Futter für ihre Tiere hätten, dominieren die Debatte, und nicht mehr die zum Teil schlechte Trinkwasserqualität. Die Initianten geniessen zwar die Unterstützung der Umweltverbände, aber sie scheinen schon jetzt ins Hintertreffen zu geraten.
Präsident der Bauern hat noch nie verloren
Bauernverbandspräsident Markus Ritter – selber Biobauer – der immer wieder mal als der mächtigste Lobbyist im Land bezeichnet wird, könnte auch dieses Mal wieder als Sieger hervorgehen. Was im Bundeshaus niemanden erstaunen würde: Mitte-Mann Ritter hat noch nie verloren.
Seine Strategie (und die des Bundesrats) könnte sich auszahlen: Kein Gegenvorschlag zu beiden Initiativen, aufs Ganze gehen. Beide Initiativen zusammen an die Urne bringen und beide als «bedrohlich für den Bauernstand» taxieren.
Verwirrende Parolen
Die SRG-Umfrage zeigt denn auch: Grosse Unterschiede zwischen den beiden Initiativen machen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zurzeit nicht, die Initiative Pestizidverbot schneidet ganz leicht besser ab.
Die Parolen der Parteien und Verbände könnten zunehmend verwirren. Biosuisse, der Verband der Knospe-Betriebe, lehnt die Trinkwasser-Initiative ab, unterstützt aber die Initiative für ein Pestizidverbot. Im Parlament fand aber eine Mehrheit, die Pestizid-Initiative sei radikaler als die Trinkwasser-Initiative.
Die Grünliberalen wiederum gaben nur für die Trinkwasser-Initiative die Ja-Parole heraus. Welche Initiative ist nun besser oder schlechter? Im Zweifelsfall dürften viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beide Volksbegehren ablehnen.
Ständemehr als Hürde
Wenig überraschend gibt es bei beiden Initiativen einen tiefen Stadt-Land-Graben. Die Zustimmung in den Städten ist hoch, die Ablehnung in der ländlichen Schweiz ist gross. Es zeichnet sich schon jetzt ab: Das Ständemehr könnte zur unüberwindbaren Hürde werden. Darauf zielt auch der mächtige Bauernverband ab. Schreibt SRF.
«Der Starke wird immer den Schwachen besiegen!» Sagte schon König Artus zu den Rittern der Tafelrunde. Sofern es König Artus wirklich gab, worüber sowohl Historiker wie Hysteriker sich lebhaft streiten.
Sei's drum. Die Schwachen machen das Siegen den Starken durch Abwesenheit an den Wahlurnen aber auch leicht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.5.2021 - Tag der Alterung
Hollywood-Star wird 60: George Clooney kauft ein Anwesen in der Provence
George Clooney zieht es zu Hollywoods Diaspora in die Provence. Der US-Schauspieler und Filmemacher habe ein Anwesen in Brignoles gekauft, wie das Rathaus der südfranzösischen Gemeinde am Donnerstag - pünktlich zu Clooneys 60. Geburtstag - bestätigte.
Die 160 Hektar grosse Domaine du Canadel, die ein Landhaus aus dem 18. Jahrhundert, einen Teich, ein Schwimmbad sowie Weinberge umfasst, ist nicht weit vom Weingut Château Margüi entfernt. Dessen Besitzer, Kult-Filmemacher George Lucas, will auf dem Gelände ein prunkvolles Hotel eröffnen.
Rund eine halbe Autostunde von Clooneys künftigem Anwesen entfernt liegt das kleine Dorf Correns mit dem Weingut Chateau Miraval, das seit 2008 im Besitz des einstigen Hollywood-Traumpaars Angelina Jolie und Brad Pitt ist. In Brignoles befindet sich zudem bereits das Weingut von Joachim Splichal, eines aus Deutschland stammenden Starkochs, der in Los Angeles tätig ist.
Bei den bisherigen Besitzern von Clooneys Domaine du Canadel handelt es sich um ein älteres australisches Ehepaar, das in Monaco lebt. Es hatte das Anwesen schon seit einigen Jahren zum Verkauf angeboten. Der Hollywoodstar besitzt bereits eine Ferienvilla am Comer See in Norditalien. Schreibt Blick.
Gut zu wissen, dass auch Hollywoodstar George Clooney, mit dem mich die chinesischen Touristen in Zeiten vor Corona stets verwechselten und um ein Selfie gebeten haben, dem natürlichen biologischen Prozess des Alterns ausgeliefert ist.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.5.2021 - Tag des Teufels und des Beelzebubs
Revolutionäre Planspiele: Straffreier Konsum? Bundesrat skizziert neue Drogenpolitik
In der Schweiz wurde die offene Drogenszene in den 1990er-Jahren aufgelöst. Seither hat sich der Drogenkonsum stark verändert. Heute werden viele illegale Substanzen vor allem von nicht schwer abhängigen Jugendlichen konsumiert, die sozial integriert sind. Deshalb will der Bundesrat seine Drogenpolitik anpassen. Er denkt darüber nach, den Konsum aller Drogen straffrei zu machen.
In der Schweiz sind alle Drogen verboten – Kauf, Handel und Konsum. Nur beim Cannabis sind wenige Gramm für den Eigengebrauch straffrei. Doch jetzt will der Bundesrat die Bestrafung des Konsums sämtlicher Drogen überprüfen lassen.
Die Kriminalisierung der Konsumierenden erfülle ihren Zweck nicht, der Konsum gehe nicht zurück, erklärt Betäubungsmittelexperte Adrian Gschwend vom Bundesamt für Gesundheit (BAG): «Der Drogenhandel wäre weiterhin verboten. Es gäbe keinen Markt in Form von Shops oder Apotheken, in denen Drogen zu nicht medizinischen Zwecken verkauft würden. Aber die Konsumierenden würden nicht mehr verfolgt.»
Die bisherige Drogenpolitik orientierte sich an der Heroinkrise in den 1980er-Jahren. Heute hingegen stünden die Jugendlichen im Fokus mit ihrem zum Teil exzessiven Konsum von sogenannten Freizeitdrogen wie Cannabis, Kokain oder Ecstasy. Diese jungen Leute seien keine Schwerstabhängigen, sondern sozial integriert und sähen oft kein Problem in ihrem Verhalten.
Eine Bestrafung habe darum vor allem negative Folgen, so Gschwend: «Durch die Kriminalisierung werden die Betroffenen stigmatisiert und teilweise ist es schwieriger, sie überhaupt zu erreichen und in Behandlung zu bringen.»
Das heisst, die jungen Konsumentinnen und Konsumenten sind misstrauisch und wollen nichts mit Präventionsprogrammen oder Fachpersonen zu tun haben. So könne der Jugendschutz nicht umgesetzt werden, befürchtet er.
Erfolgsmodell Portugal
Dass die Schweizer Drogenpolitik nicht mehr zeitgemäss ist, sieht der Bundesrat auch im Ausland. In Portugal etwa sei der Drogenkonsum seit vielen Jahren straffrei, mit erfreulichen Resultaten, so Gschwend: «Der Konsum hat in keinster Weise zugenommen. Und man kann die Leute besser erreichen: Sie melden sich eher, wenn sie ein Problem haben.»
Portugal ist ein Erfolgsmodell, das unterstreicht auch eine Kommission, von der sich der Bundesrat beraten lässt. Die 20 Drogen- und Suchtexpertinnen und -experten in dem Gremium wollten noch weiter gehen. Sie wollen das Cannabisverbot aufheben und in einem letzten Schritt sogar das Betäubungsmittelgesetz streichen.
Dem Bundesrat geht das aber zu schnell. Zuerst will er die Pilotversuche für die kontrollierte Cannabisabgabe beobachten, die bald starten. Erst dann will er über Reformen in der Drogenpolitik entscheiden.
Wie die Kommission wollen auch Suchtorganisationen und linke Politikerinnen und Politiker seit Jahren die Schweizer Drogenpolitik reformieren. Eine komplette Legalisierung scheint dennoch noch sehr weit weg. Bei vielen Bürgerlichen kommt eine liberalere Gangart nicht gut an.
Nur schon ein straffreier Konsum von Drogen sorgt bei Gesundheitspolitikern für Sorgenfalten. Etwa bei Ruth Humbel von der Mitte-Fraktion: «Ich bin gegen eine Legalisierung harter Drogen – auch wenn es um den Konsum geht.»
Humbel fragt sich auch, ob ein straffreier Drogenkonsum in der Schweiz akzeptiert würde. Auch der Bundesrat gibt sich realistisch: Der Regierung sei bewusst, dass eine mögliche Weiterentwicklung der Sucht- und Drogenpolitik umstritten bleiben werde.
Sucht Schweiz: «Die Zeit ist reif»
Für Kommissionsmitglied und Vizedirektor von Sucht Schweiz, Frank Zobel, ist die Zurückhaltung des Bundesrats keine Enttäuschung. Denn so nah dran wie jetzt sei man schon lange nicht mehr gewesen: «Das wurde vor 20 Jahren alles schon einmal besprochen und wir waren sehr nah dran, das durchzuführen. Jetzt kommen wir aus einer Art Wüste, in der wir diese Fragen gar nicht mehr besprochen haben. Die Zeit ist reif, das wieder zu tun.»
Dass Cannabis endlich legalisiert werden sollte, steht selbst bei den Schweizer Polizeikorps ausser Frage. Das Katz- und Maus-Spiel zwischen Polizisten und 14-jährigen Haschisch-Kids ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Zumal eine Legalisierung eine grosse Chance bietet, bei richtiger und konsequenter Durchführung die widerwärtigen Drogenbarone aus dem Balkan mit ihren ekelhaften Ablegern in der Schweiz endlich zu entmachten und sauberen, normal dosierten und nicht gestreckten «Stoff» anzubieten.
Die Romantisierung der harten Drogen wie Kokain, Heroin, Cristal Meth, LSD und sonstiger «Medis» ist allerdings ein Unding; vorwiegend verbreitet von unfähigen Sozialfachstellen und deren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die eher Teil des Problems als der Lösung sind. Mitarbeiter*innen der Luzerner SIP, die auf Drogenhotspots mit jungen Kids und Dealern Joints rauchen, sind ja keine Seltenheit mehr. Prävention sieht eigentlich anders aus.
Die Heroinsüchtigen der offenen Drogenszene vom Platzspitz in Zürich («Needle Park») als «Erfolgsmodell» zu verkaufen, grenzt nur noch an geschichtsklitternde Dummheit. Das unsägliche Leid der Angehörigen von jungen Menschen, die sich mit einem «goldenen Schuss» ins Jenseits beförderten, wird ausgeblendet.
Ebenso die unangenehme Frage, was denn letztendlich mit den Schwerstabhängigen passierte? Die Antwort ist so schlicht wie einfach. Sie wurden in Enziehungskuren gesteckt und mit der Ersatzdroge Methadon zugedröhnt. Eine Droge mit einer anderen Droge zu bekämpfen, nennt man im Volksmund «den Teufel durch den Beelzebub austreiben». Die meisten der «Geheilten» blieben, was der Platzspitz aus ihnen gemacht hat: Junkies, wie man sie heute noch zum Beispiel im Umfeld vom Luzerner Bahnhof zu Hauf antrifft. Sofern sie überhaupt überlebt haben.
Was der «portugiesische Weg» mit den Menschen aus prekären Verhältnissen in Portugal macht, die den Grossteil der Drogen-Klientel stellt und nicht die hippen Szene- und Partygänger*innen, wird wohlweislich verschwiegen. Auch die sozialen Folgekosten für den Staat Portugal. Wo die Drogen sind, ist das Sozialamt nicht weit! Alles hängt nun mal mit allem zusammen. Aber man kann relativ einfach wirklich alles schönreden; man muss es nur wollen. Darin sind Politiker*innen geübt.
Die totale Freigabe harter Drogen führt uns genauso wie das Nichtstun gegen diese Pest schnurstracks hin zum «American Way of Life», auf dem inzwischen laut der Studie einer angesehenen US-Universität über 50 Prozent der amerikanischen Bevölkerung entweder Drogen- und Medikamentensüchtig sind. Man darf sich fragen, welches von beiden nun das grössere Übel ist.
Weiter so und Newsletter wie derjenige der Gemeinde Ebikon aus dem Jahr 2021, in dem mit schockierender Deutlichkeit darauf hingewiesen wird, dass die harten Drogen wie Kokain und Amphetamine inzwischen in der Luzerner Vorortgemeinde bei den 13-jährigen Kids angekommen sind, werden sich häufen.
Wir alle, inklusive der Polizei, der dank der Politik die Hände gebunden sind, schauen zu und geben uns mit dieser staatlich verfügten Bankrotterklärung ab (so sie denn kommt), dass harte Drogen halt zu unserer Gesellschaft gehören. Ein Mantra, das inzwischen sogar von der Luzerner Stadtpolizei übernommen wurde.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.5.2021 - Tag der Hasenpest
Jäger warnen: Erneuter Fall von Hasenpest in NRW – Übertragung auf Menschen möglich
Wegen eines toten Feldhasen warnt die Kreisjägerschaft Düsseldorf derzeit die Bevölkerung vor der Hasenpest. Besonders Hundebesitzer werden gebeten, sich an bestimmte Regeln zu halten.
Ein toter Hase besorgt derzeit im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus die Behörden. Das Tier sei an der hochansteckenden Hasenpest verendet, heißt es vom Kreisjägerverband. Diese kann auch auf Menschen übertragen werden. Besonders Hundebesitzer sollen vorsichtig sein.
Die Hasenpest, oder Tularämie, ist eine meldepflichtige, pestähnliche Erkrankung, die hauptsächlich bei Kleinsäugern wie Hasen, Kaninchen oder Mäusen auftritt. Sie löst meist Lymphknotenschwellungen aus und verläuft oft ähnlich einer Blutvergiftung. Bei Tieren führt die Krankheit meist innerhalb weniger Tage zum Tod.
Auf Menschen kann der Erreger Francisella tularensis auf verschiedenen Wegen übertragen werden, etwa durch Hautkontakt mit infizierten Tieren oder mit kontaminiertem Wasser.
Mensch-zu-Mensch-Übertragung unbekannt
Auch der Verzehr von nicht ausreichend erhitztem, kontaminiertem Fleisch oder die Aufnahme über die Luft durch Staub kann unter Umständen zu einer Infektion führen. In einigen Fälle kann der Erreger auch durch Stiche von Mücken, Bremsen oder Zecken übertragen werden. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist nicht bekannt.
In der Vergangenheit waren häufig Jäger betroffen, die in direkten Kontakt mit erlegten Tieren kamen. Die Symptome sind vielfältig, meist haben Menschen grippeähnliche Beschwerden, Lymphknotenschwellungen oder Hautirritationen an der Stelle, an der der Erreger eingetreten ist. Bei einer rechtzeitigen Behandlung treten nur sehr selten Todesfälle auf.
Zwischen 2008 und 2015 wurden dem Robert Koch-Institut pro Jahr zwischen 20 und 30 Fälle der Hasenpest beim Menschen gemeldet. Es sei anzunehmen, dass die tatsächliche Fallzahl wesentlich höher liegt, heißt es auf der Website des Instituts.
Hunde an der Leine führen
Auch Hunde können die Hasenpest übertragen, wenn sie beispielsweise ein verendetes Tier finden und daran schnüffeln oder es berühren. Hunde erkranken meist nicht selbst an dem Bakterium, können es jedoch an ihre Halter weitergeben.
Die Kreisjägerschaft Düsseldorf rät daher zur Vorsicht. Hundehalterinnen und -halter sollen ihre Haustiere aktuell nur an der Leine führen und Spazierwege nicht verlassen. Sollte ein Hund dennoch in Kontakt mit einem Hasen oder Kaninchen gekommen sein, raten die Experten, dem Tier schnell Schnauze und Pfoten zu waschen.
»Tot aufgefundene Hasen und Kaninchen sollte man nicht anfassen und dem zuständigen Kreisveterinäramt oder dem Ordnungsamt melden«, sagte Susanne Bossy von der Kreisjägerschaft gegenüber der »Rheinischen Post«.
Der Fall im Kreis Mettmann ist nicht der erste der vergangenen Wochen. In NRW seien zuletzt mehrere Hasen an der Krankheit gestorben, zuletzt wurde über einen Fall im Kreis Paderborn berichtet. Schreibt DER SPIEGEL.
Um allen Alu-Hüten, Leerdenkern, SVP-Esoterikern*innen und deren unvermeidlichen Verschwörungstheorien vorzubeugen: Nein, es sind weder die Chinesen, noch Bill Gates oder «The Great Reset»-Klaus Schwab vom WEF, die den Nordrhein-Westfalen*innen die Hasenpest beschert haben.
Erstmals wurde die Erkrankung durch die Hasenpest 1911 durch den US-amerikanischen Mediziner George W. McCoy beschrieben. 1912 gelang ihm zusammen mit Charles W. Chapin die Isolierung des Erregers aus einer Eichhörnchenart in Kalifornien. Schreibt Wikipedia.
Damit scheiden Gates und Schwab als Erfinder schon mal aus; sie waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren. Bleibt nur noch China. Doch 1911 hatten die Nachkommen von Konfuzius anderes zu tun, als sich mit Pestviren zu beschäftigen. Wie zum Beispiel Opium rauchen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.5.2021 - Tag der Bedenkenträger*innen
Migros lanciert Plastik-Sammelsack in Luzern: Kunden sind skeptisch: «Die Idee ist zwar gut, die Umsetzung jedoch nicht»
Seit Montag kannst man dank eines Plastik-Sammelsackes der Migros auch von zu Hause aus recyceln. Luzerner sind dem neuen Angebot gegenüber jedoch skeptisch. Zentralplus nahm einen Augenschein vor Ort und hat mit Kunden über das neue Angebot gesprochen.
Die Migros will mit ihrem Öko-Projekt rund um den Plastik-Sammelsack durchstarten. Seit dieser Woche können Kunden ihren Plastikmüll in dafür vorgesehenen Sammelsäcken separat zu Hause sammeln. Ist der Sack schliesslich voll, kann er zur nächsten Migros-Filiale mitgenommen und dort entsorgt werden. Das Ziel: den Plastikkreislauf schliessen. Laut Migros gibt es den Sammelsack in drei verschiedenen Grössen: 17, 35 und 60 Liter. Kostenpunkt: zwischen 90 Rappen und 2.50 Franken.
«Die Idee ist zwar gut, die Umsetzung jedoch nicht», erklärt ein Senior. Für ihn ist klar: «Die Bevölkerung muss bereits Steuern zahlen, die normalen Abfallsäcke kosten schon viel und dann zahle ich auch noch für den Transport, um an eine Migros-Filiale zu gelangen.»
Mehr Informationen über Recycling-Prozess erwartet
Die Luzerner Stundentin Lisa Drescher (24) hört ebenfalls erstmals von den Migros-Sammelsäcken. «Die Idee eines Sammelsacks ist an sich super, vor allem da ich in einer WG wohne und so das Trennen des Abfalls einfacher wäre», so die Studentin. Ihr würden jedoch noch mehr Informationen rund um den Recycling-Prozess fehlen. Das sei anhand der Informationen auf den Containern nicht ersichtlich.
Doch was halten Migros-Kunden und Passanten von der neuen Öko-Offensive der Schweizer Detailhändlerin? zentralplus war für einen Augenschein vor Ort und hat am Montagnachmittag mit Luzernerinnen und Luzernern gesprochen. Schnell wird klar, viele haben bisher noch gar nichts von der Plastik-Sammelsack-Offensive der Migros mitbekommen. So auch ein älterer Mann, der auf einer Bank beim Migros am Helvetiaplatz sitzt. Darauf angesprochen meint der Senior nur: «Für den Aufwand ist die Sache zu teuer.»
Luzerner sind Migros-Sammelsack gegenüber skeptisch
Doch auch für die 24-Jährige ist der Preis keinesfalls unwesentlich. «Grössere Flaschen häufen sich dann schneller an und das wird dann auch teuer», so die Studentin. Auf die Frage, ob sie einen Plastik-Sammelsack kaufen wird, meint sie, dass sie es sich noch überlegen werde.
Auch bei der Migros hinter dem Schwanenplatz herrscht Skepsis gegenüber dem neuen Angebot. Die Luzerner Seniorin Angelica Ritter wurde durch die Medien auf das Angebot aufmerksam. Auch sie kann der Öko-Offensive der Migros durchaus etwas abgewinnen, zeigt sich aber dennoch verhalten. «Ich nehme an, dass der Preis angemessen ist. Doch es braucht schon einen gewissen Reiz, um die Bevölkerung besser zu motivieren», so Ritter.
Die Plastik-Sammelsäcke sorgen derweil für Verwirrung. Denn gekauft werden können die Migros-Sammelsäcke in sämlichen Luzerner Filialen, entsorgt werden können diese offenbar aber nur bei einzelnen Migros-Filialen. Bei jener in der Alstadt sei dies bisher nicht möglich.
Plastiksack-Werbung hält sich in Grenzen
In zwei weiteren Migros-Läden wiederholt sich ernüchternde Erlebnis wie in der Neustadt. Die Migros am Kasernenplatz weist zwar mit zwei grossen Bannern auf den Abfallsack hin, aber dabei bleibt es auch schon. Am Bahnhof Luzern weist eine kleine Werbung beim Kundenservice auf das neue Angebot hin. Der Sticker ist in der Alltagshektik am Bahnhof Luzern sehr leicht zu übersehen. Schreibt ZentralPlus.
Ich werde den Eindruck nicht los, dass viele Luzerner und Luzernerinnen Paul Watzlawicks Buch «Anleitung zum Unglücklichsein» gelesen haben. Anders kann ich mir die teils absolut realitätsfremden und lächerlichen Argumente der üblichen Bedenkenträger*innen nicht erklären.
Endlich wird die MIGROS als Mitverursacherin des Stadt-Luzerner Müllproblems aktiv und setzt im Sinne des Verursacherprinzips ein Zeichen. Dass die Aktion nicht vom ersten Tag an wie geschmiert läuft, müsste auch den Skeptikern*innen einleuchten.
Es ist halt wesentlich einfacher, stupide Argumente wie «Preis der Sammelsäcke» und «ein (noch) nicht zu 100 Prozent erreichbares Filialnetz der MIGROS» vorzubringen, statt den inneren Schweinehund zu besiegen und endlich selber etwas gegen die Vermüllung der Stadt Luzern zu unternehmen, auch wenn das experimentelle Projekt der MIGROS erst ein bescheidener Anfang ist, das die eigentlichen Probleme nicht löst. Besser als Nichtstun und die wirkungslosen Sensibilisierungskampagnen der Stadt Luzern ist das Projekt auf jeden Fall.
Es könnte ja sein, dass diese MIGROS-Aktion die üblichen «Schmutzfinke» auf einem der Müllhotspots animiert, die im Rucksack mitgebrachten Plastikverpackungen nach dem Genuss des Inhalts im gleichen Rucksack nach Hause zu tragen, um sie im MIGROS-Abfallsack zu entsorgen statt einfach wegzuwerfen. Das wäre immerhin ein Anfang; die Hoffnung stirbt bekannterweise zuletzt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.5.2021 - Tag der Wendehälse
Hohe Mietpreise in Stadt Zug: Vorschläge der FDP lösen Stirnrunzeln aus
Die Stadt Zug ist ein extrem teures Pflaster, wenn es um das Wohnen geht. Die Mietpreise sind teilweise so hoch, dass sich Junge und Familien das Leben in Zug nicht mehr leisten können – und wegziehen. Nun liegt eine Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnraum auf dem Tisch des Stadtparlaments. Der Absender überrascht: Es ist die bürgerliche FDP.
Insgesamt gibt es in der Stadt Zug rund 15'000 Wohnungen. Gut 2100 von ihnen gelten als preisgünstig. Diesen Anteil von 14 Prozent möchte Etienne Schumpf erhöhen. Er ist der Chef der FDP-Fraktion im Stadtparlament. Die Stadtregierung solle Anreize schaffen, damit mehr preisgünstige Wohnungen gebaut würden.
Ausnützungsquote besser auslasten
Einerseits müssten explizit für den Bau bezahlbarer Wohnungen mehr Zonen ausgeschieden werden. Andererseits sei es wichtig, «dass entsprechendes Land, das knapp ist, im Baurecht abgegeben wird und dass die Ausnützungsquote noch höher und besser ausgelastet werden kann», sagt Schumpf.
Dass also, wer preisgünstige Wohnungen realisiert, höher bauen darf. So soll der Anteil von bezahlbaren Wohnungen langfristig auf 20 Prozent steigen.
Diese Vorschläge haben im Zuger Politbetrieb Stirnrunzeln ausgelöst. Schliesslich habe die FDP erst kürzlich ähnliche Forderungen einer kantonalen Initiative vehement bekämpft, schreiben die jungen Alternativ-Grünen. Und auch Urs Bertschi, Chef der SP-Fraktion im Stadtparlament, wundert sich über den Sinneswandel der FDP. «Ich hege die Vermutung, dass auch für ihre Klientel die Luft in der Stadt Zug verdammt dünn geworden ist.»
Die Vorschläge der FDP gehen ihm viel zu wenig weit. Die Stadt Zug besitze noch einige Landreserven und müsse selber als Bauherrin von preisgünstigen Wohnungen auftreten – das fordert Bertschi. Bisher sei das in Zug ein Tabu gewesen. «Der Stadtrat müsste hier ganz klar den Lead übernehmen und eben diese Tabuzone definitiv verlassen», sagt er und erklärt weiter: «Das ist ein Muss in unserer Stadt.»
Das wiederum kommt für FDP-Politiker Schumpf nicht infrage. Es gebe in Zug zahlreiche Wohnbaugenossenschaften und Korporationen, die Überbauungen realisieren könnten. Für diese müssten einfach die Rahmenbedingungen stimmen. «Wenn diese richtig gesetzt werden, haben auch die privaten Player genug Anreize, um genug bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.»
Auf politische Grabenkämpfe zwischen links und bürgerlich wolle er sich in dieser Frage nicht einlassen. Das gemeinsame Ziel sei es doch, dass es künftig in der Stadt Zug mehr bezahlbare Wohnungen gebe. Wie genau dieses Ziel erreicht werden könnte, darüber gehen die Meinungen aber noch weit auseinander. Schreibt SRF.
Man holt tief Atem, reinigt die Brillengläser, liest den Text nochmals und wundert sich: Ausgerechnet die Co-Partei der Immobilien-Mogule nebst der SVP entdeckt ihr Herz für «bezahlbare Wohnungen».
Keine Bange! Die FDP hat als Gralshüterin des abartigen Neoliberalismus weder die soziale Marktwirtschaft noch den Sozialismus entdeckt. Auch schlägt ihr Herz nicht urplötzlich für die unteren und mittleren Einkommensschichten, die sich die exorbitanten Wohnungsmieten in Stadt und Kanton Zug schlicht und einfach nicht mehr leisten können.
Die FDP tut das, was sie immer tut, wenn ihre Umfragen beim Wahlvolk in den Keller rauschen, was aktuell wieder einmal der Fall ist: Als fleischgewordene Wendehalspartei okkupiert sie ohne Skrupel die Themen anderer Parteien; in diesem Fall das Thema einer kantonalen Initiative für bezahlbaren Wohnraum der jungen Alternativ-Grünen und der SP des Kantons Zug.
Bei den National- und Ständeratswahlen 2019 schämte sich die Partei um «Greta» Petra Gössi nicht, urplötzlich die Umwelt und den Klimawandel als Wahlthema für sich zu entdecken, nachdem die Gössi-Partei sowohl 2018 wie auch 2019 jede, aber auch wirklich jede klima-und umweltpolitische Gesetzesvorlage im Parlament bekämpft und mit ihrem Stimmverhalten versenkt hat. https://www.watson.ch/schweiz/analyse/670382038-so-umweltfreundlich-sind-fdp-svp-die-gruenen-sp-und-glp-wirklich
Wegen dieser FDP-Kehrtwendung brauchen sich Hauseigentümerverband und Immobilienbranche allerdings keine Sorgen zu machen. Denn spätestens bei den Abstimmungen über entsprechende Gesetzesvorlagen bezüglich Wohnungsmieten in den zuständigen Parlamenten wird die FDP jede auch noch so sinnvolle Vorlage derart bis zur Unkenntlichkeit verwässern, bis ihre Kernklientel zufriedengestellt ist.
Ganz zu schweigen vom Abstimmungsverhalten im Ständerat, wo beispielsweise der Luzerner FDP-Staatsmann, Obergefreiter der Schweizer Armee, Pöstchenjäger und Ständerat Damian Müller stets beweist, wessen Lied er singt: das seiner Teilzeit-Arbeitgeberin Swiss Life, ihres Zeichens eine der grössten Schweizer Immobiliengesellschaften.
So sorgte Müller u.a. zusammen mit den «bürgerlichen» Mitte- (ehemals CVP) und SVP-Ständeräten dafür, dass die von Parlament und Bundesrat vorgesehene Mietzinsreduktion um 50 Prozent für kleinere Betriebe während des Corona-Lockdowns 2021 endgültig versenkt wurde.
Auf eines ist bei Wendehalsparteien immer Verlass: Spätestens wenn es ernst wird, kümmern sie sich definitiv nicht mehr um ihr Geschwätz von gestern. Deswegen nennt man sie auch Wendehalsparteien. Dieses Unwort muss man sich ja erst verdienen. Die FDP weiss, wie's geht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.5.2021 - Tag der Erdachse
Mehr Naturkatastrophen durch Klimawandel?
Im Dossier "Naturkatastrophen" veröffentlichen Vortragende der RV "Naturkatastrophen und ihre Bewältigung", die im Sommersemester läuft, ihre Beiträge. Lesen Sie hier, was Klimaforscher Reinhard Böhm über Klimawandel und Naturkatastrophen im Blickfeld von Medien und Wissenschaft berichtet.
Die aktuelle öffentliche Debatte über den Klimawandel ist von einem Paradoxon gekennzeichnet, dem ein Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung (RV) "Bewältigung von Naturkatastrophen" nachgeht. Im Vordergrund steht das meist nicht hinterfragte – man könnte sagen – "a priori" der Folgen des Klimawandels, dass dieser mit einer Zunahme der extremen Ausformungen von Wetter und Klima einhergeht. Die Medien sind voll von Meldungen über Jahrhundertsommer, tropische Stürme, Tornados, Muren, Hangrutschungen, Hochwässer und Dürren. Das waren sie auch früher schon, nur werden derartige Ereignisse nun meist mit "dem Klimawandel" in Verbindung gebracht. Interessanterweise geschieht dies auch für solche, die auf der anderen, der kalten Seite des Spektrums der Wetter- und Klimavariabilität angesiedelt sind, wie die heurige Kältewelle, Starkschneefälle und Lawinen. Es scheint klar zu sein, die Variationsbreite des Wetters und Klimas wird breiter.
Zunahme von Extremereignissen?
Das eingangs erwähnte Paradoxon besteht nun darin, dass bei sorgfältiger Analyse von Qualitätsdaten meist weder die behauptete Zunahme der Extremereignisse nachweisbar ist, noch deren als selbstverständlich angenommene kausale Verbindung mit dem Klimawandel (worunter üblicherweise der anthropogene Klimawandel infolge der Treibhausgasemissionen beim Verbrennen fossilen Kohlenstoffs verstanden wird). Abgesehen von der wenig überraschenden Zunahme von heißen Tagen und der analogen Abnahme von kalten Tagen bleibt meist nicht mehr viel übrig.
Für Mitteleuropa etwa konnten wir zeigen, dass die Variabilität des Klimas weder in den letzten mehr als 200 Jahren der hier besonders langen "instrumentellen Periode" zugenommen hat, noch dass sich die aktuellen 30 vorherrschend anthropogen geprägten Jahre durch verstärkte Variabilität von Luftdruck, Temperatur und Niederschlag auszeichnen. Andere Studien brachten ein analoges Ergebnis für die Sturmtätigkeit bei uns und in anderen Teilen Europas. Und eine aktuelle Analyse, die gerade in Arbeit ist, zeigt weder bei den großräumigen exzessiven Starkniederschlägen in den Einzugsgebieten der in den Alpen entspringenden Flüsse eine Zunahme, noch bei den am anderen Ende der sogenannten PDF ("Probability Density Function") angesiedelten exzessiv trockenen Monaten.
Schleichendes Phänomen
Wie kommt nun aber die Dominanz dieser Zuordnung "Klimawandel = mehr Katastrophen" zustande? Das liegt zum einen in der Eigenschaft der Wetter- und Klimaextreme, dass sie natürlich per Definition selten sind, dass sie aber auch meist räumlich sehr begrenzt auftreten. Sogar eine großräumige und länger dauernde Anomalie eines "Jahrhundertsommers in Europa" nimmt nur wenige Prozent der Erdoberfläche ein – ist somit statistisch global im Abstand weniger Jahre zu erwarten. Andere Phänomene wie Stürme, Starkregen, Gewitter oder Hagel überdecken – in dieser Reihenfolge – immer geringer werdende Flächen bis hinunter auf wenige Hektar, auf denen etwa ein Sturm den Baumbestand eines Forstes vernichtet. In Verbindung mit der immer perfekter werdenden globalen Vernetzung der Medien liefert die Natur somit andauernd irgendwo Extremereignisse, die deren Zunahme perfekt suggerieren.
Da "der Klimawandel", an dessen Existenz und dessen Zuordnung zum anthropogenen Anstieg der Treibhausgase kein Zweifel besteht, jedoch ein schleichendes Hintergrundphänomen ist, kann er nur schwer direkt wahrgenommen werden. Einen globalen Temperaturanstieg von schwach ein Grad Celsius in einem Jahrhundert, den wir bereits erlebt haben, konnten wir weder fühlen noch anders direkt wahrnehmen. Er geht in der regional viel stärkeren Variabilität von Jahr zu Jahr, Monat zu Monat, Tag zu Tag unter – wissenschaftlich betrachtet ein typisches "signal to noise"-Problem.
Aufmerksamkeit für das Thema
Da liegt es nun nahe und ergibt sich beinahe von selbst, dass diejenigen, die von der ernsten Sorge um die künftige Klimaentwicklung angetrieben sind, gerade die von den Medien andauernd frei Haus gelieferten Extremwerte nutzen, Aufmerksamkeit für das Thema zu erzielen. Es sind dazu gar keine besonderen Anstrengungen nötig – das ist beinahe so etwas wie ein Selbstläufer. Unterstützt werden sie dabei von dem nicht weg zu diskutierenden tatsächlich vorhandenen Anstieg der wirtschaftlichen Schäden durch Naturkatastrophen, auch wenn man die nicht klimabedingten Schäden durch Erdbeben oder Tsunamis ausklammert. Darüber erfahren wir ja perfekt aufbereitet aus den Jahresberichten der großen internationalen Rückversicherer. Auch wenn man die Zeitreihen der Schäden inflationsbereinigt, zeigen sie meist eine starke Zunahme.
Wir sind empfindlicher gegen Naturkatastrophen geworden und erleiden mehr Schäden, da es mehr zu schädigen gibt. Zwei internationale Studien zeigen dies für die Flusshochwässer in Europa und für die Hurrikan-Schäden an der Atlantikküste der USA. Wir haben es also beim Thema "Klimawandel und Naturkatastrophen" mit einem betrüblichen Auseinanderdriften der öffentlichen Meinung und der Wissenschaft zu tun. Dieses sollte auch von denen, die das als "nützlich für einen guten Zweck" erachten, bedacht werden. Kurzfristig kann man mit den Wetter- und Klimaextremen leicht Aufmerksamkeit erzielen. Das funktioniert zurzeit perfekt. Langfristig ist aber zu befürchten, dass die Wissenschaft schleichend an Glaubwürdigkeit verliert – und das kann sehr "nachhaltig" sein.
Dr. Reinhard Böhm ist in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in der Abteilung Klimaforschung tätig.
Quelle: Universität Wien / 2012
«Die Erde taumelt – Das Schmelzen der Gletscher wurde Mitte der 1990er-Jahre zur Hauptursache dafür, dass die Erdpole gleichsam plötzlich mit einer Geschwindigkeit von 3,28 Millimeter pro Jahr in Richtung 26 Grad Ost drifteten.» So steht es geschrieben in einer Studie; veröffentlicht im Jahr 2018. Eine neue Studie vom 22. März 2021 untermauert die These der Studie aus dem Jahr 2018.
Die neue Studie macht derzeit in den Medien die Runde. Auch bei den Boulevardgrössen. Meistens unkommentiert, weil «Katastrophen» rund um das Thema Klima inzwischen Selbstläufer sind, die keine fundierte und faktenbasierte Auseinandersetzung benötigen. Angeklickt werden sie so oder so.
Doch Wissenschaftsartikel mit einem dem Clickbaiting geschuldeten Hauch von Alarmismus sind für «Otto Normalverbraucher», der/die/das weder Physik noch Naturwissenschaft studiert hat, schwer verdauliche Kost und bergen gewisse Gefahren und Risiken der Falschbeurteilung in sich.
Deshalb empfehle ich heute einen Artikel von Klimaforscher Dr. Reinhard Böhm, der von der Universität Wien am 20. März 2012 veröffentlicht wurde. Es sei darauf hingewiesen, dass Dr. Reinhard Böhm alles andere als ein «Klimaleugner» ist, der Verschwörungstheorien zum Klimawandel verbreitet. Er setzt sich lediglich mit den von der Presse teils leichtsinnig «verwursteten» Klimakatastrophen auseinander.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.5.2021 - Tag der Arbeit
Konkurs – auch wegen Corona: Das Restaurant «La Squadra» in Neuenkirch schliesst
Nach dem zweiten Lockdown schliesst Romano Simioni sein Restaurant. Gemäss dem Sohn des FCL-Ehrenpräsidenten ist Corona verantwortlich – aber nicht nur.
Die simionigastro GmbH, welche hinter dem Restaurant steht, ist konkurs, wie kürzlich dem Kantonsblatt zu entnehmen war. Betreiber Romano Simioni junior bestätigt gegenüber der «Luzerner Zeitung»: «Das Restaurant bleibt geschlossen. Gegen Ende März haben wir entschieden aufzuhören. Das ewige Auf und Zu ist uns zu viel geworden.»
Anfang sei das Restaurant gut gelaufen. Doch die Frequenzen hätten sich nicht wie erhofft entwickelt. «Wir hatten damit immer Probleme, leider.» Schon vor dem Lockdown sei zu wenig Geld reingekommen. Schreibt ZentralPlus.
Romano Simioni ist ehrlich und das spricht für ihn: Das Restaurant «La Squadra» in Neuenkirch wäre auch ohne Corona ein Fall fürs Konkursamt geworden. Früher oder später. Corona hat nun das Ende beschleunigt. Laut einer Studie von avenir suisse fallieren seit jeher mehr als 50 Prozent der Gastrobetriebe innert zwei bis fünf Jahren nach der Gründung.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.4.2021 - Tag der Klimaretter*innen
Studie: Österreich hat genügend Dächer für ausreichend Solarstrom
Mit Solarstromanlagen auf allen größeren Gebäuden wie Supermärkten und Lagerhallen könnte Österreich das Klimaziel erreichen, ab 2030 sämtlichen Strom aus erneuerbarer Energie zu beziehen, erklärte Christian Mikovits von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien der APA. Ebenso würde es reichen, auf 0,7 Prozent der verfügbaren Freiflächen Photovoltaik-Anlagen zu installieren, sagte er anlässlich der am Freitag zu Ende gehenden Konferenz der European Geosciences Union (EGU).
Mikovits, der am Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung der Boku forscht, untersuchte mit Kollegen anhand der geografischen Raster im "Geographischen Informationssystem (GIS)" der Bundesländer, wie viele Dachflächen in Österreich für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stünden. "Insgesamt gibt es in Österreich cirka 2,5 Millionen Gebäude mit einer Grundfläche von 730 Quadratkilometern", berichtet er. Dazu kommen 50 Quadratkilometer Fläche von (nicht als Gebäude klassifizierten) Gartenhütten. Nutzbar davon wären gut 15 Prozent, das sind ungefähr 120 Quadratkilometer. Der Rest fällt wegen der ungünstigen Ausrichtung, Aufbauten, Dachfenstern, einem schlechten Zustand oder Denkmalschutz aus.
400 Anlagen pro Tag unrealistisch
Ein österreichisches Klimaziel für 2030 ist, 30 Terawattstunden Strom pro Jahr aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, elf davon sollen von Solarstrom kommen. "Sortiert man die geeigneten Gebäude von groß nach klein und baut in dieser Reihenfolge Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer, wäre dieses Ziel nach 30 Prozent der Gebäude erreicht", so der Forscher. Dann wären alle Gebäude mit über 220 Quadratmeter Grundfläche mit Solaranlagen versehen. Die Krux ist aber, dass man in den nächsten knapp zehn Jahren dazu pro Tag 400 Anlagen installieren müsste, was absolut unrealistisch ist. "Deshalb wird man zumindest temporär auch freie Flächen am Boden nutzen müssen", meint er.
Deshalb untersuchten die Forscher im Zehn-Quadratmeter-Raster, welche anderen Flächen man ebenfalls für Solaranlagen nutzen könnte. Waldflächen und alpine Gebiete fallen hier prinzipiell aus, die anderen Flächen in der Landschaft wie etwa Beton-, Wiesen-, Verkehrs- und landwirtschaftliche Flächen sahen sie sich auf ihr Potenzial für Photovoltaik-Nutzung genauer an. Hier wäre zum Beispiel oft ein Doppelnutzen mit Solaranlagen und Landwirtschaft möglich, man nennt dies "Agri-Photovoltaik".
Das funktioniert am ehesten beim Gemüseanbau, denn dabei kommt man meist mit kleinen landwirtschaftlichen Fahrzeugen aus, die zwischen den Photovoltaik-Paneelen durchfahren könnten, so Mikovits. Für effizienten Getreideanbau werden oft große Traktoren und Mähdrescher benötigt, was einen Doppelnutzen der Flächen mit Solaranlagen ausschließt. Zusätzlich gibt es österreichweit viele "Verkehrsrandzonen" etwa entlang von Autobahnen, innerhalb der Autobahnknoten und bei Auffahrten sowie Deponieflächen, die sich für eine Photovoltaiknutzung sehr gut eignen.
Über ganz Österreich haben die Forscher beinahe 32.000 Quadratkilometer Freifläche identifiziert. "Davon müssten nur ungefähr 0,7 Prozent für Photovoltaik-Installationen verwendet werden, um auf die elf Terawattstunden Strom pro Jahr zu kommen", berichtet Mikovits. Schreibt DER STANDARD.
Das ist doch mal eine optimistische News am frühen Morgen, die unser aller Klimaretter*innen-Herz erfreut.
Doch eine Frage bleibt: Hat Österreich auch genügend Sonnenschein, um die Solarpanels zu füttern?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.4.2021 - Tag der Leckerbissen
Outdoor-Office: Was ist das Gegenteil von Homeoffice?
Richtig: Outdoor-Office. Dieses Bild vom Rande der stets arbeitsamen Bürostadt Frankfurt zeigt einen bequemen Chefsessel im Freien – aber wohin man auch schaut: Weit und breit keine Arbeit in Sicht. So kommt man wirklich mal auf andere Gedanken. Schreibt DER SPIEGEL zu einer thematisch aufbereiteten Fotoserie.
Herrliche Bildergalerie. Sogar ein Bild aus der Schweiz mit den «fliegenden Pferden» von Saignelégier schaffte es unter die ausgewählten Bilder.
Ein Leckerbissen für Liebhaber*innen aussagekräftiger Fotos.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
28.4.2021 - Tag der Raute des Grauens
Coronadiskurs mit Kulturschaffenden: Beim Karl-May-Darsteller wird die Kanzlerin bockig
Per Videoschaltung debattierte Angela Merkel mit Menschen aus den Bereichen Film, Theater, Kunst oder Musik über Coronahilfen – mit erstaunlicher Empathie. Nur einmal bringt sie ein vergiftetes Kompliment.
Der junge Schauspieler aus Berlin ringt mit den Worten, die Stimme stockt, die Augen werden glasig. Erst hat er aufgrund der Coronapandemie seinen Job bei den Karl-May-Festspielen verloren, dann konnte er aufgrund der Schutzmaßnahmen nicht mehr im Einzelhandel arbeiten. Schließlich klagt er Richtung Kanzlerin: »Ich kann nicht – halten Sie sich fest! – von 720 Euro leben. Ich kann keine Banken ausrauben.« Inständig bittet er die Regierungschefin um Zukunftsperspektiven für sich und die seinen.
Es ist der große emotionale Ausbruch nach gut 60 Minuten eines sachbezogenen Dialogs, den Angela Merkel am Dienstag mit Kulturschaffenden anberaumt hat. Bei der Videokonferenz, die professionell wie eine Talkshow ins Bild gesetzt ist, tritt die Kanzlerin über insgesamt 90 Minuten ins Gespräch mit 14 Menschen aus den Bereichen Film, Theater, Kunst oder Musik. Merkel hört sich Anliegen an, sie nickt zustimmend, sie hakt nach, sie verspricht, die Dinge in Absprache mit dem Ministerium für Arbeit oder mit ihrer Kulturstaatsministerin in die Gänge zu bringen. Man kann ihr eine gewisse Empathie nicht absprechen.
Nur bei dem sichtlich angefassten Karl-May-Darsteller wird sie ein wenig bockig. Erst seufzt sie sehr lang und sehr tief, dann macht sie, als wäre sie die Moderatorin der Runde, darauf aufmerksam, dass sie weit hinter dem Zeitplan liege. Schließlich bringt sie das vergiftete Kompliment, dass ihre Gesprächspartner ja alle einer Branche angehörten, »wo das Wort ihr Mittel« sei. So, als ob es jetzt langsam auch mal genug sei mit all dem kultivierten Gerede.
Trotzdem muss man die Detailgenauigkeit loben, mit der hier über Strecken über sehr spezielle Probleme der Kunst- und Kulturschaffenden in Pandemiezeiten gesprochen wird. Etwa wenn eine Buchhändlerin die insgesamt sechs verschiedenen Geschäftskonzepte aufzählt, die sie korrespondierend mit den sich ewig verändernden Corona-Schutzmaßnahmen und den schwankenden Inzidenzwerten entwickelt hat.
Ein Chaos, dessen Folgen die Ladenbesitzerin so beschreibt: »Wenn die Leute sich auf gar nicht verlassen können, stellen sie alles infrage und das Virus lacht sich ins Fäustchen.« Merkel, die zuvor sehr kleinteilig einladende Möglichkeitsformeln wie »bis zu 150 ist Click & Meet möglich« runtergebetet hat, streckt da kurz einmal die argumentativen Waffen: »Auch die Notbremse wird nicht der letzten logischen Frage standhalten.«
»Werd noch mal gucken«
Ansonsten versucht die Kanzlerin, Mut zu machen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Mit einem Jazztrompeter redet sie über Hygienekonzepte von Musikklubs (»Wir werden ihnen für Herbst Veranstaltungen ermöglichen«). Mit einer Schauspielerin über die berufsspezifischen Probleme des Arbeitslosengeldes (»Werd noch mal gucken, ob man da was machen kann«).
Aufwühlend ist die Ansprache einer freien Musikerin aus Köln, die über langsame oder ausbleibende Hilfszahlungen berichtet. Sie selbst komme aufgrund eines in 20 Jahren aufgebauten Fankreises immerhin auf ein Drittel ihrer Einnahmen, anderen sei komplett die Existenzgrundlage entzogen. Die Musikerin macht den Vorschlag, das Konzept der Kurzarbeit auch auf freischaffende Kolleginnen und Kollegen zu übertragen. Die Kanzlerin hört zu und verspricht, die Idee mal mit ihrer Staatsministerin zu erörtern: »Monika Grütters hat ein Herz für Künstler.«
Hat sie das? Eine Milliarde Euro durfte Grütters bei einem ersten Hilfspaket auf Bundesebene für die Kultur ausgeben. Zuletzt verhandelte sie sogar um weitere 1,5 Milliarden Euro, herauskam jetzt wieder eine Milliarde. Doch funktioniert ihr Verteilersystem? Schreibt DER SPIEGEL.
Also sowas! Mutti (formerly called «Raute des Grauens») ist bockig?
«Aus der Ferne denkt man an ein bockiges Tier» schreibt Wiki zum Begriff «bockig». Und weiter: «Bockig zu sein bedeutet, dass jemand stur und trotzig ist. Das Wort bockig kommt von Bock, insbesondere dem Ziegenbock, dem man nachsagt er sei bockig. Bei Menschen spricht man von bockig, wenn man das Verhalten des anderen als irrational blockierend oder als unsinnige Weigerung interpretiert. In manchen Situationen ist es durchaus angebracht widerspenstig zu handeln, da es nicht immer gut ist, sich an die Vorgaben anderer zu halten.»
Trifft dies alles wirklich auf Frau Merkel zu? Da lehnt sich DER SPIEGEL aber ziemlich weit zum Fenster hinaus.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
27.4.2021 - Tag der Luzerner Müllberge
So kämpft die Stadt Luzern gegen die Berge von Corona-Güsel an
An neuralgischen Punkten in der Stadt Luzern türmt sich der Abfall fast täglich. Die Stadt hat mittlerweile reagiert und schickt ihre Mitarbeiter auf zusätzliche Touren. Die Verantwortlichen hoffen, dass neue Lockerungen der Corona-Massnahmen bald auch hier Besserung bringen.
Wer in diesem Frühling regelmässig in der Luzerner Innenstadt unterwegs ist, hat sich mittlerweile an das Bild gewöhnt. Gefühlt an jeder Ecke steht ein hoffnungslos überfüllter «Güselchübel». Insbesondere an den Wochenenden türmen sich die Abfallberge darum herum. Die Mitarbeiter der Stadt Luzern scheinen der Entwicklung hoffnungslos hinterherzurennen.
Tatsächlich hat sich ihr Alltag seit Corona verändert, wie Florian Aschbacher, Leiter Betrieb und Strassenunterhalt bestätigt. «Wir haben unsere Touren zum Leeren der Güselchübel mittlerweile deutlich aufgestockt. Am Schweizerhofquai sind wir mittlerweile dreimal statt einmal pro Tag unterwegs, um die Eimer zu leeren. Und wir haben zusätzliche Plastikcontainer aufgestellt.» An warmen Wochenendtagen sind laut Aschbacher bis zu 17 Mitarbeiter der Stadt auf der Piste – allein um die Kübel zu leeren.
Luzern ist mit dem Problem nicht allein
Dem langjährigen Profi ist in der Coronazeit vor allem aufgefallen, wie gross und voluminös die Verpackungen der diversen Take-away-Anbieter ausfallen. Aschbacher ist mittlerweile seit fünf Jahren im Geschäft. «Das fällt einem vor allem auf, wenn diese in so rauen Mengen zusammenkommen, wie es momentan der Fall ist.» Insbesondere hat er dabei die Pizzakartons und die tausenden von Papiersäcken vor Augen, welche diverse Take-away-Betriebe und Fastfood-Ketten den Kundinnen mitgeben.
Luzern ist mit dem Problem nicht allein: In Kriens hat die Stadt zusätzlich Abfalleimer aufgestellt und der Werkdienst macht Extratouren (zentralplus berichtete). In Zug startet am 1. Mai eine Anti-Littering-Kampagne, welche die Bevölkerung wieder dafür sensibilisieren soll, den Abfall korrekt zu entsorgen.
Leeren der Kübel ist nicht ungefährlich
Viel Abfall gibt es natürlich vor allem dort, wo sich viele Leute tummeln. Und genau dies ist ein weiteres Problem: «An den Hotspots ist es mitunter gefährlich, mit unseren Elektrofahrzeugen die Kübel zu leeren. Davor haben wir enormen Respekt und nicht immer ein ganz gutes Gefühl», sagt Aschbacher. «Aber um der Abfallmenge Herr zu werden, haben wir keine andere Möglichkeit, als uns durch die spazierenden Menschen zu schlängeln.»
«Es ist so, dass Abfall wiederum Abfall anzieht.»
Florian Aschbacher, Leiter Betrieb und Strassenunterhalt Stadt Luzern
Aschbacher will aber auch aufgefallen sein, dass einige Kübel fast leer sind, während andere überquellen – obwohl sie nur ein paar Schritte voneinander entfernt stehen. «Es ist so, dass Abfall wiederum Abfall anzieht und die Leute ihren Müll einfach dort entsorgen, wo es die anderen tun.»
Soll man wieder mal über Verpackungen diskutieren?
Wie viele Tonnen Abfall die Mitarbeiter der Stadt momentan täglich abführen, kann Aschbacher nicht sagen, da der eingesammelte Güsel in grosse Pressmulden geworfen wird. Er macht jedoch ein Zahlenbeispiel: «Grundsätzlich kommen bei schönem Wetter alleine an der Ufschötti bis zu drei Tonnen pro Wochenende zusammen. Unabhängig von Corona.» Für Aschbacher ist wegen der jüngsten Entwicklungen aber nochmals deutlich geworden, dass eine Diskussion betreffend Verpackungen und wie diese in Zukunft aussehen sollen, angezeigt ist. «Das müsste dann aber auf einer höheren Ebene geschehen», so seine Meinung.
Trotz der jüngsten Entwicklung ist man bei der Stadt versucht, die Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln zu bewältigen. Hier kommt den Verantwortlichen zugute, dass das Nachtleben sich in den letzten Monaten aufgrund der Schliessung von Clubs und Bars fast ganz aus dem öffentlichen Raum zurückgezogen hat. «Wir können nun Leute für das Leeren der Abfallkübel einsetzen, die vorher für die nächtliche Strassenreinigung auf den Ausgangsmeilen aufgeboten wurden», erklärt Aschbacher.
Für leichte Entspannung gesorgt hat bereits in der ersten Woche die Öffnung der Restaurantterrassen. «Wir gehen davon aus, dass sich die Situation bei weiteren Öffnungsschritten noch mehr entspannen wird», sagt Florian Aschbacher. «Auch die Öffnung der Badis könnte zusätzliche Entspannung bringen», blickt er voraus. «Wenn die Leute im Sommer aber tatsächlich alle in der Schweiz bleiben sollten, kann es schon sein, dass wir auch dann mehr Abfall als in anderen Jahren im Sommer haben. Ich denke dennoch, dass wir auch das mit den bestehenden Ressourcen bewältigen können.» Schreibt ZentralPlus.
Eines sei vorweg festgehalten: Die Vermüllung der Stadt Luzern hat lange vor Corona begonnen. Müll-Bilder, wie sie 2021 beinahe im Tagesrhythmus in den Medien präsentiert werden, könnte ich auch aus dem Jahr 1996 zur Verfügung stellen.
Es scheint ja fast so, als ob die Corona-Pandemie für die zuständigen Luzerner Behörden ein willkommenes Feigenblatt darstellt, um ihr eigenes Versagen an einen andern Sündenbock zu adressieren, der nicht greifbar ist.
Die Wahrheit ist, dass die «Sensibilisierungskampagnen» der Stadt Luzern bezüglich Abfall nicht nur sehr teuer, sondern auch absolut wirkungslos waren.
Die Aussage von Florian Aschbacher trifft den Nagel auf den Kopf, auch wenn er sie in einem etwas andern Kontext machte: «Es ist so, dass Abfall wiederum Abfall anzieht.»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
26.4.2021 - Tag der Gratisreklame für Porno-Portale
Sexfilme boomen während Corona: Luzerner Experte: «Viele Männer kommen zu mir und meinen, sie seien pornosüchtig»
Wegen Corona werden mehr Pornos geschaut. In der Luzerner Suchtberatungsstelle suchen einige Männer Hilfe, weil sie meinen, sie seien süchtig nach Sexfilmen. Ein Luzerner Experte erzählt, wann es wirklich zu viel ist – und warum Männer, die sich nach einer Beziehung sehnen, Pornos gucken.
Die Coronapandemie verlagerte unser Leben in die eigenen vier Wände. Wir zogen uns zurück, unsere reale Welt verschob sich zunehmend ins Digitale. Geschäftsmeetings fanden per Zoom statt, mit Freunden stiess man per Videocall an. Und auch die Lust findet in der virtuellen Welt statt – während Corona boomte der Pornokonsum.
So zeigen Zahlen von Pornhub – einem der weltweit grössten Anbieter –, dass der Pornokonsum in der Schweiz seit Beginn der Pandemie um mehr als 20 Prozent gestiegen ist.
Männer haben Mühe, eine Partnerin zu finden
Auch bei «Klick», der Fachstelle Sucht Region Luzern, nimmt man seit Corona einen leichten Anstieg der Beratungen im Bereich von Sexualität und Pornografie wahr. Wenn auch noch keine Tendenz spürbar sei, sagt der Berater Giacomo Bellotto. Zu ihm kommen derzeit einige Männer in die Beratung, die Rat zu diesen Themen suchen.
Mehrheitlich seien es Singlemänner, die sich eine Partnerin wünschten. Sie möchten sich entfalten und gleichzeitig entladen. Auf Pornos zurückzugreifen ist ein möglicher Ausdruck, seine Sexualität auszuleben. «Auf pornografischen Seiten realisieren die Betroffenen, wie schnell sie ihren Fantasien, Wünschen und Bedürftigkeiten visuell begegnen können», sagt der Sozialarbeiter.
Viele Männer hätten Schwierigkeiten, überhaupt mit Frauen in Kontakt zu kommen. Sie seien unsicher, wie sie eine Frau ansprechen können. Ein Problem, das sich in Zeiten von Corona zugespitzt hat. «Viele unserer Klienten sehnen sich danach, mit einer Partnerin Nähe zu erleben, aus der mehr entstehen kann. Nicht nur Sex – sondern eine Partnerschaft.»
Pornosucht ist nicht gleich Sucht
Dass seit Corona mehr Pornos konsumiert werden, dafür hat Bellotto eine Erklärung. «Der Mensch ist ein soziales und emotionales Wesen mit entsprechenden Bedürfnissen, die gelebt werden wollen.» Während Corona war es schwieriger, neue Bekanntschaften zu knüpfen, monatelang hatten auch Massagesalons oder Erotiketablissements geschlossen.
Die Welt der Pornos offenbart sich uns als lustvoll-dreckig und schwitzig. «Für viele ist sie aber auch ernüchternd», so Bellotto. Weil Pornos häufig mit Sexchats oder Telefonsex funktionieren, realisieren Konsumenten schnell, dass es primär um gekaufte Liebe und ums Geld geht. Das emotionale Bedürfnis bleibt auf der Strecke.
«Viele Männer kommen zu mir und meinen, sie seien pornosüchtig», sagt Bellotto und relativiert: «Sucht ist immer eine Bewertung.» Die wenigsten sind nach diagnostischen Kriterien wirklich süchtig, wenn sie sozial integriert seien, so Bellotto. «In den meisten Fällen haben sie einen problematischen, belastenden Umgang mit Pornos, ohne schon eine Abhängigkeit entwickelt zu haben.»
Dass der Konsum ein Übermass angenommen habe, sei nur ein Kriterium einer Sucht. «Unsere Klienten treibt ein ungutes Gefühl um. Ich höre dann oft: Ständig Lust nach Sex oder Pornos zu haben, immer diesen Lustpegel in sich zu haben, ist belastend.»
Übermüdet und unkonzentriert
Doch: Wann ist es denn zu viel? «Ein Erkennungsmerkmal für einen zu hohen Pornokonsum oder übermässiges Gamen ist der soziale Rückzug», sagt Felix Wahrenberger von der Luzerner Fachstelle «Akzent Prävention und Suchttherapie». Wenn jemand nicht mehr unter Menschen geht oder nicht mehr auf Einladungen reagiere.
Kürzlich luden die Fachstelle Arbeitgeberinnen und Personalverantwortliche zu einem Onlinetreffen zum Thema Games und Pornos ein. Eigentlich sind Letztere Privatsache – in Zeiten von Homeoffice können diese Bereiche aber ineinanderfliessen. Denn laut Pornhub werden die meisten Filme seit Beginn der Coronapandemie während der Arbeitszeit konsumiert. «Wohl auch, weil aufgrund des Homeoffice weniger soziale Kontrolle im Betrieb herrscht», sagt Felix Wahrenberger, Teamleiter Prävention bei Akzent.
Bei Süchtigen wird nicht nur der Konsum, quasi die Dosis, mit der Zeit erhöht, sondern es komme auch zu einem Verlust der Selbstbestimmung. Erlebbar ist dies beim Handy, auf dessen Bildschirm eine Nachricht aufploppt. Bestimme ich, wann ich das Handy in die Hand nehme und die Nachricht checke – oder ist das Handy quasi der Chef, der die Kontrolle darüber hat, wann ich mich ihm zuwende?
Investiert jemand übermässig viel Zeit in Porno oder Games, seien die die am schnellsten am Arbeitsplatz spürbaren Folgen Übermüdung und Unkonzentriertheit. «Die Gedanken driften auch bei der Arbeit immer wieder ab. Betroffene können dann so abgelenkt sein, dass sie beispielsweise auch versuchen, längere WC-Pausen zu machen – weil sie lieber Pornos gucken als bei der Arbeit sitzen wollen.»
Laut Wahrenberger ist es gut, wenn Personen aus dem Umfeld reagieren und ihre Sorgen äussern. Denn bis Betroffenen das Problem bewusst wird, sei meist schon viel passiert. Um zu verhindern, dass Sucht überhaupt entsteht, ist es zum Beispiel hilfreich, unterschiedliche Freizeitbeschäftigungen zu haben und reale Gespräche zu führen. Am Arbeitsplatz soll Wertschätzung und Anerkennung vermittelt werden.
Männer haben mit dem Druck und den Erwartungen zu kämpfen
Oft liest man in den Medien, dass Erektionsstörungen mögliche Folgen eines überhöhten Pornokonsums seien. Sozialarbeiter Giacomo Bellotto von «Klick» meint: «Es ist mehr die Angst vor dem Versagen.» Oftmals hängt dies wohl mit dem gesellschaftlichen Druck zusammen, verinnerlichte Erwartungen erfüllen zu müssen, wie ein Mann sein sollte. Und bei manchen ist wohl auch die starre Rollenteilung in Pornos ein Faktor: der Mann, grob und rücksichtslos mit dem ewig stehenden Phallus. Die Frau, gefügig und zu allem bereit.
Bellotto hatte schon Gespräche mit Paaren, in denen Frauen äusserten, dass sie mit dem Pornokonsum des Partners zu kämpfen hätten. «Sie sagen, dass sie sich dadurch als Lustobjekt und mit Fantasien konfrontiert sehen, die sie nicht wollen.»
Klienten sind reflektiert
In seinen Therapiegesprächen nimmt Bellotto Pornokonsumenten indes als sehr reflektiert und achtsam wahr. «Sie wissen, dass es sich um reine Sexfantasien und Ideen im Kopf handelt, die sie so nicht 1:1 in die Realität umsetzen wollen.»
Bellotto spricht in seinen Therapieberatungen sehr offen mit seinen Klienten über Sexualität und Pornos. «Ich frage sie dann, ob Frauen sich wirklich einen Partner an ihrer Seite wünschen, der den in den Pornoseiten dargestellten Bilderwelten entspricht.» Und er ermutigt sie auch, mit Frauen – etwa Kolleginnen – darüber zu sprechen.
«Dass Menschen sexuelle Wesen sind, ist etwas völlig Natürliches und auch etwas Schönes», sagt Bellotto. «Die Frage ist nur, ob es sich beim Sex und bei Pornos um ein entspanntes, tief befriedigendes Gefühl oder um ein vordergründiges körperliches Abreagieren handelt.» Schreibt ZentralPlus.
Es fällt auf, dass ZentralPlus seit einiger Zeit mit einem Mix von Corona-Pandemie, menschlichen Abgründen aus der Schublade Sex / Drogen und entsprechender Beratung durch Experten*innen auf der Jagd nach Clickbaiting ist.
Allzeit rund um die Uhr verfügbare Pornos und Sex-Chats jeglicher Fantasiegelüste gehören zur schönen neuen und digitalen Welt wie das Weihwasser in der Kirche seit es Internet gibt.
Dabei spielen nicht nur Pornhub & Co. eine grosse Rolle, sondern auch Sozial Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Telegram und wie sie alle heissen, wo vermutlich mehr Homemade-Pornovideos zu sehen sind als auf den einschlägigen Porno-Plattformen. Sozial Media-Plattformen, die auch und vor allem von den minderjährigen Kids und Teenagern genutzt werden. Es soll ja noch Eltern geben, die ihrem Nachwuchs gewisse Pornoportale auf dem Handy sperren. Fatalerweise aber Messenger- und Social Media-Portale unberührt lassen.
Dass Pornhub mit einem Presseaussand darauf aufmerksam macht, dass der Pornokonsum auf Pornhub 2020 um 20 Prozent gestiegen sei, ist nichts anderes als ein medienwirksamer Marketing-Gag in eigener Sache, der von den den willfährigen Medien ungeprüft und unkommentiert als Gratisreklame für Pornhub weiterverbreitet wird.
Dass die üblichen Verdächtigen, die vermutlich noch nie in ihrem Leben ein Buch gelesen haben, während Kurzarbeit und der damit verbundenen Langeweile noch häufiger ihrem Lieblingsvergnügen nachgehen, ist eigentlich nur logisch. Dafür braucht es keine Bestätigung von einem Porno-Portal.
Der ZentralPlus-Artikel verknüpft alles mit allem. «Viele Männer hätten Schwierigkeiten, überhaupt mit Frauen in Kontakt zu kommen. Sie seien unsicher, wie sie eine Frau ansprechen können», steht da geschrieben. Das hat mehr oder weniger mit Corona rein gar nichts zu tun. Wer unter erschwerten Bedingungen der Kontaktaufnahme während einer Pandemie mit dem anderen Geschlecht nicht genügend Kreativität aufbringt, der/die/das wird auch in ganz normalen Zeiten mit dem gleichen Problem konfrontiert sein.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.4.2021 - Tag der Verwechslung
140 Patienten in Frankreich vergebens «geimpft»
Durch ein Versehen sind in Frankreich dutzende Patienten mit Kochsalzlösung statt dem Corona Vakzin von Pfizer/Biontech «geimpft» worden. Insgesamt 140 Patienten hätten die wirkungslose Injektion erhalten, erklärte das Spital von Reims im Nordosten des Landes am Samstag.
Zwar habe dies für die Betroffenen keine gesundheitlichen Folgen, doch müssten sie nun erneut zur Impfung antreten. Kochsalzlösung wird unter anderem als Verdünnungsmittel bei Injektionen eingesetzt.
Die Klinik nahm nach eigenen Angaben eine Untersuchung zu den Ursachen für den Irrtum vor. Eine Mitarbeiterin sei damit beauftragt worden, die Sicherheitsverfahren bei den Corona-Impfungen zu verstärken. Schreibt SRF im Corona-Liveticker.
Kann schon mal passieren, dass man in der Hitze des Impf-Gefechts Absinth mit Kochsalzlösung verwechselt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.4.2021 - Tag der Attentäter
Polizeimitarbeiterin in Polizeiwache nahe Paris erstochen
Nach einer tödlichen Messerattacke auf einer Polizeiwache in Rambouillet bei Paris hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Ein Angreifer hatte am Freitag eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe von Paris mit einem Messer ermordet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, man werde im Kampf gegen den islamistischen Terror nicht aufgeben.
Die Frau wurde ersten Erkenntnissen nach von dem Mann am Kommissariat in Rambouillet hinterrücks angegriffen und Berichten nach mit dem Messer an der Kehle attackiert. Sie starb noch am Tatort. Der Angreifer, nach Medienberichten ein Mann aus Tunesien, wurde von der Polizei erschossen. Aus dem Umfeld des Tatverdächtigen wurden drei Menschen festgenommen und in Gewahrsam genommen. Ermittler durchsuchten zwei Wohnungen.
Terrorserie
Die Tat weckt in Frankreich Erinnerungen an zahlreiche ähnliche Terrorangriffe in den vergangenen Jahren. Das Land wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert – dabei starben mehr als 250 Menschen. Im Oktober wurde ganz in der Nähe der Lehrer Samuel Paty von einem Islamisten auf offener Straße ermordet – er wurde enthauptet. Die Tat hatte international großes Entsetzen ausgelöst. Kurze Zeit später schlug ein Angreifer in einer Kirche in Nizza zu und tötete dort drei Menschen mit einem Messer. Es gibt auch immer wieder brutale Angriffe islamistischer Extremisten auf die Polizei.
Der Ablauf der Tat und die Äußerungen des Täters seien Gründe, warum die Anti-Terror-Ermittler übernommen hätten, sagte Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-François Ricard am Tatort. Die Frau sei "feige" ermordet worden. Ricard nannte keine Details. Medien zufolge soll der Frau die Kehle durchgeschnitten worden seien. Dabei habe der Mörder "Allahu Akbar" geschrien. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann aus Tunesien handeln, der den Behörden zuvor nicht bekannt war. Er soll etwa 36 Jahre alt gewesen sein.
Erinnerungen an Samuel Paty
Premierminister Jean Castex eilte nach der Tat sofort zum Tatort. Er erinnerte an brutale Anschläge im Pariser Umland wie den Mord an Samuel Paty. "Ich möchte allen Franzosen sagen, dass unsere Entschlossenheit, gegen alle Formen des Terrorismus zu kämpfen, intakt ist", sagte er. Die Republik habe eine Heldin des Alltags durch einen barbarischen Akt unendlicher Feigheit verloren.
Die Anti-Terror-Fahnder ermitteln nun unter anderem wegen Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben. Medien berichteten, dass die Frau beim Betreten des Kommissariats von dem Angreifer überrascht worden sei. Die Tat soll sich im Eingangsbereich ereignet haben, die Mutter zweier Kinder war gerade von ihrer Pause zurückgekommen. Sie war demnach etwa 49 Jahre alt und hat seit Jahren in dem Kommissariat gearbeitet. Jérome Moisant von der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police sagte dem Sender Franceinfo, dass die getötete Kollegin in der Verwaltung gearbeitet habe. Der Angreifer habe sich zuvor vor der Wache auffällig aufgehalten.
Der Sender BFM TV berichtete, dass der Angreifer vor der Tat ein jihadistisches Video auf seinem Telefon geschaut haben soll. Innenminister Gerald Darmanin wies unterdessen die Präfekten im Land an, die Sicherheit rund um Polizeistationen zu verstärken. Sie sollen die Wachsamkeit und die Sicherheitsmaßnahmen in insbesondere an den Eingangsbereichen erhöhen.
Die immer gleichen Schrecken
Die Tat löste in Frankreich heftige Reaktionen aus. Die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen kommentierte auf Twitter, dass immer die gleichen Schrecken aufeinander folgten. Es seien immer die "gleichen islamistischen Motive". Sie warf der Regierung vor, bei Sicherheitsfragen zu lax zu sein. Die Präsidentin der Hauptstadtregion, Valérie Pécresse, sprach von einem "barbarischen" Angriff.
Die Police National schrieb von "unermesslichem Schmerz". "Unsere Kollegin Stéphanie M. wurde in der Polizeistation von Rambouillet feige ermordet", hieß es.
Auch international löste die Tat Betroffenheit aus. "Dem französischen Volk und seinen Sicherheitskräften spreche ich die volle Solidarität Europas in dieser Tragödie aus", schrieb etwa EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter.
Immer wieder gibt es in Frankreich Angriffe auf die Polizei. Im Herbst 2019 tötete etwa ein Angestellter im Polizeihauptquartier in Paris vier seiner Kollegen mit einem Messer. Die Ermittler gehen von einem Terrorhintergrund aus. 2017 tötete ein Mann auf der Pariser Nobelstraße Champs-Élysées einen Beamten und verletzte zwei weitere. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Im Jahr 2016 wurden ein Polizist und seine Lebensgefährtin in Magnanville westlich von Paris von einem Mann erstochen worden. Der Täter hatte sich zuvor ebenfalls zum IS bekannt. Frankreichs Mitte-Regierung will mit einem neuen Sicherheitsgesetz mehr Schutz für die Ordnungskräfte im Land bieten. Schreibt DER STANDARD.
Warum treffen die Terroranschläge immer wieder Frankreich? Frankreich erntet die Früchte seiner Kolonialpolitik. Es wird sehr oft vergessen, dass Frankreich im 19. Jahrhundert die zweitgrösste Kolonialmacht der Welt war.
Vorschnell werden die französischen Terroranschläge – in der Regel durch Muslime ausgeführt – von den französischen Politikern*innen als «islamistischer Anschlag» deklariert. Das trifft allerdings in den meisten Fällen nicht den eigentlichen Kern des Tatmotivs und verschleiert das jahrzehntelange Versagen der französischen Politik.
Jeder Terrorist hat eine Vorgeschichte, die am Schluss meistens mit einem Messer, einer Kalaschnikow oder gar mit einer selbstgebastelten Bombe und einem «Allahu akbar» in einem Blutbad endet. An dieser Vorgeschichte sind die jeweiligen Behörden nicht unschuldig.
Trabantenstädte wie zum Beispiel die Cité «Banlieue» in Paris entwickelten sich zu «Cités» des sozialen Abstiegs durch einen extrem hohen Anteil an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, darunter überproportional viele Einwanderer aus den ehemaligen arabischen und afrikanischen Kolonien wie beispielsweise Algerien.
Eine Cité «Banlieue» hätte aber in der heutigen Form gar nie entstehen dürfen. Solche Cités sind die Brutstätten von Verlierern und soziale Brennpunkte mit Problemen wie extrem überproportional hoher Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Drogenkonsum. Nicht nur in Frankreich; auch Belgien lässt grüssen. Selbst eine pittoreske Stadt wie Luzern kennt mit der «Baselstrasse» ein solches «Problemviertel», das sich durch eine hohe Kriminalitätsrate, Drogen an jeder Ecke und Messerstechereien artikuliert.
Kein Mensch wird als Terrorist geboren. Es handelt sich bei den Einzel-Attentätern durchs Band weg um «Loser», die den sozialen Aufstieg verpasst haben. Hinzu kommt eine eklatante Bildungsferne, die letztendlich nur noch den Konsum einschlägiger Handy-Plattformen mit den entsprechenden Videos zulässt, die selbst ein arabischer Analphabet versteht. Dass bei dieser sozialen Tragödie und der Alltags-Misere des Lebens der Islam die letzte Zuflucht darstellt, ist leider die Konsequenz behördlichen Versagens. No-go-Areas und Analphabeten fallen nämlich nicht vom Himmel.
Wer Migranten*innen bei sich in seinem Land aufnimmt, hat die Pflicht, für entsprechend konsequente Bildung, Ausbildung und last but not least für die professionelle Betreuung auffälliger Problemfälle zu sorgen. Selbst wenn das eine Menge Geld kostet. Das dürfte vermutlich immer noch günstiger als lebenslängliche Sozialhilfe sein.
Wer A sagt, muss auch B sagen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.4.2021 - Tag der Seuchenvögel
Impfschutz vor Coronavirus: Wie ansteckend sind Geimpfte?
Die Corona-Massnahmen sollen auf den Sommer hin gemäss dem Plan des Bundes schrittweise aufgehoben werden. Umso wichtiger wird dann die Frage sein, wie gut die Impfungen wirken. Können Geimpfte das Virus noch weitergeben oder nicht – und allenfalls Ungeimpfte anstecken?
Grossbritannien hat sehr früh die Weichen gestellt, um die Pandemie wissenschaftlich zu begleiten. Nach dem Zufallsprinzip wurden Hunderttausende von Menschen für eine Corona-Langzeitstudie ausgewählt. Diese Daten zeigen jetzt, wie sich das Virus in der breiten Bevölkerung verhält.
Ein Aspekt der Studie ist der Impfschutz. Die neuesten Daten zeigen: Nur ganz wenige Personen mit einer vollständigen zweifachen Impfung mit Pfizer/Biontech haben eine Infektion mit Symptomen. Der mRNA-Impfstoff schützt mit 90 Prozent sehr gut und das liegt nahe bei den 95 Prozent aus den grossen klinischen Zulassungsstudien der Impfhersteller.
Das schlechtere Abschneiden in Grossbritannien erklären sich die Forschenden mit dem höheren Alter der Probandinnen und Probanden. Doch weil die britische Studie alle Freiwilligen regelmässig testet, egal ob sie sich gesund oder krank fühlen, können so auch sogenannte asymptomatische Personen gefunden werden.
Asymptomatische Personen rücken in den Fokus
Die Forscher haben festgestellt: Asymptomatisch Infizierte gibt es auch unter den geimpften Personen. Nimmt man auch diese Fälle dazu, beträgt der Impfschutz nur noch 70 Prozent. Das heisst, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sich trotz vollständiger Impfung nochmals anstecken, ohne es zu merken.
Was schon länger befürchtet wurde, konnte jetzt bestätigt werden. Immerhin hatten diese symptomatische infizierten Personen meist nur wenig Viren in Nase und Rachen. Sie sind also potenziell wenig oder nicht ansteckend. Es ist aber keine vollständige Entwarnung, denn die Forschenden fanden auch geimpften Personen mit vielen Viren, die wohl durchaus andere noch anstecken können. Für ungeschützte Personen könnte das dereinst noch zum Problem werden. Schreibt SRF.
Wir werden wohl oder übel auch in Zukunft noch längere Zeit mit Corona leben müssen.
Seuchenvögel bleiben Seuchenvögel.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.4.2021 - Tag der brasilianischen Huren
Sex-Betriebe durften über Nacht öffnen, Prostituierte sind überrumpelt: Luzern kam sogar den Puffs zu schnell
Der Kantönligeist zwang die Luzerner Sexarbeiterinnen zu ausserkantonalem Verkehr. Sechs Monate Corona-Sexverbot. Seit Mittwoch dürfen sie auch in Luzern wieder arbeiten. Wegen der spontanen Ankündigung haben die Bordelle aber ein echtes Frauenproblem.
Im Bordell Penthouse 9 rumpelt es rhythmisch aus dem hinteren Teil des Clubs. «Die Waschmaschine hat Standschäden», sagt der Luzerner Puffkönig André B.* (40) entschuldigend. «Wir müssen sie ersetzen.» Sechs Monate lief sie nicht mehr – auch sonst war tote Hose. Im Kanton Luzern waren die Sexclubs wegen des Lockdowns seit dem 24. Oktober zwangsgeschlossen. Doch seit Mittwoch dürfen sie wieder Freier empfangen. Dementsprechend kommt nicht nur die Waschmaschine wieder auf Touren.
Frauen verzweifelt gesucht
«Die Kunden wissen noch gar nicht richtig, ob es schon wieder losgeht», sagt die Prostituierte Aleksandra (27). «Ich hoffe, sie kommen bald. Wir haben viel aufzuholen. Das halbe Jahr war schwierig.» Um trotz Sexbusiness-Verbot Geld zu verdienen, musste die Rumänin in andere Kantone ausweichen. «Ich arbeitete in einem Saunaclub in Bern und in einem Club in der Ostschweiz. Zum Glück habe ich auch noch einen Sugar-Daddy», sagt sie schmunzelnd.
Chef André B. klagt: «Ich hatte gerade mal zwölf Stunden Zeit, um für die Eröffnung Frauen zu finden. «Zum Glück arbeiten die Frauen schon seit Jahren gerne bei mir und sind zufrieden. Da waren sie auch sofort bereit, wieder in meinen Club zu wechseln.» Als er mit einem Branchen-Kollegen telefoniert, ist das Thema Frauen auch gleich das Thema Nummer eins. Brennendste Frage: «Kennst du noch eine für mich?» Unbefriedigende Antwort: «Nein, nein, von meinen kannst du keine abwerben.»
Bordelle in den «falschen» Kantonen
Der Bordellbetreiber ärgert sich über den Kanton und fragt: «Was nützt eine Bordellschliessung, wenn in den Kantonen ringsherum alles erlaubt ist? Frauen und Freier ziehen einfach über die Grenze. Weniger Sex wird darum nicht verkauft.» Und: «Die Pandemie wurde so nicht eingedämmt!»
André B. hat mit seinen Standorten viel Pech. Er hat zwar ein gutes Dutzend Clubs, aber alle liegen in Kantonen mit harten Sex-Massnahmen: Zürich, Luzern und Solothurn. Für die Angestellten im Backoffice oder am Empfang konnte er Kurzarbeit einführen. Für die Sexarbeiterinnen ging das nicht, sie gelten als Selbständigerwerbende. Er beantragte auch keinen Corona-Kredit oder Härtefall-Gelder. «Ich habe von Rückstellungen und Business in anderen Bereichen gelebt», so der Unternehmer.
Nur Zürich bleibt noch hart
Ob und wie es mittelfristig mit dem Sexbusiness während der Pandemie weitergeht, ist unsicher. Im Moment sind nur noch die Clubs im Kanton Zürich geschlossen. Die Limmatstadt muss aber vermutlich wohl oder übel bald nachziehen. Oder alle schliessen wieder, wenn die Corona-Zahlen nicht endlich mal schlappmachen. Schreibt Blick.
«Luzern war der Menschheit schon immer einen Schritt voraus.» Sagte einst der grossartige Philosoph und Psychologe Giuseppe di Malaparte.
Das stimmt.
Jedenfalls wenn es um «Du wolle Figgi Figgi mache?», wie eine umgebaute brasilianische Hure mit ihrer sonoren, leicht männlich klingenden Stimme an der Luzerner Baselstrasse jedem, selbst denen, die es gar nicht wissen wollen und auch nicht im Ständerat sind, unverblümt beim Vorbeigehen zuflüstert.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.4.2021 - Tag des SVP-Sünneli's
Von wegen Tessin!: In Zürich liegt die wahre Sonnenstube der Schweiz
Die Zürcher Kantonalbank hat erstmals schweizweit alle Sonnenuntergangszeiten berechnet. Dazu hat ein Hochleistungsrechner die Simulation für 100 Millionen Punkte durchgeführt. Das Ergebnis überrascht. Und kann für den Wert einer Immobilie entscheidend sein.
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig ein trautes Eigenheim bei Homeoffice und Lockdown sein kann. Genug Platz, eine entspannte Nachbarschaft und vor allem viel Sonne. «Wer schätzt es nicht, die letzten Sonnenstrahlen des Tages auf der eigenen Terrasse geniessen zu können?», sagt Ursina Kubli (41), Immobilien-Expertin bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Schweizer schätzen dieses Privileg. Und sind auch entsprechend bereit, für gut besonntes Wohneigentum tiefer in die Tasche zu greifen.
Immo-Verkäufer wissen: Abendsonne ist eines der wichtigsten Argumente für ein Haus oder eine Wohnung. Gerade Südwest-Hanglagen versprechen einen späten Sonnenuntergang. Kommt noch eine gute Aussicht dazu – wenn möglich mit Seesicht –, dann bewegt man sich im Reich der besonders exklusiven Wohnlagen. An solchen Lagen wird entsprechend auch mit grosser Kelle angerührt.
Im Sommer bis 20 Uhr Sonne
Viele Regionen haben ihren bekannten Sonnenhügel. Im Tessin, der Sonnenstube der Schweiz, heisst eine Gemeinde Collina d'Oro, übersetzt Goldhügel. Sie liegt am Sonnenhügel ob Lugano. Die Sicht auf den Luganersee ist beeindruckend. Am Zürichsee ist es die Goldküste, an der die gesuchtesten Wohnlagen im warmen Abendlicht erstrahlen.
Das Immo-Team von Ursina Kubli hat darum die besonders gut besonnten Wohnlagen aufgespürt. Ein Hochleistungsrechner hat die Simulation für 100 Millionen geografischen Punkte in Bezug auf den längsten und den kürzesten Tag des Jahres durchgeführt.
In den Sommermonaten scheint die Sonne in weiten Teilen der Schweiz relativ lang. 84 Prozent der Wohnungen haben am 21. Juni selbst um 20 Uhr noch Sonne.
Südwesthänge haben es in sich
Entscheidend ist an diesen Lagen aber der Winter. Also die Jahreszeit, in der man sich nach Licht und Wärme sehnt. Es gibt viele Wohnlagen, in denen die Sonne ausgerechnet dann äusserst rar ist. Gerade in engen Bergtälern verschwindet sie kurz nach dem Mittag.
Und doch: Auch in den Bergen gibt es sonnige Wohnlagen. Bevorteilt sind Liegenschaften an den Südwesthängen weiter Täler. Gut sichtbar sei das etwa auf der Nordseite des Rhonetals, wo sich die Hänge in Richtung Sonne neigen.
Wie sieht es im Mittelland aus, wo zwei Drittel der Bevölkerung leben? Vom Genferseebogen bis nach St. Gallen zieht sich ein breites orangerotes Band. Es zeigt auf, dass die Sonne hier am Winterabend besonders lang scheint.
Grosse Unterschiede im Mittelland
Aber: Auch im Mittelland gibt es grosse Unterschiede. Grund dafür sind die vielen Hügel und Bergzüge. So auch in den Grossstädten. Am Genfersee scheint die Sonne besonders lang. Genf und Lausanne stehen ganz weit vorne, wenns um den Sonnenschein geht.
Auch in Biel BE scheint die Sonne entlang des Jurasüdfusses im Winter noch lange ungehindert über die Uhrenmetropole. Nördlich des Juras erwärmt sie das Gemüt der Basler. Genfer, Berner und Basler geniessen im Durchschnitt bis zu 30 Minuten länger Sonne als Stadtzürcher.
Deren Pech: Die Ausläufer des Uetlibergs stehen ihnen vor der Sonne. Die Folge: Die Stadt Zürich schneidet im Vergleich mit anderen Grossstädten zumindest in den Wintermonaten schlecht ab, was das Sonnenlicht anbelangt. Ähnlich geht es den Luzernern. Am Vierwaldstättersee geht die Sonne noch eine halbe Stunde früher hinter dem Pilatus unter.
Sonne und tiefe Steuern
Wer die Kombination von sonnige Lagen, Stadtnähe und tiefen Steuern sucht, der kommt in Uitikon ZH auf seine Rechnung. Oder am Goldhügel von Lieli AG. Zumikon, Zollikon und Küsnacht an der Zürcher Goldküste werden bis 16.20 Uhr von der Sonne verwöhnt. Den spätesten Sonnenuntergang hat man aber in Benken ZH, Truttikon ZH und Rafz ZH. Die Dörfer bieten auch im Winter Sonnenschein bis 16.40 Uhr. Das Zürcher Weinland ist also die eigentliche Sonnenstube der Schweiz.
Und erst noch deutlich günstiger als die Region Pfannenstiel, wo Küsnacht, Zumikon und Zollikon liegen. Laut dem Immobilien-Marktbericht von Wüest Partner kostet dort eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung 1'296'000 Franken, ein 4-Zimmer-Einfamilienhaus deren 1'282'00 Franken.
Im Weinland stehen die Preise bei 692'000 Franken für eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung. Ein 4-Zimmer-Einfamilienhaus gibt es für 631'000 Franken. Schreibt Blick.
Das Zürcher Sonnenresultat ist sicher auf «das SVP-Sünneli» zurückzuführen, das angeblich für alle scheint, wie Christoph Mörgeli einmal in einem Talk erwähnte.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.4.2021 - Tag der Schweizer Gesundheitskommission
Schweizer Politiker drängen auf Zulassung von AstraZeneca-Impfstoff
Experten gehen davon aus, dass der Impfstoff Vaxzevria mehr Vorteile als mögliche Risiken mit sich bringt. Nationalräte wollen das Vakzin bei einer Zulassung schnell verfügbar machen.
Hirnthrombosen und Blutplättchenmangel: Seit AstraZeneca unter dem Verdacht schwerer Nebenwirkungen steht, haben verschiedene Länder den Impfstoff ausgesetzt. Nun mehren sich jedoch Stimmen aus der Wissenschaft, die das Vakzin, das unter dem Namen Vaxzevria vermarktet wird, als zuverlässigen Schutz gegen eine schwere Covid-Erkrankung einschätzen. Viele Wissenschaftler sind sich einig: Die Gefahr, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist im Vergleich zu möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffs Vaxzevria höher.
In der Schweiz ist das Vakzin noch nicht zugelassen, Swissmedic wartet noch zu. Bestellt hat der Bund davon rund fünf Millionen Dosen. Laut dem Hersteller könnten diese rasch nach der Zulassung geliefert werden. Geht es nach Politikern, darf die Schweiz bei der Zulassung nicht mehr unnötig Zeit verlieren.
«Studien prioritär vorantreiben»
Es sei wichtig, dass die Schweiz so viel Impfstoff wie möglich generiere und die Impfkapazität erhöhe, sagt der Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy. Derzeit zeigt sich, dass das bereits einmal korrigierte Impfziel von Alain Berset – alle Willigen sind bis Ende Juli geimpft – in einigen Kantonen auf der Kippe steht. Hinzu kommen Lieferengpässe wie jüngst beim Vakzin von Moderna.
«Swissmedic muss die Studien, die für eine Zulassung oder Nicht-Zulassung von AstraZeneca entscheidend sind, prioritär vorantreiben», sagt Bregy. Sobald die Studien da seien, gelte es, keine Zeit mehr zu verlieren. «Vielleicht sind für Swissmedic ein paar Überstunden nötig – Hauptsache ist, dass die Bevölkerung raschestmöglich mit welchen Impfstoffen auch immer geimpft werden kann.»
Bevölkerung müsse aufgeklärt werden
Bregy würde sich auch wünschen, dass das BAG die in den letzten Wochen entstandenen Zweifel am Impfstoff thematisiert und richtig stellt. «Es ist wichtig, die Bevölkerung aufzuklären, damit sich möglichst viele impfen lassen.» In Deutschland haben sich Kanzlerin Angela Merkel sowie der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach öffentlichkeitswirksam mit AstraZeneca impfen lassen.
«Je mehr Impfstoff wir verfügbar haben, desto schneller können wir in die Normalität zurückkehren», sagt auch FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Sobald sich ein neuer Impfstoff als wirksam und sicher herausgestellt habe, müsse die Schweiz diesen zulassen.
Auch Ruth Humbel (Die Mitte), Präsidentin der nationalrätlichen Gesundheitskommission, sagt: «Es ist klar: Sobald sich erwiesen hat, dass das gesundheitliche Risiko einer Impfung kleiner ist als jenes einer Nicht-Impfung, muss das Vakzin zugelassen werden.» Sie gehe davon aus, dass die Arzneimittelbehörde Swissmedic diese Fragen vertieft abkläre.
Impfstoff sei keine Zigarettenmarke
GLP-Nationalrat Martin Bäumle warnt hingegen vor zu viel Druck auf die Zulassung von Vaxzevria. «Impfen ist auch ein Solidaritätsakt und muss sicher sein.» Die Wahl eines Impfstoffs sei nicht mit dem Konsum einer bestimmten Zigarettenmarke oder Antibabypille vergleichbar. «Mit einer Impfung wollen insbesondere Jüngere, die Covid nicht als Risiko sehen, kaum Gesundheitsrisiken in Kauf nehmen.» Es sei deshalb essentiell, dass Swissmedic für den Impfstoff vom Hersteller die erforderlichen Datengrundlagen erhalte.
Auch SVP-Nationalrat Thomas Aeschi vermutet: «Swissmedic wird ihre Gründe haben, weshalb die AstraZeneca Impfung noch nicht zugelassen ist.» Jeder solle möglichst bald seinen Impfstoff frei wählen können. «So trägt jeder selbst die Verantwortung, falls vielleicht später langfristige Folgeschäden bei einem Impfstoff entdeckt werden.»
Swissmedic wartet auf Daten
Swissmedic-Mediensprecher Lukas Jaggi bestätigt, dass die Datengrundlage für den Impfstoff von AstraZeneca zurzeit unvollständig ist. «Wir warten noch auf Daten aus einer in Nord- und Südamerika laufenden Zulassungsstudie.» Wann diese vorliegen würden, sei zurzeit unbekannt. Gemäss amerikanischen Medienberichten will die Firma die Studiendaten bei der US-Arzneimittelbehörde bis Ende April einreichen.
Sobald Swissmedic die kritische Masse an Daten hat, kann die Behörde laut Jaggi sehr schnell entscheiden. «Dank der laufenden Begutachtung ist ein Entscheid innerhalb von wenigen Tagen möglich.» Schreibt 20Minuten.
Während etliche Staaten wie Südafrika oder Dänemark die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff komplett eingestellt haben und die eingekauften Impfdosen gar auf dem Müll entsorgen (Dänemark), weil man sie zu Recht nicht einmal gratis Drittländern zur Verfügung stellen will, werben die üblichen Verdächtigen aus der schweizerischen Pharma- und Gesundheitslobby wie die unsägliche Ruth Humbel (Die Mitte), Präsidentin der nationalrätlichen Gesundheitskommission, für die Zulassung des Desaster-Impfstoffs in der Schweiz.
Trotzdem die EU den Export des AstraZeneca-Impfstoffs komplett gestoppt hat, nehmen ein paar vermutlich nimmersatte* Politiker*innen, vorwiegend aus «bürgerlichen» Parteien wie «Die Mitte» (ehemals CVP) und FDP, in einer menschenverachtenden Güterabwägung den Tod von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern in Kauf. Ob das mit Kickback seitens der im Schweizer Parlament bestens vernetzten Herstellerfirma von AstraZeneca zusammenhängt, sei dahingestellt.
* Es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.4.2021 - Tag der Schweizer Lachnummer-Apps
«Völlig unbrauchbar», «Schrott», «Rückschritt»: Neue Postfinance-App erntet vernichtende Kritik
Die neue Postfinance-App fällt bei den Nutzern durch. Die Postfinance sitzt den Shitstorm aus, verspricht aber auch leichte Nachbesserungen bis zum Herbst. Derweil stehen über 10'000 User vor einem neuen Problem.
Seit knapp über einem Monat kämpft die Postfinance gegen einen Sturm der Entrüstung. Grund ist die neue App. Die Nutzer beschweren sich über fehlende Funktionen, über das Design, eigentlich über alles. «Völlig unbrauchbar», urteilt ein Postfinance-Kunde. «Die App ist Schrott», lautet sein Fazit. Hunderte teilen seine Meinung.
Die Bewertung im App Store von Google und Apple ist vernichtend. Bei Google gibt es 1,6 von 5 Punkten – bei über 18'000 Bewertungen. Knapp über zwei von fünf Sternen sind es bei Apple. Zum Vergleich: Die Credit Suisse, die in den letzten Wochen wegen anderer Verfehlungen stark in der Kritik stand, hat zumindest mit dem neuen CSX-Konto einen guten Wurf gelandet. Die Bewertung: über 4 Sterne – in beiden Stores.
Die Postfinance-User machten ihrem Ärger gleich nach dem Launch Anfang März Luft. Der April brachte keine Besserung, nur noch mehr Wut. «Ein enormer Rückschritt» sei die App, heisst es. «Zum Glück habe ich letztes Jahr die privaten Konten zur UBS verschoben», schreibt ein anderer. «Kein Wunder, entlädt sich der Zorn der Nutzer», schreibt ein weiterer. «Man lässt ein halb fertiges Produkt auf die Kundschaft los – und bessert dann aufgrund des Feedbacks nach.»
Alte Apple-Geräte ohne Support
700'000 aktive App-Nutzer hat Postfinance laut eigenen Angaben. Viele wünschen sich die vorherige App zurück. Diese wird aber im Mai abgeschaltet. Daran ändert auch der Shitstorm nichts. Rund 10'000 Kunden müssen sich nun ein neues Handy besorgen, wenn sie die Rechnung weiterhin mit dem Smartphone begleichen wollen. Die Postfinance setzt bei Geräten von Apple das Betriebssystem iOS 13.3 voraus. Wer ein iPhone 6, ein iPhone 6 Plus oder ein älteres Modell besitzt, schaut in die Röhre.
Postfinance verspricht zumindest, die Reaktionen «sehr ernst» zu nehmen. «Wir entwickeln unsere App laufend weiter und beziehen dabei die Rückmeldungen mit ein. Eine Vielzahl der aktuell noch fehlenden Funktionen werden wir mit mehreren Updates bis voraussichtlich im Herbst 2021 einführen», sagt Sprecherin Tatjana Guggisberg.
Postfinance hofft ausserdem darauf, dass die Nutzer mit dem neuen Design noch warm werden. «Wie bei allen Veränderungen braucht es zu Beginn Zeit, um sich an das neue Erscheinungsbild zu gewöhnen», sagt Guggisberg. Man sei überzeugt, dass die neue App die Abwicklung der eigenen Finanzgeschäfte schneller und einfacher mache.
Schamlose Android-Nutzer
Die Kritiker in den App Stores sehen das anders. «Alles langsam und träge», lautet ihr Urteil. «Da schläft dir das Gesicht ein», heisst es. «Selbst nach zwei Wochen gewöhnt man sich nicht an die App.» Und wieder die Drohung: «Eigentlich müsste ich mit meinem Geld zu einer anderen Bank.»
Nutzer des Google-Betriebssystems Android zeigen sich besonders hemmungslos. Guggisberg erklärt das Verdikt damit, dass Android-Nutzer «generell aktiver und kritischer bewerten. So erhalten wir im Google Play Store fast doppelt so viele Rezensionen wie im Apple App Store. Möglicherweise hängt dies mit dem stärkeren Community-Gedanken der Open-Source-Lösung Android oder der User-Struktur entsprechender Betriebssysteme zusammen.»
Immerhin: Die Drohung der User, das Geld abzuziehen, bleibt oft Geschwätz. Das App-Fiasko zieht keinen Exodus nach sich, obwohl praktisch zeitgleich auch noch die Gebühren geändert wurden. 60 Franken zahlen Postfinance-Kunden in Zukunft extra, wenn sie eine Papierrechnung haben wollen. Zusätzlich zu den 60 Franken Kontoführungsgebühren. Schreibt Blick.
Das haben Apps, die in der Schweiz programmiert werden, so an sich, dass sie mehr oder weniger Schrott sind. Siehe Schweizer Corona-App – die millionenteure Lachnummer schlechthin.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
18.4.2021 - Tag des Polizeibashings
Aargauer Polizei geht gezielt gegen Ausländer vor
Gemäss einem Bericht der «Sonntagszeitung» kommt es im Kanton Aargau vielfach zu Festnahmen, denen eine gesetzliche Grundlage fehlt.
Ein einschlägiger Dienstbefehl der Aargauer Kantonspolizei nimmt mutmassliche Kriminaltouristen ins Visier. Ein Gutachten, das unter anderem zehn Fälle von Festnahmen untersucht hat, kommt laut «SonntagsZeitung» zum Schluss, dass die gesetzlichen Bestimmungen häufig nicht eingehalten würden. Schon ein Schraubenzieher in einem kontrollierten Auto mit osteuropäischem Nummernschild reichte offenbar aus, damit die Insassen des Einbruchsdiebstahls beschuldigt wurden.
Aber auch in Fällen, die Personen mit Wohnsitz in der Schweiz betrafen, hat die Aargauer Kantonspolizei Wildwest-Methoden angewendet. So urteilt das Aargauer Obergericht, dass ein 24-Jähriger einer in der Bundesverfassung ausdrücklich verbotener «erniedrigenden Behandlung» ausgesetzt worden sei. Seit mehr als eineinhalb Jahren wartet das mutmassliche Opfer nun, dass die verantwortlichen Beamten Rechenschaft ablegen müssen. Schreibt 20Minuten.
Nichts ist einfacher als Polizei-Bashing. Es sind meistens die gleichen Schreiberlinge, die der Aargauer Polizei Nichtstun vorwerfen, wenn – wie letztes Jahr passiert – innert einer Woche drei Einbrüche im Kanton Aargau stattfinden.
Aber im Gegensatz zu Journalisten muss sich die Polizei für gemachte Fehler vor Gericht verantworten, während die Presse sich für nachträglich aufgedeckte und erwiesene «Fake»-Meldungen nicht einmal entschuldigt.
Dass den meisten Schweizer Polizeikorps die politische Unterstützung fehlt, ist eine altbekannte Tatsache. Zusammen mit dem Polizei-Bashing in den Medien ein gefährlicher Mix. Wohin dieser Mix führen kann, zeigt sich beispielsweise in der Stadt Luzern, die innert einem Jahrzehnt nach Zürich zum Drogenhotspot Nummer zwei im Schweizer Ranking aufstieg.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.4.2021 - Tag der Parkbussen
Erotik-Betriebe im Kanton Aargau dürfen wieder öffnen
Im Kanton Aargau dürfen Erotik-Betriebe ab Montag wieder öffnen. Noch nicht erlaubt ist ihnen, in den Innenräumen eine Gastronomie anzubieten und Wellness-Einrichtungen in Betrieb zu nehmen.
Die Schliessung von Bordell- und Erotik-Betrieben, Cabarets, Etablissements, Sex-, Strip- und Saunaclubs war am 18. Dezember 2020 beschlossen worden. Die entsprechende Verfügung laufe nun per 19. April aus und werde nicht verlängert, teilte der Kanton Aargau am Freitag mit.
Der Kantonsärztliche Dienst erachtet es demnach wegen der Lockerungen des Bundesrats und wegen der schwierigen Situation der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter als gerechtfertigt, den Erotik- und Sexbetrieben und insbesondere den dort Arbeitenden eine Perspektive zu geben. Es müssten aber strikte Schutzmassnahmen berücksichtigt werden.
Auch der Regierungsrat von Solothurn hat das kantonale Verbot für Erotik- und Sexbetriebe inzwischen aufgehoben. Künftig ist in diesem Bereich ausschliesslich das Bundesrecht massgebend. In anderen Kantonen, wie etwa in Zürich, sind die Erotik-Betriebe noch immer zu. Schreibt Blick.
«Endlich, wurde auch Zeit!», werden jetzt die Apologeten der Öffnung aller Öffnungen im Aargau schreien. So müssen die von steifen Gliedern geplagten Aargauer nicht mehr in die Stadt Luzern fahren, wo in einigen Mietkasernen dem Treiben, Reiben, Schlucken und weiss der Teufel was allem noch trotz Corona-Massnahmen im 24-Stunden-Betrieb gefrönt wird. Das beste Stück eines echten Aargauers kennt nun mal keinen Shutdown.
Zwar wurden einige Vertreterinnen vom ältesten Gewerbe der Menschheit, vorwiegend aus Südostasien oder Lateinamerika stammend, von der Luzerner Polizei immer wieder mal für zwei, drei Stunden abgeholt. Ob zur ordentlichen Leibesvisitation auf Drogen, Waffen und sonstige gefährliche Gegenstände oder lediglich zur Kontrolle des wirklichen Geschlechts sei dahingestellt: Etliche Brasilianerinnen, die sich am Fusse des Pilatus sehr grosser Beliebtheit erfreuen, sollen ja in Tat und Wahrheit unbestätigten Gerüchten zufolge Brasilianer mit XXL-Gehänge sein.
Who cares? Sexuelle Dienstleistungen aller Art gehören nun mal zu einer weltoffenen, kosmopolitischen Stadt wie Luzern. Auch und vor allem während einem von den Behörden verfügten Lockdown.
Parkvergehen gehören jedoch nicht zu Luzern. Da kennt die Luzerner Polizei keinen Pardon. Das solltet Ihr, liebe Aargauer in Euren furchtbaren weissen Socken, stets berücksichtigen, sonst werden aus den üblichen hundert Franken schnell mal 140 Franken oder mehr für Euer kurzes Vergnügen in der Leuchtenstadt. Oder im Worst Case-Szenario wird Euer Mercedes, wie kürzlich an der Baselstrasse passiert, mit Ketten an den Rädern blockiert oder gar abgeschleppt. Das wird dann richtig teuer!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.4.2021 - Tag der Speicherkapazität
Ösi-Korruptionsaffäre wird schlüpfrig: 2500 Penis-Fotos auf Handy von Kurz-Intimus
Die österreichische Regierung schlittert von einer Krise in die nächste. Blick erklärt die Zusammenhänge zwischen den jüngsten Korruptionsvorwürfen und Schmuddelbildern auf dem Handy von Kanzler Kurz' bestem Freund.
In Österreich, dem Land der Operette, spielt sich gerade eine der grössten Seifenopern ab, die das Land je erlebt hat. Es geht um Vetterliwirtschaft auf höchster Ebene – und um Schmuddelfotos auf dem Diensthandy eines Intimus von Kanzler Sebastian Kurz (34).
Das Image der Regierung ist einmal mehr schwer angekratzt. Mit Schaudern erinnern sich die Österreicher an das Video der Ibiza-Affäre, die vor zwei Jahren die erste Regierung unter Kurz zu Fall brachte.
Vetterliwirtschaft par excellence
Dieses Mal sind es Chats, die öffentlich gemacht wurden und die zeigen, wie auf höchster Ebene wichtige Posten zugeschanzt werden. Was bei uns Vetterliwirtschaft genannt wird, heisst in Österreich Postenschacher.
Hauptakteure sind Kanzler Kurz und der Ex-Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid (45). Schmid war damit beauftragt worden, alle staatlichen Beteiligungen in der neuen Firma Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) zu vereinen. Damit er sich selbst zum Chef des Unternehmens (Beteiligungen im Wert von 27 Milliarden Euro) machen konnte, wurde die öffentliche Ausschreibung auf ihn zugeschnitten.
Das belegen die veröffentlichten Chatprotokolle, die unter anderem Konversationen zwischen Kurz und Schmid wiedergeben. Kanzler Kurz schrieb Schmid: «Kriegst alles, was du willst», worauf Schmid mit Emojis antwortete: «Ich bin so glücklich :-))), ich liebe meinen Kanzler.»
2500 Penis-Fotos auf Handy entdeckt
Die Korruptionsaffäre hat einen brisanten Nebenschauplatz. Auf Schmids Diensthandy wurden offenbar 2500 schlüpfrige Fotos mit «Beidls» – wienerisch für Penis – gefunden. Losgetreten wurde diese Diskussion von Politaktivist Rudi Fussi (42) auf Twitter. Er postete: «2500 Schwanzpics auf einem Diensthandy. Österreichische Beidldatenbank AG oder was heisst ÖBAG?»
Die Affäre wird inzwischen zu einem Fall für die Justiz. Die Bilder auf Schmids Handy werden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft überprüft. Ermittelt wird auch, wie die Fotos aus der Untersuchungsakte überhaupt geleakt werden konnten. Offenbar gibt es in Österreichs Staatsanwaltschaft undichte Stellen, was wiederum die grüne Justizministerin Alma Zadic (36) in massive Kritik bringt. Schreibt Blick.
Das hat der Thomas Schmid nun von der gewaltigen Speicherkapazität seines Hightech-Handys. Mit einem alten NOKIA wär' ihm das nicht passiert. Da war nach 20 Bildern Schluss.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
15.4.2021 - Tag der kleinen Schritte
Klimaschutz in Frankreich: Abgeordnete stimmen für Verbot von Inlandsflügen entlang von TGV-Strecken
Linienmaschinen sollen innerhalb Frankreichs künftig nur noch Ziele anfliegen dürfen, die mit dem Zug nicht binnen zweieinhalb Stunden zu erreichen sind. Umweltschützer hatten eine strengere Regel gefordert.
Für sein TGV-Netz ist Frankreich weltberühmt, die Parlamentarier des Landes wollen es zum Klimaschutz nun noch stärker einsetzen: Sie haben mehrheitlich für ein Verbot von Inlandsflügen auf Strecken gestimmt, die mit dem Zug in weniger als zweieinhalb Stunden zurückgelegt werden können. Flüge von Paris nach Lyon oder Bordeaux könnten damit schon bald der Vergangenheit angehören.
Finanzminister Bruno Le Maire hatte entsprechende Ideen bereits im Mai 2020 geäußert, als über Staatshilfen für AirFrance-KLM entschieden wurde. Das Votum vom Wochenende greift diese Pläne auf und will dazu beitragen, die CO₂-Emissionen dauerhaft zu senken – auch wenn die Flugreisebranche nach der globalen Pandemie wieder an Fahrt aufnehmen sollte. Das Verbot ist Teil eines umfassenderen Klimagesetzes, mit dem die französischen Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden sollen.
Staat rettet AirFrance-KLM mit weiteren Milliarden
Umweltaktivisten werfen Präsident Emmanuel Macron jedoch vor, dass frühere Versprechen nun verwässert werden. Ein von Macron eingerichtetes Bürger-Klimaforum, das bei der Ausgestaltung der Klimapolitik helfen soll, hatte die Abschaffung von Flügen auf Strecken gefordert, auf denen die Zugfahrt weniger als vier Stunden dauert. Das käme einem Verbot von deutlich mehr Inlandsflügen gleich und hätte etwa auch Flüge in die zweitgrößte Stadt des Landes Marseille betroffen.
Nach der Entscheidung der Nationalversammlung geht der Gesetzentwurf nun an den Senat, bevor eine dritte und letzte Abstimmung im Unterhaus stattfindet.
Die Abstimmung der Nationalversammlung kam nur wenige Tage, nachdem die Regierung angekündigt hatte, sich an einer Rekapitalisierung von Air France in Höhe von vier Milliarden Euro zu beteiligen. Der Staat greift damit der in der Coronakrise durch die Reisebeschränkungen schwer angeschlagenen Fluggesellschaft erneut unter die Arme und vergrößert seinen Anteil an dem Unternehmen auf mehr als das Doppelte.
Luftfahrt dürfte lange unter der Pandemie leiden
Industrieministerin Agnes Pannier-Runacher wies die Kritik aus der Luftfahrtindustrie zurück, dass eine Pandemie-Erholung nicht der richtige Zeitpunkt sei, um Inlandsflüge zu verbieten. Für sie sei es ein Widerspruch, die Airline zu retten und zugleich auch das Klimagesetz zu verabschieden.
»Wir wissen, dass die Luftfahrt ein Verursacher von Kohlendioxid ist und dass wir wegen des Klimawandels die Emissionen reduzieren müssen«, sagte sie dem Radiosender Europe 1. »Ebenso müssen wir unsere Unternehmen unterstützen und dürfen sie nicht auf der Strecke bleiben lassen.«
Auch ohne das Verbot von Inlandsflügen dürfte die Luftfahrt noch lange mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben. Analysten von McKinsey hatten prognostiziert, dass der Flugverkehr nicht vor 2024 wieder das Vorkrisenniveau erreichen werde. In Frankreich, aber auch in Spanien, versuchen Bahnunternehmen zudem mit Kampfpreisen den Billigfliegern Konkurrenz zu machen. Schreibt DER SPIEGEL.
Wenn auch ein kleiner, so ist es dennoch ein vernünftiger und richtiger Schritt. Damit dieser Mini-Schritt Wirkung zeigt und nicht nur zur reinen Symbolpolitik verkommt, sollte die französische Massnahme auf die gesamte EU ausgedehnt werden.
Greta Gössi, die mit ihrer FDP in einem Umfragetief sitzt, sollte das französische Modell sofort ins Parteiprogramm der FDP schreiben und nicht warten bis zu den Wahlen von 2023. Sonst läuft sie Gefahr, wieder eine «Wendehälsin» geschimpft zu werden. Was sie, so nebenbei bemerkt, ja auch tatsächlich ist.
Es gibt, ich glaube da sind wir «Gretas» uns für einmal einig, keine nachvollziehbaren Gründe, um von Zürich nach Genf und Basel zu fliegen oder von Altenrhein nach Innsbruck.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.4.2021 - Tag des Scheiterns
Rückzug aus Afghanistan: Ein Eingeständnis des Scheiterns
Barack Obama wollte es, Donald Trump wollte es, Joe Biden tut es nun: Abziehen aus Afghanistan. Wenn die Amerikaner gehen, ist klar: Die Deutschen, die Briten, die insgesamt gegen 7000 Soldaten aus mehr als einem Dutzend weiterer Nato-Länder werden ihnen folgen.
«Gemeinsam rein, gemeinsam raus», lautete stets das Motto. Und ohne die Amerikaner, die das Rückgrat des Afghanistan-Einsatzes bilden, können die anderen gar nicht bleiben – aus logistischen und aus Sicherheitsgründen.
Mit dem Rückzug wird erstmals klar gesagt: Afghanistan hat für den Westen, für die USA keine strategische Priorität mehr. Zumal grosse Terroranschläge auf westliche Ziele à la 9/11 genauso gut in Syrien, im Jemen, im Sahel, in London, Paris oder, notabene, in New York ausgeheckt und vorbereitet werden können.
Demokratisierung kolossal gescheitert
Von «erfüllter Mission» kann hingegen keine Rede sein. Zwar wurde das ursprüngliche Hauptziel erreicht, nämlich al-Kaida aus dem Land und die radikalislamischen Taliban von der Macht zu vertreiben.
Das Bestreben, aus Afghanistan mit «Nation-Building» ein freiheitliches, demokratisches, stabiles, sicheres und zudem prosperierendes Land zu machen, ist jedoch hochkant gescheitert. Joe Biden sah dieses umfassende Ziel übrigens immer schon skeptisch.
Gewiss: Punktuelle Erfolge gibt es. Millionen von Frauen können inzwischen in Afghanistan wählen. Millionen von Mädchen gehen zur Schule. Vor allem in Städten gibt es mehr wirtschaftliche Perspektiven. Doch auch diese Fortschritte sind nicht in Stein gemeisselt.
Die Uhr lässt sich auch zurückdrehen. Am Hindukusch droht jetzt nämlich die Rückkehr der Taliban an die Macht. Und zwar über freie Wahlen.
Billionen-Kosten – kaum Gegenwert
Es ist also kein ruhmvoller Abgang der USA und der Nato. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Mehr als 2400 Todesopfer und 2.3 Billionen Dollar (also 2300 Milliarden) hat das Afghanistan-Engagement allein die Amerikaner gekostet. Kein Wunder, dass die Bevölkerung in den USA und in vielen Nato-Ländern den Sinn der Sache kaum mehr sieht und ein Ende fordert.
Nun zieht sich der Westen also zurück. Bedingungslos. Bisher wurden stets zwei Voraussetzungen dafür genannt: Die afghanischen Sicherheitskräfte müssten selber imstande sein, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen, bevor man gehe. Und die Taliban müssten mit der demokratisch legitimierten afghanischen Regierung eine Friedens- und Kooperationsvereinbarung schliessen. Beide Bedingungen werden nun fallengelassen. Sang- und klanglos.
Das Ende der Afghanistan-Mission ist damit ein spätes und ein doppeltes Eingeständnis: Man war bisher nicht erfolgreich. Und man glaubt auch in Zukunft nicht an einen Erfolg. Selbst wenn die westlichen Truppen noch zwei, drei, vier oder noch mehr Jahre blieben. Es ist also das Eingeständnis des Scheiterns. Obschon der Rückzug natürlich anders verkauft wird. Schreibt SRF.
Der US-Feldzug im gewohnten Einklang mit der «hehren westlichen Wertegemeinschaft» war nie etwas anderes als ein Rachefeldzug für Nine Eleven und ein Geschenk an die US-Waffenschmieden.
Um den aus Saudi Arabien (!) stammenden Terrorfürst Osama bin Laden und seinen Kumpel Mullah Omar* zu fangen und unschädlich zu machen, hätten auch ein paar Millionen US-Dollar statt Billionen (!) gereicht.
Saddam Hussein wurde letztendlich auch nicht durch den ebenso sinn- wie planlosen Irak-Feldzug in einem Schmutzloch auf einem Bauernhof erwischt, sondern für ein paar Millionen US-Schmiergeld von einem (oder mehreren) Ortsansässigen der Gegend rund um Tikrit an die US-Streitkräfte verraten.
Auch bei der Ermordung des libyschen Diktators Gaddafi soll der US-Geheimdienst laut einer ARTE-Doku mit Greenbacks nachgeholfen haben.
Das US-Dogma «Money rules» führt immer zum Ziel. Auch bei Muslimen. Man muss es nur anwenden.
* von 1996 bis 2001 Staatsoberhaupt des Islamischen Emirats Afghanistan; vermutlich im April 2013 unter Einwirkung von «Schmiergeld» in einem Krankenhaus in der pakistanischen Stadt Karachi gestorben. Aus verständlichen Gründen und im Sinne der unzähligen Koranschulen Pakistans hängt der pakistanische Geheimdienst den Mantel des Verschweigens über die genauen Umstände.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.4.2021 - Tag der Sanktionen
Menschenrechtslage in Xinjang: Seilziehen um Schweizer Sanktionen gegen China
Die EU hat Sanktionen gegen China wegen der fragwürdigen Menschenrechtssituation verhängt. Die Schweizer Politik ist in dieser Frage gespalten.
Die Schweiz pflegt gute Beziehungen zu China, ihrem drittwichtigsten Handelspartner. Sie hat – anders als die EU – auch ein Freihandelsabkommen mit der zweitgrössten Wirtschaftsmacht der Welt abgeschlossen.
Gute Wirtschaftsbeziehungen haben also traditionellerweise einen hohen Stellenwert. Doch in letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die eben das kritisieren. Sie fordern, dass die Schweiz nicht nur auf gute Geschäftsbeziehungen achtet, sondern den Menschenrechten mehr Gewicht gibt.
Schweiz soll härtere Linie fahren gegenüber Peking
«Für uns Grüne ist klar: Die Schweiz soll unbedingt diese Sanktionen der EU mit übernehmen», sagt Christine Badertscher, grüne Nationalrätin aus dem Kanton Bern und Mitglied der Aussenpolitischen Kommission (APK-NR). «Es darf nicht sein, dass die Schweiz hier abseits steht. Es braucht diese Sanktionen unbedingt, weil die Situation wirklich unhaltbar ist.»
Damit meint Badertscher die Unterdrückung der Uigurinnen und Uiguren in China. In der Vergangenheit war die Schweiz zurückhaltend bei der Übernahme von Sanktionen. Die Schweizer Politik setzt eher auf den Dialog.
Doch gemäss Badertscher reicht dieser Dialog eben nicht aus, um in China etwas zu verändern. «Die Erfahrung zeigt einfach in diesem Fall, dass der Menschenrechtsdialog nicht genügt, weil er einfach nicht verbindlich ist. Und es braucht verbindlichere Massnahmen, sei es eben im Freihandelsabkommen oder mit dem Nachziehen der Sanktionen, wie es die EU beschlossen hat.»
Mehrere Bundesratsreisen nach China geplant
Wie wichtig China für die Schweiz ist, zeigen aktuelle Recherchen der NZZ. So planen gleich drei Bundesräte, dieses Jahr nach China zu reisen. Das begrüsst der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser. Je intensiver der Austausch sei, desto besser. Von Sanktionen rät er hingegen ab.
«Ich bin überzeugt, dass eine gute wirtschaftliche Zusammenarbeit langfristig zu besseren Resultaten führt als Embargos. Darum denke ich, die Schweiz sollte sehr vorsichtig sein, wenn sie jetzt gegen China Sanktionen ergreift.»
Stattdessen auf den Menschenrechtsdialog zu setzen sei gut, meint Noser. «Einfluss zu nehmen auf China ist so oder so schwierig. Aber ich bin auch überzeugt, dass Gespräche und damit dieser Menschenrechtsdialog der richtige Weg ist. Das ist besser als brüskieren», so Noser.
Bei den Schweizer Aussen- und Wirtschaftspolitikern stehen sich also zwei Lager gegenüber. Da ist einerseits das bürgerliche Lager, das vor allem auf gute Wirtschaftsbeziehungen setzt, und andererseits das Mitte-Links-Lager, das die Menschenrechte stärker betont.
Auf jeden Fall zeigen die zunehmenden Spannungen mit China, dass die Schweizer Politik aktuell auf die Probe gestellt wird. Generell versucht die Schweiz mit allen grossen Mächten gute Beziehungen zu pflegen. Doch der Druck der USA und der EU nimmt zu, dass die Schweiz gegenüber China klarer Stellung beziehen soll. Schreibt SRF.
Die gegenseitigen Sanktionen zwischen der EU und China* werden China im gleichen Mass interessieren, wie uns in Europa ein Sack Reis, der in China umgefallen ist. Das ganze Sanktionstheater ist nichts anderes als lächerliche Symbolpolitik.«Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!»
Ich sass vor ein paar Jahren, als die chinesischen Touristen noch die Schweiz fluteten, zufälligerweise neben einem jungen Individualtouristen aus China, IT-Mitarbeiter von Huawei wie er mir erzählte, am Mittagstisch im tibetanischen Restaurant an der Ledergasse in Luzern. Wir kamen miteinander ins Gespräch.
Während wir uns im Smalltalk übten, blickte er plötzlich auf mein HTC-Handy, das auf dem Tisch lag. «Oh, HTC!». Ich schmunzelte und erwiderte: «Made in Taiwan, not China». Er sah mich an, lächelte und sagte in diesem Brustton der Überzeugung, der keine Widerrede zulässt: «Taiwan belongs to China». Staatsdoktrin at its best. Was Xi Jinping andauernd verkündet, muss ja stimmen.
Unser Gespräch plätscherte hin und her. Ich lobte China für seine unglaubliche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten und er lobte die Schweiz für all die touristischen Highlights und unsere tollen «but very expensive watches». Er machte auf mich einen sehr gebildeten Eindruck, sprach in gepflegtem Englisch (weit besser als ich) und arbeitet vermutlich nicht umsonst in der Entwicklungsabteilung von Huawei.
Als ich dann aber wagte, das Gespräch weg vom Smalltalk hin zur Politik zu verlagern und ihn fragte, was er von Menschenrechten in Bezug auf die «eingesperrten Uiguren» in China halte, schaute er mich durch seine Designerbrille an und stellte mir, wieder mit diesem geheimnisvollen Lächeln auf den Lippen, höflich aber bestimmt eine Gegenfrage: «Würden Sie diese Frage auch an einen Touristen aus Saudi Arabien stellen?».
Eine einzige Frage eines chinesischen Touristen führte mir vor Augen, welche Doppelmoral die hehre westliche Wertegemeinschaft pflegt. Was die chinesischen Strafmassnahmen gegen die Uiguren allerdings auch nicht besser macht.
So viel zur Sanktionspolitik des Westens!
*https://www.srf.ch/news/international/erstmals-seit-30-jahren-eu-verhaengt-sanktionen-gegen-china
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.4.2021 - Tag der Astronomie
Interview mit Astronom Oliver Müller (31): «Einstein könnte falsch gelegen haben»
Der junge Schweizer Astronom Oliver Müller bringt mit seinen Beobachtungen Einsteins Gravitationstheorie ins Wanken. Bei uns redet er über die Schönheit des Universums, wieso es eventuell einen Gott gibt und warum das Leben als Forscher so unsicher ist.
Blick: Herr Müller, wie wird man Astronom?
Oliver Müller: Ich wusste nach dem Gymi überhaupt nicht, was machen. Ich war ein schlechter Schüler, in der Physik hatte ich einen knappen Vierer. Ich dachte dann, ich mach das Lehramt, mit Geschichte und, weil Mathelehrer gesucht sind, am besten zusätzlich Mathe.
Und dann?
Geschah ein glücklicher Zufall: Ich habe gemerkt, dass mir die Geisteswissenschaft gar nicht liegt, die Mathe aber sehr. Mir lag einfach dieses Schul-Lernen nicht. Für Physik hab ich mich eigentlich nur angemeldet, um aus einem Geschichtsseminar rauszukommen, und innerhalb des Physikstudiums habe ich einen astronomischen Beobachtungskurs belegt – da wars um mich geschehen. Und die Physik war dann plötzlich auch gar kein Problem mehr, weil das Lernen interessengesteuert dann sehr gut funktioniert hat.
Wenn Sie einem fünfjährigen Kind erklären müssen, was Sie forschen, was antworten Sie?
Uff. Moment, ich versuchs: Ich studiere Galaxien, das sind so Objekte im Universum, die Millionen und Millionen von Sonnen enthalten. Und ich interessiere mich dafür, wie die sich im Weltraum bewegen, und suche solche Objekte und beobachte sie dann. Und mich interessiert, ob diese Objekte sich so bewegen, wie wir uns vorstellen, dass sie sich bewegen sollten.
Also, wie wir aufgrund unserer Theorien berechnen, wie sie sich bewegen sollten?
Genau.
Und? Tun sie das?
Eben nicht. Man hat aufgrund der bekannten Physik angenommen, dass sich Zwerggalaxien auf zufälligen Achsen chaotisch im Raum bewegen. Sie sind aber, wie ich in meiner Dissertation zeigen konnte, in einer Ebene einem rechten Winkel zu grossen Galaxien wie der Milchstrasse ausgerichtet.
Verzeihung, aber: Weshalb ist das wichtig?
Wissenschaft funktioniert doch so, dass man aufgrund bekannter Tatsachen ein Modell entwickelt. Und wir haben ein Modell, das sogenannte «Dunkle-Materie-Modell», basierend auf Albert Einsteins Gravitationstheorie. Solche einmal ausgeklügelte Modelle kann man dann heranziehen, um andere, unbekannte Dinge vorauszuberechnen. Nur bewegen sich Galaxien anders, als es dieses Modell nahelegen würde. Stimmt das Modell also nicht? Das wird mittlerweile als eines der grössten Probleme der Galaxienforschung bezeichnet.
Moment, Sie sagen also, Albert Einstein habe falsch gelegen?
Es ist zumindest eine Möglichkeit. Es kann sein, dass es dunkle Materie gar nicht gibt, und dann wäre Einsteins Gravitationstheorie widerlegt, zumindest auf der Grössenordnung von Galaxien.
Stichwort dunkle Materie: Was ist das überhaupt?
Niemand weiss es wirklich. Messungen zeigen aber, dass das Verhalten der Galaxien und der Sterne mit den bekannten Teilchen nicht erklärt werden kann. Es braucht also ein weiteres Teilchen. Man geht davon aus, dass dunkle Materie Teilchen sind, die nur Gravitation, also Anziehungskraft haben, aber nicht leuchten, also unsichtbar sind. Drei Viertel der Masse des Universums müsste eigentlich aus solchen Teilchen bestehen. Aber das ist nur eine theoretische Annahme. Man versucht, etwa am Cern in Genf, herauszufinden, ob es diese Teilchen gibt.
Am Cern wurde ja gerade ein neues Teilchen gefunden – hat das mit dunkler Materie zu tun?
Ich bin da noch extrem vorsichtig, überhaupt etwas zu sagen. Die Messungen müssen derart genau sein, da gibt es viel Spielraum für Fehler …
Was hat es eigentlich für den Normalbürger für einen Einfluss, ob es nun diese dunkle Materie gibt, oder nicht?
Im alltäglichen Leben kaum einen. Aber falls wir mal in die Weiten des Alls fliegen wollen, einen grossen.
Das müssen Sie bitte näher erklären!
Wenn man sich die Forschung und Technologie anschaut: Die Berechnungen, aufgrund derer GPS-Systeme, überhaupt Satelliten und Fernerkundung funktionieren, beruhen beispielsweise auf Einsteins Gravitationsgesetz.
Aber die funktionieren ja prächtig?
Ja, aber: Gäbe es einen Fehler in dem Gesetz, würde das auf die Distanz zwischen Satelliten und einer Strasse auf der Erde vielleicht einen Unterschied von ein paar Millimetern oder sogar Hundertstelmillimetern machen, ob nun die Formel stimmt oder nicht. Sie ist also genau genug. Wenn man sich nun Distanzen in der Raumfahrt ansieht, kann man dann aber mit einer falschen Gravitations-Formel plötzlich Tausende von Lichtjahren danebenliegen. Ich spreche hier aber von der Erkundung unserer Galaxie und nicht nur unseres Sonnensystems, das ist also noch weit weg vom heute Möglichen. Aber wir legen hier die Grundsteine, die vielleicht in ein paar Hundert Jahren wichtig sein werden.
Mit der Annahme, dass Einstein falsch gelegen haben könnte, stellen Sie das Lebenswerk vieler Physiker in Frage. Haben Sie deshalb viele Feinde?
Aus der Wissenschaft eigentlich nicht sehr. Wissenschaftler sind sich gewohnt, dass ihre Positionen hinterfragt werden, das liegt in der Natur der Wissenschaft. Aber ich werde, wie viele Wissenschaftler, immer mal wieder von Laien oder Halblaien angefeindet.
Echt, weshalb?
Viele fühlen sich beleidigt, wenn man etwas entdeckt, das ihren Überzeugungen widerspricht. Und viele haben das Gefühl, Wissenschaftler seien gut verdienende ältere Männer, die abgehoben von der realen Welt ihre Theorien entwickeln.
Stimmt das denn nicht?
Sehen Sie doch mich an: Der allergrösste Teil der Forschung wird von Leuten wie mir gestemmt: jung, idealistisch, mit zeitlich begrenzten Forschungsverträgen und deshalb mit massiver Unsicherheit, was die Zukunft betrifft. Man hat auf ein, zwei Jahre begrenzte Verträge und weiss, weder wo auf der Welt man hinziehen muss für einen neuen Forschungsauftrag, noch wo im nächsten Jahr der Lohn herkommt. Darum ist es auch so ärgerlich, wenn die Wissenschaft, wie jetzt auch bei Covid-19, von der Politik und anderen Meinungsmachern nicht ernst genommen wird: Wir kommen nämlich mit Selbstausbeutung, wenig Geld, viel Arbeit und Herzblut zu unseren Resultaten und chrampfen uns einen ab. So. Das musste mal gesagt sein.
Sie benutzen oft Teleskope und schauen in die Weiten des Universums. Glauben Sie, dass wir darin allein sind?
Ich habe dazu gerade einen Vortrag von einem der führenden Astrophysiker auf dem Feld gehört. Es müssen schon sehr, sehr viele Zufälle und Gegebenheiten aufeinandertreffen, damit nur schon einzelliges Leben entstehen kann: Temperatur, Abstand des Planeten zum Stern, Masse des Planeten, Vorhandensein eines Magnetfelds, chemische Zusammensetzung, Vorhandensein von Wasser … Das sind nur einige der vielen Voraussetzungen. Mir scheint es eher unwahrscheinlich, dass anderswo ähnliche Zivilisationen entstanden sind wie bei uns. Allerdings gibt es da draussen schier unendlich viele Sterne und Planeten …
Der Gedanke, dass wir doch die Einzigen sein können, könnte viele bestätigen, die gläubig sind. Sind Sie in irgendeiner Form religiös?
Nein, ich fühle mich den Agnostikern am nächsten. Ich glaube, dass es wahrscheinlicher ist, dass es keine irgendwie gestalteten Götter gibt. Ich will aber die Möglichkeit auch nicht ganz ausschliessen.
Kommen Sie sich angesichts dieser Weiten manchmal allein vor? Packt Sie das Grauen?
Gar nicht. Ich staune vielmehr über die Schönheit, die ich beobachten darf, und bin manchmal davon sehr ergriffen.
Was erscheint Ihnen, wenn Sie zurück in die Froschperspektive gehen, dann wieder am absurdesten auf Erden?
Dass wir Milliarden bereitstellen können, um auf den Mars zu fliegen, es aber nicht schaffen, unsere Probleme hier zu lösen und allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das ist einfach krank. Und das Potenzial, das so verloren geht, auch forschungs- und bildungsmässig, ist enorm.
Und was scheint Ihnen am absurdesten in der Schweiz?
Aus meiner Perspektive wäre ein Schnitt mit der EU katastrophal. Wenn wir zum Beispiel aus den bilateralen Verträgen austreten würden, wäre die Schweiz isoliert, was die Forschung betrifft. Und zwar gleich zweifach: Zum einen stünden EU-Forschungsgelder nicht mehr zur Verfügung, und da muss erwähnt werden, dass wir viel mehr Geld hereinholen als einzahlen. Zum anderen wäre auch der Austausch nicht mehr so einfach gegeben, das Renommee der Schweiz würde sehr leiden. Die Schweiz würde ihre Spitzenposition in der Forschung aufgeben. Das kann sich der Standort Schweiz auch wirtschaftlich nicht leisten. Aber die Wissenschaft hat leider kaum eine Lobby in der Politik.
Warum gibt es nicht mehr Wissenschaftler in der Politik?
Ich glaube, weil Wissenschaftler einfach brennend an ihrer Materie interessiert sind, und wie oben erwähnt, allermeistens unter nicht rosigen Bedingungen arbeiten. Sie hätten gar keine Zeit, in der Politik aktiv zu sein – ich auch nicht, obwohl ich mir das auch schon überlegt habe.
Woran wollen Sie in der Zukunft weiterforschen?
Ich arbeite derzeit daran, wie mit Hilfe künstlicher Intelligenz zukünftige Datensätze schneller ausgewertet werden können. Das wird in der Zukunft enorm wichtig, da einige Grossprojekte in den Startlöchern stehen, welche uns mit Daten überhäufen werden. Und ich will weiter Musik machen – ich spiele jeden Tag E-Gitarre und freu mich darauf, wenn ich mit der Band, die ich mit einem Schulfreund habe, wieder mal auftreten kann. Schreibt Blick.
Wie sagte schon Sokrates? «Ich weiss, dass ich nicht weiss". (Das ergänzende «-s» an «nicht» ist ein Übersetzungsfehler; deswegen wird das Zitat von Sokrates fälschlicherweise häufig als «Ich weiss, dass ich nichts weiss» verwendet).
Egal, ob das Zitat richtig oder falsch übersetzt angewendet wird, auf den Astronom Müller trifft es so oder so zu. Das gilt aber für alle Astronomen. Trotzdem sind viele Äusserungen von Müller selbst in der Formulierung im Konjunktiv interessant.
Einige sogar auch einleuchtend: «Dass wir Milliarden bereitstellen können, um auf den Mars zu fliegen, es aber nicht schaffen, unsere Probleme hier zu lösen und allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.»
Was allerdings mehr mit Soziologie als mit Astronomie zu tun hat. Richtig ist es trotzdem.
Falsch (Clickbaiting?) ist allerdings die Videoüberschrift von Blick: «Dieser Schweizer Forscher widerlegt Albert Einstein». Das tut Müller mit keinem einzigen Wort. Er stellt lediglich Einsteins «allgemeine Relativitätstheorie» in Frage.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.4.2021 - Tag von Schacher Seppli
ÖVP attackiert Österreichs grünen Vizekanzler Kogler wegen "Postenversorgung"
Angriff ist die beste Verteidigung. Nach diesem Motto scheint die ÖVP derzeit im Rahmen der Chat-Affäre zu agieren. Am Samstag wurde von jener Partei, die wegen mutmaßlicher Freunderlwirtschaft und Postenschacher seit Wochen in der Kritik steht, eine Attacke gegen den eigenen Koalitionspartner gestartet. Der Vorwurf: Postenschacher. VP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger unterstellt Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), wiederholt engen Vertrauten zu einem Posten verholfen zu haben.
ÖVP stößt sich an "Postenversorgung"
Konkret geht es um Josef Meichenitsch, der zum Aufsichtsrat in der Abbag, der Verwertungsgesellschaft der Hypo Alpe Adria, bestellt wurde. In offen hämischem Ton, bezichtigt Hanger den Vizekanzler, "den Begriff 'Green Jobs' offenbar falsch verstanden" zu haben. " Denn es werde immer klarer ersichtlich, dass die Grünen mit ihrer Ansage, ‚Green Jobs‘ schaffen zu wollen, "in Wahrheit gemeint haben, fleißig Postenversorgung für ihre grünen Parteifreunde betreiben zu wollen", so Hanger in einer Aussendung am Samstag.
Als weitere Beispiele nennt der VP-Mandatar den ehemaligen Grünen-Abgeordneten Dieter Brosz, der Sport-Abteilungsleiter in Koglers Ministerium wurde, den ehemaligen Büroleiter des Grünen Klubs Marc Schimpel, der Geschäftsführer der Cofag wurde, die COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes und die ehemalige Grünen Bezirksrätin Karin Tausz, die in den Aufsichtsrat der Austro Control entsandt wurde. Darüber hinaus ortet Hanger grüne Netzwerke hinter der Bestellung von Kathrin Vohland zur Direktorin des Naturhistorischen Museums. Die Deutsche sei nämlich ebenfalls als Grünen-Politikerin aktiv gewesen.
Abbag und Cofaq
Was Hanger nicht erwähnt: Der grüne Schimpel ist Teil einer Doppelspitze in der Cofag. Er leitet die Geschicke zusammen mit Bernhard Perner, seines Zeichen früherer Kabinettsmitarbeiter im ÖVP-geführten Finanzministerium. Pikanterweise ist Perner auch Geschäftsführer der Abbag, wo der Kogler-Vertraute Meichenitsch nun im Aufsichtsrat sitzt, worüber sich Hanger sehr empört.
Und Perner spielt auch eine entscheidende Rolle rund um die umstrittene Postenbestzungen in der Öbag, wie der STANDARD berichtete. Er bereitete schon Ende 2018 seinen Transfer in die Staatsholding im Sog von Thomas Schmid, dem derzeitigen Vorstand, vor, wie aus Akten des Untersuchungsausschusses hervorgeht. Damals gab es noch nicht einmal eine Ausschreibung für die Öbag-Spitze, Perner und Schmid wird schon länger vorgeworfen, die Jobbeschreibung auf sich zugeschnitten zu haben.
Grüne: Erfuhren von ÖVP über Bestellung
Auf eine Anfrage des STANDARD im Büro Kogler hieß es am Samstag, man wolle keine Stellungnahme zu den Vorwürfen Hangers abgeben. Es müsse nicht alles kommentiert werden. Allerdings zeigen sich die Grünen offenkundig überrascht vom türkis-schwarzen Angriff. Denn die Bestellung Meichenitschs erfolge zwar auf Vorschlag Koglers, bestellt werde er aber durch das Finanzministerium. Und man habe selbst erst durch Hangers Aussendung erfahren, dass der gewünschte Bewerber den Zuschlag erhalten habe. Zudem hatten sich Kogler und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstagvormittag noch in trauter Einigkeit präsentiert, als sie ihren "Comebackplan" für die Zeit nach der Pandemie präsentierten.
VP-Mandatar Hanger fand dennoch deutliche Worte für die Vorgänge rund um die Bestellung Meichenitschs: "Das Vorgehen der Grünen verdeutlicht, wie heuchlerisch die aktuelle Debatte rund um die Postenbesetzung in der Öbag geführt wird." Die besagte Öbag-Debatte um die Bestellung von Vorstand Thomas Schmid war heute Mittag auch Thema beim Interview des ÖVP-Klubobmannes August Wöginger auf Ö1. Anders als sein Parteikollege Hanger bezeichnete dieser solche Postenbesetzungen allerdings als "normal" und konnte nichts Verwerfliches daran erkennen.
Finanzministerium besetzt die Posten, Vizekanzler redet mit
Der Abbag-Aufsichtsrat besteht aus vier Personen. Zwei werden vom Finanzministerium (BMF) bestellt, zwei vom Vizekanzler in Absprache mit dem BMF, das die Bestellung letztlich absegnet. Neben Meichenitsch ebenfalls auf Vorschlag des Vizekanzlers neu im Gremium ist die Finanzrechtsexpertin und Universitätsprofessorin Sabine Kirchmayr-Schliesselberger. Meichenitsch, er ist Abteilungsleiter bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), und Kirchmayr-Schliesselberger ersetzten nach Ablauf der fünfjährigen Periode Ernst Marchart und Marion Medlitsch. Im Aufsichtsrat verblieben sind der Vorsitzende Wolfgang Nolz und Christine Winter, wie das Finanzministerium auf Anfrage der APA mitteilte. Schreibt DER STANDARD.
Wo moralische Entrüstung am grössten, da ist Scheinheiligkeit am nächsten.
Immer wieder belustigend, wenn ein Esel den andern Esel einen Esel nennt.
Wenn es um Postenschacher geht, bleiben sich die Parteien gegenseitig nichts schuldig. Kennen wir auch in der Schweiz zur Genüge. Stichwort Levrat / SP Schweiz / Post.
Noch Fragen?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.4.2021 - Tag der Bussi-Emojis
Krisen rund um Kanzler Kurz: Der Lack ist ab – und jetzt? Steht das Ende der Ära Kurz bevor?
Seine Maske ist gefallen – und das mit einem einzigen kräftigen Ruck. Vielen galt Sebastian Kurz als politischer Heilsbringer; jung, ambitioniert, aufstrebend, anders, angetreten mit dem Versprechen einer sauberen Politik und der salonfähigen Härte gegen Migranten. "Neuer Stil" war das Mantra seiner Kanzlerwerdung – heute wird es nur noch schmähend von seinen Kritikern wiederholt. Die große Frage ist, was das nun eigentlich heißt.
Kurz ist in Beliebtheitsrankings abgestürzt, selbst internationale Medien berichten vom Fall des österreichischen Polit-Wunderkinds. Gegen Freunde und Parteifreunde des Kanzlers wird ermittelt. Von der Justiz sichergestellte Chatprotokolle bringen zutage, wie Kurz und seine Leute gemunkelt und gemauschelt haben. Gleichzeitig erreicht die Pandemie ihren neuen Höhepunkt. Auch in Europa hat Kurz einen nachhaltigen Imageschaden erlitten. Das ist Fakt.
Aber kann der Kanzler die Affären rund um ihn aussitzen? Oder ist – wie manche sagen – das Ende der Ära Kurz in Sicht? Man muss jenen, die jubeln, wohl die Stimmung vermiesen: Kurz wird Österreich trotz allem noch länger erhalten bleiben.
Der Aufschrei über das unsaubere, vielleicht korrupte Verhalten der türkisen Truppe ist zwar nicht nur in Qualitätsmedien laut. Viele halten Kurz dennoch die Stange. Die Causen sind komplex, Ermittlungen oft langwierig. Nur weil sich viele über die Chats mit peinlichen Emojis amüsieren, heißt das nicht, dass sie die ÖVP nicht mehr wählen.
Kurz hat einen Aufstieg hingelegt, der seinesgleichen sucht. Der Status des politischen Messias ist endgültig Geschichte – aber deshalb nicht er selbst. Der rote Kanzler Werner Faymann konnte zeigen, wie man sich längst angezählt an der Macht hält. Der Lack von Kurz ist ab, darunter kommt der ungeschminkte Politiker hervor – den weiterhin viele schätzen.
Das wird sich so schnell nicht ändern. Nicht, bis auf der politischen Bühne jemand erscheint, der ihm ernsthaft Konkurrenz macht. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner legt in Umfragen zu, konnte als Epidemiologin inmitten der Pandemie dennoch nicht annähernd aufschließen. Die FPÖ befindet sich in einem internen Machtkampf zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickl.
Spannend wird, wie sich Kurz eine Mehrheit sichert, sollte auch die Koalition mit den Grünen platzen. Vermutlich fände er eine Lösung. Kurz ist demaskiert, der talentierte Polittaktiker dahinter wird nun noch sichtbarer werden. Schreibt DER STANDARD.
Ist es eine Schande, seinen Kanzler zu lieben? Österreichische Kanzler wurden schon immer vom Volk geliebt, auch wenn sich ebendieses Volk von seiner grenzenlosen Liebe nach 12 Jahren und verlorenen Schlachten schnellstens davon distanzierte.
Das scheint jetzt bei «Baby Hitler», wie Kurz vom deutschen Satiremagazin «TITANIC» betitelt wurde, etwas weniger lang zu dauern.
Chats mit peinlichen Emojis? Wahre Liebe scheint es halt wirklich nur unter Männern zu geben. Jedenfalls bei den Ösen im Öster-Reich.
Und möglicherweise im Schweizer Ständerat.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
9.4.2021 - Tag der brasilianischen Huren
Frauen raubten Prostituierte auf dem Luzerner Strassenstrich aus
Viel zu holen gab es nicht. Trotzdem haben zwei Frauen immer wieder Sexarbeiterinnen auf dem Strassenstrich überfallen. Eine von ihnen wurde nun vom Kriminalgericht verurteilt. Sie muss weder ins Gefängnis noch wird sie des Landes verwiesen.
Die Überfälle beginnen im August 2017. Ein rotes Auto biegt vom Seetalplatz herkommend in den Kreisel im Gebiet Ibach ein. Erst steigen zwei Männer aus. Dann zwei Frauen. Letztere laufen auf die Prostituierten zu, die am Strassenrand stehen. Eine der Herbeieilenden hält eine Pistole in der Hand. «Geld, oder ich schiesse», schreit sie die Sexarbeiterinnen an. «Mach, mach, mach!», brüllt die andere.
Die beiden Prostituierten kramen panisch ihr ganzes Bargeld aus den Taschen und werfen es den Räuberinnen vor die Füsse. Diese heben die paar Scheine auf – und ergreifen dann mit quietschenden Reifen die Flucht. Die Beute teilen sie mit den zwei Männern, die das Fluchtauto fahren.
Was passiert ist, macht sofort die Runde
Keine Woche später taucht das rote Auto wieder am Strassenstrich auf. Es ist kurz vor drei Uhr morgens, nur noch eine Sexarbeiterin ist vor Ort. Der Wagen dreht eine Runde. Als die Prostituierte ihn sieht, ruft sie sofort die Polizei. Sie weiss genau, was ihren Kolleginnen nur wenige Nächte zuvor passiert ist. Die Frauen halten zusammen.
Wieder rennen die zwei Frauen mit gezogener Pistole auf ihr Opfer zu. Die Prostituierte schreit, sie habe die Polizei angerufen. Da machen die Kriminellen kehrt und verschwinden in der Nacht.
Das Opfer wähnte sich in Sicherheit
Knapp einen Monat lang bleibt alles ruhig. Dann folgt der nächste Überfall. Dieses Mal kommen die Täterinnen nicht im Auto – dieses ist schon zu bekannt. Sie laufen einfach auf die Reusseggstrasse zu. Eine Sexarbeiterin, die dort steht, fragt die beiden, ob sie auch der Prostitution nachgehen.
«Ja», sagen sie. Sie laufen vorerst weiter, um ihr späteres Opfer in Sicherheit zu wiegen. Dann aber kehren sie plötzlich um und halten zwei Sexarbeiterinnen vor Ort eine Pistole an den Kopf. Sie rauben sie aus und springen dann ins Auto, welche hinter der Ecke steht, in dem ihre Komplizen schon auf sie warten.
Eine letzte Chance zur Bewährung
Der Serie von Raubzügen wird erst im August 2018 ein Ende gesetzt. Die Luzerner Poilzei verhaftet eine 19-jährige Brasilianerin. Wie sich herausstellt, hat sie die brutalen Überfälle zusammen mit ihrer WG-Kollegin begangen. Bereits in der ersten Vernehmung gibt sie alles zu.
Wer einen Raub begeht, riskiert eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Zudem handelt es sich um eine Anlasstat, die einen obligatorischen Landesverweis von mindestens fünf Jahren zur Folge hat. Vorliegend passiert beides nicht.
Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigen sich darauf, dass eine bedingte Freiheitstrafe von zwei Jahren angemessen ist. Das heisst: Die Täterin bleibt auf freiem Fuss, wenn sie sich in den nächsten drei Jahren keine weiteren Delikte zuschulden kommen lässt.
Zwar zeugen die Taten von «Egoismus und Respektlosigkeit», schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrem Urteilsvorschlag. Aber: Nach Angaben der Frau handelte es sich bei der Tatwaffe «nur» um eine Schreckschusspistole. Und: «Sie scheint ihre Taten zu bereuen.» Abgesehen von einer Vorstrafe wegen Beschimpfung habe die Frau vorher und nachher keine Straftaten begangen.
Schlechte Jobchancen im Heimatland
Auch auf den obligatorischen Landesverweis will die Staatsanwaltschaft verzichten. Die Frau ist zwar in Brasilien geboren und lebte dort, bis sie zehn Jahre alt war. Sie hat den Rest der obligatorischen Schulzeit dann aber in der Schweiz verbracht, hat hier seit vielen Jahren einen festen Freund und ein inniges Verhältnis zu ihrer Mutter und ihrer Stiefschwester.
Da sie ihre Lehre abgebrochen hat, gesteht ihr die Staatsanwaltschaft zu, dass es für sie in Brasilien «schwierig wäre, wieder Fuss zu fassen» und einen Job zu finden. Zudem lebt in ihrem Heimatland nur noch ihr Vater, zu dem sie seit 12 Jahren keinen Kontakt mehr hat. Deshalb handelt es sich aus ihrer Sicht um einen Härtefall.
Dass die Opfer Geld bekommen, ist unwahrscheinlich
Das Kriminalgericht hat bei abgekürzten Verfahren wie dem vorliegenden nur drei Möglichkeiten: Entweder es genehmigt den «Deal» zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, es ändert ihn nur leicht ab oder es weist den Fall zurück. Geschieht Letzteres, muss die Staatsanwaltschaft Anklage erheben und ein ordentliches Verfahren durchführen – was mithin Jahre dauern kann.
Im vorliegenden Fall winkt das Kriminalgericht den Vorschlag durch. Einzig eine von der Staatsanwaltschaft zusätzlich beantragte Busse von 1000 Franken streicht es aus dem Urteil. Den Opfern spricht die Einzelrichterin zwar Schadenersatz zu. Nur ist leider nicht bekannt, wo sich die Frauen heute aufhalten. Das Urteil ist rechtskräftig. Schreibt ZentralPlus.
Es kann die frömmste Luzerner Hure nicht in Frieden arbeiten, wenn es der brasilianischen Hure von der Baslerstrasse nicht gefällt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.4.2021 - Tag der Gebrüder Grimm
Eine Globale Mindeststeuer soll Oasen trockenlegen. Wie kann das funktionieren?
Stellen Sie sich vor, etwas Kreativität und ein Internetzugang würden es Ihnen ermöglichen, die gesamte Einkommensteuer zu ersparen. Dafür müssten Sie online in Irland oder den Niederlanden eine Tochtergesellschaft gründen, eine Art zweites Steuer-Ich, das all Ihr Einkommen verwaltet. Das Geld würden Sie zunächst dorthin überweisen und dann weiterleiten auf ein Konto, welches auf den Bermudas registriert ist. Sie könnten auf die Mittel zugreifen, müssten aber nie etwas versteuern. All das wäre ganz legal.
Für Arbeitnehmer und die absolute Mehrzahl der Unternehmen ist es unmöglich, eine solche Vorstellung zu verwirklichen. Viele multinationale Konzerne können dagegen mit ein paar legalen Tricks ihre Steuerbelastung auf ähnliche Art senken. Sie nutzen dafür ihre Präsenz in vielen Ländern und einladende Regelungen in diversen Steueroasen. Die Gewinne werden verschoben, indem Tochtergesellschaften in Hochsteuerländern hohe Gebühren für Lizenzen oder die Nutzung von Markenrechten in Niedrigsteuerländer verschieben.
Alphabet, der Mutterkonzern von Google, etwa überweist seine in Europa erzielten Gewinne via irische und niederländische Gesellschaften seit Jahren auf die Bermudas. Dort müssen Konzerne keine Gewinnsteuern zahlen. Was auf der nordatlantischen Insel ist? Nichts, aber Google hat das geistige Eigentum hinter seiner Suchmaschine auf eine Gesellschaft mit Sitz in den Bermudas registriert.
Der Konzern hat erklärt, diese Praxis auslaufen lassen zu wollen. Doch das Problem im internationalen Steuerrecht ist von jeher, dass für jedes legale Schlupfloch, das geschlossen wird, sich irgendwo ein anderes findet.
Eine neue Untergrenze
Aber was, wenn sich die gesamte Praxis der Gewinnverschiebung durch eine Veränderung im internationalen Steuersystem zurückdrängen ließe? Genau über eine solche Reform wird derzeit im Rahmen der Industriestaatenorganisation OECD diskutiert, und es sieht so aus, als wäre ein großer Wurf in Reichweite. Der Vorschlag, um den sich alles dreht, ist die Einführung einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen. Im Gespräch sind 12,5 Prozent.
So sieht die Idee aus: Multinationale Konzerne können weiterhin ihre Gewinne verschieben. Aber wenn eine Steuerschwelle unterschritten wird, könnte jenes Land, in dem das Unternehmen beheimatet ist, eine Nachforderung erheben. Beispiel: Ein Konzern aus Österreich verlagert Gewinne zu einer Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands. Auch dort gibt es keine Gewinnsteuern. Wäre eine globale Mindeststeuer von 12,5 Prozent vereinbart, könnte Österreich den Profit der Tochtergesellschaft mit diesem Satz nachversteuern.
In Europa sind es vor allem Deutschland und Frankreich, die diesen Vorschlag, der schon seit 2018 diskutiert wird, vorantreiben. Nun bekundet die US-Regierung lautstark Interesse. Finanzministerin Janet Yellen sagte diese Woche, die Idee könnte einen 30 Jahre andauernder Steuerwettbewerb nach unten beenden. Das ist symbolisch wertvoll: Ohne die USA als größte Volkswirtschaft der Welt sind große steuerpolitische Reformen kaum umsetzbar.
Aber was genau kann eine Mindeststeuer verändern? "Wird das Konzept ernsthaft umgesetzt und nicht durch Ausnahmeregelungen verwässert, steckt in der Mindeststeuer eine große Chance. Dann wäre es vorbei mit dem Geschäftsmodell der klassischen Steueroasen", sagt Johannes Becker, Ökonom von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster.
Droht die Verwässerung?
Nicht verwässert würde bedeuten, dass die Grundideen hinter dem Vorschlag konsequent umgesetzt werden. So müsste auf die effektive Besteuerung von Unternehmen abgestellt werden. Als Basis dient dafür der Gewinn, der nach Regeln des Handelsrechts errechnet wird. Diese Regeln sind international ähnlich.
Wenn der globale Mindeststeuersatz in einem Land eingehalten oder überschritten wird, erfolgt kein Ausgleich. Das passiert nur dort, wo eine Unterschreitung stattfindet. Für die digitalen Konzerne aus Amerika wie Facebook oder Google blieben bei möglichen Steuernachforderungen die USA zuständig.
Die Einnahmen der Staaten würden durch eine solche Reform steigen, aber in überschaubarem Rahmen: Die OECD rechnet mit einem Plus von 50 bis 100 Milliarden US-Dollar. Das gesamte Aufkommen der Körperschaftsteuer würde um bis zu drei Prozent steigen. Hier zeigt sich, dass nur eine überschaubare Gruppe von Konzernen die globale Verflechtung für Gewinnverschiebungen nutzt.
Für den Ökonomen Becker liegt der Clou woanders: Die Mindeststeuer würde den Steuerwettbewerb zwischen den Ländern zurückdrängen. Anstatt Unternehmen über niedrige Steuersätze anlocken zu wollen, müssten Staaten auf klassischere Anreize wie gute Infrastruktur setzen.
Bis Mitte 2021 wollen sich die Industriestaaten und Schwellenländer auf eine Mindeststeuer einigen. Offen sind nicht nur technische Details, sondern auch die Höher der Steuer. Auch zehn Prozent waren im Gespräch. Hindernisse gibt es noch viele. So ist die Frage, ob die Schutzmächte vieler Steueroasen, wie das Vereinigte Königreich, zu dem die Caymans oder Bermuda gehören, mitziehen. Auch Staaten wie Irland und die Niederlande sind große Profiteure des aktuellen Regimes. "Die OECD muss den Impuls der USA jetzt nutzen um einen möglichst hohen Mindeststeuersatz zu erreichen", sagt Dominik Bernhofer, Steuerexperte der Arbeiterkammer. "Wir dürfen uns beim Mindeststeuersatz nicht an den Steueroasen orientieren." Schreibt DER STANDARD.
Erinnert mich an das Märchen der Gebrüder Grimm «Der Hase und der Igel».
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.4.2020 - Tag der Nacktselfies
Marco und Jessica haben sich Nackt-Selfies geschickt, die eigentlich nur für sie selbst bestimmt waren. Doch Marco hat ein Nackt-Selfie von Jessica mit einer Gruppe von Freunden geteilt. Nun kursiert das Bild in der ganzen Schule. Seither wird Jessica täglich beschimpft und verspottet.
Die folgenden Regeln helfen, eine solche Situation zu vermeiden:
• Leiten Sie nie erotische Fotos/Videos weiter.
• Wenn Sie ein ein Nacktfoto bekommen, löschen Sie es.
• Wer erotische Aufnahmen teilt, muss mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen.
Wenn Sie miterleben, dass jemand Spott, Beleidigungen, Ausgrenzung oder Gewalt ausgesetzt ist, oder wenn Sie selbst Opfer solcher Taten sind, dann sprechen Sie mit jemandem, dem Sie vertrauen darüber. Schreibt die Luzerner Polizei etwas holprig («... dem Sie vertrauen darüber») auf Facebook.
Learning by Geri Müller.
Das gehört nun mal zu den Verlockungen der Messenger-Dienste. Drogen gehören ja schliesslich laut Dogma der Luzerner Polizei auch zur Stadt Luzern.
Der Geist ist längst aus der Flasche. Da hilft vermutlich nicht mal das ohnehin bisher stets untaugliche Allheilmittel der Luzerner Regierung einer Sensibilisierungskamapagne.
Das Problem könnte einzig und allein durch die Messenger-Dienste selbst behoben werden. Aber die Social Media haben nun mal ihre eigenen Gesetze, an denen (bisher) noch keine Regierungsinstanz zu rütteln wagte.
So viel Ehrlichkeit muss sein. Alles andere ist in Zeiten des entfesselten Internets weltfremde Schönmalerei.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.4.2021 - Tag der Osterhühner
Geflügelpest bedroht Halter in Deutschland, Virus offenbar aggressiver: Bisher mussten 1,8 Millionen Stück Geflügel getötet werden
Die seit einigen Monaten in Deutschland aufgetretene Geflügelpest hat bereits größeren Schaden angerichtet als der letzte große Ausbruch 2016/2017. "Der Virus scheint diesmal deutlich aggressiver zu sein, was die Geflügelhalter sehr stark besorgt", sagte Katharina Standke, Geschäftsführerin des Geflügelwirtschaftsverbandes Brandenburg. Bisher mussten bundesweit bereits 1,8 Millionen Stück Geflügel getötet werden, damals waren es insgesamt 1,2 Millionen.
"Eine Impfung gegen den Vogelgrippen-Virus ist in Deutschland aktuell nicht erlaubt und aufgrund der Vielzahl von Subtypen auch nicht sinnvoll", sagte Stahnke. Damit gebe es keinen dauerhaften und umfassenden Schutz vor der Seuche, nur die akribische Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen. Die genauen wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs könnten derzeit nicht beziffert werden, sagte sie. Schreibt DER STANDARD.
Auch das noch! Als ob Corona nicht schon genug wäre.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.4.2021 - Tag der Knute
Die Jesus-Industrie
Es ist schon spannend, was im Laufe der Jahrzehnte so über Jesus "enthüllt" wurde. Und wieder pünktlich zu Ostern ein Buch, dem gemäß Jesus (vermutlich) nicht auferstanden ist. Sondern? Darüber lässt sich der deutsche Bestsellerautor Franz Alt gar nicht so sehr aus. Sein Ansatzpunkt ist, dass ein Übersetzungsfehler für die Auferstehung, also für die göttliche Natur, des als Aufrührer hingerichteten Wanderpredigers Jesus verantwortlich ist.
Das ist insofern originell, als sich Alt auf die Arbeit eines anderen Autors stützt, der seit Jahrzehnten die griechische Bibel ins Aramäische rückübersetzt. Zur Erinnerung (und für Jüngere, deren Religionsunterricht kursorisch war): Die vier anerkannten Evangelien sind von ihren Autoren auf Altgriechisch verfasst worden, dem damaligen Business English des östlichen Mittelmeerraums. Sie wiederum basieren zum Teil auf einer schriftlich nicht erhaltenen "Logienquelle" auf Aramäisch, das zu Christi Zeit in Palästina überwiegend gesprochen wurde. Übersetze man aber das griechische Neue Testament ins Aramäische zurück, sei die Sache mit der Auferstehung nicht so eindeutig.
Nun ja. Es ist schon spannend, was im Laufe der Jahrzehnte so über Jesus "enthüllt" wurde. Da sind die Verschwörungstheorien der "Querdenker" Kinderkram dagegen. Viele gehen davon aus, dass er die Kreuzigung überlebt hat, was angesichts dieser Hinrichtungsmethode extrem unwahrscheinlich ist. Aber die "Das mit Jesus war ganz anders"-Industrie blüht, während der Glaube mehr und mehr verdorrt. Schreibt Hans Rauscher im STANDARD.
Eines muss man den theistischen Religionen lassen: Sie alle haben nicht nur die perfideste, sondern auch wirksamste Marketingstrategie aller Zeiten entwickelt: Ein Bonus- Malussystem, das erst nach dem Tod der Religionsgläubigen durch die himmlischen Götter eingelöst wird und somit auch nie bewiesen werden muss.
Erstaunlich, dass dieser Klimbim auch nach der Erfindung des Buchdrucks, der Aufklärung, der MIGROS-Cumuluspunkte und des erweiterten Blicks dank Hubble tief ins Universum hinein noch immer funktioniert, um Milliarden von Menschen unter der Knute zu halten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.45.2021 - Tag der Osterprosa
Russland wird zum drittgrössten Öllieferant der USA
Vieles ist anders unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden. Doch eines bleibt gleich: die Ablehnung der Pipeline Nord Stream 2, die jährlich 55 Millionen Kubikmeter russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland bringen soll. An dem Projekt ist neben Uniper und Wintershall (Deutschland), Engie aus Frankreich und der britisch-niederländischen Royal Dutch Shell auch die OMV beteiligt.
OMV-Chef Rainer Seele sagte mehrfach, es handle sich um ein gesamteuropäisches Projekt. Das Interesse der Osteuropäer, allen voran der Ukraine, aber auch von Polen, Estland, Lettland und Litauen an der Leitung ist aber gering. Sie fürchten um Transiteinnahmen, die Ukraine auch um politische Sicherheiten.
Lobbyist für US-Industrie
Unterstützung bekamen die Stimmen in den letzten Jahren aus Übersee. US-Präsident Donald Trump machte keinen Hehl aus seiner Lobbyarbeit für die US-Öl- und -Gasindustrie, die selbst Flüssiggas nach Europa liefern wollte. Biden, obwohl weniger eng mit Big Oil verbandelt, nutzt die gleichen Argumente für die Bekämpfung von Nord Stream 2: Europa bringe sich mit der Leitung in zu große Energieabhängigkeit von Russland.
Tatsächlich liegt der Anteil russischen Gases am Gesamtverbrauch in Europa mit 36 Prozent relativ hoch. Wobei Gazprom und Novatek 2020 Marktanteile verloren haben. Die zunehmende Anzahl an LNG-Terminals eröffnet den Europäern zudem die Möglichkeit, im Fall des Falles schnell auf andere Gaslieferanten umzusteigen.
Interessant ist, dass zugleich mit der von Washington betriebenen Containment-Politik gegenüber russischen Kohlenwasserstoffen die Ölexporte aus Russland in die USA in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Das ist insofern erstaunlich, als die USA sich in den vergangenen 15 Jahren vom Netto-Importeur zum Netto-Exporteur gewandelt haben.
Drittgrößter Öllieferant
Importierte das Land 2006 noch täglich 13 Millionen Fass (je 159 Liter) mehr, als es exportierte, so decken die Amerikaner inzwischen ihren Bedarf zu mehr als 70 Prozent selbst.
Die Lieferungen der meisten erdölexportierenden Länder in die USA sind daher zurückgegangen. Nicht so bei Russland – und das trotz der sich seit der Krim- und Ukraine-Krise 2014 drastisch verschlechternden bilateralen Beziehungen. 2020 hat Russland fast 27 Millionen Tonnen Rohöl und -derivate in die USA exportiert. Pro Tag sind das 538.000 Fass, 63 Prozent mehr als 2014.
Damit ist Russland erstmals zum drittgrößten Ölimporteur der USA aufgestiegen – hinter Kanada und Mexiko. Das Land hat dabei den langjährigen Hoflieferanten Saudi-Arabien überholt und seinen Marktanteil bei den Importen fast verdoppelt. Mit 6,85 Prozent liegt dieser deutlich unter den Werten für Europa (etwa 30 Prozent), was vor allem damit zu tun hat, dass aufgrund der langen Transportwege russisches Öl in den USA teurer ist als in Europa.
Sanktionspolitik
Die hohen Kosten setzen dem weiteren Wachstum der Lieferungen Grenzen. Allerdings gibt es einige Gründe, die dafür sprechen, dass Russland weiter eine wichtige Rolle in der Treibstoffversorgung der USA spielen wird. Einer davon besteht in der Sanktionspolitik.
Washington hat nämlich nicht nur die Russen im Visier. Seit Jahren werden in viel härterer Form auch der Iran und Venezuela boykottiert. Gerade das venezolanische Öl spielte in der Vergangenheit für die US-Raffinerien eine gewichtige Rolle. Da die russische Sorte Urals in seiner Konsistenz dem Schweröl aus dem Maracaibo-Tiefland am nächsten kommt, ersetzt es dieses. Ein Umstieg der Raffinerien auf das leichtere US-Öl der Marke WTI wäre kostspielig.
Heuer kommt tendenziell noch mehr russisches Öl in den USA an. Im Jänner hat Russland seine Lieferungen ausgeweitet. Mit insgesamt 20,1 Millionen Fass liegt Russland damit nur noch knapp hinter Mexiko (23,2 Millionen). Schreibt Der Standard.
Früher, als wir an Ostern noch den Ostergottesdienst in der katholischen oder reformierten Kirche besuchten, umschrieb man dieses Verhalten mit einer Redewendung aus Heinrich Heines Versepos «Deutschland. Ein Wintermärchen»:
«Ich weiss, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser.»
Tempi passati!
Ein Hegemon kümmert sich nicht um die Prosa von Dichtern. Nicht mal an Ostern.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.4.2021 - Tag der Champagnerkorken
BLICKpunkt über das schwindende Vertrauen in die Wirtschaft: Völlig losgelöst
Was für ein Gegensatz! Kleinunternehmer kämpfen ums Überleben, Konzernchefs kassieren trotz Corona ungerührt Millionen. Diese Entkoppelung ist zum Schaden aller.
Das erste Corona-Jahr hat der Schweiz eine Krise von historischem Ausmass beschert: Viele Menschen mussten den Gürtel enger schnallen, nicht wenige Kleinunternehmen blicken noch immer in den Abgrund.
Nur an der Spitze gewisser Grosskonzerne scheint man davon wenig zu spüren. Dies zeigt ein Blick auf Topsaläre, die derzeit in den Geschäftsberichten 2020 auftauchen.
Zu Beginn der Pandemie war noch viel von Zusammenhalt die Rede. Tatsächlich zeigten sich manche Unternehmen solidarisch mit Corona-Geschädigten. Doch von dieser vorbildlichen Bescheidenheit in schwierigen Zeiten ist heute nicht mehr viel zu spüren.
Beispiel UBS: Für 2020 bezog Sergio Ermotti 13,3 Millionen Franken – mehr als im Jahr zuvor, obwohl er nur bis Ende Oktober CEO war. Immerhin spendete er eine Million für Corona-Geschädigte. Nachfolger Ralph Hamers kassierte für seine ersten vier Monate bei der UBS 4,2 Millionen Franken.
Die Credit Suisse strauchelt derzeit von einem Desaster ins nächste: erst der Überwachungsskandal um Iqbal Khan, jetzt verzockte Anlage-Milliarden. Und man fragt sich: Hat hier eigentlich niemand aus der Finanzkrise gelernt? Zumal die CS als systemrelevant gilt, also nicht in Konkurs gehen darf, weil im Notfall der Steuerzahler einspringen müsste.
Dennoch erhielt Verwaltungsratspräsident Urs Rohner 2020 gleich viel wie im Vorjahr: 4,7 Millionen Franken. Wo es sonst immer heisst, hohe Boni seien an gute Leistungen geknüpft …
Die Chefs von Nestlé, Novartis, Roche bezogen jeweils mehr als zehn Millionen. Die Gehälter bei ABB, CS, Lonza und Zurich lagen nicht allzu viel darunter.
Zwar ist die Schweiz ein Land der Grosskonzerne. Und wenn sie sogar in Krisenzeiten funktionieren, ist das gut für Arbeitsplätze, Zulieferer und Steueraufkommen – also für uns alle.
Aber die Entfremdung dieser Kolosse von der Bevölkerung wird umso grösser, als ihre Topmanager in abgeschotteten Teppichetagen residieren, völlig losgelöst von der Lebenswelt der meisten Schweizerinnen und Schweizer. Wenn sie in den gesellschaftlichen Debatten nicht präsent sind, sondern einzig von ihren Aktienkursen getrieben scheinen.
Zum Glück leben wir in einem freiheitlichen System. Da dürfen Aktionäre ihren Managern zahlen, so viel sie wollen. Sogar mitten in der Corona-Krise Milliarden verspekulieren, wie es ihnen beliebt. Und in ihrer eigenen Kunstwelt leben, wenn es ihnen Spass macht.
Aber alles hat seinen Preis.
Die globalisierte Wirtschaft zahlt den Preis für ihre Entfremdung vom Rest der Gesellschaft an der Urne – zum Beispiel bei den Abstimmungen über die Konzernverantwortungs-Initiative oder die E-ID: Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger glauben nicht mehr, was die Wirtschaft sagt.
Wen wunderts?
Schreibt Blick.
Was ist denn das für eine unsinnige Debatte, die der Chefredaktor der Blick-Gruppe, Christian Dorer, verbreitet? Clickbaiting?
Geschätzter Herr Dorer, die Entfremdung der globalisierten Wirtschaft vom Rest der Gesellschaft hat mit dem Corona-Virus nichts zu tun. Sie existiert seit vielen Jahren; lange bevor die Coronapandemie über uns hereinbrach! Das müsste auch dem Boulevard an der Zürcher Dufourstrasse bekannt sein.
Der völlig entfesselte Neoliberalismus der perversen Art hat seit Jahrzehnten eine ihm hörige Polit-Elite rund um den Erdball geschaffen, die in unseren westlichen «Wertegemeinschaften» von uns selbst, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, an den Wahlurnen stets aufs Neue bestätigt wird.
Auch von den Menschen, die von der neoliberalen Abartigkeit nicht einmal profitieren. Und, notabene, vor allem auch und besonders von der frustrierten Gruppe der Nichtwählern*innen, die nicht in der Lage ist zu erkennen, dass sie mit ihrem kindischen Frustgehabe exakt diese «bürgerliche» Klientel unterstützt, die für die absurden Gesetze zum Wohle des legalisierten (!) Raubrittertums verantwortlich ist.
Corona zeigt uns lediglich in seiner gesamten Spannbreite der brutalen Realitäten, was in unseren westlichen Gesellschaften seit mehreren Dekaden falsch läuft. Neiddebatten um Boni und Gehälter der Fürsten der neoliberal dekadenten Dunkelheit sind allerdings schlechte Ratgeber und führen uns nicht weiter.
Ebenso wenig wie Diskussionen um Dividendenzahlungen, auf die unser falsch gesteuertes System der Pensionskassen zwingend angewiesen ist. Was wir bräuchten ist eine grundlegende Systemdebatte über einen regulierten Kapitalismus, die nicht zwangsweise in den Sozialismus oder Kommunismus führen muss.
Wir können gesellschaftlich relevante Veränderungen einzig und allein an den Wahlurnen herbeiführen. Doch leider ist zu befürchten, dass wir spätestens bei den nächsten Parlamentswahlen 2023 das teilweise beschämend unfähige und egoistische Handeln der politischen Akteure während der Coronakrise längst vergessen haben.
Wie beispielsweise die Forderung des Schweizer Parlaments querbeet durch alle Parteien (!) für Sitzungsgelder der ach so ehrenwerten Parlamentariern*innen für Sitzungen, die wegen dem Lockdown 2020, der auch das Parlament umfasste, nie stattgefunden haben.
Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Damen und Herren mit der unsäglichen Spreizwürde der Etablierten aus dem «Hohen Haus mit der abgrundtiefen Moral» hatten tatsächlich die Chuzpe, vom Bund Geld (Steuergeld, wohlverstanden!) für etwas zu fordern, wofür Sie nicht eine einzige Minute gearbeitet haben.
Den Flüchtlingen hingegen gönnen die gleichen Leute nicht mal ein paar Franken fürs Spargelstechen oder Abfallentsorgen!
Zugegeben: Peanuts. Peanuts allerdings, die das verwerfliche Gedankengut des parlamentarischen Raubrittertums gnadenlos aufdecken. Und dies in einer Zeit, in der viele Menschen in der Schweiz ihren Lebensunterhalt mit 80 Prozent des früheren Einkommens bewältigen mussten. Wenn überhaupt! Gelebte Solidarität sieht anders aus.
Dass auch der Feldherr vom Herrliberg und SVP-Gründer Jesus Christophorus Blocher vom Bund Steuergeld in Millionenhöhe ausgerechnet im ersten Jahr der Coronapandemie forderte, zeigt wessen Geistes Kind der Gesalbte in Tat und Wahrheit huldigt.
Krisen trennen die Spreu vom Weizen. Unverschämt verlangte der Wendehals unter Angabe von skurrilen Gründen die Bezahlung seiner Bundesratsrente, auf die er seinerzeit grossgekotzt verzichtet hatte.
Vermutlich wollte er mit den Millionen als Rache die Defizite seiner Gratisblättchen abdecken, die von der Coronakrise hart getroffen wurden, aber keine Hilfsgelder vom «Rettungsschirm» des Bundes erhielten. Das ist meine (unbewiesene) Meinung, die ich darauf abstütze, dass Blocher schon immer ein rachsüchtiger Politiker war.
Erinnern Sie sich noch an die globale Finanzkrise 2009? Politiker*innen der westlichen Wertegemeinschaften überschlugen sich mit Vorschlägen, die überbordende globale Finanzwirtschaft ein für allemal zu zähmen.
Im Schweizer Parlament glänzte damals besonders FDP-Nationalrat Schneider-Ammann mit glühenden Reden über fehlende Moral und Ethik im «systemrelevanten» Banken- und Finanzgewerbe, das zwingend an die Kandare genommen werden müsse.
Doch kaum war der Märchenonkel aus dem Emmental zum Bundesrat gewählt, wanderten seine hehren Überzeugungen in den neoliberalen Abfallkübel seiner FDP. Dafür glänzte er mit Zitaten über Donald Trump, die in Sachen Anbiederung, Dummheit und moralischer Verkommenheit ihresgleichen suchen.
Statt den angekündigten Regulierungen des Banken- und Finanzwesens folgten weltweit weitreichende Deregulierungen, die den «Bankstern» das Agieren in ihren Finanzkasinos auf Kosten der jeweiligen Gesellschaften noch einfacher machen. Und erst noch dauerhaft legalisieren!
Auch diese Fakten (für die Ungläubigen: Google hilft weiter; Sie können meine Aussagen nachprüfen) wurden von uns allen nur zu schnell vergessen und hatten bei den nachfolgenden Wahlen überhaupt keine Wirkung. Als ob nichts geschehen wäre, wählten wir weiterhin wie dumme Osterschafe unsere Metzger selber. Der «bürgerliche» Neoliberalismus mit seinem Hang zu Kleptomanie und Korruption lachte sich einmal mehr ins Fäustchen.
Ich prophezeie Ihnen heute an dieser Stelle: Die Champagnerkorken werden in den neoliberalen Hochburgen der Sch(w)einheiligkeit auch 2023 wieder knallen. Warum? Weil wir so sind, wie wir sind.
Frohe und besinnliche Ostertage allerseits!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
2.4.2021 - Tag des Fastens
Karfreitag: Warum das Ritual des Fastens in vielen Religionen Tradition hat
Moderne Fastenzeiten haben andere Beweggründe. Durch die Pandemie fanden viele Fastenwochen online statt.
Brot, Salz und Wasser, mitunter Hülsenfrüchte, Kräuter, Gemüse und Beeren – das sind die klassischen Fastenspeisen, die im frühen Christentum erlaubt waren. Und man tat gut daran, diese tunlichst einzuhalten, um seinen Glauben zu beweisen. Gefastet wird Jahrhunderte später noch immer, allerdings weniger aus religiösen Gründen. Vielmehr ist das Ritual selbst zum Mittelpunkt geworden. „Für viele ist es wichtig, sich bewusst aus dem Alltag herauszunehmen, für eine Zeit des Reflektierens“, sagt die Fastenbegleiterin und psychologische Beraterin Gini Czernin.
Strenge Fastenzeiten
Die Wienerin leitet im Waldviertler Kloster Pernegg zahlreiche Fastenwochen – vor allem in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karfreitag. Diese 40 Tage gehen auf den überlieferten, ebenso langen Aufenthalt von Jesus in der Wüste zurück. Die strengen Fasttage der katholischen Kirche haben sich im Lauf der Jahrhunderte von rund 150 auf zwei reduziert: Neben dem Aschermittwoch ist dies der heutige Karfreitag. Wer ihn als Katholik streng einhält, nimmt nur eine (Haupt-)Mahlzeit zu sich, selbstredend kein Fleisch oder Alkohol. Vielerorts wird etwa traditionell eine Rahmsuppe (Stosuppe) aufgetischt. Für evangelische Christen zählt der Karfreitag zu den höchsten Feiertagen überhaupt und ist daher ein strikter Fasttag. Orthodoxe Christen sollen überhaupt auf Nahrung verzichten.
Nahrungsverzicht
Das Motiv, durch bewussten Nahrungsverzicht Gott näherzukommen, findet sich nicht nur im Christentum, sondern in allen großen Religionen. Auch die Religionsgründer fasteten: Neben Jesus werden von Buddha, Zarathustra oder Mohammed Fastenzeiten erzählt. Die Gründe sind unterschiedlich; es geht um Buße, Besinnung, innere Einkehr, geistige Klarheit oder Erleuchtung.
Kloster vs. Online
Wer heute aus nicht-religiösen Gründen fastet, hat meist etwas andere Beweggründe, sagt Fastenbegleiterin Gini Czernin. „Es gibt den Bedarf nach einer Auszeit, einem Neustart für Körper und Geist.“ An diesen Bedürfnissen konnte auch die Pandemie nichts ändern. Dennoch verliefen die Kurse heuer anders als sonst – nämlich online.
Czernin war der Unterschied von Anfang an bewusst. „Die Atmosphäre vor Ort kann durch Online-Begleitung nicht ersetzt werden.“ Dennoch nahmen viele die Angebote in Anspruch. „Viele wollten sich in dieser ungewöhnlichen Situation etwas Gutes tun.“ Das Erfreuliche: „Auch in den Zoom-Gruppen entstand im Lauf der Fastenwoche eine richtige Gruppendynamik.“
Basisch oder Saft?
Eine weitere Erkenntnis der erfahrenen Begleiterin: Wer zu Hause, in der gewohnten Umgebung, fasten will, achtet wesentlich mehr auf Zeitpunkt und Thema.“ Gefragter waren etwa Kurse mit Intervallfasten und basischem Fasten. „Ich habe das Gefühl, da traut man sich eher drüber, weil man dabei auch feste Nahrung zu sich nimmt.“ Nur mit Säften, Tee oder leichten Suppen zu fasten, „da ist es schon wichtig, sich die Zeit dafür zu nehmen. Ich hatte auch Teilnehmer, die sich Urlaub genommen haben und die Woche allein im Zweitwohnsitz verbrachten.“ Schreibt KURIER.
Die einen fasten im Ramadan, die andern in der Karwoche. Stetig dicker werden sie trotzdem alle.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.4.2021 - Tag der Aprilwitze
Warum sinkende Arbeitslosenzahlen in Österreich nicht reichen
Es gibt Branchen, die zählen in der Corona-Krise eher zu Gewinnern oder haben sich wacker geschlagen. Da sind zum Beispiel die Baumärkte. Sie waren die meiste Zeit über geöffnet und lockten viele Kunden an, außer heimwerken und garteln war ja mitunter nicht viel erlaubt. Auch die Telekomunternehmen und die Industrie schlugen sich wacker in der Krise. Ebenso gibt es Berufsgruppen, die nichts gespürt haben: Beamte oder Lehrer hatten keine finanziellen Verluste erlitten.
Dann gibt es eine große Gruppe, die von der Krise zwar betroffen war, aber sich durchgeschlagen hat. Da gehören die vielen Menschen in Kurzarbeit dazu, deren Einkommen größtenteils aufgefangen wurde. Auch zehntausende Unternehmer sind Teil dieser Gruppe, die zwar Einbußen erlitten haben, aber nur darauf warten, dass es wieder losgeht.
Und dann gibt es die ganz klaren Verlierer: die Arbeitslosen. Für sie bedeutet die Pandemie nicht nur den Verlust von einem großen Teil ihres Einkommens inklusive weniger sozialer Teilhabe. Auch die staatlichen Hilfen sind für diese Gruppe ausgelaufen, seit Ende 2020 gibt es keine automatische Zuzahlung mehr zum Arbeitslosengeld. Diese Gruppe bekommt jetzt also das, was ihr ohnehin per Versicherung zusteht: das Arbeitslosengeld.
Dieser Tage wird sich in der Statistik ein interessanter Bruch vollziehen, der auf den ersten Blick so aussehen kann, als würde sich die Situation der Jobsuchenden ohnehin entschärfen. Die Zahl der Arbeitslosen wird nämlich erstmals seit Beginn der Pandemie im Vorjahresvergleich sinken.
Wenn das AMS heute, Donnerstag, seine neuen Arbeitsmarktdaten für März vorstellt, ist der relevante Vergleichsmonat dafür der März 2020. Und der hatte es so richtig in sich: Damals wurde der erste Lockdown in Österreich verhängt. 562.000 Menschen seien auf Jobsuche, wurde damals vermeldet.
Die aktuellen Zahlen sind deutlich niedriger. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sprach diese Woche von rund 460.000 Jobsuchende, also 100.000 weniger als zum Beginn der Pandemie. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe. So hat sich die Kurzarbeit auch in Branchen etabliert, in denen das noch vor einem Jahr nicht der Fall war, wo also eher gekündigt wurde. Manche Sektoren, die vor einem Jahr stillstanden, arbeiten heute zudem Vollzeit, allen voran der Bau.
Langzeitarbeitslose rücken nach
So viel zu den guten Nachrichten. Die schlechte lautet: Trotz des beschriebenen Rückganges bleiben die Spuren der Pandemie deutlich zu sehen (siehe Grafik). Derzeit bleiben noch immer rund 100.000 Menschen zusätzlich arbeitslos, als es vor der Corona-Pandemie um diese Jahreszeit der Fall war.
Besonders stark war die Zunahme bei Langzeitarbeitslosen, also Menschen, die seit über einem Jahr nichts mehr finden. Und diese Situation wird sich noch einmal zuspitzen. Zahlen des AMS von Anfang März zeigen, dass aktuell rund 15.000 Menschen schon seit zehn oder elf Monaten eine Stelle suchen, also selbst bald zu Langzeitarbeitslosen werden. Das ist typisch: Kennzeichen des Pandemiejahres war nach einem rasanten Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu Beginn, dass sich viele Menschen, die einmal ihren Job verloren haben, schwer damit taten, wieder etwas zu finden. Im Dezember 2020 gab es zum Beispiel halb so viele Arbeitsaufnahmen wie im Dezember ein Jahr davor.
Länder springen ein
Ein bundesweites Beschäftigungsprojekt oder eine andere gute Idee für die Gruppe der Langzeitarbeitslosen gibt es bisher nicht, in der Koalition haben noch nicht einmal Gespräche dazu begonnen. Die ÖVP lehnt Vorschläge von Gewerkschaften, SPÖ und Arbeiterkammer ab, die ein staatliches Förderprogramm wollen, bei denen Arbeitsuchende für Gemeinden oder karitative Organisationen arbeiten können und vom AMS bezahlt werden. Wifo-Chef Christoph Badelt brachte zuletzt eine abgeänderte Version dieses Vorschlages in Diskussion, er regte vor, dass auch Unternehmen in den Genuss einer solchen Förderung kommen sollen.
Die Lücke beim Bund zum Teil zu schließen versuchen derzeit die Bundesländer, sie haben allesamt eigene Förderprogramme aufgelegt. AMS und Stadt Wien zum Beispiel versuchen Jobsuchende über 50 an die Gemeinde in geförderte Stellen zu vermitteln, bei gut 1.000 ist das bisher gelungen. Das AMS Niederösterreich testet in Gramatneusiedl eine Jobgarantie für Arbeitslose. Das Bildungsministerium hat seit Juli 2020 ein Projekt laufen, um insbesondere Langzeitarbeitslose als Hilfskräfte an Schulen zu vermitteln. Das Ergebnis ist überschaubar: 145 Vollzeitjobs wurden bisher geschaffen, 1.000 sollten es bis Jahresende sein.
Angesichts von mehr als 140.000 Langzeitarbeitslosen ist das aber höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein. Größeren Beschäftigungsprogrammen am zweiten oder dritten Arbeitsmarkt, kann Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) dennoch nichts abgewinnen. Im Ministerium wird darauf verwiesen, dass die üblichen AMS-Programme wie Eingliederungsbeihilfen trotz Pandemie laufen. Dazu kämen eben die diversen Projekte der Länder.
Fix ist, dass die Herausforderungen nicht nur die Gruppe der Langzeitarbeitslosen betreffen. Nachdem zu Beginn der Krise Frauen und Männer etwa gleich stark betroffen waren, zeichnet sich seit dem Herbst auch klar ab, dass Frauen sich mit dem Comeback schwerertun. Die Zahl der arbeitslosen Frauen lag im Februar um 34 Prozent über Vorjahreswert, bei Männern sind es "nur" 22 Prozent. Was die genaue Ursache dafür ist, sei noch unklar, sagt Wifo Ökonom Helmut Mahringer. Allein daran, dass Frauen und Männer in unterschiedlichen Branchen arbeiten und sich die Männerbranchen nun eher erholen, liege es nicht.
Eine Erklärung wäre für Mahringer, dass sich Frauen angesichts der zunehmenden Doppelbelastung mit der Familie in der Pandemie schwerer damit tun, wieder in den Job zurückzufinden. Schreibt DER STANDARD.
«Trau' keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast»: Auch wenn dieses Zitat immer wieder fälschlicherweise Winston Churchill in den Mund gelegt wird, verliert es dennoch nichts von seinem wahren Kern.
Gewisse Statistiken verfügen durchaus über eine gesellschaftliche Sprengkraft die beispielsweise Wahlen oder Umfragen drastisch beeinflussen kann. Da lohnt es sich schon, gewisse Gruppen wie die Langzeitarbeitslosen verschwinden zu lassen.
Diese Kunst der «Statistikbereinigung» ist kein österreichisches Phänomen. Wird – mehr oder weniger – in allen Industrieländern praktiziert. Selbst in den USA.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
Tag der Neolippen
Steuergelder für Immobilienfirmen statt Ladenbesitzer
Das Geld sollte eigentlich den Geschäftsinhabern zugute kommen. Doch es fliesst zum Grossteil an Immobilienfirmen.
Als während der ersten Pandemiewelle vor gut einem Jahr zahlreiche Laden- und Restaurantbesitzer ihre Geschäfte schliessen mussten, dauerte es nicht lange, bis sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen konnten. Damals sind ihnen viele Vermieter entgegengekommen und haben die Mieten gesenkt.
«Tempi passati», sagt Armin Zucker, Vizepräsident des Geschäftsmieterverbandes: «In der zweiten Welle ist die Verhandlungsbereitschaft im Vergleich zum ersten Lockdown merklich gesunken.» Anders als vor einem Jahr würden sich die Immobilienbesitzer inzwischen bewusst zurükhalten.
Die Zurückhaltung der Vermieter komme nicht von ungefähr, so Zucker. Viele Vermieter zählten darauf, dass bald Härtefallfelder fliessen würden. Solche À-fonds-perdu-Beiträge der öffentlichen Hand dienen zur Deckung der übrigbleibenden Fixkosten der geschlossenen Betriebe.
Steuerzahlende finanzieren Immobilienbesitzer
In der Praxis bedeutet das, dass die Steuerzahlenden die unnachgiebigen Vermieter jetzt indirekt über die Härtefallgelder finanzieren. Eine Entwicklung, die auch der Hauseigentümerverband nicht abstreiten mag.
Die Härtefallgelder seien dazu gedacht, die Zahlungsfähigkeit bei den Unternehmen aufrechtzuerhalten, erklärt Markus Meier, Direktor des Hauseigentümerverbands. Dies, damit diese «ihren Verpflichtungen gegenüber den Vermietern nachkommen können, die ja wiederum auch ihre Verpflichtungen zu erfüllen haben.»
Bei den Geschäftsinhabern und Wirten macht sich unterdessen Unmut breit. Anders als Laden- und Restaurantbesitzer habe die Immobilienbranche in der Krise nicht gelitten, erklärt Armin Zucker. Es sei ein Fehler gewesen, dass das Parlament letztes Jahr eine generelle Mietzinsreduktion abgelehnt und damit «die Chance für eine faire Lösung» verpasst habe.
Das damals vorgebrachte Argument, dass sich Vermieterinnen und Vermieter kulant zeigen würden, habe sich leider als falsch erwiesen, so Zucker. «Das Parlament hat sich von der Immobilienlobby täuschen lassen. Die hat eine gütliche Einigung versprochen und bricht jetzt ihr Wort.»
Diese Kritik will der Hauseigentümerverband nicht gelten lassen. Er rufe seine Mitglieder dazu auf, sich mit ihren Mietern zu einigen, heisst es vom Verband. Ob die dazu besonders motiviert sind, wenn bald Härtefallgelder fliessen, ist allerdings fraglich.
Immobilienfirmen: Beispiel Swiss Life
Eine der grössten Immobilienfirmen Europas.
Umsatz Vermögensverwaltung 2020: 345 Millionen Franken (plus 12 Prozent), 22 Prozent der Vermögenswerte sind Immobilien.
Swiss Life schreibt: «Mit konstruktiven und pragmatischen Lösungen hat Swiss Life Mieterinnen und Mieter unterstützt, die aufgrund der angeordneten Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind.»
Swiss Life hat seine Dividende fürs letzte Jahr erhöht. Grossaktionäre sind unter anderem UBS Fund Management AG (3 Prozent) und BlackRock Inc. (5 Prozent).
Immobilienfirmen: Beispiel PSP Swiss Property
Besitzt Geschäftsliegenschaften in der Schweiz, vor allem Büroflächen. Von den Schliessungen waren die Mieter von 19 Prozent der Flächen, die PSP besitzt, betroffen.
Betriebsgewinn 2020: 271 Millionen Franken, plus 5.8 Prozent, dank steigenden Mietzinseinnahmen.
Mietzinserlasse 2020 im Umfang von 4.6 Millionen.
PSP hat im letzten Jahr 97 Prozent der Mietzinsen eingenommen und die Dividende fürs letzte Jahr erhöht. Grossaktionäre sind unter anderem Black Rock (6 Prozent), die Credit Suisse Funds AG (5 Prozent) und das UBS Fund Management (3 Prozent)
Schreibt SRF.
«Steuergelder für Immobilienfirmen statt Ladenbesitzer»: Diesen Satz werden sich die grossen Schweizer Immobilienfirmen und deren Stakeholder wie der US-Gigant BlackRock, die CS, UBS usw. erst mal genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Auch wenn es sich dabei in diesen Zeiten der Not um die «brutalstmögliche»* Bankrotterklärung gegenüber der Solidarität einer von Gier zerfressenen Spezies handelt, die in der Krise im Gegensatz zu den Mietern*innen nicht gelitten hat.
Es ist aber auch die Bankrotterklärung der Ständeräte*innen der pervers neoliberalen, «bürgerlichen» Parteien der CVP (neu «Die Mitte»), SVP und FDP, die eine generelle, von einigen Parlamentariern*innen geforderte Mietzinsreduktion versenkten. Unter ihnen, wen wunderts, der solariumgebräunter Luzerner Pöstchenjäger und FDP-Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller, der – sieh mal an! – in einem 40%-Pensum als «Spezialist Group Communication» bei der SwissLife arbeitet.
Nie trennt sich bei den politischen Eliten die Spreu vom Weizen augenfälliger als in Zeiten der Krise und der Not. Die unsäglichen persönlichen Bereicherungen der handelnden Akteure aus den Parlamenten – Stichwort «Maskenskandale» – sind nur die Spitze des Eisbergs. Doch bevor wir der Empörung freien Lauf lassen, sollten wir uns die Frage stellen, warum wir solche Menschen überhaupt gewählt haben, wohl wissend, welch' abartigen Thesen diese Apologeten des ungezügelten Neoliberalismus nachhängen.
«Nur die allerdümmsten Schafe wählen ihren Metzger selber» sagt der Volksmund, leicht abgewandelt, weil ja in ein paar Tagen das Osterfest gefeiert wird. Leider ist anzunehmen, dass wir dieses Zitat bis zu den nächsten National- und Ständeratswahlen (2023) längst wieder vergessen haben. Oder unseren Frust als Nichtwähler*innen ausleben. Dabei wäre es so einfach, diese widerwärtigen Glücksritter der Neolippen an der Urne ein für allemal abzuwählen.
* Copyright by CDU-Politiker Roland Koch
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
30.3.2021 - Tag des Trivialen
Sven Epiney und sein Verlobter verraten die 10 Geheimnisse ihrer Liebe: «Wenn wir uns anschauen, steht die Welt still»
Seit zehn Jahren gehen TV-Moderator Sven Epiney und sein Partner Michael Graber gemeinsam durchs Leben. BLICK verraten die beiden, was die Geheimnisse ihrer harmonischen Beziehung sind.
Dieses Wochenende feierte das berühmteste Männerpaar der Schweiz sein Liebesjubiläum: Sven Epiney (49) und Michael Graber (28) sind seit zehn Jahren zusammen. Der TV-Moderator schrieb im März 2019 TV-Geschichte, als er bei der SRF-Tanzshow «Darf ich bitten?» seinem Partner einen Heiratsantrag machte, den dieser sichtlich bewegt annahm. Schliessen die beiden nun im Jubiläumsjahr den Bund fürs Leben? «Wir haben keine Eile», erklärt Michael Graber. «Unser Ziel ist es, dieses Jahr eine schöne Location zu finden und uns dann nächsten Sommer oder Herbst das Jawort zu geben.» Doch was macht Epiney und Graber, die stets harmonisch und vertraut wirken, zu einem solchen Traumpaar? BLICK verraten die beiden zum ersten Mal ihre zehn Liebesgeheimnisse.
1) Verliebt wie am ersten Tag
Wir ertappen uns oft im Alltag, wie wir uns anschauen. Dann scheint einen Moment lang die Welt stillzustehen, wir lachen uns an, wissen, wir gehören zusammen. Das sind unsere kleinen Magic-Moments. Oft nehmen wir uns auch in den Arm und schauen uns dabei bewusst in die Augen.
2) Ähnlich sein und doch verschieden
Wir sind beide sehr individuell und eigenständig, haben aber eine ähnliche Lebenseinstellung. Wir respektieren uns gegenseitig und können uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen. Wir sind beide sehr begeisterungsfähig und entdecken gerne die Welt. Die vielen gemeinsamen Interessen und doch individuellen und unterschiedlichen Herangehensweisen machen unsere Beziehung spannend und abwechslungsreich.
3) Kommunikation ist der Schlüssel
Wir reden viel und gerne miteinander und zu unserem Erstaunen gehen uns die Themen nie aus (lachen). Kommunikation ist bei uns einer der Schlüssel für eine gut funktionierende Beziehung. Aber wir verstehen uns wirklich auch blind! Wir haben beide ein gutes Bauchgefühl und wissen meist auch ohne Worte, was der andere denkt.
4) Mut zur Meinungsverschiedenheit
Es ist wichtig, den Charakter des anderen zu akzeptieren und nicht zu versuchen, einander zu verändern. In eine harmonische Beziehung gehört bei uns aber auch die Individualität und Meinungsverschiedenheit. Wir diskutieren und argumentieren gerne kontrovers und intensiv. Versuchen aber stets, Meinungsverschiedenheiten vor dem neuen Tag zu klären.
5) Das Knistern aufrechterhalten
Wir versuchen, im Alltag keine Routine aufkommen zu lassen und uns Zeit für Romantik zu nehmen. Da bei uns jeder Tag anders aussieht, erleichtert es das Ganze. Oft sind es auch die kleinen Sachen, mit denen wir uns gegenseitig überraschen und dem andern eine kleine Freude bereiten. Wie etwas Feines zum Zvieri beim Beck holen oder den anderen spontan mit der Vespa vom Arbeitsplatz abholen.
6) Zusammen abschalten
Ein wichtiger Punkt in jeder Beziehung ist, sich im stressigen Alltag bewusst Zeit füreinander zu nehmen. Das ist enorm wertvoll. Gemeinsam tauchen wir gerne in die Natur ein und lüften unsere Köpfe zum Beispiel beim täglichen Spaziergang mit unseren Hunden. Natürlich sehen wir uns auch gerne eine Serie zusammen an, im Moment ist es die Agentenserie «Blacklist» auf Netflix.
7) Dem anderen seinen eigenen Raum lassen
Zeit für sich braucht jeder. Wir schaffen uns kleine Zeitinseln, in denen jeder für sich selbst seinen individuellen Tätigkeiten oder Hobbys nachgehen kann. Sven ist der vielseitige Handwerker im Haus, hängt Bilder und Lampen auf. Michael ist der kreative Kopf in der Küche und sorgt mit seinem grünen Daumen für ein behagliches Wohngefühl.
8) Gemeinsam Zeit mit Freunden und Familie geniessen
Da wir beide grosse Familienmenschen sind, verbringen wir auch gerne und oft gemeinsam Zeit mit unseren Familien und Freunden – das ist uns sehr wichtig. Da machen wir dann einen Jass zusammen oder spielen ein Brettspiel. Es ist wunderschön, dass sich alle so gut verstehen.
9) Abwechslung auch in den Ferien
Reisen ist eine Leidenschaft, die wir beide teilen. Wir lieben es, mit unserem VW-Bus loszufahren und spontan auf einen kleinen Roadtrip zu gehen. Wir mögen es aber auch, neue Länder und Kulturen zu entdecken. Daher wechseln sich Action-Ferien mit ruhigen Mal-nichts-Tun-Tagen ab. Tipp: Das Handy in den Ferien für ein paar Tage einfach ausgeschaltet lassen.
10) Liebe geht durch den Magen
Sven zaubert an den freien Sonntagen oft ein leckeres Frühstück ans Bett. Da kann es auch mal selbst gemachtes Brot, Egg Benedict auf Avocado-Fächer und frische Pancakes mit feinen Früchten geben. Michael mag besonders die asiatische Küche und serviert ein pikantes Curry, eine Poke-Bowl oder selbst gemachte Momos mit leckerer Füllung und passender Garnitur. Schreibt Blick.
Egg Benedict auf Avocado-Fächer.
Arthur Schopenhauer: «Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungsleer, von aussen gesehen, und wie dumpf und besinnungslos, von innen empfunden, das Leben der allermeisten Menschen dahinfliesst. Es ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebenalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken.»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.3.2021 - Tag der Polit-Schwergewichte
Pierre Maudet scheitert: Das Ende und der Anfang einer Ära
Es war ein kurzes Warten auf die Resultate und ein sehr klarer Ausgang der Ersatzwahl. Bereits vor 13 Uhr war klar: Fabienne Fischer komplettiert ab Ende April den Genfer Staatsrat.
Es war eine historische Wahl. Nicht wegen der Gewinnerin, sondern wegen ihres stärksten Kontrahenten: Pierre Maudet. Dieser erzielte über 30 Prozent der Stimmen, wurde von Fischer aber klar auf Abstand gehalten.
Es wäre eine grosse Überraschung gewesen, wenn Pierre Maudet die Wahl gewonnen hätte. Nicht in erster Linie wegen seiner Vorgeschichte, sondern weil links der Mitte Fabienne Fischer die einzige Kandidatin war – wohingegen Maudet das Feld mit dem SVP-Nationalrat Yves Nidegger und der Präsidentin der Genfer CVP, Delphine Bachmann, teilen musste. Rein mathematisch gesehen haben diese beiden Kontrahenten einen Sieg Maudets fast verunmöglicht.
Abschied – aber für immer?
Ohne Partei und ohne politisches Amt wird Pierre Maudet nun zwangsläufig über seine Zukunft nachdenken müssen. Das werde er tun, abseits vom Rampenlicht, bestätigte er gegenüber den Medien. Möglich, dass er sich für die Gesamterneuerungswahlen 2023 in Position bringen wird. Denn die Politik sei und bleibe seine Berufung.
Eines bleibt aber unbestritten: Pierre Maudet geniesst weiterhin das Vertrauen eines beachtlichen Teils der Genfer Bevölkerung; jede dritte Stimme ging an ihn, und er wurde sogar vom Genfer Wirtschaftsverband offiziell unterstützt.
Ausserdem war seine Kampagne beeindruckend. Maudet gelang es, sich als Anti-Establishment darzustellen, obwohl er die letzten neun Jahre selber Mitglied der Genfer Regierung war. Zudem schaffte er es, mit seinen Auftritten in den sozialen Medien und mit seinem Beratungsdienst die Bevölkerung direkt anzusprechen. Ein wahres Polit-Schwergewicht.
Hoffen auf politische Ruhe
Der Staatsrat und viele Genferinnen und Genfer hoffen nun, dass mit dem Abschied von Pierre Maudet Ruhe einkehrt in der Regierung. Die letzten Jahre waren nervenaufreibend, oft hatte man das Gefühl, die Regierung sei in erster Linie mit sich selbst und ihren internen Querelen beschäftigt. Die etlichen Reorganisationen der Departemente haben dabei sicher nicht geholfen.
Ab dem 29. April beginnt auch aus einem anderen Grund eine neue Ära in der Genfer Regierung: Der Kanton Genf wird nun von einer links-grünen Mehrheit regiert, wie zuletzt vor mehr als zehn Jahren. Schreibt SRF.
Dass ein Politiker wie Pierre Maudet (ehemals FDP), dessen Namen in letzter Zeit fast nur noch im Zusammenhang mit Korruption genannt wurde, vom Genfer Wirtschaftsverband offiziell unterstützt wird und über 30 Prozent der Stimmen erhält, sagt nicht nur einiges über den Genfer Wirtschaftsverband aus, sondern auch über die (noch verbliebenen) Stimmbürger*innen.
Die erstinstanzliche Verurteilung Maudets wegen Vorteilsannahme – immerhin ging es um 50'000 Franken – und seine Lügen um die Reise nach Abu Dhabi scheinen ein reines Kavaliersdelikt zu sein. «Das ist halt so bei Politikerinnen und Politikern», so das übliche Statement.
«Ein wahres Polit-Schwergewicht», wagt die Tante von SRF den ehemaligen Freisinnigen auch noch überschwänglich zu loben. Allerdings ein Schwergewicht frei von Sinnen bezüglich Anstand, Moral und Ethik. Diese Begriffe scheinen auch beim Zwangsgebührensender und Mirjam Mathis unter den Tisch gefallen zu sein.
Maudet kann das nun alles egal sein. Er erhält als ehemaliger Genfer Staatsrat eine lebenslange Rente von rund 90’000 Franken pro Jahr.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
28.3.2021 - Tag der toxisch kontaminierten Wörter
Alex Frei gibt Gas: «Ich traue der Nati den EM-Final zu»
Wenn er spricht, gibts Klartext. Alex Frei (41) über die Nati, Spieler im Lamborghini, Geheimgespräche mit Sion und die Entwicklung beim FC Basel. Und warum ihm Jadon Sanchos Einstellung und der Champions-League-Modus nicht passen.
SonntagsBlick: Alex Frei, lassen Sie sich impfen?
Alex Frei: Ich habe mich registriert und angemeldet. Meine Frau auch.
Sollen Profisportler vorher geimpft werden, damit man eine EM durchpauken kann?
Man darf den Sport sicher nicht über Menschenleben stellen. Die anfälligsten Menschen sollen zuerst geimpft werden. Meine Frau und ich machen es auch, weil wir, so sind wir der Meinung, auch flexibler sind für Besuche im Ausland. Ich denke, wir werden eh als Familie in der Schweiz bleiben, das wird meine Frau bald in die Hand nehmen. In der fussballfreien Zeit bestimmt sie. Vielleicht gehen wir auch ins Wallis.
Das ist gut, dann haben Sie zum Trainingsauftakt nur einen kurzen Anfahrtsweg zum FC Sion.
(Lacht.) Coole Frage, banale Antwort: Ich bin entspannt und der FC Wil muss sich keine Gedanken machen. Solange ich nicht im Büro des Präsidenten Maurice Weber stehe und sage, ich will gehen.
Aber Sie haben ihn informiert, als Sie sich mit Christian Constantin getroffen haben?
Selbstverständlich. Ich bin transparent. Ich bin keiner, der den Klub hintergeht. Ich habe auch als Spieler nie irgendwelche Lippenbekenntnisse gemacht und das Wappen geküsst, um danach wegen 2 Franken 50 mehr Lohn den Klub zu wechseln. Ich bin auch mit Sebastian Kehl im regelmässigen Austausch, darum hatte ich aber auch nicht die Hoffnung, BVB-Trainer zu werden.
Reizt es Sie, nach Sion zu gehen?
Der FC Sion hat einen Trainer und dies sollte man respektieren.
Das ist kein Nein. Und CC will Sie. Über was haben Sie denn mit ihm geredet?
Über Gott und die Welt. Über die Entwicklung des Schweizer Fussballs.
Die Strukturen des FC Sion hat er Ihnen nicht erklärt?
So viel Zeit hatten wir gar nicht.
Sie verhandelten auch mit Hannover, sagten wegen der schwierigen Verhältnisse dort ab. In Sion müsste man Ihnen doch auch sagen: Sie sind vom Wahnsinn umzingelt, wenn Sie als 41-jähriger Jung-Trainer Ihren Ruf aufs Spiel setzen.
Ich sehe das ein wenig anders. Entspannter. Ich bilde mir immer eine Meinung über Leute, die ich kennenlerne. Und entscheide danach oft nach Bauchgefühl, nicht immer nach Verstand. Weil mich der Verstand auch schon im Stich liess.
Wann?
Nehmen wir meinen Nati-Rücktritt 2011. Im Nachhinein hätte ich gar nie den Rücktritt öffentlich geben sollen, sondern es einfach stets Ottmar Hitzfeld überlassen, ob er mich aufbieten will. Übrigens ist dies auch heute Ottmars Meinung, da wir einen sehr guten Austausch pflegen.
Wie sehen Sie die Nati heute?
Wir haben unglaublich talentierte Spieler, die heute auch dominant sind in ihren ausländischen Klubs. Sommer, Akanji, Elvedi, Xhaka, Freuler, Zakaria, Gavranovic oder Seferovic zähle ich da alle dazu. Bei diesen Spielern merkt man es in ihren Klubs, wenn sie ausfallen. Und das ist ein Kompliment. Besonders wie Xhaka sich durchgesetzt hat, imponiert mir.
Er hatte brutale Widerstände bei Arsenal.
Mittlerweile ist TV-Experte ja auch ein Job, der unglaublich gut bezahlt ist. Dann kannst du nicht immer Floskeln rauslassen, sondern musst auch kritisieren. Alle mal runterzufräsen, das fällt dir einfacher, wenn du einen Hammer-Vertrag hast.
Sie sind bei Blick TV höchst willkommen.
Ich bin viel zu teuer für euch (lacht) … Nein, aber zu Granit und den anderen Unverzichtbaren in ihren Klubs: Ihr Selbstverständnis und Selbstvertrauen gibt der Nati ein ganz anderes Auftreten. Und darum kann es interessant werden an der EM.
Erreicht man dann endlich mal den Viertelfinal?
Ich traue der Nati den Final zu. Aber auch das Ausscheiden in der Vorrunde. Es wird ein komisches Turnier, mit den Corona-Umständen und ohne Fans.
Sind Sie sicher? Uefa-Boss Aleksander Ceferin erzählte was anderes.
Ich denke, es ist utopisch, zu glauben, dass die Nati in Rom vor Fans spielt im Juni. Wir im Fussball müssen auch unsere Vorbildfunktion wahrnehmen. Es ist aber auch klar, dass zur neuen Saison Lösungen gefunden werden müssen, um zumindest einen Teil der Zuschauer wieder in das Stadion zu lassen.
Ist es die talentierteste Nati aller Zeiten?
Talent ist eine besondere Begabung. Das heisst noch gar nichts, das macht vielleicht 20 Prozent aus. Im nächsten Schritt zählen Umfeld, Selbstmanagement, Wille, Mentalität, Gier, Klubs, Trainer und so weiter. Sicher sind alle unsere Jungs in der Nati sehr gut, aber in der Kreativität nach vorne fehlt uns der Spieler, der im Klub dominant ist. Da fehlt der letzte Zwick.
Sie meinen Xherdan Shaqiri.
Shaq hat das Können, dieses Instinktive. Als Schweizer Nati kannst du theoretisch nicht auf Shaq verzichten. Aber wenn er selten spielt, ists heikel.
Er wird 30 im Herbst. Sollte er Ergänzungsspieler bei Liverpool bleiben oder doch mal eine Stufe runter und sich als Stammspieler beweisen?
Er hat eine fantastische Karriere, was Titel und Klubs anbelangt. Aber es muss jeder für sich selbst wissen, ob ihm 10, 15 Spiele reichen und man sich dafür deutscher und englischer Meister nennen kann. Oder ob man lieber zu einem Klub mit anderen Ambitionen geht und 36 Spiele macht.
Schön ausgewichen.
Jeder muss es doch selber für sich bestimmen, was ihn glücklich macht. Ich verstehe ihn, dass er bei Liverpool bleibt, um die Grenze auszuloten. Und er hat einen sehr guten Trainer, der ihn immer weiterbringen kann.
Ein Thema, was viele Funktionäre in der Liga unter der Hand aufregt, ist das Auftreten der Nati-Stars. Dass man in einer Zeit, in der die Klubs um Subventionen vom Bund kämpfen, mit dem Lamborghini vorfährt.
Man muss einfach immer wissen, welche Botschaft man damit sendet. Mir ist es egal, ob einer im Fahrrad oder im Helikopter kommt. Ich würde nicht Leute anhand der Kleidung oder des Autos definieren. Aber was ich sagen kann: Wenn einer mit dem Lamborghini kommt, muss er einfach verdammt gut sein. Cristiano Ronaldo kann von mir aus fünf Mal pro Woche mit dem Privatjet nach Madeira fliegen – der darf das, weil er immer in Form ist und liefert, seit zehn Jahren. Was aber heute noch dazukommt, ist die Vorbildfunktion gegenüber dem Klimawandel.
Sie fuhren auch Jaguar und kamen nie damit zur Nati. Eine Generationen-Frage?
Man darf und sollte auch nicht Generation zu sehr vergleichen oder gegenseitig ausspielen. Man muss auch lernen, sie zu verstehen. Darum lese ich auch viel Studien über die Generation Z. Mein Eindruck als Trainer ist aber schon: Junioren kommen ins Training der ersten Mannschaft und verstehen nicht, um was es geht. Dass ihnen eine einmalige Chance gegeben wird. Sie treten gleichgültig auf, da fehlt mir der Durchhaltewillen, die Geduld der Jungs. Wenn sie zwei-, dreimal Ersatz sind, beginnen viele zu hyperventilieren. Unsere Generation war «friss oder stirb», überspitzt gesagt. Da führte kein Trainer mit dir dreimal monatlich ein Vier-Augen-Gespräch. Da schaute kein Talent-Manager mit dir Videos an. Da war kein Spielerberater, der dir half. Aber das Schöne ist auch heute noch, dass die Besten sicher immer durchsetzen werden. Es kommt aber noch die Verantwortung der Klubs dazu.
Inwiefern?
Früher hast du den Ist-Zustand gekauft. Also, wenn ein 27-Jähriger eine gute Saison machte, hast du ihn verpflichtet. Heute holst du das Potenzial. Du kaufst einen, wenn du ihn in zwei Jahren wieder teuer weiterverkaufen kannst. Das geht beim 27-Jährigen nicht mehr. Die Konsequenz ist: Alle wollen junge Spieler holen, die alle dann mindestens ein halbes Jahr brauchen, um sich einzugewöhnen.
Das ist mit ein Grund, warum gute Spieler wie Nsame oder Fassnacht, beide 27, immer noch bei YB sind.
Und weil Christoph Spycher sie nicht für 1 Franken 50 verkauft, ja.
Sie sind nun Coach. Stellen Spieler heute auch mehr Ansprüche an den Trainer?
Ja, das kann man schon so sagen. Sie sind viel wissensbegieriger. Die Problematik auf hohem Niveau hat aber Lucien Favre zu spüren bekommen: Junge Spieler wollten bei Dortmund nicht mehr umsetzen, was er ihnen sagte. Während sich der eine oder andere wohl mehr überlegte, wie er am Sonntag nach dem Spiel möglichst schnell im Privatjet nach London kommt. Statt sich zu fragen, wie sich sein Körper richtig regeneriert, dass er den nächsten Schritt machen kann. Für mich sind coole Spieler immer jene, die von 34 Spielen 26, 27, 28 Mal ihre Leistung gebracht haben.
Also lieber Robert Lewandowski als Jadon Sancho.
Lewandowski macht 24 Stunden, von der Ernährung, Erholung und Schlaf alles, um gierig zu sein. Auf den Gerd-Müller-Rekord. Und er holt ihn, davon bin ich überzeugt.
Sancho war wegen eines Goldsteaks auf Dubai in den Schlagzeilen.
Ich würde nie eines bestellen. Vor den Fotos wusste ich nicht mal, dass es so was gibt … Ich stelle mir halt die Frage: Gebe ich das Geld aus für eine 30-Meter-Yacht oder nicht? Dann reut es mich – und ich gehe in ein schönes Kinderhotel (lacht).
Gut, das Problem ist, dass alles mit dem Handy dokumentiert wird.
Ja, wir sind halt anders aufgewachsen. Mit 17 hatte ich auch eins, aber das war ein Dinosaurier-Knochen im Vergleich zu heute. Ich bin kein Befürworter dieses unglaublichen Mitteilungsbedürfnisses. Erst wollen sie alles von sich preisgeben, und wenn es dann Kritik auf Social Media gibt, fangen sie an zu heulen. Das passt mir nicht, weil es immer zwei Seiten der Medaille gibt – auch wenn ich diese anonymen Beleidigungen schärfstens verurteile.
Sind Ihre Spieler anders mit Instagram?
Ich kriegs ja nicht mit erst mal, weil ich ja kein Instagram und so habe ... Aber klar, wenn wir im Bus sitzen, sind da schon ein paar am Handy. Spieler wie Silvio und Philipp Muntwiler bilden da eher die Ausnahme. Wobei ich auch schon Spieler gesehen habe, die ein Buch lesen, also die Hoffnung ist noch da (lacht). Für mich müssen aber allgemein alle im Fussball lernen, wieder auf den Boden zu kommen.
Das ist schwierig, solange die Gehälter so weit weg von normalen Menschen bleiben.
Da gebe ich Ihnen teilweise recht, die Saläre sind explodiert. Gerade für den Durchschnitt wird zu viel bezahlt. Aber das kommt von den Wettbewerben. Vielleicht bin ich ein Dinosaurier, aber für mich müssten in der Champions League nur die Meister spielen. Hin- und Rückspiel und «tschau zäme». Wenn man aber nun beginnt, Regeln zu machen, die es verunmöglichen, als Schweizer Meister irgendwann mal dabei zu sein, dann müssen wir aufhören. Aber immer auf den Fussball zu zeigen, ist mir zu einfach. Oder wie erklären Sie sich, dass Boni bezahlt werden in der Privatwirtschaft in der Corona-Zeit, aber Stellen abgebaut werden? Um aber auf den Fussball zurückzukommen. Wenn der Premier-League-Elfte irgendwie noch Champions League spielen darf, lach ich mich kaputt.
Es geht um Historie, wer mal was geleistet hat.
Ja, aber wenn wir so was diskutieren, dann müssen wir Kaiserslautern aus der dritten deutschen Bundesliga irgendwie in die Champions League bringen. Rot-Weiss Essen, Nürnberg oder Sheffield. Nein, aufhören.
Na ja, Geld regiert die Welt. Und der asiatische Markt will hundert Mal Barcelona gegen ManCity sehen.
Man darf nie vergessen, wer die Champions League bildet. Nicht die Asiaten. Sondern die Europäer. Ich bin hundert Prozent überzeugt: Macht man eine Umfrage beim englischen, deutschen oder italienischen Fan, dann sind 80 Prozent wieder für eine Champions League mit nur Champions.
Wie sehen Sie denn den Modus in der Schweiz?
Er ist okay. Aber wenn man den nächsten Schritt machen will, muss man ihn ändern.
An was denken Sie?
Rein sportlich: Ich glaube, man könnte mit 14 bis 16 Klubs in der Super League spielen, mit GC, Xamax, Aarau und Thun aus der Challenge League. Auch Schaffhausen oder Winterthur hätten das Potenzial dazu. Die Liga würde besser, die Mannschaften auch und somit auch die Spieler. Und auch in der Challenge League könnte man auf 16 bis 18 Teams ausbauen. Ich glaube, der Schweizer Fussball würde damit einen Schritt vorwärtsmachen. Am Ende müssen es immer sportliche Kriterien bleiben, keine anderen.
Wie schauen Sie Ihren Abgang beim FC Basel im Nachhinein an?
Es wird dann schwierig, wenn sich Leute grösser sehen als der Verein. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.
Sie behaupteten bei Ihrer Vorstellung in Wil, dass Sie nie FCB-Trainer werden wollten. Wie passt das zusammen, dass Sportchef Ruedi Zbinden mit Ihnen bereits einen Vertrag als Cheftrainer ausgearbeitet hatte?
Heute würde ich mich vielleicht ein wenig anders ausdrücken. Präziser und direkter.
Wenn David Degen den Klub übernimmt: Werden Sie neuer Trainer?
Ich habe null Ahnung, ob er den Klub übernimmt oder nicht. Ich habe etwa so viel Ahnung wie vom FC Sion. Schreibt SonntagsBlick.
Das Wort «Gas» ist toxisch kontaminiert und steht auf dem Index, lieber Alex Frei.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
27.3.2021 - Tag der Monotheisten
Iran und China schmieden enge Wirtschafts-Kooperation
Teheran und Peking schmieden offenbar einen »politischen, strategischen und wirtschaftlichen Pakt für die nächsten 25 Jahre. Das Abkommen beinhaltet unter anderem chinesische Investitionen in den iranischen Energie- und Infostruktursektor.
Iran und China wollen an diesem Samstag ein umfassendes und langfristiges Kooperationsabkommen unterzeichnen. Der auf 25 Jahre angelegte Pakt enthalte «politische, strategische und wirtschaftliche» Vereinbarungen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Chatibsadeh, im Staatsfernsehen. Unterzeichnet werden soll das Abkommen demnach anlässlich des derzeitigen Besuchs von Chinas Außenminister Wang Yi in Teheran.
Nach Angaben der iranischen Staatsmedien und der »South China Morning Post« beinhaltet der Vertrag unter anderem chinesische Investitionen in Irans Energie-, Verkehrs- und Infostruktursektor.
Yi war am Freitagabend in der iranischen Hauptstadt eingetroffen. Die Unterzeichnung des Kooperationsabkommens soll heute um die Mittagszeit erfolgen.
Teheran sei der Ansicht, dass das Abkommen »sehr effektiv zur Vertiefung der chinesisch-iranischen Beziehungen« beitragen könne, sagte der Regierungssprecher laut Staatsmedien. Er erinnerte an den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Teheran vor fünf Jahren, bei dem der Grundstein für die umfassende Kooperationsvereinbarung gelegt worden sei.
Xi und sein iranischer Kollege Hassan Ruhani hatten damals eine Stärkung der bilateralen Beziehungen ihrer Länder beschlossen. International steht Iran wegen seiner Atompolitik in der Kritik. Schreibt DER SPIEGEL.
Wo die hehre westliche Wertegemeinschaft versagt, ist die aufstrebende Weltmacht aus Asien nicht fern. Selbst muslimische Länder ergreifen die dargebotene Hand, auch wenn der chinesische Partner die (sunnitischen) Muslime der Uiguren zu Hunderttausenden einsperrt.
Was sagt uns das? Wenn es ums liebe Business und damit ums Geld geht, verlassen auch muslimische Staaten den Pfad der so viel gepriesenen muslimischen Tugenden. Auch wenn der Iran von der schiitischen Glaubensrichtung des Islams geprägt ist, sind die sunnitischen Uiguren letztendlich Glaubensbrüder- und Schwestern. Selbst der sunnitische Sultan und Hardcore-Islamist vom Bosporus, Recep Tayyip Erdogan, schweigt beim Thema «Uiguren» beharrlich, wie auch die Salafisten aus Saudi Arabien.
Fazit: In Bezug auf die Verlogenheit bleiben sich die Eliten der monotheistischen Weltreligionen tatsächlich nichts schuldig.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
26.3.2021 - Tag der Lagunen
Neue Anlegestelle – Venedig verbannt riesige Kreuzfahrtschiffe
Kreuzfahrtschiffe in Venedig dürfen künftig nicht mehr in der Nähe des Markusplatzes anlegen. Nach Regierungsangaben müssen sie künftig im Industriehafen der norditalienischen Stadt vor Anker gehen.
Mit dieser Entscheidung solle ein kulturelles und historisches Erbe geschützt werden, das nicht nur Italien, sondern der ganzen Welt gehöre, hiess es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung der Ministerien für Kultur, Tourismus, Umwelt und Infrastruktur.
Der Industriehafen sei eine vorübergehende Lösung, erklärten die Ministerien. Sie riefen zu Vorschlägen für eine endgültige Lösung des Problems mit dem Schiffsverkehr in Venedig auf. Es solle ein neues Schiffsterminal ausserhalb der Lagune der historischen Stadt geschaffen werden.
Vor der Corona-Pandemie waren mit den Kreuzfahrtschiffen jedes Jahr Millionen Besucher in die Lagunenstadt geströmt. Von den riesigen Schiffen verursachte Wellen schaden den Fundamenten der zum Weltkulturerbe gehörenden Lagunenstadt Venedig und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune.
Die extrem nahe vor der Küste fahrenden Schiffe stellen zudem eine Gefahr für andere Schiffe dar. Auch andere Kreuzfahrtziele leiden unter den Folgen des Massen-Kreuzfahrttourismus. Schreibt BLICK.
Endlich, kann man da nur noch seufzen. Und so hat die Corona-Pandemie politisch ein positives Umdenken bewirkt, wozu die italienischen Politiker*innen bisher unfähig waren.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.3.2021 - Tag des Balkans
Illegale Wett- und Glücksspiele: Luzerner Polizei nimmt sieben Personen fest
Zusammen mit der interkantonalen Geldspielaufsicht (gespa) hat die Luzerner Polizei am letzten Samstag an zwei Standorten im Kanton Luzern koordinierte Aktionen durchgeführt. Wegen Verdachts auf illegale Wett- und Glücksspiele sowie wegen Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz wurden in Luzern und Emmenbrücke insgesamt sieben Personen festgenommen.
Die koordinierte Aktion hat in der Stadt Luzern und in Emmenbrücke stattgefunden. Die Luzerner Polizei hat am Samstag (20. März 2021), nach 23.00 Uhr, an zwei Standorten Hausdurchsuchungen durchgeführt. Insgesamt wurden 37 Personen kontrolliert. Sieben Personen wurden festgenommen. Die verdächtigen Personen stammen aus Albanien (1), der Schweiz (1), Serbien (4) und der Türkei (1).
An den beiden Standorten wurden mehrere Glücksspielautomaten, Wettterminals und rund 10'000 Franken mutmassliches Spielgeld sichergestellt. In den Räumlichkeiten wurden zudem ohne Bewilligung Getränke serviert. Die Covid-Bestimmungen wurden komplett missachtet.
Die Untersuchungen führen die Staatsanwaltschaften Luzern und Emmen.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer gestrigen Medienmitteilung.
Eine alte Weisheit, leicht abgewandelt: Wo Rauch ist, ist auch Balkan.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.3.2021 - Tag der Covid-Kredite
Jeton U. (35) soll 110'000 Franken veruntreut haben: Mit Corona-Kredit Shisha-Bar seines Bruders renoviert?
Bauunternehmer Jeton U.* (35) soll sich unter falschen Angaben einen Covid-19-Kredit über 110'000 Franken erschlichen haben. Statt das Geld für die Firma in Not zu verwenden, unterstützte er damit wohl Verwandte. Ihm droht eine Freiheitsstrafe und ein Landesverweis.
Null Einsicht vor dem Kriminalgericht. Der Luzerner Bauunternehmer Jeton U.* (35) soll sich hohe Covid-Hilfen ergaunert haben. Doch als Angeklagter spielt er am Dienstag lieber den hart arbeitenden Büezer, der 16 Stunden am Tag auf der Baustelle schwitzt. Buchhaltung sei nicht sein Ding.
Die Staatsanwaltschaft sieht es anders und macht heftige Vorwürfe. Der Albaner soll unter falschen Angaben einen Covid-19-Kredit über 110'000 Franken bezogen haben. Er täuschte vor, aufgrund der Pandemie einen massiven Umsatzrückgang zu erleiden. Ausserdem gab er mit 1,1 Millionen Franken einen viel zu hohen Umsatz an.
Keine Not, sondern gute Umsätze
Laut Staatsanwaltschaft war die Not durch Corona komplett vorgetäuscht. Denn: Die Firma steigerte 2020 den Umsatz von 43'000 im März auf 142'500 Franken im Juni. Dank der soliden Liquidität konnte das Unternehmen sogar auf die Kurzarbeitsentschädigung verzichten. Kurz: Es fehlte jede Berechtigung für Hilfe.
Ebenfalls verdächtig: Bereits zwei Tage nach dem Eingang des Geldes gewährte er seinem Vater über das Geschäftskonto einen Kredit von 15'000 Franken. Seit 2017 hagelt es laut Staatsanwalt bei dem Rentner Betreibungen. Er ist insolvent – eine Rückzahlung des Kredits also nicht zu erwarten.
Shisha-Bar des Bruders renoviert
Weiter renovierte Jeton U. die Shisha-Bar seines hochverschuldeten Bruders für über 164'000 Franken. Ausserdem lieh er einem Kumpel in Deutschland 5000 Franken.
«Ich habe den Notkredit beantragt, weil ich einen Baustopp befürchtete», verteidigt Jeton U. die Eingabe. Warum er falsche Angaben machte, kommentiert er nicht. Er will im «Sinne der Firma gehandelt» haben.
Hohe Strafe gefordert
Bei einem Schuldspruch droht eine harte Strafe. Die Staatsanwaltschaft fordert für Betrug, Urkundenfälschung und mehrfach ungetreue Geschäftsbesorgung eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten – teilbedingt. Dazu eine Busse (20'000 Franken) plus Landesverweis (fünf Jahre). Der Verteidiger will einen Freispruch.
Der Albaner ist kein Einzelfall. Allein im Kanton Luzern sind 70 Klagen wegen unberechtigt eingeholter Covid-Kredite hängig. Bisher wurde in den Kantonen Genf und Tessin je ein Covid-Betrüger verurteilt. Das Urteil folgt heute. Schreibt Blick. *Name geändert
It takes two to tango. Das gilt auch für einen (vorerst) erfolgreich über die Bühne gebrachten Betrug.
Da wäre einerseits die Behörde zu nennen, die den Antrag auf einen Covid-19-Kredit über 110'000 Franken bewilligt. 110'000 Franken sind ja nicht Nichts oder gar Peanuts. Da dürfte wohl bei der Prüfung des Unternehmens in der Hektik der Corona-Pandemie in der Luzerner Amtsstube einiges schiefgelaufen sein.
Andererseits braucht es logischerweise auch die perfide und kriminelle Energie des Antragsstellers für den Kredit. Sich auf Kosten der Allgemeinheit – letztendlich sind die 110'000 Franken nichts anderes als Steuergelder – in Zeiten der Not zu bereichern, spricht Bände über Moral und Ethik des Kreditnehmers.
Viele werden jetzt mit dem Zeigefinger auf die albanische Herkunft von Jeton U. (geäderter Name) zeigen. Es mag ja sein, dass das Bewusstsein über Recht und Unrecht auf dem Balkan aus historischen Gründen (Kommunismus) etwas weniger ausgeprägt ist als in anderen Regionen. Das gilt vor allem für den Drogenhandel, der beispielsweise in Luzern zum grössten Teil von Drogenbossen aus Balkan-Staaten wie Albanien und Kosovo dominiert wird.
Doch nicht alles, was rechtlich legal ist, entspricht auch unseren moralischen Vorstellungen. Die schamlose Bereicherung mit fragwürdigen Maskendeals der SVP-Boys vom Züriberg, sprich EMIX Trading, wurden ebenfalls in Zeiten der Not getätigt.
Gegen die Millionengewinne, die EMIX Trading allein in der Schweiz dank schamlos überhöhten Preisen und Steuergeldern von der «öffentlichen Hand» eingestrichen hat, sind Jetons 110'000 Franken wirklich nur noch «Fränkli».
Aber im Gegensatz zu Jeton U. stehen die Züriberg-Boys weder in der Schweiz noch in Deutschland, wo sie mit ihren Coronamasken ebenfalls wüteten, vor keinem Strafgericht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.3.2021 - Tag der Steuerhinterziehungen
Steuerhinterziehung: Die reichsten Amerikaner verstecken ein Fünftel ihrer Einkünfte
Steuerhinterziehung ist laut einer Studie der US-Steuerbehörde weitverbreitet – jedenfalls unter Superreichen. Die Untersuchung erscheint ausgerechnet während der Steuerermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump.
Steuerhinterziehung ist in den USA offenbar weiter verbreitet als bisher angenommen – jedenfalls unter Superreichen. Das geht aus einer neuen Studie der US-Bundessteuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) hervor, über die die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Demnach melden jene Amerikaner, die zum einen Prozent der Superreichen gehören, mehr als 20 Prozent ihrer Einkünfte nicht an die Steuerbehörde.
Zufallsprüfungen bei dieser Gruppe würden zwar immer wieder Steuerhinterziehungen aufdecken, heißt es in der Studie. Doch die US-Steuerbehörde würde leicht Vermögen übersehen, das auf Offshore-Konten und in anderen komplizierten Finanzstrukturen verborgen sei. Die Erhebung aller nicht gezahlten Einkommensteuern der Superreichen würde die Einnahmen des US-Finanzministeriums um 175 Milliarden US-Dollar pro Jahr erhöhen, heißt es in der Studie.
»Wir betonen, dass unsere Schätzungen in Bezug auf das Ausmaß der Umgehung voraussichtlich konservativ ausfallen«, schreiben die Autoren. Während viele Einkommensformen, einschließlich Gehälter, automatisch an die Steuerbehörde gemeldet und bei einer Basisprüfung leicht aufgedeckt werden, sind die Gewinne privater Unternehmen und komplexer Investitionspartnerschaften schwerer nachzuvollziehen.
Die Studie wurde von zwei Forschern der Finanzbehörde durchgeführt, John Guyton und Patrick Langetieg, sowie von drei Professoren: Daniel Reck von der London School of Economics, Max Risch von der Carnegie Mellon University sowie Gabriel Zucman von der University of California in Berkeley.
Das versteckte Einkommen an der Spitze bedeutet, dass die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen stärker verzerrt sein könnte, als Forscher zuvor geschätzt haben, folgern die Autoren. Die Wissenschaftler schlagen vor, dass die Steuerbehörde »zusätzliche Instrumente« einsetzen sollte, um »Steuerhinterziehung mit hohem Einkommen wirksam zu bekämpfen«, einschließlich der Verwendung von Hinweisgebern und spezialisierteren Prüfungen.
Die Untersuchung dürfte die Diskussion um einen berühmten mutmaßlichen Steuersünder weiter anheizen: Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident, über dessen wahres Vermögen seit Jahren spekuliert wird, hat wegen seines Finanzgebarens Ärger mit der Justiz. So ermittelt der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Cyrus Vance, gegen die Trump Organization wegen des Verdachts auf kriminellen Banken- und Versicherungsbetrug, Steuerhinterziehung und Manipulation von Geschäftsergebnissen. Schreibt DER SPIEGEL.
Sparen Sie sich Ihre Empörung: So funktioniert nun mal der brachiale Neoliberalismus seit Jahrzehnten. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Selbst im Lande Wilhelm Tells.
Eigenartig, dass uns dies erst in Zeiten einer globalen Krise bewusst wird, in der die Reichsten der Reichen sowie ein paar perfide Kriegsgewinnler (Stichwort EMIX Trading AG) in einem einzigen Jahr hinzuverdient haben wie kaum je zuvor in der Geschichte des Neoliberalismus.
Gleichzeitig sind 40 Millionen US-Bürger*innen von Food-Stamps abhängig. Nicht weil es ihnen so gut geht, sondern weil sie sich ohne Lebensmittel-Marken schlicht und einfach keine Lebensmittel leisten können. Ein explosives Gemisch aus Ignoranz und Dummheit der handelnden Polit-Eliten mit Zündstoff für die Zukunft.
Zu den illegalen Steuerhinterziehungen kommen weltweit legale Steuerspar- und Offshore-Modelle hinzu, die vor allem dazu dienen, die Gewinne zu privatisieren und die Verluste zu sozialisieren. Das kann und wird auf die Dauer nicht gutgehen. Ohne Moral und Ethik zerstört sich der Kapitalismus selbst.
«Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen!» Dieser Satz, der der französischen Königin Marie Antoinette oftmals in den Mund gelegt wurde, ist von ihr niemals gesagt worden. Er ist aber zum Sinnbild für das Unverständnis Marie Antoinettes – und der adeligen Eliten des Ancien Régime generell – gegenüber den sozialen Problemen der Zeit geworden. Alles klar?
Gustav Heinemann: «Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt.» Wie wahr!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.3.2021 - Tag der Ballermänner*Frauen
Strikte Reisebeschränkungen: Belgien hält bis nach Ostern an Reisestopp fest
Belgien hält bis nach Ostern an seinen strikten Reisebeschränkungen fest. Nicht notwendige Reisen bleiben bis 18. April untersagt, wie aus einer am Sonntag vom Innenministerium veröffentlichten Verordnung hervorgeht.
Ab dem 19. April dürften Belgier demnach wieder in andere EU-Länder reisen, ergänzte die «Brussels Times». Davon werde aber dringend abgeraten.
Erst am Freitag hatte die Regierung wegen steigender Corona-Zahlen Lockerungen verschoben, die eigentlich für Anfang April geplant waren. Ursprünglich sollten dann wieder Veranstaltungen und Gottesdienste mit maximal 50 Personen mit Masken im Freien stattfinden. Lockerungen für Amateursportler und Vergnügungsparks fallen ebenfalls vorerst aus. Schreibt Blick.
Aufgrund der letztjährigen Erfahrungen mit den Sommerferien quer durch Europa und den darauf folgenden Fallzahlen vermutlich eine kluge Entscheidung der belgischen Regierung. Man darf auf die Rückkehr der deutschen Mallorca-Touristen gespannt sein, die derzeit gemäss Medienmitteilung der TUI in Massen Flüge für Ostern auf die Insel ihrer Herzen buchen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.3.2020 - Tag der Integration
«Woher kommst du», oder: Warum Integration keine Einbahnstraße ist
Jonas ist Wiener, sein Vater ist Deutscher, und nie im Leben würde jemand darüber nachdenken, ihn als "ausländisch" zu bezeichnen. Das ist gut, denn er ist selbstverständlich Österreicher. So wie viele andere Menschen in diesem Land auch. Aber sie heißen nicht Jonas und haben nicht seine Hautfarbe. Deswegen sind sie ohne Chance auf Entkommen immer wieder mit der Frage konfrontiert: "Woher kommst du?" Sie erfahren immer wieder ungefragt, dass sie "aber gut Deutsch" sprechen. Und wenn gleich rassistische Kommentare folgen sollen, werden sie mit Aussagen wie "Ich meine natürlich nicht dich, aber ..." eingeleitet.
Die Frage nach der Herkunft muss an sich keine bösartige Intention enthalten, häufig wird argumentiert, dass sie aus Interesse oder Neugier gestellt werde. Und trotzdem insinuiert "Woher kommst du?", ob bewusst oder nicht, dass die Person nicht von "hier" komme. Selbst dann, wenn Österreich ihre einzige Heimat ist. Auch dann, wenn sie einen Großteil ihres Lebens in diesem Land verbracht hat. Immer noch dann, wenn sie kein anderes Zuhause kennt. Mit derartigen Fragen wird sie stets daran erinnert, dass sie offenbar für immer "ausländisch" sein wird. Ihr wird die Mündigkeit geraubt, über die eigene Heimat zu bestimmen, und damit ein grundlegender Teil der Identität abgesprochen. Und das häufig noch, bevor der Fragesteller die Person überhaupt kennt – rein aufgrund der Hautfarbe, des Aussehens oder des Namens. Auch wenn es unbeabsichtigt geschieht, grenzt es dennoch aus: indem es eine Unterscheidung zwischen "wir und "sie" schafft und damit rassistischen Ressentiments den Weg ebnet.
Gleichberechtigung oder "Farbenblindheit", wie sie etwa von einer Kolumnistin der NZZ zuletzt eingemahnt wurde, mag ein Ideal sein, das wir als Gesellschaft anstreben müssen. Aber dafür müssen wir alle unsere Andersbehandlung von nichtweißen Menschen überdenken. Das gilt auch für die Politik, die eigentlich eine Vorbildwirkung hat und die Bevölkerung in Krisenzeiten einen sollte. Mit Aussagen, wie dass "vor allem Personen mit Wurzeln auf dem Balkan und in der Türkei das Virus nach Österreich geschleppt" hätten, agiert ein Bundeskanzler spaltend. Er postuliert einen Unterschied zwischen Menschen mit Migrationsgeschichte und anderen – ohne Belege. Damit Integration funktionieren kann, muss auch er verstehen, dass sie keine Einbahnstraße ist. Schreibt DER STANDARD. Ich kann die These der 22-jährigen STANDARD-Journalistin Muzayen Al-Youssef nicht wirklich nachvollziehen.
Ein Rassist oder eine Rassistin – es gibt auch unglaublich viele Rassistinnen, was gerne unterschlagen wird – wird in der Regel andersfarbige Menschen gar nicht erst fragen, woher er/sie/es kommt.
Ausnahmen bestätigen zwar die Regel, aber Rassisten haben vorgestanzte Vorurteile und einen beschränkten Horizont (sonst wären sie ja keine Rassisten): Schwarz oder braun wird mit Afrika assoziiert, selbst wenn der Braune ein Tamile ist. Gelbe Hautfarbe und «slitted Eyes» werden automatisch Asien, seit einiger Zeit aber auch nur noch China zugeordnet. Die Dumpfbacken aus der Rassistenszene kennen vermutlich nicht einmal die Namen der einzelnen Länder der jeweiligen Kontinente, denen sie andersfarbige Menschen zuordnen.
Dass Integration keine Einbahnstrasse ist, bestreitet kein normaler Mensch. Dazu gehört aber auch, dass Einheimische und Migranten und Migrantinnen MITEINANDER statt ÜBEREINANDER reden. Solche Gespräche landen logischerweise irgendwann bei der Frage «woher kommst du?». Nicht selten wird die Frage in umgekehrter Reihenfolge gestellt: «Bist du Schweizer / Schweizerin»? Würde man der These von Muzayen Al-Youssef folgen, wäre das ja dann auch sowas wie Rassismus. Allerdings von der andern Seite.
Die Frage «woher kommst du?» wurde zu Unrecht zum Synonym für Rassismus hochgejazzt und erstickt als Reflexbegriff letztendlich jede Diskussion um die Werte der jeweils «anderen» Kultur. Die Eiterbeule des Rassimus wuchert in sämtlichen Gesellschaften, seit es die Menschheit gibt. Selbst unter Migranten und Migrantinnen. Sie ist leider als solche nicht kurierbar. Zumal der verdeckte oder offen ausgesprochene Rassismus inzwischen bei den erfolgreichen Populisten ein probates und äusserst erfolgreiches Wahlkampfinstrumentarium ist.
Oder glaubt wirklich jemand, dass es der SVP bei der sinnlosen und demokratiezersetzenden Volksabstimmung über die «Burka» (Verhüllungsinitiative) um die Rechte der muslimischen Frauen ging?
Mit geschätzten 30 Burkaträgerinnen in der Schweiz wurde nichts anderes als ein lächerlicher und beschämender Popanz konstruiert zur Befriedigung des SVP-Fussvolkes, das endlich wieder einmal einen Erfolg an der Urne brauchte.
Entsprechend bejubelten die SVP-Granden vom Herrliberg bis nach Eich ihren äusserst knappen Erfolg nach der Abstimmung als «grandiosen Wahlsieg». Dass fast 50 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer an der Urne fehlten, weil das Thema «Burka» ihnen vermutlich am Allerwertesten vorbeiging, wurde geflissentlich verschwiegen.
Wie sagte Bundesrat Ueli Maurer so treffend wie unverblümt? «Die SVP gewinnt die Wahlen mit den Themen «Flüchtlinge» und «EU». Wie wahr!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.3.2021 - Tag der positivn Pilot-Projekte
Ausnutzung oder Integration? Kontroverses Pilotprojekt: Flüchtlinge halten Schulen in Emmen «blitzblank»
Der Kanton Luzern hat ein Littering-Problem. In der Gemeinde Emmen sind deshalb Asylbewerber auf Abfalltouren unterwegs. Dass «Flüchtlinge den Wohlstandsdreck räumen müssen», sorgte für harsche Kritik – trotzdem ziehen die Beteiligten ein positives erstes Fazit.
Unter dem Namen «Team blitzblank» sind anerkannte Flüchtlinge an den Wochenenden auf Schulgeländen unterwegs, um Abfall einzusammeln und Kehrichteimer zu leeren.
Schulareale mit ihren Pausen- und Spielplätzen werden immer stärker auch ausserhalb der Schulzeit als Treffpunkte und Aufenthaltsorte genutzt und verdreckt. Neben Securitas-Patrouillen und Einsätzen der mobilen Jugendarbeit ist das «Team blitzblank» eine zusätzliche Massnahme, um das Littering-Problem in den Griff zu bekommen.
Das dreimonatige Pilotprojekt läuft seit Anfang Februar und entstand in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk SAH Zentralschweiz. Es sorgte bereits kurz nach der Lancierung für massive Kritik. «Dieser Einsatz wirft ein schlechtes Licht auf die Gemeinde«, schrieb Einwohnerrat Paul Jäger (parteilos) in einem Vorstoss. Es könne nicht sein, dass Flüchtlinge aufräumen müssten. Die Antwort des Gemeinderats darauf steht noch aus.
Klar ist: Der Einsatz läuft auf freiwilliger Basis, und die Flüchtlinge werden dafür «branchenüblich» bezahlt, wie die Gemeinde betont. «Sechs Personen haben sich für den Einsatz gemeldet», erklärt Philipp Bucher, Sprecher der Gemeinde Emmen. «Diese sind aktuell abwechslungsweise in Zweierteams jeweils am Samstag- und Sonntagmorgen auf den Emmer Schulanlagen im Einsatz.»
Unter den Freiwilligen seien auch Familienväter, wie Bucher weiter ausführt. «Sie möchten ihren Kindern vorleben, dass Arbeit wichtig ist, um mit dem Einkommen den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können.»
Das Projekt kommt an
Die bisherigen Rückmeldungen der Team-Mitglieder seien alle durchwegs positiv. «Die Männer machen ihren Job gerne», sagt Barbara Meier, Leiterin Arbeit und Vermittlung beim SAH Zentralschweiz gegenüber zentralplus. «Sie sagen, dass ihnen die Arbeit guttut und dass es besser ist, als zuhause herumzusitzen.» Sie seien an der frischen Luft und haben etwas Sinnvolles zu tun.
Einer dieser Männer ist Amanuel Gebreyesus. Für ihn beginnt die Schicht an den Wochenenden jeweils um 8 Uhr morgens und dauert ein paar Stunden – je nach Aufwand. Gebreyesus stammt aus Eritrea und ist seit 2015 in der Schweiz. Wie der 35-Jährige gegenüber der Gemeindezeitschrift «Emmenmail» beteuert, gefällt ihm die Arbeit: «Es ist schön und tut gut, draussen zu arbeiten, wenn die Sonne scheint.»
Für die weggeworfenen Zigarettenstummel, Einwegmasken und dergleichen hat er jedoch kein Verständnis: «Überall Abfall ist nicht gut für die Natur und für die Tiere und Menschen.»
Gute Ergebnisse vermeldet
Für Barbara Meier von der SAH Zentralschweiz eine Win-win-Situation: «Die Gemeinde Emmen leistet mit diesem Pilotprojekt einen wertvollen Beitrag zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.» Der Einsatz der «Blitzblank»-Teams sei nicht nur ein Sprungbrett für die Teilnehmenden in die Arbeitswelt, sondern auch eine Entlastung der Hauswarte und des Werkdienstes.
Ob das Projekt über die drei Monate hinaus verlängert wird, ist möglich, aber noch nicht sicher. «Die Situation hat sich wesentlich verbessert», so Gemeindesprecher Bucher. «Entsprechend sind wir mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden und können uns eine Weiterführung des Projekts vorstellen.» Für einen definitiven Entschluss wird allerdings der Abschluss der dreimonatigen Pilotphase abgewartet. Schreibt ZentralPlus.
«Dümmer geht nümmer». Anders lässt sich das krude Statement von Einwohnerrat Paul Jäger nicht bezeichnen. Das Pilot-Projekt der Gemeinde Emmen könnte durchaus Vorbildcharakter haben.
Statt die Hände in den Schoss zu stecken und eine teure, aber leider absolut wirkungslose «Sensibilisierungskamapagne à la Luzerner Stadtregierung zu lancieren, packt die Luzerner Vorortgemeinde das Übel an den Wurzeln an.
Es ist für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation: Die Flüchtlinge, die ja nicht zur Verrichtung der Müllbeseitungsarbeiten gezwungen werden, sondern auf freiwilliger Basis ein paar Franken hinzuverdienen, die man ihnen von Herzen gönnt, werden dies zu schätzen wissen.
Hinzu kommt ein weiterer positiver Aspekt: Die von Emmen angeheuerten Flüchtlinge werden sicherlich eine wertvolle Botschaft gegen die Vermüllung der Landschaft auch und vor allem in ihre eigene Community hineintragen. Denn Hand aufs Herz und ohne Flüchtlingsbashing: Auch Flüchtlinge gehören gelegentlich wie wir alle ebenfalls zu den Verursachern*innen des Problems.
Dem «Georg Kakao» (Anm. Mundart: Schorsch Gaggo*) Paul Jäger vom Einwohnerrat kann man eigentlich nur noch mit einem Zwischenruf des ehemaligen deutschen Aussenministers Joschka Fischer antworten, das der Grünen-Politiker 1984 im deutschen Bundestag von sich gab:
«Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch!»
* https://www.idiotikon.ch/wortgeschichten/schorsch-ggaggo
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.3.2021 - Tag der Krisenbewältigung
Astra-Zeneca-Impfungen starten in Deutschland wieder
Heute Freitag nimmt Deutschland die Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin wieder auf. Dies lässt Forderungen nach einer Ausweitung der Impfkampagne auf die Hausärzte lauter werden. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Telefonkonferenz darüber beraten. Zuvor stellen sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade, den Fragen der Öffentlichkeit.
In den Bundesländern starten die Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin wieder, so dass in der Folge allmählich überall auch wieder neue Impftermine vergeben werden können. Dem war ein Votum der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) vorangegangen. Die EMA erneuerte darin ihre Haltung, dass der Nutzen des Impfstoffs die Risiken übersteigt. Daraufhin kündigte Spahn noch am Abend an, dass in die Informationen zu dem Impfstoff ein Warnhinweis aufgenommen werde.
Schreibt SRF im Corona-Liveticker
Ein Warnhinweis auf der Verpackung der Astra-Zeneca-Impfungen? Was bei den Zigaretten nicht funktioniert hat, soll nun ausgerechnet bei einem umstrittenen Impfstoff die Impfwilligen überzeugen?
Sowas kann wirklich nur einem Politiker einfallen.
Erinnert stark an die ebenso wirkungslosen «Sensibilisierungskampagnen» der Luzerner Stadtregierung und steht vermutlich als Vorlage in einem Handbuch für Politiker*innen zur Krisenbewältigung.
Eine Frage drängt sich auf: Haben wir wirklich die smartesten Leute in die Parlamente gewählt?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
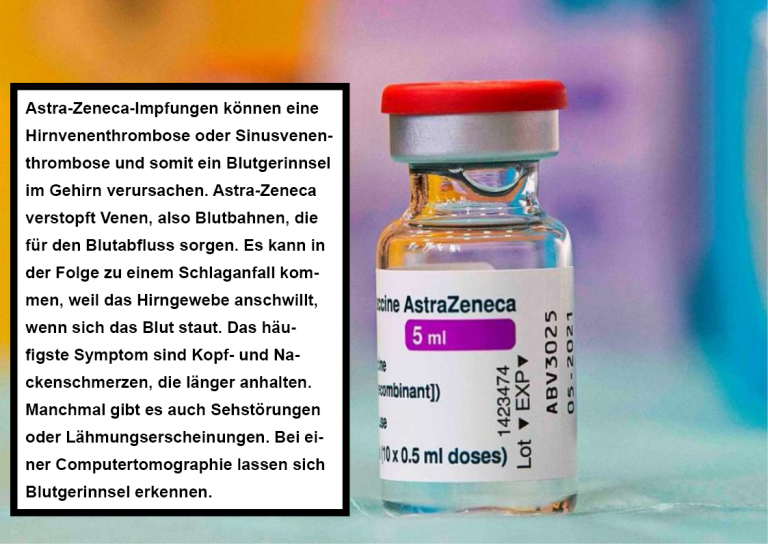
-
18.3.2021 - Tag der Naturwissenschaft
Riesiger Findling bei Bauarbeiten im Luzerner Bruchquartier entdeckt
Aussergewöhnlicher Fund auf der Baustelle beim Elisabethenheim im Bruchquartier: Letzte Woche brachten dort Bauarbeiten einen riesigen Findling zu Tage. Der etwa 40 Millionen Jahre alte Block wiegt an die 17 Tonnen und ist damit einer der grössten bekannten Findlinge auf Luzerner Stadtgebiet. Um ihn für die Nachwelt zu erhalten, wird er heute Dienstag auf die Allmend transportiert. Dort kann er im Naturerlebnisgebiet bestaunt werden.
Im Luzerner Bruchmattquartier wird derzeit der neue Elisabethenpark, ein Pflegezentrum mit Wohnungen und Dienstleistungen, realisiert. Nun ist bei den Bauarbeiten ein riesiger, 3,3 Meter langer, 3 Meter breiter und 1,7 Meter hoher Findling entdeckt worden. Er wiegt zirka 17 Tonnen, was dem Gewicht von etwa zehn Nilpferdbullen entspricht. Der Findling besteht nicht wie die meisten Findlinge aus Granit, Gneis oder Kieselkalk, sondern aus einem rund 40 Millionen Jahre alten Quarzsandstein. Derartige, sehr harte Quarzsandsteine kommen im Einzugsgebiet der Zentralschweizer Eiszeit-Gletscher vor allem im hinteren Engelbergertal, beispielsweise bei der Fürenalp, vor. Daher ist naheliegend, dass ihn der eiszeitliche Engelbergergletscher, der sich im Kreuztrichter mit dem Reussgletscher vereinte, vor gut 17'000 Jahren über 30 Kilometer nach Luzern transportiert hatte.
Die schönen Gletscherschliffe auf dem gerundeten Findling belegen, dass er nicht auf dem Rücken des Gletschers transportiert worden ist, sondern in der Grundmoräne an der Basis des Gletschers über das Felsbett schrammte. Nach gut 17'000 Jahren haben ihn die Bagger vergangene Woche ausgegraben, zusammen mit anderen interessanten Findlingen. Der Luzerner Geologe Beat Keller hat den Fund untersucht: «Ein so spezieller Findling aus einer Grundmoräne ist mir auf Stadtboden nicht bekannt. Zum Glück haben die Leute der Baufirma umsichtig reagiert und die Findlinge nicht einfach zerstört».
Die Allmend als neue Heimat
Da die Findlinge der Überbauung weichen müssen, wurden sie am Dienstagnachmittag auf die Luzerner Allmend ins Naturerlebnisgebiet transportiert. Dabei handelt es sich um ein anspruchsvolles Unterfangen, das einen Tieflader und einen Grosskran erfordert. Dieser Schwertransport ist dank dem Sponsoring der beteiligten Firmen Lötscher Tiefbau Plus und Eberli AG möglich.
Der aussergewöhnliche Riesenfindling und seine kleinen Gefährten können künftig auf der Allmend, hinter den Hochhäusern direkt am Zihlmattweg, bestaunt werden.
Schreibt die Stadt Luzern in ihrer gestrigen Medienmitteilung.
Um es vorweg zu nehmen: Nein, ich bin kein Leugner des Klimawandels. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass die Menschheit den Klimawandel sogar beschleunigt.
Doch frei nach Alexander von Humboldt vertrete ich seit langem meine (subjektive) Meinung, dass eben doch «alles mit allem zusammenhängt». Das Universum hat seine eigene Gesetze, die wir allerdings aus verschiedenen Gründen naturwissenschaftlich noch nicht verstehen. Oder nicht verstehen wollen. Selbst die Koryphäen der Naturwissenschaft sind sich nicht einig.
Zudem spielen die monotheistischen Religionen sicherlich auch eine Rolle, wenn man bedenkt, dass an den salafistischen Koranschulen noch heute die These gelehrt wird, dass es nur eine einzige Sonne gibt. Religionen haben mit dem Universum und der von ihnen verbreiteten «Schöpfungsgeschichte» seit jeher ihre ureigenen Probleme, was schon Galileo Galilei dank der damaligen Macht des Vatikans im wahrsten Sinne des Wortes «schmerzvoll» am eigenen Leib erleben musste.
Vor gut 17'000 Jahren überdeckte der eiszeitliche Engelbergergletscher (besser bekannt als Titlisgletscher), der sich im Kreuztrichter mit dem Reussgletscher vereinte, das heutige Gebiet des Kantons Luzern bis weit hinunter in den Kanton Aargau. (Wer das nicht glaubt, kann sich beim «wandelnden Lexikon» Res bei einer Stadtführung durch Zofingen eines Besseren belehren lassen.) Innerhalb einer Zeitspanne von wenigen Jahrtausenden schmolz diese gewaltige Eismasse dahin. Viel ist von ihr selbst auf dem Titlis nicht mehr zu sehen.
Doch für das Dahinschmelzen des Reussgletschers kann man die Menschheit wohl kaum verantwortlich machen. Weder gab es damals die Industrialisierung noch umweltschädliche Abgase von Autos, Flugzeugen, Kraftwerkerken und was sonst noch so alles heutzutage dem Klima in Extremis schadet. Planeten folgen nun mal den Gesetzen des Universums.
Der Mensch spielt dabei in der für uns kaum vorstellbaren Zeitrechnung des Universums keine Rolle. Oder wenn, dann nur eine untergeordnete im Sekundenbereich der «Ewigkeit», die es als solche ebenfalls nicht gibt. Denn wie unsere Sonne eines fernen Tages enden wird, wissen wir bereits.
Das Menschenzeitalter (Anthropozän) wird genau so enden wie alle anderen Zeitalter vor ihm. Die Menschheit leistet trotz der vorhandenen Intelligenz ihren Beitrag dazu. Der Klimawandel ist nur einer davon. Ein paar Jahrtausende früher oder später spielt für das Universum keine Rolle.
Um dies vorauszusagen, braucht man nicht einmal ein Fatalist zu sein.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
17.3.2021 - Tag der AHV-Rente für die Frau
Wie viel Rente soll es denn für die Frauen sein?
Mit der Altersreform soll das Rentenalter der Frauen erhöht werden. Umstritten ist, wie die Übergangsjahrgänge entschädigt werden.
Von 2023 bis 2026 soll das Frauenrentenalter schrittweise auf 65 Jahre erhöht werden. Umstritten ist, wie diese Erhöhung finanziell abgefedert werden soll. Der Bundesrat will dafür 700 Millionen Franken einsetzen. Neun Jahrgänge sollen profitieren. Entweder indem Frauen die Rente weniger stark gekürzt wird, wenn sie nicht bis 65 Jahre arbeiten. Oder indem sie eine höhere Rente erhalten, sofern sie ein tieferes Einkommen als 85320 Franken haben. Die Mehrheit der vorberatenden Kommission will an diesem Modell festhalten – aber nur für eine Übergangsgeneration von sechs Jahren. Kostenpunkt 440 Millionen Franken.
Die-Mitte-Partei und an sich auch die Linke bevorzugt das Trapezmodell. Frauen sollen einen Rentenzuschlag erhalten – aber abgestuft. Will heissen, wer wegen der Erhöhung des Rentenalters drei oder sechs oder neun Monate länger arbeiten muss, bekommt weniger als eine Frau, die ein ganzes Jahr später in Rente gehen kann. Später sinkt der Rentenzuschlag wieder.
Das Plenum wird drei verschiedene Varianten des Trapezmodells diskutieren. Die Kosten variieren von 420 Millionen bis 2,5 Milliarden Franken im teuersten Jahr.
Einen dritten Weg schlägt schliesslich die FDP vor, mit dem Müller-Modell, benannt nach Ständerat Damian Müller. Der Luzerner will insbesondere Frauen mit tiefen Löhnen besserstellen. Bis zu einem Einkommen von 56880 Franken sollen sie einen Rentenzuschlag von 150 Franken monatlich bekommen, darüber soll er noch 50 Franken betragen. Kostenpunkt: 600 Millionen Franken pro Jahr. Die Übergangsgeneration umfasst in diesem Modell sechs Jahrgänge. Schreibt die Luzerner Zeitung.
Müller Modell: Damian Müller entdeckt sein Herz für die Frauen. Wurde aber auch Zeit!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.3.2021 - Tag der verkommenen Imperatorin
Arabischer Frühling: Als die Nato in Libyen die Sache in die Hand nahm
Vor zehn Jahren erteilte der Uno-Sicherheitsrat das Mandat, die libysche Bevölkerung zu beschützen. Das war kriegsentscheidend zugunsten der Rebellen.
Nach fast sieben Jahren Krieg und politischem Chaos hat Libyen seit vergangener Woche wieder eine einheitliche Regierung: Sie ist auf Uno-Vermittlung zustande gekommen, wurde jedoch von Vertretern aller Landesteile gewählt, vom Parlament – auch davon gab es jahrelang zwei – bestätigt und soll das schwer gespaltene Land in Neuwahlen im Dezember führen. Hoffnung, aber auch Skepsis begleiten den Neustart unter Premier Abdul Hamid Dbeibah, einem reichen Bauunternehmer aus Misrata, der gleich einmal in den Verdacht geriet, seiner Wahl mit Geld nachgeholfen zu haben.
Wichtig ist, dass der Waffenstillstand hält, der im Oktober 2020 den Krieg zwischen Ost- und Westlibyen beendete – und damit die im April 2019 gestartete Offensive des starken Manns des Ostens, General Khalifa Haftar, auf die Hauptstadt Tripolis und die von der Türkei unterstützte Gegenoffensive der Regierung von Fayez al-Serraj.
Hinter Haftar standen Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten: Es müssen also auch eine Reihe äußerer Akteure mitspielen, um Libyen zehn Jahre nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi zur Ruhe kommen zu lassen.
Sicherheitsrat greift ein
Unter den arabischen Staaten, in denen sich 2011 Anti-Regime-Demonstrationen zu Massenprotesten oder zu einem bewaffneten Aufstand entwickelten, kommt Libyen eine Sonderrolle zu: In keinem anderen Land griff der Westen koordiniert militärisch ein. Diese Woche, am 17. März, jährt sich zum zehnten Mal die Verabschiedung von Resolution 1973 im Uno-Sicherheitsrat, die das Mandat erteilte, zum Schutz der Zivilbevölkerung eine Flugverbotszone über Libyen zu errichten.
Am 19. März 2011 griffen Frankreich, Großbritannien und die USA Gaddafis Luftabwehr und Kommandozentralen an, am 23. März wurde gemeldet, dass die libysche Luftwaffe außer Kraft gesetzt sei. Am 27. März übernahm die Nato das Kommando über die Luftoperationen. Am Boden gingen die schweren Kämpfe zwischen Gaddafi-Truppen und Rebellen weiter.
Da war bereits die Debatte darüber voll im Gang, ob das vom Sicherheitsrat verliehene Mandat, die libysche Bevölkerung zu schützen, nicht längst überschritten sei und zum Sturz von Gaddafi "missbraucht" werde. Manche befürchteten, dass damit das relativ neue völkerrechtliche Konzept "R2P" – Responsibility to Protect (Schutzverantwortung) – beschädigt würde.
Kriegsmüdes Deutschland
Das nach zehn Jahren in Afghanistan kriegsmüde Deutschland, das damals als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat saß, hatte seine westlichen Verbündeten mit einer Stimmenthaltung schockiert – während die Enthaltungen Russlands und Chinas als möglicher neuer Kooperationsansatz gesehen wurden. Sie hatten immerhin kein Veto eingelegt. Aber der Kriegsverlauf zugunsten der Rebellen, die unter dem Schutz der Nato vormarschiert waren, war später einer der Gründe dafür, dass beim nächsten Krieg im Nahen Osten, in Syrien, im Sicherheitsrat mit Moskau überhaupt nicht mehr zu reden war. Im August ging Gaddafi in den Untergrund, im Oktober wurde er von Rebellen festgenommen und getötet.
Dem Verzicht Russlands und Chinas auf das Veto hatte auch nachgeholfen, dass sogar die Arabische Liga die Flugverbotszone gefordert hatte. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar beteiligten sich an den Lufteinsätzen. Der zunehmend erratische Gaddafi, 1969 durch einen Putsch an die Macht gekommen, hatte keine Freunde mehr. Die Aufständischen nannte er Kakerlaken und Ratten. Europa – wo man in dieser Hinsicht zuvor gerne mit ihm kooperiert hatte – drohte er damit, es von Libyen aus mit afrikanischen Flüchtlingen zu überschwemmen. Und dann waren da natürlich auch die Ölanlagen, die man schützen wollte.
Gut organisierte Rebellen
Für ein militärisches Eingreifen in Libyen sprach wohl auch einfach, dass es militärisch machbar war, ohne erwartbare politische Kollateralschäden – und mit einem absehbaren Ende. Das Mandat schloss ein militärisches Engagement am Boden aus. Dass die Aufständischen die Verwaltung sofort selbst in die Hand nahmen, verschaffte dem Ausland den legitimen Ansprechpartner, den man später in Syrien so vermisste. Bereits im März gründeten Rebellen den Transitional National Council (TNC), der zuerst von Frankreich und im September von der Uno-Generalversammlung als Repräsentant des libyschen Volkes anerkannt wurde. Libyen hatte eine Führung.
Erleichtert wurde das Eingreifen zusätzlich dadurch, dass die Rebellen schon früh ein zusammenhängendes Gebiet kontrollierten, den Osten. In Bengazi hatten sich auch die ersten Proteste formiert, sie gingen von Menschen aus, deren Angehörige bei der Niederschlagung der Revolte im Gefängnis Abu Salim 1996 getötet worden waren, mindestens 1200. Die Verhaftung des Anwalts Fethi Tarbel, der die Familien vertreten hat, löste am 15. Februar 2011 die ersten Demonstrationen aus, bei denen – nach dem tunesischen und ägyptischen Vorbild – das Ende des Regimes gefordert wurde.
Frühe Spaltung
Die Reaktion Gaddafis war äußerst brutal, der Weg zu einem bewaffneten Aufstand damit programmiert. Relativ früh setzten sich auch Regimemitglieder, später auch Militärs ab, dazu kam das Engagement von Exilanten, wie ja auch Haftar einer war, der sich mit Gaddafi Ende der 1980er-Jahre im Tschad-Krieg überworfen hatte.
Zwischen dieser Gruppe, die den Übergangsrat dominierte, und den sich selbst als die echten "Revolutionäre" bezeichnenden Kämpfer – viele an die Geschehnisse an Abu Salim gebunden, viele davon Islamisten – bildete sich bald jenes Misstrauen, das 2014 zur politischen Spaltung und zur militärischen Auseinandersetzung führte. Und sie zogen unterschiedliche Unterstützung aus dem Ausland an, gegen die Türkei- und Muslimbrüdernahen Islamisten bildete sich die von Haftar angeführte Front, die sich auf die Fahnen heftete, gegen "Terroristen" zu kämpfen. Nun sollen sie wieder gemeinsam regieren. Schreibt DER STANDARD.
Wie sagte die furchtbare Hillary Clinton triumphierend wie eine verkommene Imperatorin aus der frühbabylonischen Zeit in einem Interview mit CBS über den Tod Gaddafis? «We came, we saw, he died.» Übersetzt: Wir kamen, wir sahen, er starb. (In Anlehnungan Cäsars berühmtes Zitat: Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte.)
https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y&t=1s
All den Staaten der hehren westlichen Wertegemeinschaft, die sich jahrzehntelang (u.a. Italien und Frankreich) mit Krediten von Gaddafis Gnaden hoch verschuldet hatten, fielen vermutlich ganze Berge von Steinen vom Herzen.
Frankreichs ex-Präsident Sarkozy dürfte sich wohl vor Freude die Kleider vom Leib gerissen haben, war es doch ebendieser «he died»-Gaddafi, der den Wahlkampf Sarkozys mit Millionenspenden unterstützt hatte.
Das Internet-Portal Mediapart veröffentlichte 2012 ein libysches Geheimdienstdokument, dem zufolge al-Gaddafi im französischen Präsidentschaftswahlkampf 2007 rund 50 Millionen an Sarkozy zahlen liess.
Nach dem Sturz Gaddafis verlangte Gaddafis Sohn Seif al-Islam von Sarkozy, «das Geld zurückzugeben, das er von Libyen angenommen hat, um seinen Wahlkampf zu finanzieren». Der französische Staatschef nannte die Vorwürfe damals «grotesk».
Seit 2020 steht Sarkozy in dieser Causa unter Anklage.
«Ist es vorstellbar, dass ein früherer französische Präsident seinen Wahlkampf mit dem Geld eines libyschen Diktators finanziert hat? Nach allem, was man an Zynismus, Lügerei und Korruption erlebt hat, muss man wohl antworten: Ja, ist es.» Schrieb Klaus-Dieter Frankenberger am 20.3.2018 in der FAZ.
Und ausgerechnet diese von Korruption zerfressene westliche «Wertegemeinschaft» will rund um den Globus mittels Waffengewalt ihre Doktrin von Demokratie und Werten durchsetzen! Wo bleibt da eigentlich die Empörung der Aufrechten?
Es scheint, dass die AufRECHTEN auf diesem Auge blind sind.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.3.2021 - Tag der Hampelmänner
Deutsche SPD nach den Landtagswahlen: Der Ampelmann
Malu Dreyer beschert der SPD einen Erfolg, in Baden-Württemberg könnten die Genossen trotz schwachen Abschneidens regieren: Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht sich gestärkt. Doch was sind die Ergebnisse wert?
An der Abstimmung müssen Olaf Scholz und die SPD-Vorsitzenden bis zur Bundestagswahl noch ein wenig arbeiten. Denn sonst kommt es zu Szenen wie an diesem Sonntagabend: Da lässt sich der Kanzlerkandidat in der ARD befragen, parallel treten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in der Parteizentrale vor die Kameras.
Ein Patzer aus Sicht von Parteistrategen, vielleicht aber auch bezeichnend für den Zustand der Partei.
Die SPD schwankt nach den beiden Landtagswahlen zwischen zwei Extremen: klar stärkste Partei in Rheinland-Pfalz dank Malu Dreyer. Und nur noch knapp zweistellig in Baden-Württemberg.
Was, bitte schön, sollen die Sozialdemokraten jetzt daraus machen?
Ein durchwachsenes Ergebnis, könnte man sagen. Doch so funktioniert das Spiel nach Wahlen nicht. Sowohl Scholz als auch Esken und Walter-Borjans feiern den Tag als Erfolg. Es sei »ein Auftakt nach Maß ins Superwahljahr«, jubelt Esken. Die SPD habe gezeigt, wie man Wahlen gewinnt.
Scholz sagt: »Es ist ein guter Tag.« Eine Regierung ohne die CDU sei möglich. Er wolle Kanzler werden, so Scholz, und da habe sich gezeigt, »dass das geht«.
Seit mehr als einem halben Jahr ist Scholz nun Kanzlerkandidat. Und auf einmal scheint sein Ziel, die SPD nach 16 Jahren zurück ins Kanzleramt zu führen, ein wenig realistischer zu werden.
Denn auch wenn die SPD in Baden-Württemberg gerade mal auf gut elf Prozent kommen dürfte und die Rheinland-Pfälzer ihren Sieg im Wesentlichen Malu Dreyer verdanken: Von den Wahlen geht tatsächlich ein Signal aus, das die Sozialdemokraten lange herbeigesehnt haben: die Ampel.
In Rheinland-Pfalz gibt es ein solches Bündnis schon seit dem Jahr 2016. Und künftig könnten SPD, Grüne und FDP auch in Baden-Württemberg gemeinsam regieren – dort allerdings geführt vom Grünen Winfried Kretschmann. Laut einer ARD-Hochrechnung am Sonntagabend schien im Stuttgarter Landtag kurzfristig sogar eine Mehrheit für Grün-Rot möglich, dafür reicht es nun aber nicht.
Doch wie realistisch ist ein Comeback der SPD auf Bundesebene? Angekündigt haben führende Genossen es schon oft. Doch in den Umfragen bewegte sich wenig, die Partei dümpelt weiter bei 16 bis 17 Prozent. Malu Dreyer holte nun doppelt so viel.
So hohe Beliebtheitswerte wie sie hat Scholz nicht. Noch wichtiger aber: Dreyer profitierte wie Kretschmann vom Amtsbonus. Beide Ministerpräsidenten zogen ihre Partei zu Ergebnissen weit über dem Bundestrend. Eine Entwicklung, die es zuletzt häufig bei Landtagswahlen gab, die durch die Coronapandemie aber verstärkt worden sein könnte.
Klar ist aber auch: Bei der Bundestagswahl tritt Angela Merkel nicht wieder an. Scholz könnte als Kandidat mit der größten Regierungserfahrung punkten, hoffen die Sozialdemokraten. Ihr Ziel lautet: die Union unter 30 Prozent drücken, am Abend formuliert Scholz bei »Anne Will« genau das als eines seiner Wahlziele. Dann, so die Annehme der SPD-Strategen, könnte die SPD das Kanzleramt zurückerobern.
Die Schwäche der Union lässt dieses Szenario nicht mehr als reinen Wunschtraum der Genossen erscheinen. Doch damit Scholz überhaupt eine Chance hat, müsste seine Partei ein wenig so werden wie der rheinland-pfälzische Landesverband. Von dessen Geschlossenheit und Professionalität ist die Bundes-SPD allerdings weit entfernt.
Streit über Identitätspolitik legt Sollbruchstelle offen
Obwohl sich am Sonntag alle als Gewinner feiern, ist die Stimmung im Willy-Brandt-Haus nicht so euphorisch. Dabei wähnten die Genossen sich eigentlich auf einem guten Weg. Die Partei trat im Winter vergleichsweise geschlossen auf, gemeinsam mit Scholz präsentierten Esken und Walter-Borjans Anfang März einen Programmentwurf, in dem sich sowohl Parteilinke als auch konservative Sozialdemokraten wiederfinden.
Doch kurz darauf war es um die Einigkeit geschehen, und die SPD beschäftigte sich mal wieder mit sich selbst. Ein öffentlicher Streit zwischen Esken und Kevin Kühnert auf der einen Seite und Gesine Schwan und Wolfgang Thierse auf der anderen entbrannte. Von einer »Katastrophe« ist unter führenden Genossen die Rede, der Frust sei groß.
Die Debatte über Identitätspolitik legte eine Sollbruchstelle offen: Was für eine Partei will die SPD sein? Kämpfen die Genossen vor allem für sozial Schwächere oder für Minderheiten? Zwischen Traditionssozis und Teilen der Parteilinken herrschen hier völlig unterschiedliche Vorstellungen. Und das könnte es auch Wählerinnen und Wählern erschweren zu erkennen, woran sie bei der SPD eigentlich sind.
Wie tief der Konflikt wirklich geht, zeigt sich auch daran, dass es der Parteispitze trotz zahlreicher Bemühungen tagelang nicht gelang, den Streit abzuräumen. Scholz beschwichtigt, er habe kürzlich mit einem Aufsatz in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« eine Haltung formuliert, hinter der sich alle versammeln könnten. Doch der Konflikt könnte jederzeit wieder aufbrechen.
Eine dauerhafte Einigkeit ist bei der streitlustigen SPD schwer vorstellbar. Helfen könnten dabei Attacken auf den Koalitionspartner, die auch Scholz seit Anfang des Jahres immer häufiger fährt. Parteichef Walter-Borjans warf der Union am Sonntag vor, die Verfehlungen in der Maskenaffäre hätten System. »In Teilen von CDU und CSU ist das Prinzip, dass eine Hand die andere wäscht, immer wieder zum Vorschein gekommen«, sagte Walter-Borjans der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«.
Die Union schlug direkt zurück. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warf dem SPD-Chef vor, »in einer ziemlich dreisten Art Tausende CDU-Mitglieder verächtlich« zu machen.
Das macht auch eines deutlich: Der Bundestagswahlkampf ist in vollem Gange. Schreibt DER SPIEGEL.
Es ist anzunehmen, dass nach den deutschen Bundestagswahlen der «Ampelmann» Olaf Scholz von der SPD nicht als neuer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland dastehend wird, sondern als «Hampelmann».
Zu mehr reicht es nun mal nicht mit den geschätzten zehn bis zwölf Prozent Stimmenanteil.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.3.2021 - Tag der Ausgleichszahlungen
Das Zünglein an der Waage: Kurzarbeit stürzt Menschen in finanzielle Not
Kurzarbeit hat letztes Jahr tausende Jobs gerettet. Doch für Geringverdiener ist die Lohnreduktion ein Problem. Sie gibt den Ausschlag dafür, dass es Ende Monat nicht reicht.
Vimalraj Savarijan Logu (39) lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Sargans SG. Er arbeitet als Hilfskoch in einem Hotelrestaurant. Zumindest würde er das unter normalen Umständen. Bis auf Weiteres war der 22. Dezember sein letzter Arbeitstag.
Die Kurzarbeit hat während Corona zahllose Jobs gerettet, auch jenen von Vimalraj Savarijan Logu. Doch die Arbeitnehmenden müssen eine Lohnreduktion in Kauf nehmen: Vom Staat ersetzt werden lediglich 80 Prozent des eigentlichen Salärs, bei Löhnen unter 4340 Franken kann die Entschädigung höher liegen. So kommt es, dass Hilfskoch Logu seine vierköpfige Familie neuerdings mit 3472 Franken monatlich durchbringen muss.
Natürlich gibt es Arbeitgebende, die ihren Angestellten die Verdienstlücke ausgleichen – mit Geld aus dem eigenen Sack. Gemäss Angaben des Gewerkschaftsbundes tun das aber lediglich 15 bis 20Prozent der Firmen. Als Faustregel gilt: In den Genuss einer Ausgleichszahlung kommen vor allem Leute mit höherem Lohn. Insgesamt wurden 2020 10,8 Milliarden Franken an Kurzarbeitsentschädigungen ausbezahlt. Wären sämtliche Arbeitnehmer zu 100 Prozent entschädigt worden, würde dieser Betrag 13,5 Milliarden Franken betragen – die Menschen in Kurzarbeit mussten im letzten Jahr also eine Lohneinbusse von 2,7 Milliarden Franken hinnehmen.
«Wir haben nie ein Luxusleben geführt»
Geringverdienende kommen schon mit dem Normalsalär kaum über die Runden. Jetzt sind sie in finanzieller Not. So auch die Familie von Vimalraj Savarijan Logu. «Das Geld war schon knapp, als ich noch normal arbeiten konnte», sagt der Küchenmitarbeiter. «Wir haben nie ein Luxusleben geführt, Ferien können wir uns nicht leisten. Aber wenigstens hat es fürs Essen und für die Kinderbetreuung gereicht.» Das tut es nun nicht mehr. Mehrfach musste der Familienvater die Caritas um Hilfe bitten. Die Organisation bezahlte einzelne Rechnungen, half mit Lebensmittelgutscheinen. Auch diesen Monat sieht es nicht gut aus.
Was es für Logu noch schwieriger macht: Er ist Alleinverdiener, seine Frau Sinthuja Coonghe Logu ist seit Jahren schwer krank und kann nicht arbeiten. Ihre Krankheit verursacht zusätzliche Kosten. Letzten August musste sie sich einer 13-stündigen Operation unterziehen, während der ein Teil eines Tumors entfernt wurde. Danach musste sie für eineinhalb Monate in eine Rehaklinik.
Mit Anträgen überfordert
Die Prämie für die Krankenkasse ist neben dem Wohnen der grösste Ausgabenposten der Familie. Laut Caritas trifft das auf die meisten Haushalte in Not zu. Bei ihrer Schuldenberatung melden sich vor allem Personen mit Zahlungsrückständen bei den Steuern und Krankenkassenprämien.
Rechnungen bleiben auch offen, weil der Lohn bei Kurzarbeit oft verspätet ausgezahlt wird. Das bestätigt die Gewerkschaft Unia auf Anfrage. Die Betriebe müssen die Kurzarbeitsentschädigung bei den Arbeitslosenkassen anfordern. Viele sind mit dem Prozedere überfordert, reichen unvollständige Unterlagen ein oder machen falsche Angaben. In der Folge verzögert sich die Auszahlung. Ausserdem sind viele Arbeitslosenkassen heillos überlastet.
Vimalraj Savarijan Logu hofft, dass er ab April wieder arbeiten kann. Dann könnte er seine Rechnungen endlich wieder ohne Hilfe zahlen. Schreibt SonntagsBlick.
«In den Genuss einer Ausgleichszahlung (Anmerkung: auf 100 Prozent des Lohnes) kommen vor allem Leute mit höherem Lohn.» Dieser Satz sagt mehr aus über unsere Gesellschaft als der gesamte Artikel.
«Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Gliederverfährt.» Gustav Heinemann, ehemaliger Präsident der Bundesrepublik Deutschland.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.3.2021 - Tag der albanischen Drogendealer
Albanischer Drogendealer in Kriens festgenommen
Die Luzerner Polizei hat am Dienstagnachmittag einen mutmasslichen Drogendealer aus Albanien festgenommen. Nach der Festnahme hat die Polizei grössere Mengen Kokain und Heroin sichergestellt.
Die Luzerner Polizei hat den mutmasslichen Drogendealer am Dienstagnachmittag (9. März 2021) in Kriens festgenommen. Dies nachdem er einem Kunden Drogen verkauft hatte. Im Auto des 29-jährigen Albaners hat die Polizeihündin Sina (Labrador, 7 Jahre alt) ein Versteck mit portionierten Drogen aufgespürt. Bei einer Hausdurchsuchung wurden zusätzliche Drogen (Kokain und Heroin) und mehrere tausend Franken mutmassliches Drogengeld sichergestellt.
Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung vom 12.3.2021
Kriens ist inzwischen ja auch eine Stadt. Die Nachbarstadt von Luzern. Aber in Kriens gehören Drogen im Gegensatz zu Luzern scheinbar doch (noch) nicht zu einer Stadt, wie uns die Luzerner Polizei weismachen will.
Nicht jeder Albaner ist ein Drogendealer! Das sei hier unmissverständlich festgehalten. Allerdings fällt auf, dass polizeilich festgenommene Hardcore-Drogendealer sehr oft – um nicht zu sagen meistens – vom Balkan stammen. Wo letztendlich ja auch ihre Big-Bosse irgendwo in prächtigen Villen zwischen Tirana und Pristina residieren.
Dass ausgerechnet Albanien in der Statistik der Liste der Länder nach Kokainkonsum an dritter Stelle liegt, überrascht nicht wirklich.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.3.2021 - Tag der leeren Phrasen
Corona-Krise und Drogenkonsum bei Jugendlichen
Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass der Drogenhandel mit Benzodiazepinen, Cannabis und Amphetaminen massiv zugenommen hat. Beängstigend ist, dass die Zielgruppe (ab 12 Jahren) immer jünger wird.
Der Grund für den Drogenhandel und -konsum ist, dass Jugendliche die grossen Verlierer der Corona-Krise sind. Die Jungen brauchen sich eigentlich vor dem Coronavirus kaum zu fürchten, und doch hat die Krise ihnen prägende Momente ihrer Biografie gestohlen.
Die grosse Mehrheit hält sich vorbildlich an die verordneten Regeln, ist solidarisch, hilfsbereit und rücksichtsvoll. Obwohl Rebellion zu diesem Alter gehört wie die Hormonachterbahn und der erste Liebeskummer. Tatsache ist aber, dass die Jugendlichen in der Corona-Krise viel Sicherheit und Orientierung verloren haben. Für sie ist die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt, der Austausch mit Gleichaltrigen und die Selbstbehauptung gegenüber anderen für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit überlebenswichtig.
Das alles ist nun seit fast einem Jahr stark erschwert. Dies hat dazu geführt, dass gewisse Jugendliche sich im Ausprobieren mit verschiedenen Drogen den Kick verschaffen, den sie sich sonst im ganz «normalen» Wahnsinn des Lebens holen würden. Das Medikament «Xanax» ist unter den Jugendlichen besonders im Trend, weil es hilft auszuhalten, was man sonst nicht ertragen würde. Auf einmal ist es einem egal, wenn man alleine zu Hause im Zimmer sitzt und sich nur noch im virtuellen Leben bewegen darf.
Xanax kann relativ einfach auf dem Schwarzmarkt gekauft oder im Darknet bestellt werden. Der Wirkstoff Alprazolam dient der Behandlung von Angstzuständen und Panikstörungen. Xanax führt jedoch langfristig in die Abhängigkeit und hat schwerwiegende Nebenwirkungen wie z. B. Depressionen und Gedächtnisschwäche. Gefährlich bis tödlich wird es, wenn Jugendliche Xanax mit Cannabis oder Alkohol mischen.
Aber warum ist Xanax plötzlich so im Trend? Nach Ansicht von Fachleuten spielt unter anderem die Hip-Hop-Kultur eine wichtige Rolle, welche den Medikamentenmissbrauch glorifiziert. In der Schweiz sind in der Corona-Krise bereits mehrere Jugendliche an einer Medikamentenüberdosis oder an Mischkonsum gestorben.
Uns macht diese Entwicklung grosse Sorgen, da wir in unseren täglichen Beratungen Jugendlichen begegnen, die das Bedürfnis haben, einfach nichts mehr zu fühlen. Die Jugendlichen bleiben ruhig, passen sich an und versuchen, ihre Überforderung mit einer Tablette wegzuwischen und wir sind bemüht, den Jugendlichen im Rahmen unserer Beratungen Alternativen zu Drogen und Medikamenten für den Umgang mit den erschwerten Alltagsbedingungen im Rahmen der Corona-Krise aufzuzeigen.
Schreibt die Gemeinde Ebikon in einer Medienmitteilung.
Der Corona-Krise nun auch noch den Drogenkonsum der immer jünger werdenden Hardcore-Drogenkids in die Schuhe zu schieben, ist viel zu kurz gesprungen. Man hat den Pfad der Tugend «wehret den Anfängen» seitens der zuständigen Behörden und einer saturierten Wohlstandsgesellschaft schon viel länger verlassen. Drogen fallen ja nicht vom Himmel. Oder vom KKL-Dach am Europaplatz. Schon gar nicht von den Bäumen auf dem Inseli oder auf der Aufschütti.
Die Verhaftung eines in dieser Grösse bisher noch nie dagewesenen Schüler-Drogenrings von 50 Kantons- und Berufsschülern sowie Hochschulstudenten in der Stadt Luzern plus Agglo fand im September 2019 statt, also vor der Corona-Pandemie. Die damaligen Medienberichte wurden mit dem üblichen Schulterzucken zur Kenntnis genommen, fanden aber nicht überaus grossen Nachhall in der Bevölkerung. Geschweige denn bei den zuständigen Behörden. Dabei hätte uns allein die Tatsache, dass diese Jugendlichen nicht unbedingt aus «prekären Familienverhältnissen» stammten, aufhorchen lassen müssen.
Dass die Corona-Pandemie den Konsum harter Drogen bei den Jugendlichen befeuert hat, mag sein. Dies als Tatsache per se zu bestreiten wäre töricht. In welchem Ausmass sei mal dahingestellt. Ebenso die Vermutung der Gemeinde Ebikon, dem Hip-Hop die Urheberschaft für die Drogenkrise Jugendlicher zuzuschanzen. Das Jahr 2015 dürfte vermutlich mehr Einfluss auf die Drogenentwicklung bei den Jugendlichen der Stadt Luzern plus Agglo gehabt haben als Hip-Hop und Rap zusammen.
Das Darknet nach dem «Schwarzmarkt» als zweite Quelle für die Beschaffung von Drogen etwelcher Art zu bezeichnen ist ein Unfug bei dieser Altersklasse. Deckt aber auch auf, wie wenig selbst Eltern und Sozialarbeiter*innen über den Umgang ihrer Kinder und Schutzbefohlen im Internet wissen. Darknet ist eher für die «Grossen», sowohl was Umfang der illegalen Geschäfte wie auch das Alter der Klientel betrifft. Die «kleinen» Geschäfte finden online ganz woanders statt. Bei den Messengern nämlich!
Die Eltern der Kids wären nicht schlecht beraten, ab und zu die ganz legalen Messenger-Portale wie Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram usw. ihrer Kids zu besuchen. Sie würden vielleicht nicht schlecht staunen, wenn sie auf dem Account ihres 12-jährigen Kindes plötzlich den über 50-jährigen Türsteher eines bekannten Luzerner Clubs finden würden. Um so mehr, wenn es sich bei diesem Herrnvom Balkan um ein «Privatkonto» handelt.
Unbestreitbar ist hingegen die Tatsache, dass die Corona-Krise die Zuspitzung und damit auch die Wahrnehmung eines gravierenden Drogenproblems in Luzern und Agglo beschleunigt hat. Ein Problem das uns lange vor Corona schon hätte beschäftigen müssen und uns auch nach Corona dank Versagen der zuständigen Behörden noch lange beschäftigen wird.
Denn alles hängt mit allem zusammen. Wo die Drogen sind, sind auch Müll, menschliches Elend und das Sozialamt nicht weit entfernt. Und dies auf Jahre hinaus.
Die üblichen Sensibilisierungskamapagnen der Luzerner Stadtregierung, Floskeln der Luzerner Polizei wie «Das ist halt so in einer Stadt» und vor Betroffenheit triefende Medienmitteilungen einer Luzerner Gemeinde werden daran nichts ändern.
Ein Satz wie «Die Jungen brauchen sich eigentlich vor dem Coronavirus kaum zu fürchten, und doch hat die Krise ihnen prägende Momente ihrer Biografie gestohlen» tönt zwar schön, gilt aber für alle Altersgruppen; Risikogruppen ausgenommen. Vielleicht liegt im ersten Teil dieses Satzes mehr Weisheit als im zweiten: What doesn't kill you, makes you stronger!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.3.2021 - Tag der Gauner
Maskenaffäre und Staatsversagen in Deutschland: Mittendrin die Emix-Boys und Jung-SVPler vom Zürichberg
Ich wünschte mir, dass Talkformate dieser Art, wie sie Markus Lanz unter der Voraussetzung interessanter Gäste immer wieder aus dem Ärmel zaubert, auch hierzulande stattfinden würden. Jenseits des Wohlfühlgeschwurbels und Schulterklopfens einer Schweizer Arena, wo jeder jedem und jede jeder ins Wort fällt, um danach dennoch Zungenküsschen auszutauschen. Frei nach dem Motto «Ich hab dich doch lieb; wir Parlamentarier*innen bedienen uns ja trotz unterschiedlicher Parteifarben aus dem gleichen Futtertrog.»
Einem geschmeidigen Profi-Politiker wie Ralph Brinkhaus, seines Zeichens Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und damit mitten im Zentrum der deutschen Regierungsmacht, Sätze wie nachfolgende Reaktionen des mächtigen CDU-Politikers aus der gestrigen Talkrunde zu entlocken, zeugt von hoher Professionalität des Interviewführers und seinem «Side-Kick» Sascha Lobo vom SPIEGEL. Die beiden Medienprofis liessen es schlicht und einfach nicht zu, dass der hohe Gast aus Berlin seine vorgestanzten Worthülsen absondern konnte.
So sagte Brinkhaus: «Wir brauchen eine Jahrhundertreform, wenn nicht gar eine REVOLUTION! Manchmal braucht es eine Krise, um so was durchzusetzen.» Damit spricht er mir schon lange aus dem Herzen. Und dies nicht erst seit der Corona-Krise.
Und auf die Vorwürfe bezüglich Korruption diverser deutscher Politiker beim Coronamasken-Einkauf, in die auch die Emix-Boys und Jung-SVPler vom Zürichberg und der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn involviert sind, wie man aus dem Talk entnehmen kann, meinte er: «Macht funktioniert nicht ohne Moral.»
Allein um diese Worte aus dem Munde eines ranghohen deutschen Politikers zu vernehmen lohnt es sich, die ganze Sendung der gestrigen Talkrunde von Markus Lanz anzusehen. Auch wenn Brinkhaus für eine Revolution der falsche Mann ist und wohl eher als Teil des Problems und nicht der Lösung eingestuft werden muss.
Rhetorisch begabt ist er aber auf jeden Fall. Doch um Lanz und Lobo zu kontern, reicht es dem elitären CDU-Mann im Büssergewand halt doch nicht.
Ulrich Wickert hat vor langer Zeit das Buch «Gauner muss man Gauner nennen» geschrieben, ein Buch über Werte in der Gesellschaft. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.3.2021 - Tag der Coronamasken-Mafia
Maskenprüfer von Hygiene Austria war nicht über China-Produktion informiert
Das Versprechen "made in Austria" interpretierte der heimische Maskenhersteller Hygiene Austria durchaus kreativ. Wie der Konzern bereits zugegeben hat, ließ er einen Teil seiner FFP2-Masken in China statt in Niederösterreich produzieren. Dass das Tochterunternehmen der Traditionsfirmen Lenzing und Palmers seine Masken in Ungarn zertifizieren ließ, statt eine österreichische Prüfstelle zu beauftragen, sorgte angesichts der vorgeworfenen Vertuschungen rund um die Produktion für Kritik.
Bei Hygiene Austria weist man Bedenken rund um die Zertifizierung zurück: Die Qualität sei "gleichwertig und übererfüllt alle europäischen und österreichischen Schutzanforderungen". Die CE-Zertifizierung sei durch das Schweizer Unternehmen SGS festgestellt worden. Die so überprüften Masken enthalten dennoch die Kennziffer eines Zertifizierers aus Ungarn, und zwar die der Firma Gépteszt. Das Unternehmen mit Sitz in Budapest tritt als notifizierte Prüfstelle auf und bestätigt, dass der Bauplan der Masken EU-Vorschriften entspricht. Zugelassene Labore wie jene der SGS können zuarbeiten.
Harter Test
Eine derartige Prüfung dauert mehrere Wochen. Die Masken werden Temperaturen von 70 Grad bis minus 30 Grad ausgesetzt. Auch der CO2-Rückstau wird genau untersucht. Das Material wird angezündet und mit bestimmtem Staub angeschüttet, um die Durchlässigkeit zu testen. Schließlich laufen Probanden mit den Masken auf Laufbändern, um zu testen, ob Aerosole bei aktiver Atmung und Bewegung durchdringen. Steht eine CE-Nummer drauf, muss all das geschehen sein, egal ob in Österreich oder in einem anderen EU-Land.
Warum ließ Hygiene Austria in Ungarn zertifizieren? Die ungarische Firma Gépteszt wurde laut Hygiene Austria beauftragt, weil kein heimischer Zertifizierer vorhanden war. Ganz so stimmt das nicht: Unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie im März 2020 hat das Wiener Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH (OETI) eine behördliche Akkreditierung beantragt und darf also Zertifizierungen nach dem beschleunigten Verfahren vornehmen. Warum die Hygiene Austria nicht in Österreich eine Zertifizierung beantragt hat, weiß man beim OETI nicht. Eine ungarische Firma zu beauftragen sei aber nicht ungewöhnlich.
Prüfer im Dunklen gelassen
Der Laborchef der in Budapest ansässigen Firma, Daniel Budai, erinnert sich an Hygiene Austria gut, berichtet er. Das Unternehmen habe 50 bis 60 Masken als Muster zur Gépteszt geschickt, anschließend seien sie überprüft worden. Die Ergebnisse hätten gepasst, darum habe man das Testat erteilt. Im Übrigen habe man Kunden aus Österreich wie auch aus Deutschland.
Der Zertifizierungsstelle kommen weitere Kontrollfunktionen zu: Sie muss einmal im Jahr eine Vor-Ort-Prüfung machen, diese hat laut Budai noch nicht stattgefunden. Außerdem muss der Zertifizierer darüber unterrichtet werden, wenn die Produktion verlagert wird, um prüfen zu können, ob weiterhin alle EU-Normen erfüllt sind. Das sei im Fall Hygiene Austria ursprünglich nicht passiert, sagt Budai.
Familiäre Verbindung
Zuletzt traten Palmers und Lenzing in offenen Streit. Lenzing kritisierte mangelnde Einsicht in wichtige Unterlagen der gemeinsamen Gesellschaft. Eine familiäre Verbindung wirft indes Fragen der Vereinbarkeit auf: Die Tochter von Lenzing-Chef Stefan Doboczky arbeitete bei Hygiene Austria, wie der Konzern bestätigt. Deshalb wird Vorstand Stephan Sielaff direkt an den Aufsichtsrat berichten. Schreibt DER STANDARD.
Herrlich! Die Coronamaskenbeschaffung in beinahe sämtlichen Staaten der hehren westlichen Wertegemeinschaft malt ein Sittengemälde über die Verkommenheit der handelnden Politiker*innen wie selten zuvor. Und dies ausgerechnet in einer Krisenzeit!
Egal ob Deutschland, Österreich oder Schweiz: Alle Staaten lecken derzeit die Korruptionswunden, die durch eine ausser Rand und Band geratene, geldgierige Politkaste verursacht wurden. Rücktritte von den politischen Ämtern als Folge dieser Verbrechen gegen die vielgepriesene Solidarität mit der gesamten Bevölkerung der jeweiligen Staaten finden kaum statt, und wenn, nur unter unsäglichem Gewürge. Die nimmersatten Helden der Selbstbereicherung müssen quasi aus den Ratssälen getragen werden. Donald Trump lässt grüssen.
Die Akteure*innen der «Coronamasken-Mafia» sind sich keiner Schuld bewusst. Das ist die eigentliche Tragödie und bestätigt eine alte Volksweisheit, wonach die Untertanen ihrer Politelite nicht nichts zutrauen, sondern eben alles!
So kommt es, wenn die Jungen aus nachvollziehbarer Wahlverdrossenheit ihre Zukunft an den Wahlurnen aufs Spiel setzen und zulassen, dass die Senioren*innen inzwischen der heimliche Souverän* der drei genannten Staaten sind.
Gesellschaftlich zwingend notwendige Veränderungen werden, wie die Geschichte beweist, in der Regel niemals von den Alten angestossen, die in ihrer eigenen Vergangenheit und dem Status Quo 'til the End gefangen sind. Für Revolutionen ist nun mal seit jeher die Jugend zuständig. Just do it!
Quo vadis Demokratie? Welcome to the Bananenrepublik?
* Über 65-Jährige weisen mittlerweile die mit Abstand höchste Wahlbeteiligung auf, wählen im Schnitt deutlich konservativer als ihre jüngeren MitbürgerInnen und stellen aufgrund gestiegener Lebenserwartung und anhaltend tiefer Geburtenziffer einen immer grösseren Teil der Stimmberechtigten. Da stellt sich die Frage, wie die nationalen Parteistärken in den letzten Jahren ausgefallen wären, hätten die jüngeren Generationen ihre Wahlzettel auch so fleissig ausgefüllt. Schreibt die UZH (Universität Zürich in einem Blog-Beitrag).
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
9.3.2021 - Tag der Wendehälse
Parteichefin Petra Gössi denkt schon an ihre berufliche Zukunft: FDP-Talfahrt bringt Cassis' Bundesratssitz ins Wanken
Die FDP stolpert von Wahlschlappe zu Wahlschlappe. Setzt sich der Abwärtstrend fort, steht der zweite Bundesratssitz zur Debatte. Erst recht, weil den Freisinnigen in wichtigen Themen derzeit eine klare Linie fehlt.
Mitten in der Frühlingssession verabschiedet sich FDP-Chefin Petra Gössi (45) zur Weiterbildung an die Uni St. Gallen. Just in jener Woche, in welcher der Nationalrat das Covid-19-Gesetz debattiert, fehlt die freisinnige Präsidentin – ein symptomatisches Bild für ihre Partei.
Man stelle sich vor: Bei der Beratung des Gesetzes, mit dem die Schweiz ihre schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg meistern will, kümmert sich Gössi lieber um die eigene Berufsqualifikation für die Zeit nach dem FDP-Job.
20 Sitze verloren
Derweil stolpert die Partei von Wahlschlappe zu Wahlschlappe – am Sonntag auch in Solothurn: Vier Kantonsratssitze gingen flöten. Sogar sechs, zählt man die Sitze von zwei in der Legislatur zur FDP gewechselten BDPlern dazu. In der Stadt Freiburg flog die FDP aus der Exekutive. Und in Genf warf der von der FDP ausgeschlossene Pierre Maudet (43) den freisinnigen Kandidaten für den Staatsratssitz aus dem Rennen. Einzig im Wallis durfte sich die FDP über einen Sitzgewinn im Grossen Rat freuen.
Die Tendenz ist deutlich: Seit den Nationalratswahlen im Oktober 2019 hat die FDP in zehn kantonalen Parlamenten 20 Mandate verloren – so viel wie keine andere Partei. Mit aktuell 534 Mandaten schweizweit liegt sie nur noch knapp vor der SVP mit 532 Sitzen.
Im Corona-Clinch
Die FDP steckt in der Krise. Und das hat vor allem einen Grund: Es fehlt ihr ein klares Profil. In den Schlüsselthemen ist sie gespalten. Das zeigt sich gerade bei der Corona-Politik, in der die FDP mit ihren eigenen Bundesräten im Clinch ist. Die Partei läuft mit ihrer Forderung nach sofortiger Öffnung schon bei ihren eigenen Magistraten auf.
In ihrem Ärger wollen freisinnige Wirtschaftspolitiker Öffnungsdaten im Gesetz fixieren und Maulkörbe für Wissenschaftler verteilen. Und das ausgerechnet in der Wirtschaftskommission, in der die FDP mit den Schwergewichten Gössi und Fraktionschef Beat Walti (52) sitzt. Und jetzt wird plötzlich Hinterbänklerin Daniela Schneeberger (53, BL) zu ihrer Wortführerin.
Selbst in den eigenen Reihen heisst es jetzt: In der Corona-Politik trottet die FDP bloss noch der SVP hinterher, statt pragmatischen Lösungen zum Durchbruch zu verhelfen.
Hickhack um EU-Rahmenabkommen
Die Kakophonie innerhalb der Partei zeigt sich exemplarisch bei der Positionierung zum Rahmenabkommen mit der EU. Hier zerfleischen sich die Parteiexponenten gegenseitig. Aus dem Vernunfts-Ja ist ein Hickhack geworden.
FDP-Aussenminister Ignazio Cassis (59) zaudert bei seinem wichtigsten Dossier, und alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann (69) bemängelt faktisch mit seiner Fundamentalkritik seine frühere Arbeit zum Rahmenabkommen. Damit schlägt der einstige Wirtschaftsminister eine Bresche in die freisinnigen Reihen. Prominente Unternehmer haben sich in einem Nein-Komitee zusammengeschlossen, während der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann (58) ein Unterstützerkomitee zusammenzutrommeln versucht, das einfach mal «blind» Ja sagt zum Rahmenabkommen – egal was die Nachverhandlungen der drei noch offenen Punkte Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen und Lohnschutz ergeben.
Aber auch in der Klimapolitik kann die FDP nicht punkten. Zwar unterstützt sie das CO2-Gesetz unter einem liberalen Gesichtspunkt, wie Gössi in einem BLICK-Interview betont hat. Doch mit dieser Haltung gewinnt sie keinen Blumentopf. Ökologisch eingestellte Wähler verliert sie trotzdem an die Grünliberalen und die mit dem grüneren Kurs Unzufriedenen an die SVP. Der Groll der Erdöl-Lobbyisten in der Partei ist ebenfalls noch nicht verraucht.
Zweiter Bundesratssitz wackelt
Und schon tauchen am Horizont weitere dunkle Wolken auf. Denn mit dem derzeitigen Abwärtstrend gerät der zweite Bundesratssitz 2023 immer mehr in Gefahr. Die auf einer Erfolgswelle reitenden Grünen beanspruchen einen der beiden FDP-Sitze für sich. Und auch die neue Mitte-Partei ist in Lauerstellung. Legen die Grünen in zwei Jahren weiter zu und sinkt die FDP in der Gunst der Wählerschaft ganz nach dem derzeitigen Trend weiter, ist der Sitz nur noch schwer zu halten.
Dabei glänzen derzeit gleich beide FDP-Bundesräte nicht. Justizministerin Karin Keller-Sutter (57) muss nach dem Ja zur Burka-Initiative und dem Nein zur E-ID gleich einen Doppelschlag verdauen. Doch wirklich zittern muss Cassis. Ausser bei der letztjährigen Corona-Rückholaktion hat der Tessiner als Magistrat kaum je «bella figura» gemacht, und das zentrale EU-Dossier hat er tief in den Sumpf gefahren. So gibt es mehrere Stimmen, die mit einem freiwilligen Abgang von Cassis rechnen, sollte ihm 2023 die Abwahl drohen.
FDP-Vize Caroni ortet bereits Trendwende
FDP-Vizepräsident und Ständerat Andrea Caroni (40, AR) hingegen macht sich um die Bundesratssitze keine Sorgen. «Niemand weiss, wie die Wahlen 2023 ausgehen – vielleicht ist die grüne Welle bis dahin längst verebbt», sagt er zu BLICK. Denn für die freisinnige Durststrecke macht er die politische Grosswetterlage verantwortlich, die derzeit auf Grün stehe. «Darunter leiden aber auch die anderen Bundesratsparteien.»
Dass seine Partei bei wichtigen Themen wie dem Rahmenabkommen oder der Corona-Politik zwischen Stuhl und Bank gerät, streitet Caroni gar nicht ab. «Uns geht es nicht um plakative Positionen, sondern um eine sinnvolle Güterabwägung.» Und mit Blick auf den Sitzgewinn im Wallis versprüht er bereits Optimismus: «Das ist vielleicht schon der Beginn der Trendwende.» Schreibt Blick.
Dass die von Parteichefin «Greta»-Petra Gössi für die Parlamentswahlen 2019 verordnete «Grüne»-Wendehalspolitik bezüglich Klimapolitik nicht von Langfristigkeit gekrönt sein würde, war abzusehen.
Dieser Spagat zwischen den Interessen brachialer Neoliberalismus-Politik und Pöstchenjägerei bis hinauf in den Ständerat, welche nach wie vor den Kern der FDP-Ideologie darstellt, und einer nachhaltigen Klimapolitik entpuppt sich wie erwartet als Quadratur des Kreises. Mission Impossible!
Politiker mit dem Makel der «Korruption» (*gemäss Christoph Blocher) wie «Staatsrat» Pierre Maudet, der in Genf als «Parteiloser» trotzdem das zweitbeste Ergebnis bei den Wahlen vom vergangenen Sonntag holte und dabei den offiziellen FDP-Kandidaten Cyril Aellen haushoch schlug, sind normalerweise keine erfolgsversprechende Visitenkarte.
Doch bei der überwiegenden Mehrheit der FDP-Wähler*innen spielt Korruption scheinbar keine Rolle, wie das Genfer Wahlresultat eindeutig aufdeckt. Das sagt mehr über die Wähler*innen der FDP aus als über Maudet selbst.
* Blocher schreibt in seiner wöchentlich im eigenen Zeitungsimperium erscheinenden Kolumne, dass ER und SEINE SVP FDP-Bundesratskandidat Maudet, den er offen der Korruption bezichtigt, seinerzeit als Bundesrat verhindert hätten. Dafür erwartet der Napoleon vom Herrliberg nachträglich auch noch ein Dankeschön von der Schweizer Bevölkerung, weil dadurch ein Überschwappen der «Korruptionsaffäre Maudet» in den Bundesrat verunmöglicht worden sei.
Ein seltsames Anliegen: Wozu sollen wir uns für etwas bedanken, was ohnehin selbstverständlich ist? Oder anders ausgedrückt: Der Kampf gegen Korruption in der Politik müsste doch Pflicht eines jeden Politikers*in sein.
Auch bei der SVP scheint dies aus naheliegenden Gründen nicht der Fall zu sein. Welche Partei hat denn schon keine Korruptionsleichen im Keller?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
8.3.2021 - Tag der hoffnungsvollen Kommunikation
Schweizer Arbeitsmarkt im Februar 2021 - Arbeitslosigkeit gegenüber Vorjahr um 42,5 Prozent gestiegen
Gemäss den Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) waren Ende Februar 2021 167’953 Arbeitslose bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben, 1’800 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank damit von 3,7% im Januar 2021 auf 3,6% im Berichtsmonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 50’131 Personen (+42,5%).
Jugendarbeitslosigkeit im Februar 2021
Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) verringerte sich um 438 Personen (-2,5%) auf 17’328. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einem Anstieg um 5’208 Personen (+43,0%).
Arbeitslose 50-64 Jahre im Februar 2021
Die Anzahl der Arbeitslosen 50-64 Jahre verringerte sich um 227 Personen (-0,5%) auf 47’288. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Zunahme um 13’871 Personen (+41,5%).
Stellensuchende im Februar 2021
Insgesamt wurden 259’735 Stellensuchende registriert, 1’764 weniger als im Vormonat. Gegenüber der Vorjahresperiode stieg diese Zahl damit um 69’336 Personen (+36,4%).
Gemeldete offene Stellen im Februar 2021
Auf den 1. Juli 2018 wurde die Stellenmeldepflicht für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 8% schweizweit eingeführt, seit 1. Januar 2020 gilt nun neu ein Schwellenwert von 5%. Die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen erhöhte sich im Februar um 5’737 auf 38’678 Stellen. Von den 38’678 Stellen unterlagen 26‘143 Stellen der Meldepflicht.
Abgerechnete Kurzarbeit im Dezember 2020
Im Dezember 2020 waren 293’678 Personen von Kurzarbeit betroffen, 2’914 Personen weniger (-1,0%) als im Vormonat. Die Anzahl der betroffenen Betriebe erhöhte sich um 356 Einheiten (+1,0%) auf 34’667. Die ausgefallenen Arbeitsstunden nahmen um 546’285 (-2,9%) auf 18’610’337 Stunden ab. In der entsprechenden Vorjahresperiode (Dezember 2019) waren 154’535 Ausfallstunden registriert worden, welche sich auf 3’279 Personen in 152 Betrieben verteilt hatten.
Aussteuerungen im Dezember 2020
Gemäss vorläufigen Angaben der Arbeitslosenversicherungskassen belief sich die Zahl der Personen, welche ihr Recht auf Arbeitslosenentschädigung im Verlauf des Monats Dezember 2020 ausgeschöpft hatten, auf 2’123 Personen. Schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Vom SECO lernen heisst siegen lernen. Das Glas ist niemals halbleer, sondern immer halbvoll, merkt Euch diese konfuzianische Weisheit! Wir sollten eine neue Woche nicht mit Defätismus beginnen, sondern mit Mut, Optimismus und einem positiven Blick auf die Schweizer Arbeitslosenzahlen für den Monat Februar 2021, die heute veröffentlicht worden sind.
«Die Arbeitslosenquote sank damit von 3,7% im Januar 2021 auf 3,6% im Berichtsmonat Februar 2021» schreibt SECO. Tönt doch viel besser als «gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 50’131 Personen (+42,5%)».
Wäre ich Kommunikationsberater vom SECO, hätte ich in der Titel-Headline sogar auf die markanteste Verbesserung auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hingewiesen: Die gerne und oft mit Bashing und Vorurteilen vorverurteilten Mitbürger*innen aus dem Kosovo konnten die Arbeitslosenstatistik um 34 Personen von 5'538 auf 5'504 Arbeitslose reduzieren.
In diesem Sinne einen frohen und hoffnungsvollen Start in die neue Woche.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.3.2020 - Tag der Zettelwirtschaft
Krise überwunden: Chinas Aussenhandel boomt wieder
Ungeachtet der globalen Corona-Krise zeigt Chinas Wirtschaft ein ungewöhnlich starkes Wachstum. Die chinesischen Exporte machten in den ersten beiden Monaten des Jahres in US-Dollar berechnet einen Sprung um Plus 60.6 Prozent im Vorjahresvergleich, wie die Zollverwaltung in Peking berichtet. Die Einfuhren der zweitgrössten Volkswirtschaft legten ebenfalls stark um 22.2 Prozent zu. Damit kletterte der Aussenhandel im Jahresvergleich um 41.2 Prozent und übertraf die Erwartungen von Experten.
Als eine Ursache für die ungewöhnlich starken Zuwächse sehen Ökonomen die niedrige Vergleichsbasis zu Beginn des Vorjahres, als China nach dem Ausbruch des Coronavirus in der zentralchinesischen Metropole Wuhan scharfe Kontrollmassnahmen ergriffen und Fabriken geschlossen hatte. Der Aussenhandel entwickelte sich aber schon seit der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder kräftig und trägt stärker als erwartet zur Erholung der chinesischen Wirtschaft bei.
Im vergangenen Corona-Jahr war China die einzige grosse Volkswirtschaft, die Wachstum verzeichnet hat. China hat das Virus mit strengen Massnahmen wie Ausgangssperren und Massentests für Millionen sowie Kontaktverfolgung, Quarantäne und aussergewöhnlich strikten Einreisebeschränkungen weitgehend unter Kontrolle bekommen. So konnten sich der Alltag und die Wirtschaft schon seit dem vergangenen Sommer weitgehend normalisieren. Schreibt SRF im Corona-Liveticker.
Von China lernen heisst siegen lernen: China hat das Virus mit strengen Massnahmen wie Ausgangssperren und Massentests für Millionen sowie Kontaktverfolgung, Quarantäne und aussergewöhnlich strikten Einreisebeschränkungen weitgehend unter Kontrolle bekommen.
Die Instrumente zur Pandemiebekämpfung wie Kontaktverfolgung, Massentests, Quarantäne und Einreisebeschränkungen wurden,und werden teilweise bis heute, von einer verpflichtend vorgeschriebenen App unterstützt. Ohne «Grün» auf der Ampel der chinesischen Corona-App kam beispielsweise kein Mensch in ein chinesisches Kaufhaus.
Die hehre westliche Wertegemeinschaft entwickelte ebenfalls in vielen Mitgliedsländern Corona-Apps. Die kosteten die Steuerzahler*innen zwar unglaubliche Millionenbeträge, nützten aber mehr oder weniger rein gar nichts und entwickelten sich zu Lachnummern. Einerseits, weil vielen westlichen Staaten das IT-Know How schlicht und einfach fehlt und andererseits von den Bürgerinnen und Bürgern die persönlichen Daten, die man zwar ohne Wimpernzucken Google, Microsoft, Facebook, Pornhub & Co. überlässt, zur heiligen Kuh erklärt wurden.
Wer aber in einer digitalen Welt wichtige Daten wie z.B. Kontaktverfolgung oder die Erhebung von Fallzahlen mit Steinzeitinstrumenten wie Fax und handgeschriebenen Zetteln und Bleistift erhebt, wird immer scheitern.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.3.2021 - Tag der Marktingstrategien
Leben wird verschwinden: Die Erdatmosphäre verliert Sauerstoff
In rund einer Milliarde Jahren könnte die Erdatmosphäre fast ihren gesamten Sauerstoff verloren haben – von den heute rund 20 Prozent bleiben weniger als ein Prozent. Schuld daran ist die Sonne.
Ohne Sauerstoff könnten wir nicht existieren. Die Luft zum Atmen ist für uns Menschen etwas so Selbstverständliches, dass wir nie auf den Gedanken kommen würden, dass dieser Sauerstoff eines Tages einmal ausgehen könnte. Doch genau dazu wird es kommen.
Wie die Umweltwissenschaftler Kazumi Ozaki von der japanischen Toho Universität und Christopher Reinhard vom Georgia Institute of Technology im Fachjournal «Nature Geoscience» schreiben, wird von den 21 Prozent Sauerstoff, die sich jetzt in der Erdatmosphäre befinden, in etwa einer Milliarde Jahren nur noch ein Prozent übrig sein.
Je älter die Sonne, desto unwirtlicher wird es
Verantwortlich für den Sauerstoffschwund ist die natürliche Alterung der Sonne und die damit verknüpfte Zunahme ihrer Strahlung, so die Forschenden. Die gibt mit ihren aktuell rund 4,5 Milliarden Jahren schon jetzt ordentlich Strahlung ab und sorgt damit dafür, dass Pflanzen Fotosynthese betreiben können.
Nimmt diese aber zu, verstärkt die erhöhte Einstrahlung Verwitterungsprozesse und hohe Temperaturen. Das wiederum verändert biogeochemische Stoffkreisläufe und kann dazu führen, dass Pflanzen irgendwann keinen Sauerstoff mehr herstellen können. Unter diesen Bedingungen könnte ein Grossteil der heutigen Lebensformen nicht mehr existieren.
Verhältnisse verschieben sich
Während Sauerstoff und Kohlendioxid stark abnehmen, wird der Methananteil deutlich zunehmen. «In vieler Hinsicht wird die Erdatmosphäre der fernen Zukunft damit derjenigen der Urerde vor dem sogenannten Great Oxidation Event gleichen», zitiert Scinexx.de die Forscher. Dieses Ereignis vor rund 2,4 Milliarden Jahren reicherte die zuvor von Methan, Stickstoff und Kohlendioxid dominierte Uratmosphäre in kurzer Zeit mit Sauerstoff an. Die Erde würde dann – aus dem All betrachtet – eher dem Saturnmond Titan ähneln.
Immerhin, laut der Prognose von Ozaki und Reinhard, geht der Erde, wie wir sie kennen, erst in 1,08 Milliarden Jahren die Luft aus. Und nicht bereits in zwei bis vier Jahren, wie im Dezember Forschende warnten. Schreibt 20Minuten.
Clickbaiting at its best - geschrieben im Konjunktiv. Dabei wäre die Schreibweise in der «Möglichkeitsform» für einmal gar nicht notwendig. Dass unsere Sonne wie alle Sonnen des Universums eine begrenzte Lebensdauer hat und mit einer gewaltigen Explosion als «Nova» enden wird – für den Begriff der «Supernova» reicht die Masse der Sonne nicht aus, – ist eine längst gesicherte Tatsache*.
Hubble sei dank verfügen wir inzwischen sogar über Bilder von Sternen-Explosionen. Dass dabei der Sauerstoff in der Atmosphäre flöten geht, liegt auf der Hand. Unsicherheit herrscht nur über den genauen Zeitpunkt.
Das spielt aber auch keine Rolle. Ob der Sauerstoff aus der Erdatmosphäre in einer Milliarde Jahren oder etwas früher oder später entweicht, kann ohnehin niemand exakt voraussagen. Ist auch nicht wichtig. Die unvorstellbaren Dimensionen des Universums lassen sich nicht auf unsere Zeitrechnung ein.
Umso mehr, weil das Anthropozän (die Erde in der Menschenzeit) ohnehin vorbei sein wird, bevor dem Ballon die Luft ausgeht. Da werden für einmal auch Lockdowns nichts ausrichten. Das Atmen lässt sich ja nur schwerlich verbieten.
Für alle Seligen und Gläubigen der «7-Tage-Schöpfungsgeschichte» entschuldige ich mich in aller Form. Leider sind Tora, Bibel und Koran nichts anderes als Instrumente, um Euch über eine Spiritualität, die nichts beweisen muss, beherrschen zu können.
Und dies nicht erst seit der Homo Sapiens im alten Ägypten den Pfad der Tugend verlassen hat: Re (auch Ra) war der altägyptische Sonnengott, zu dem die Untertanen aufschauten und ihre spirituellen Bedürfnisse befriedigten. Das bedeutete damals, dass die Sonne der reale «Gott» war und daher nicht von einem göttlichen Wesen geschaffen wurde.
Das gefiel logischerweise weder den herrschenden Königen noch den Pfaffen des Niltals. Sie erschufen in ihrer unermesslichen Kreativität fiktive Wesen oder übernahmen sie im Laufe der Zeit von bereits existierenden monotheistischen Glaubensrichtungen als genialste Marketingstrategie, die bisher über Jahrtausende hinweg Wissenschaft, Bildung und Aufklärung trotzten. Wer kann denn schon den Verlockungen von Cumuluspunkten fürs Jenseits widerstehen?
Alles klar?
* https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/sonne/pwiewirddiesonneewigscheinen100.html
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.3.2020 - Tag der Quoten-Toten
Schweigeminute ab 11.59 Uhr: Heute gedenkt die Schweiz der 2,5 Millionen Corona-Opfer
Am 25. Februar 2020 wurde im Tessin der erste Patient positiv auf Corona getestet. Neun Tage später starb in der Romandie die erste Person an einer Covid-Erkrankung. Tausende starben seither. Heute gedenkt die Schweiz der Corona-Opfer.
Heute Freitag hält die Schweiz inne. Genau vor einem Jahr starb im Universitätsspital Lausanne die erste Corona-Patientin. Seither sind mehr als 10'000 Frauen und Männer in unserem Land den Folgen einer Corona-Ansteckung erlegen. Weltweit sind über 2,5 Millionen Menschen an einer Covid-19-Infektion gestorben.
Erkrankte mit Spätfolgen nicht vergessen
Bundespräsident Guy Parmelin (61) ruft die Schweizer Bevölkerung dazu auf, heute Mittag an diese Opfer zu denken. Und auch die zahlreichen Erkrankten nicht zu vergessen, von denen viele noch an Spätfolgen leiden.
Die Schweigeminute ab 11.59 Uhr soll laut dem SVP-Bundesrat aber nicht nur ein Moment der Trauer sein. Sondern aus dieser Solidarität mit den Opfern und deren Angehörigen solle man Kraft schöpfen und nach vorne schauen können. «Denn nur so können wir die gegenwärtige Krise meistern», sagt Parmelin.
Kirchen läuten die Glocken
Die drei Landeskirchen lassen ab 12 Uhr die Kirchenglocken läuten. Die Schweizer Flagge am Bundeshaus wird jedoch nicht auf halbmast stehen. Schreibt Blick.
Nichts gegen Clickbaiting. Das gehört zu den Medien in der digitalen Welt von Heute dazu wie das Amen in der Kirche. Damit müssen wir leben.
Doch in gewissen Momenten sollte auch ein Boulevardblatt auf Clickbaiting verzichten. Denn eigentlich war die Gedenkminute als Trauer für die Schweizer Opfer der Corona-Pandemie vorgesehen. So stand es jedenfalls geschrieben in der Medienmitteilung vom WBF, dem Bundespräsident Guy Parmelin vorsteht.
Doch «2,5 Millionen Corona-Opfer» als Titelzeile tönt halt nun einmal verführerischer als 10'000 Corona-Tote.
«Tote bringen Quote». Dieser uralte Medien-Marketing-Claim hat auch in der digitalen Welt nichts von seiner Wahrheit eingebüsst.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.3.2021 - Tag der verschlerten Absichten
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»: Probleme lösen
Am 7. März 2021 kommt die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» zur Abstimmung. Wie auch immer diese ausgehen mag, sie löst nicht das zugrundeliegende Problem: die wirkungsvolle Bekämpfung radikaler fundamentalistischer Ideologien bei gleichzeitiger religiöser Toleranz und der Anerkennung, dass die überwiegende Mehrheit der Musliminnen und Muslime nichts mit menschenverachtendem politischem Fundamentalismus zu tun hat.
Die Schweiz akzeptiert die religiöse Vielfalt, wie sie durch die Migration noch verstärkt worden ist. Grundrechte - z.B. die Rechtsgleichheit, das Diskriminierungsverbot, die Glaubens- und Gewissensfreiheit oder die Meinungsfreiheit - verwirklichen die Freiheiten der Einzelnen. Und sie nehmen den Staat in die Pflicht, Massnahmen zum Schutz dieser Freiheiten zu entwickeln.
Die Initiantinnen und Initianten geben vor, mit ihrer Initiative die Gleichberechtigung der Frauen zu fördern und gegen Radikalisierungstendenzen anzukämpfen. Die Gegnerinnen und Gegner hingegen sprechen von einem Scheinproblem, weil nur eine Handvoll Frauen - insbesondere Konvertitinnen und Touristinnen - verhüllt ist. Und sie finden das Verbot einer bestimmten Kleidung nicht vereinbar mit einer freiheitlichen Wertordnung.
Was immer aber das Abstimmungsresultat sein wird, es löst keines der wirklichen Probleme: die wirkungsvolle Bekämpfung der radikalen islamistischen Ideologie bei gleichzeitiger religiöser Toleranz und diskriminierungsfreier Akzeptanz jener überwiegenden Mehrheit von Musliminnen und Muslimen, die nichts mit diesem menschenverachtenden politischen Fundamentalismus zu tun hat.
Es gibt eine politische und religiöse Ideologie des Islamismus, die nicht mit den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft zu vereinbaren ist. Frauen sind in dieser Ideologie nie als gleichgestellt akzeptiert. Diese Ideologie gilt es wie alle fundamentalistischen Tendenzen mit effizienten Massnahmen zu bekämpfen.
Gleichzeitig braucht es eine diskriminierungsfreie Akzeptanz des Islams als Religion, die in vielfältigen Ausprägungen längst Teil der schweizerischen Gesellschaft geworden ist. Der Islam, der hier gelebt wird, hat zu einem überwiegenden Teil nichts mit fundamentalistischen Dogmen zu tun. Er soll wie alle anderen hier gelebten Religionen akzeptiert, Musliminnen und Muslime respektiert und gleich wie alle anderen Menschen im Land behandelt werden. Diskriminierungsfreie Akzeptanz der Religion und Bekämpfung fundamentalistischer Ideologien sind grundlegende Elemente einer freiheitlichen Gesellschaft.
Schreibt die Eidgenössische Migrationskommission.
Dieser exzellenten Short-Analyse der Migrationskommission ist nichts hinzuzufügen. Die tatsächlichen Probleme mit dem Islam werden offen und schonungslos umschrieben. Ohne rassistische Untertöne. Die Vollverschleierung einer Handvoll Konvertitinnen und Touristinnen gehört definitiv nicht zu diesen Problemen.
Unsinnige Volks-Abstimmungen über Stammtisch-Geplänkel, die einzig und allein der Befriedigung eines extremen, aber mächtigen Flügels der SVP dienen, sind einer Demokratie nicht würdig und untergraben den eigentlichen Sinn dieses hohen Guts der Volksinitiativen.
Man darf der SVP zu Recht vorwerfen, dass sie mit ihrem absurden und unerträglichen Gesülze um «Frauenrechte» die wahren Absichten «verschleiert»! Sie verschweigt auch, dass die «Vollverschleierung» im behördlichen Raum von den Kantonen untersagt werden kann und in vielen Kanton längst gesetzlich geregelt und somit verboten ist. Ohne «Volchsabstimmung», wie der Prophet vom Herrliberg seine stärkste politische Waffe zu nennen pflegt.
Da braucht man sich nicht zu wundern, dass die Wahlbeteiligung der Schweizer Bevölkerung immer tiefer in den Keller fällt. Mit Wahlbeteiligungen zwischen 20 und 30 Prozent wird auch das Wort «Volksabstimmung» ad absurdum geführt und langfristig zu Grabe getragen.
Wir sind vom alten Hippie-Slogan (leicht der Situation angepasst) nicht mehr weit entfernt: «Stellt Euch vor, es finden Wahlen statt und keiner geht hin!»
Dass dieser Zustand letztendlich dazu führt, dass geistig minderbemittelte, aber raffinierte und wortgewaltige Populisten und deren krude Anhänger*innen das Regierungshandeln bestimmen und wir somit von einer krassen Minderheit regiert werden, dürfte der SVP vermutlich mehr als recht sein. Nicht umsonst wird Trump in der SVP – bis hinauf zu den höchsten Kadern – noch immer bewundert.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.3.2021 - Tag des Lädelisterbens
Leere Ladenlokale in der Innenstadt: City-Manager für Luzern – Das Gewerbe rüstet sich für den Kampf gegen das Lädelisterben
Behörden und Verbände können die wirtschaftlichen Entwicklungen in der Luzerner Innenstadt kaum nachvollziehen und steuern. Das zeigt sich an der Löwen- und der Alpenstrasse, wo viele Ladenlokale leer stehen. Deshalb macht die City-Vereinigung bei einem schon länger laufenden Projekt Dampf.
In der Altstadt Luzern gibt es momentan mehr als zwei Dutzend leere Ladenlokale. Der Trend, der schon seit längerem anhält, dürfte durch Corona noch verstärkt worden sein.
Geht man derzeit durch das Quartier zwischen der Zürichstrasse und dem Gebiet Wey, trifft man auch dort auf viele leerstehende Ladenlokale. Es scheint, dass in jüngster Zeit einige Betriebe ihre Türen geschlossen haben. Ein Phänomen, das aber kaum jemand auf dem Radar zu haben scheint, obwohl tote Schaufenster in den Erdgeschossen gemeinhin als erhebliches Problem für die Attraktivität des Lebensraumes betrachtet werden.
Auch die City-Vereinigung, das Sprachrohr des Detailhandels und des Gewerbes in der Luzerner Innenstadt, ist nicht im Bilde. «Zu leeren Läden kann ich nichts sagen», sagt Lucas Zurkirchen, Politikverantwortlicher bei der Organisation. Gleichzeitig ortet er bei diesem Umstand eine Herausforderung, mit dem sich die lokale Wirtschaft sowie die Politik aktuell stark beschäftigen müsse.
Projekt ist seit Längerem in der Pipeline
«Das Problem ist, dass wir momentan über kein Monitoring über solche Prozesse verfügen», so Zurkirchen. Die Lösung: Die Einsetzung einer City-Managerin oder eines City-Managers. Einen solchen kennen zum Beispiel verschiedene Städte in Deutschland.
«Die Luzerner Innenstadt ist eigentlich wie ein grosses Shoppingcenter», sagt Zurkirchen. Analog dazu brauche auch sie einen Manager, um die vielen Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Denn die Veränderungen seien nicht aufzuhalten, was auch mit Corona zu tun habe. Es geht um den Tourismus, die Verkehrsproblematik oder die intensiver werdende Nutzung des öffentlichen Raumes mit entsprechenden Nutzungskonflikten.
Die Idee, eine Managerin für die Innenstadt einzusetzen, ist in der Stadt Luzern mittlerweile seit mehr als drei Jahren auf dem politischen Tapet und stösst auch beim Stadtrat auf offene Ohren. Doch nun scheint neuer Schwung in die Sache zu kommen. Jedenfalls arbeite man gemäss Zurkirchen bei der City-Vereinigung derzeit intensiv an dem Projekt.
Die Arbeiten wurden Anfang November unter der Leitung des Verantwortlichen für Wirtschaftsfragen bei der Stadt, Peter Weber, gestartet. «Bei der City-Vereinigung steht das Projekt derzeit zuoberst auf der Prioritätenliste», betont Zurkirchen. «Wegen Corona kam die Weiterbearbeitung etwas ins Stocken und wird in den kommenden Wochen fortgesetzt.»
In einer ersten Phase werden laut Zurkirchen persönliche Gespräche mit den wichtigsten Beteiligten geführt, um deren Meinung abzuholen. Geplant ist ebenfalls eine Online-Umfrage mit Mitgliedern der verschiedenen Organisationen in der Stadt. Erste Ergebnisse erwartet die City-Vereinigung zu Beginn der Sommerferien.
Stelle soll nicht bei der Stadt sein
Die Lösung sieht Zurkirchen indes nicht bei einer personellen Aufstockung der Stadtverwaltung. «Die entsprechenden Aufgaben müssen von einer unabhängigen Stelle ausgeführt werden», hält er fest. Und weiter: «Finanziert werden könnte die Stelle von einer Trägerschaft, an der sich beispielsweise die Hoteliers, der Tourismus und die lokalen Wirtschaftsverbände beteiligen.» Für Zurkirchen ist dennoch klar, dass sich auch die Stadt angemessen daran beteiligen muss. Schliesslich gehe es um die Attraktivität des Lebensraumes.
«Ziel muss es sein, dass wieder mehr Leute in die Innenstadt kommen. Darum ist es wichtig, dass man die Entwicklungen in allen relevanten Stadtteilen rechtzeitig erkennt und bei Bedarf reagieren kann», sagt Zurkirchen zum Schluss. Und meint damit auch das Quartier um den Löwenplatz. Schreibt ZentralPlus.
Es ist richtig, dass die Corona-Pandemie wie ein Durchlauferhitzer eine Entwicklung beschleunigt, die ohnehin nicht aufzuhalten ist. Die Onlineshops haben während den Lockdown-Phasen zugelegt, wie kaum eine andere Branche – nicht nur in der Schweiz – und damit das Kaufverhalten von Jung und Alt nachhaltig verändert.
Gegen diesen Trend, der in den Schweizer Dörfern längst vollendete Tatsachen geschaffen hat, wird auch ein City-Manager*in machtlos sein. Die omnipräsenten «Sensibilisierungskampagnen» der Luzerner Stadtregierung, die als Mittel zur Problemlösung noch nie weitergeholfen haben, werden auch beim Thema «Lädelisterben» einmal mehr versagen. Hinausgeworfenes Geld, mehr nicht. Ein Kampf gegen Windmühlen. Oder wie König Artus den Rittern der Tafelrunde offenbart haben soll: «Nichts bleibt wie es ist. Doch der Starke wird immer den Schwachen besiegen.»
Zu den Starken in diesem Game um die künftige Nutzung von Ladenflächen waren bisher die Immobilienvermieter zu zählen, die nun mit 30 bis 40 Prozent tieferen Mietkosten um neue Ladenmieter buhlen. Ein Sinneswechsel, der zu spät stattfindet.
Diese vergifteten Angebote werden das Problem leerstehender Läden weder kurz- noch langfristig lösen. Kurzfristig nicht, weil die so viel geschmähten ca. 300'000 Touristen pro Jahr aus China (und Asien) die Stadt am Fusse des Pilatus vorerst kaum mehr besuchen werden. Und langfristig wird der Trend mit immer neuen digitalen und noch raffinierteren Angeboten in einer total vernetzten Konsumgesellschaft nicht mehr aufzuhalten sein.
Nicht mal mit Barbershops und noch mehr Kebab-Klitschen ist das Lädelisterben zu stoppen. Selbst die Bäckerei Bachmann wird sich irgendwann mit ihren Läden an jeder Ecke in der Stadt Luzern ohne die Ni Haos selber kannibalisieren. Jörg Bucherer hat ja nicht umsonst mit Massenentlassungen auf die Lockdowns reagiert. Ohne chinesische Touristen ist selbst der grösste Uhrenhotspot der Welt nichts mehr wert.
Die Immobilienvermieter werden sich wohl oder übel nach neuen Geschäftsmodellen umsehen müssen. Kreativ genug sollten sie eigentlich sein, wie die Vergangenheit oft genug bewiesen hat.
Unersättliche Gier war schon immer eine Triebfeder der Kreativität.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.3.2021 - Tag der Formel1
Kosovare mit 152km/h in Schötz durch 80er-Zone gerast
Die Luzerner Polizei hat am Freitag in Schötz einen Raser gestoppt. Der Mann war mit seinem Auto massiv zu schnell unterwegs.
Der 29-jährige Mann wurde am Freitag (26. Februar 2021), kurz vor 14.30 Uhr, in Schötz kontrolliert. Er war mit seinem Auto auf der Gettnauerstrasse - im 80er-Bereich - mit 152km/h unterwegs. Dem Lenker wurde vor Ort der Führerausweis abgenommen. Das zuständige Strassenverkehrsamt wird über die Dauer vom Ausweisentzung entscheiden. Das Auto des Lenkers, ein Audi A8, wurde vorübergehend sichergestellt. Der Mann wohnt im Kanton Luzern und stammt aus dem Kosovo.
Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.
Schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung
Die Schnappatmung könnt Ihr Euch sparen: Es ist völlig untypisch, dass Kosovaren mit ihren geleasten Audis oder sonstigen Luxuskarossen zu schnell durch Schweizer Dörfer und Städte fahren. OK, manchmal cruisen sie etwas auffällig mit einem gemieteten Supersportwagen der Marke Lamborghini und aufgedrehtem Motor zwischen Inseli und Aufschütti auf dem Luzerner Alpenquai umher.
Aber das macht Walter Bruns Sohn auch, wenn er auf der Suche nach weissem Milchpulver fürs Kafi Complet mit seinem Hummer-Gigantomobil samt botoxierter Gucci-Freundin auf dem Nebensitz den Alpenquai hinauf und hinunter fährt. Und Bruns Sohn ist nun wirklich ein waschechter Schweizer. Kein Kosovare. Also: Nix wie alle, aber wirklich alle Vorurteile auf der Stelle einpacken.
Vermutlich hatte der «Raser», wie ihn die Luzerner Polizei in ihrer heutigen Medienmitteilung etwas despektierlich und beinahe schon diskriminierend nennt*, eine unglückliche Jugend, die ihn immer wieder traumatisiert, wenn er durch Dörfer wie Schötz fährt.
Passiert mir auch ab und zu. Jedenfalls wenn ich in Schötz bin, das mich immer irgendwie an Pristina, die Hauptstadt des Kosovos, und dessen ehemaligen UCK-Führer und Staatspräsidenten Hashim Thaçi erinnert, der als Student während seinem Studium in der Schweiz im Emmen-Center eine unbezahlte Jeans-Hose mitlaufen liess. Das kann schon mal passieren. Sollte man nicht überbewerten. Die Lappalie ist ja auch aus den Luzerner Akten verschwunden, nachdem er Staatspräsident wurde.
Warum mich Schötz an Pristina und Hashim Thaçi erinnert, weiss ich eigentlich gar nicht. Möglicherweise ist es die Strafanstalt in der Nähe von Schötz, genauer gesagt in Wauwil, die in mir dumme und unangebrachte Assoziationen weckt.
Wer noch niemals im Formel1-Renntempo durch Schötz gebrettert ist und auch noch nie eine Jeans-Hose geklaut hat, werfe den ersten Stein!
* Hallo SP Luzern, das wäre eigentlich wieder mal eine Demo wert! Ich bin schon voller Erwartung und stante Pedes bereit, Euch mit meiner Nikon und in meinen karierten Golfhosen auf Schritt und Tritt zu begleiten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.3.2021 - Tag der arabischen Portokassen
Vor internationaler Geberkonferenz: Uno nennt Lage im Jemen »schlimmste Entwicklungskrise der Welt«
»Kindsein im Jemen ist eine besondere Hölle«: Seit fünf Jahren leiden die Menschen im Jemen unter einem blutigen Stellvertreterkrieg, Uno-Generalsekretär António Guterres warnt eindringlich vor einer großen Katastrophe.
Seit bald fünf Jahren tobt im Jemen ein blutiger Bürgerkrieg. Ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis kämpft seit März 2015 gegen schiitische Rebellen im Land – die Bevölkerung wird zwischen den Konfliktparteien zerrieben. Die Vereinten Nationen fordern nun dringende Hilfe für die Menschen im Land.
Schon jetzt seien fast 50.000 Menschen dem Hungertod nahe, berichtete das Uno-Nothilfebüro (OCHA) am Montag. 400.000 Kinder unter fünf Jahren seien akut unterernährt und könnten ohne dringende Hilfe bald sterben. Um die Menschen zu retten und Millionen weitere vor einer ähnlich prekären Situation zu bewahren, brauchen die Vereinten Nationen in diesem Jahr 3,85 Milliarden Dollar (3,15 Milliarden Euro). Möglichst viel davon sollte an diesem Montag bei einer virtuellen Geberkonferenz zusammenkommen. Deutschland beteiligt sich daran.
Der Leiter des Uno-Entwicklungsprogramms für das arabische Land hat die dortige Lage als »schlimmste Entwicklungskrise der Welt« bezeichnet. »Der Jemen hat zwei Jahrzehnte an Entwicklungsfortschritten verloren«, sagte Auke Lootsma im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Das Bürgerkriegsland sei derzeit »definitiv eines der ärmsten, wenn nicht das ärmste Land der Welt«.
Wenn das Land weiter so heruntergewirtschaftet werde, werde es »sehr schwer wieder aufzubauen sein«, sagte der Uno-Vertreter. »Wenn mehr Güter zerstört und die Menschen immer ärmer und ärmer werden, wird es fast ein wirtschaftlich nicht überlebensfähiger Staat werden.«
»Kindsein im Jemen ist eine besondere Hölle«
Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte an, dass auch Berlin die Mittel für das Land aufstocken wolle. »Heute geht es nicht nur darum, im Jemen eine akute Hungersnot abzuwenden. Neue blutige Kämpfe um Marib, Cholera- und Polio-Ausbrüche, Heuschreckenplagen – die Not der Menschen sprengt jede Vorstellungskraft«, erklärte der SPD-Politiker vor der Konferenz. »Heute werden wir noch einmal mit einer substanziellen neuen Hilfszusage vorangehen und eindringlich dafür werben, dass andere es uns gleich tun.« Hoffnung auf echte Besserung gebe es jedoch nur, wenn es endlich gelänge, die Kämpfe zu stoppen.
»Kindsein im Jemen ist eine besondere Hölle«, sagte Uno-Generalsekretär António Guterres vor dem Auftakt. »Der Krieg schluckt eine ganze Generation von Jemeniten. Wir müssen ihn jetzt beenden und uns sofort um die enormen Folgen kümmern.«
Stellvertreterkrieg von Saudi-Arabien und Iran
Durch Bombardierungen und Gefechte sind nach Uno-Angaben seit 2015 insgesamt 3,6 Millionen Menschen vertrieben worden. Friedensbemühungen scheitern seit Jahren. Der Konflikt ist vor allem ein Stellvertreterkrieg: Das von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis kämpft an Seite der jemenitischen Regierung gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen. Die Rebellen hatten im Herbst 2014 die Hauptstadt Sanaa überrannt und wichtige Einrichtungen besetzt.
Nach Angaben des Uno-Nothilfebüros sind 2,3 Millionen Kinder unter fünf Jahren von akuter Unterernährung bedroht, so viele wie nie zuvor. 16 der 29 Millionen Einwohner brauchen Nahrungsmittelhilfe. Die Situation hat sich 2020 durch neue Kämpfe und die Corona-Krise verschärft. Zusätzlich konnte mangels Geld deutlich weniger Menschen geholfen werden als nötig. Insgesamt kamen 2020 an Spenden nur 1,9 Milliarden Dollar zusammen, 56 Prozent der benötigten Bedarfs. Schreibt DER SPIEGEL.
The neverending Blues: Die Söhne Allahs führen mit Unterstützung der Waffenlieferanten und moralischer Zustimmung von den USA über die EU bis hin zu den üblichen Verdächtigen wie China und Russland mörderische Kriege und lassen nebst unsäglichem Leid für die jeweils betroffenen Bevölkerungsgruppen «failded States» zurück. Die hehre westliche Wertegemeinschaft und deren Steuerzahler*innen dürfen für die humanitären Folgeschäden der unsäglichen Glaubenskriege zwischen Sunniten und Schiiten und den daraus resultierenden Flüchtlingskolonnen aufkommen.
Dabei könnten Saudi-Arabien und die Scheichtümer vom Golf diese Kosten aus ihren Portokassen bezahlen. Genug Geld, um weltweit den Bau von Moscheen im Kosovo, in Moskau, Indonesien und Reinach im Kanton Aargau zu sponsern, ist ja auch vorhanden.
Vermutlich sind die von der UNO verlangten Milliardensummen der Rabatt, den sich die Waffenkäufer aus dem Orient bei den Vertragsabschlüssen mit den Waffenkonzernen jeweils einhandeln. Waffenschmieden sind schliesslich systemrelevant.
Man darf sich nach Jahrzehnten ununterbrochener Kriegshandlungen nach dem immer gleichen Schema schon fragen, was uns die blutigen Auseinandersetzungen um die Deutungshoheit des Korans oder um die räumlich/religiöse Vorherrschaft muslimischer Pfaffen-Staaten angehen?
So wie selbst ein blindes Huhn manchmal ein Korn findet, gibt auch Christoph Blocher ab und zu Weisheiten von sich, denen man zustimmen kann. So sagte der Feldherr vom Herrliberg vor langer Zeit, als es um die «Volchsabstimmung» über den Beitritt der Schweiz zur UNO ging: «Wir sollten uns nicht in fremde Händel einmischen!»
Dass wir unsere Freiheit vom Hindukusch bis zum Golf von Oman verteidigen müssen, glaubt inzwischen nach all den verheerenden und desaströsen militärischen Eingriffen von USA, Nato & Konsorten sowieso kein vernünftiger Mensch mehr, auch wenn der von der hehren westlichen Wertegemeinschaft ununterbrochen wie auf einer tibetanischen Gebetsmühle verbreitete Unsinn noch so gut tönt.
Das osmanische Heer steht schliesslich nicht wie weiland 1683 vor den Toren Wiens. Der Sultan vom Bosporus praktiziert zusammen mit seinen salafistischen Brüdern der Wahhabiten-Zunft längst smartere Strategien.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
28.2.2021 - Sonntag der Heuchler
Aufruf zu Gewalt in Facebook-Gruppe – Andreas Glarner war Administrator
In einer geschlossenen Facebook-Gruppe wird immer wieder zu Gewalt aufgerufen. Bis vor wenigen Tagen war SVP-Nationalrat Andreas Glarner ein Administrator dieser Gruppe. Glarner sagt, er habe davon nichts gewusst.
«Schweizer erwache!!» – so heisst eine geschlossene Facebook-Gruppe, bei der SVP-Nationalrat Andreas Glarner bis am Mittwochabend einer von drei Administratoren war, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) berichtet. Eine Gruppe mit 1500 Mitgliedern, in der antisemitische Verschwörungstheorien, rassistische Hetze, sexistische Abwertungen, Aufrufe zu Gewalt gegen Politiker, Flüchtlinge und Andersdenkende verbreitet werden.
Das Brisante: Gemäss Facebook-Richtlinien war Glarner als Administrator dafür verantwortlich, dass die in der Gruppe geteilten Inhalte «sämtlichen geltenden Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften» entsprechen. Doch wie eine Recherche laut Bericht zeigt, haben Glarner sowie die beiden anderen Administratoren von «Schweizer erwache!!» diese Verantwortung nur sehr selten wahrgenommen.
Rund zehntausend Posts und Kommentare aus den letzten Monaten wurden ausgewertet. So diskutierten einige Gruppenmitglieder nach dem Amtsübergabe-Tweet vom Silvesterabend beispielsweise über Simonetta Sommaruga. Die Kommentare reichten von Beleidigungen – «Landesverräterin», «Leere Hülle ohne Rückgrat» – bis zum Mordaufruf: «… am besten Kopfnuss ä Kopfsch...»
Auch als Anfang Februar in der Gruppe über den Migrationspakt diskutiert wurde, liessen die drei Administratoren zahlreiche Aufforderungen zu Gewalt stehen.
Glarner will Gruppe nicht kennen
Glarner selbst hat sich in der Gruppe nicht an den Diskussionen beteiligt. Weder schrieb er Beiträge, noch trat er als Moderator in Aktion. Er kenne diese Gruppe nicht, sagt der SVP-Nationalrat laut Bericht. «Ich wurde offenbar willkürlich von jemand anderem als Administrator hinzugefügt.» Nachdem er mit den Inhalten konfrontiert worden war, hat Glarner die Gruppe am Mittwochabend verlassen.
Bei Facebook hiess es, es sei nicht möglich, dass jemand Administrator einer Gruppe werde, ohne seine Zustimmung dazu zu geben. Facebook hat demnach eine Untersuchung eingeleitet, ob die Gruppe «Schweizer erwache!!» den Standards des sozialen Netzwerks entspricht. Falls nicht, könnten Kommentare entfernt oder sogar die ganze Gruppe gelöscht werden. Schreibt 20Minuten.
Was erwarten wir denn vom unsäglichen SVP-Nationalrat und Präsident der Aargauer SVP Andreas Glarner, den man gemäss einem Urteil des Aarauer Obergerichts ungestraft einen «dummen Mensch», «infantilen Dummschwätzer» und einen «üblen, verlogenen Profiteur» nennen darf?
https://www.luzart.ch/.../man-darf-andreas-glarner-von...
Antisemitische Verschwörungstheorien, rassistische Hetze, sexistische Abwertungen, Aufrufe zu Gewalt gegen Politiker, Flüchtlinge und Andersdenkende gehören bei Glarner und seinen Followern*innen zur intellektuellen DNA, mit der sie täglich nach Aufmerksamkeit heischen. Eigentlich ein in sich geschlossener Stuhl(gang)kreis, würden die Medien nicht jedem Furz dieser verschrobenen, radikal esoterisch angehauchten und aus der Zeit gefallenen Armleuchtern*innen ihre Aufmerksamkeit widmen und damit als Durchlauferhitzer für die Echokammer auf Facebook wirken. Wie ich es jetzt, so viel Ehrlichkeit muss sein, auch praktiziere. Wenn auch mit begrenzter Durchschlagskraft und Reichweite. Frei nach meinem Motto «NEVER WALK ALONE - Klasse vor Masse.»
Dies alles stört mich aber nicht unbedingt. Es bringt ja nichts, sich über etwas aufzuregen, was man ohnehin nicht ändern kann. Dumme und infantile Menschen, Dummschwätzer und verlogene Profiteure hat es schon immer gegeben und wird es auch immer geben. Vor allem in der Politiker*innen-Kaste. Gegen Dummheit ist nun mal kein Kraut gewachsen und Transplantationen von Hirnzellen sind bis zum heutigen Tag ein Ding der Unmöglichkeit.
Auch die 1'500 Mitglieder einer Facebook-Gruppe sollten uns kein Kopfzerbrechen bereiten. Kim Kardashian, auf ihrem Gebiet auch nicht unbedingt eine Intelligenzbestie, hat das Millionenfache an Followern. Immerhin sieht sie besser aus als all die verbitterten, rassistischen und verlogenen Vollpfosten aus der Ecke der Verschwörungstheoretiker einer ebenso verlogenen Partei mit dem Namen SVP, die mit zwei Themen – EU und Flüchtlinge – zur stärksten Schweizer Partei avancierte.
Dass die SVP nur zwei zugkräftige Themen beackert, bestätigt SVP-Bundesrat Ueli Maurer, der vor den Wahlen 2019 lautstark verkündete, dass die SVP die Wahlen nicht mit dem Thema Klimawandel gewinne, sondern ausschliesslich mit der Fokussierung auf die Themen EU und die Flüchtlingskrise. Dies gegen besseres Wissen, dass es «die» Flüchtlingskrise aus dem Jahr 2015 – «Wir schaffen das» – 2019 längst nicht mehr gab.
Wer diesen verlogenen Spagat zwischen öffentlicher Empörungsmaschinerie, Unwahrheit und insgeheimen Profiteur genau dieser beiden Themen schafft, braucht sich um radikale und stumpfsinnige Follower keine Sorgen zu machen.
Denn, Hand aufs Schweizer Herz: Kaum eine Partei profitiert mehr von der Flüchtlingsindustrie mit Asylzentren und Horden von SVP-Security-Hilfs-Sherifs wie die SVP. So wie die SVP-Granden rund um den Herrliberg, die Ems-Chemie, die Spuhler-Eisenbahnen und wie sie alle heissen, dank der EU als grösster Handelspartner der Schweiz zu alpinen Oligarchen aufstiegen.
Was mir allerdings Sorge um den Zustand des schweizerischen Wahlvolks und der Schweizer Demokratie bereitet ist die Tatsache, dass diese hinterwäldlerische Partei aus der Zeit des Rütlischwurs noch immer als stärkste Partei im Hohen Haus von und zu Bern herumgeistert. Und damit als vorsintflutlicher Goldgräber in den nach Parteigrösse im Bundeshaus streng abgesteckten Claims der Vorteilsnahme herumstochert. Wie all die anderen Parteien auch.
Ein ehemals dominantes Mitglied dieser Heuchler- und Hetzer-Zunft, der eloquente Demagoge Christoph Mörgeli, ex-Nationalrat und inzwischen zur Witzfigur und zum Almosenempfänger aus dem Dunstkreis des Herrlibergs abgerutscht, den alt Bundesrat Couchepin einmal in einer geistigen Umnachtung mit dem KZ-Arzt Mengele statt mit dem Nazi-Demagogen Goebbels verglich, hatte jahrelang keine Hemmungen, tagtäglich über den Schweizer Staat zu lästern und dennoch als Direktor eines Zürcher Museums von genau diesem, von ihm verachteten Staatsgebilde monatlich seinen üppigen Lohn zu empfangen, dessen Höhe diametral Mörgelis Leistung gegenüberstand, wie sich später herausstellte.
So geht SVP. So geht Doppelzüngigkeit. So geht verlogener Populismus. Glarner ist nur ein mittelmässiger Möchtegern-Selbstdarsteller all dieser Synonyme. Sein Mittelmass bestätigt er durch seine Handlungen: Von ihm veröffentlichte Posts auf den Social Media-Kanälen löscht er meistens nach dem (gewollten) Shitstorm einen Tag später.
Nicht, weil er sich seiner eigenen Dummheit bewusst geworden ist, sondern weil er sein Ziel erreicht hat: Den Shitstorm. Man redet über einen Mann, über den zu reden sich eigentlich gar nicht lohnt. Was gibt es denn schon über graue Mäuse zu erzählen?
So dumm, dass Glarner das nicht selber weiss, ist er nun auch wieder nicht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
27.2.2021 - Tag der solariumgebräunten Pouletschenkel
Wie kommt jetzt der Phoenix wieder aus der Asche?
Zu träge in Sachen Impfen, zu kompliziert bei der schnellen finanziellen Hilfe: Die Schweizer Regierung macht in den Augen von «Ich meinti»-Kolumnist Dolf Stockhausen nicht die beste Falle. Trotzdem ist er optimistisch, dass es vorerst zu keinem grossen Firmensterben kommt – zumindest in Nidwalden nicht.
Während in Israel, Grossbritannien, in den Emiraten und auf den Seychellen erfolgreiche Impfkampagnen die Infektionsraten drücken, sucht man solche Erfolge in der Schweiz vergeblich. Während Ende letzter Woche Israel die Hitliste der Impfungen pro 100 Einwohner mit 78 anführte, lag die Schweiz mit 6,35 noch hinter Serbien, der Türkei und Rumänien auf dem 17. Platz.
«Die Schweizer Behörden sind zu träge», titelte Francesco Benini in dieser Zeitung. Daran, dass die Impfstoffe überall fehlen, ist vor allem die Zulassungsbehörde Swissmedic schuld, die bei Moderna bummelte und Astrazeneca gar nicht erst zuliess, obwohl auch deren Impfstoff zuverlässig schwere Verläufe verhindert. Sie muss sich doch fragen lassen, welchen Mehrwert für die Schweiz sie denn überhaupt stiftet, der ihre Existenz neben der European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam rechtfertigt. Hinzu kommen Knauserigkeit und Zögerlichkeit des Bundes bei der Impfstoffbestellung und auch bei der Bereitstellung von Tests, die bei der Eindämmung der Pandemie unerlässlich sind und erst jetzt tropfenweise erhältlich werden.
Der Kanton Nidwalden tut, was er kann, liegt mit etwa 12 Impfdosen pro 100 Einwohner weit vorne, und die Organisation klappt reibungslos. Aber gegen ständigen Impfstoffmangel ist auch er machtlos.
Der Bundesrat wird mitunter für Zurückhaltung beim Lockdown gelobt. Dennoch haben seine Bestimmungen mit den realen Ansteckungsgefahren nur zufällig etwas zu tun. Hier hätten empirische Studien wie die der Technischen Universität Berlin mehr Treffsicherheit gebracht. Die Gefahr mit Maske und Abstand im Konzertsaal liegt gerade bei der Hälfte des Risikos im Supermarkt, und beim Shopping und im Restaurant kaum darüber. Konzertverbote und Restaurantschliessungen erscheinen da eher willkürlich. Dass sich Nidwalden jetzt im Streit um die Restaurantterrassen widersetzt, ist ein Lichtblick.
In der 7-Tage-Inzidenz liegt Nidwalden zwischen 54 und 75 und damit unter dem Durchschnitt der Schweiz. In seinen produzierenden Unternehmen greifen die Sicherheitskonzepte. Und der Lebensmittelhandel profitiert von mehr Konsum in den eigenen vier Wänden. Aber die Veranstaltungsbranche, die Gaststätten, der Einzelhandel und die Reise- und Tourismusbranche sind schwer getroffen. Kurzarbeit ist eine wertvolle Hilfe, und das erste Hilfsprogramm hat zumindest vorübergehend Liquidität gebracht, aber für viele Unternehmen sind die Mieten kaum zu tragen. Dass der Bund hier keine Regelung fand, etwa eine Drittelung zwischen Vermieter, Mieter und Staat, ist ein weiteres Armutszeugnis.
Unmut erregt auch das zweite Hilfsprogramm. Im Gegensatz zum ersten ist es ein bürokratisches Monstrum mit komplizierten Bedürftigkeitsprüfungen und mehrstufigen Genehmigungsprozessen, durch die für manche Unternehmen Hilfe zu spät kommen könnte. Eine typische Ausgeburt der Bürokratie, die wirtschaftliche Notlagen allenfalls vom Formularblatt kennt.
Dennoch herrscht ein gewisser Optimismus, dass es nicht zu einem grossen Firmensterben kommen wird, weil die mittelständische Nidwaldner Wirtschaft (noch) solide finanziert ist. Auch gehen viele Betriebe energische Schritte zur Anpassung an die neue Situation, etwa durch veränderte Lieferwege, auch mit Hilfe der Nidwaldner Wirtschaftsförderung, durch Digitalisierung und vieles mehr. Ob das auch über den Tag hinaus reicht, um den durch die Pandemie dauerhaft veränderten Lebens-, Konsum- und Reisegewohnheiten Rechnung zu tragen, wird sich weisen. Schreibt Dolf Stockhausen in der Luzerner Zeitung.
Dolf Stockhausen, Unternehmer aus Hergiswil, äussert sich abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema.
Doktor Dolf, der Unternehmer, für den die Begriffe Moral und Ethik keine leeren Floskeln sind, hat es einmal mehr auf den Punkt gebracht. So geht Dolf bezüglich Mietzinsreduktionen für die von zwangsweisen Schliessungen betroffenen Unternehmen während des Lockdowns sogar weiter als der Bundesrat! Er schlägt eine Drittelung der Mietkosten vor. Weil er als Unternehmer genau weiss, welche Kosten diese Betriebe bis ins Mark treffen.
Danke Dolf.
Ich möchte gerne noch etwas hinzufügen: "Dass der Bund hier keine Regelung fand, etwa eine Drittelung zwischen Vermieter, Mieter und Staat, ist ein weiteres Armutszeugnis."
Schreibt mein Freund Doc Dolf absolut richtig. Fairerweise möchte ich allerdings festhalten, dass es der Ständerat war, der das vom Bundesrat und dem Parlament vorgeschlagene Gesetz für eine 50-prozentige Mietzinsreduktion für kleine und mittlere Betriebe hemmungslos versenkte.
Eine Allianz aus SVP, CVP (neu die "Mitte", die Lachnummer schlechthin) und FDP machte ihrem bezahlten Lobbyismus für die Immobilienvermieter alle Ehre.
Darunter auch unser aller wie ein Pouletschenkel solariumgebräunter FDP-Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller, der in diversen Immobilienfirmen als VR aufgeführt ist. Ein Schelm, wer Böses denkt.
Leider ist zu befürchten, dass das «Stimmvolch» (Copyright by Herrliberg) bis zu den nächsten Parlamentswahlen im Oktober 2023 längst vergessen hat, wer sie in Zeiten höchster Not im Stich gelassen hat. Dafür sorgt allein schon das tägliche Berset-Bashing von Leuten, denen das «Kollegialprinzip» im Bundesrat ein Fremdwort ist.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
26.2.2021 - Tag der Impfwilligen
Mai statt März: Impfwillige im Kanton Luzern müssen sich noch länger gedulden
Der Kanton Luzern hat den Fahrplan für die Impfung angepasst. Die nächsten Gruppen kommen frühestens im Mai dran. Eine Kategorie fällt ganz weg. Grund ist der knappe Impfstoff.
Der Kanton Luzern hat am Mittwoch den Fahrplan für die Impfungen angepasst. Dies hat er aber nicht etwa offensiv kommuniziert, sondern lediglich die Termine auf seiner Impfseite im Internet angepasst. «Das Gesundheits- und Sozialdepartement hat stets und von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Termine bezüglich dem Impfen auf der kantonalen Website laufend aktualisiert werden. Dies wurde mehrfach so kommuniziert», sagt dazu David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport auf Anfrage.
Was ändert sich konkret? Das lässt sich für die Bevölkerung auf der Website nicht mehr transparent nachvollziehen. Zur Erinnerung: Ursprünglich sollten ab März Personen zwischen 65 und 74 Jahren, Personen unter 65 Jahren mit chronischen Krankheiten sowie das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen an der Reihe sein.
Chronisch Kranke unter 65 gehören jetzt zur «übrigen Bevölkerung»
Wer sich aus diesen Gruppen auf einen baldigen Impftermin gefreut hat, wird enttäuscht. Neu werden die über 65-Jährigen sowie das Gesundheits- und Betreuungspersonal «frühestens Mai/Juni 2021» geimpft, wie es auf der Website heisst. Die Gruppe der chronisch Kranken unter 65 Jahren fällt gänzlich weg. David Dürr: «Die Kategorie ‹Personen unter 65 Jahren mit chronischen Krankheiten, die noch nicht geimpft wurden› wurde gelöscht und zusammengelegt mit der Kategorie ‹übrige Bevölkerung›.» Und: «Mit dieser Umgruppierung orientiert sich das Gesundheits- und Sozialdepartement an den Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit.» Dürr weist weiter darauf hin, dass der Bund die Kriterien für die «chronisch kranken Personen mit höchstem Risiko», die bereits jetzt impfberechtigt sind, angepasst hat. Eine Konsultation der entsprechenden Dokumente auf der Website des Bundes zeigt zum Beispiel, dass eine Asthma-Erkrankung nun nicht mehr für eine vorzeitige Impfung reicht. «Medikamentös gut eingestelltes Asthma gehört nicht zu diesen Hochrisiko-Erkrankungen», heisst es da. Die «übrige Bevölkerung soll zudem laut Kanton wie bisher «voraussichtlich» im Juni geimpft werden.
Zur Verzögerung sagt David Dürr: «Das Gesundheits- und Sozialdepartement hat stets und von Anfang an darauf hingewiesen, dass es sich beim Impffahrplan um eine rollende Planung handelt, die bei genügend Impfstoff beschleunigt werden, bei Lieferengpässen aber auch Verzögerungen erfahren kann.» Und der Impfstoff ist Mangelware: «Der Grund für die Verzögerung liegt bei der geringen Anzahl an Impfdosen, die dem Kanton Luzern aktuell zur Verfügung steht.» Zudem würden sich immer noch viele über 75-Jährige und Hochrisikopatienten für eine Impfung anmelden. «Verimpft werden kann nur, was wir an Impfstoffen zur Verfügung haben», sagt Dürr. Eine Randnotiz: Noch vor drei Wochen gab Luzern 3000 Impfdosen an andere Kantone ab.
Nachschub soll bald kommen. «Wir erwarten nächste Woche rund 11'800 Moderna-Impfstoff-Dosen und Mitte März sollten es dann nochmals 14'000 Impfdosen des Moderna-Impfstoffes sein», sagt Dürr. Dabei handle es sich aber lediglich um Planmengen. «Der Bund bestätigt die Angaben jeweils erst sehr kurz vor der effektiven Lieferung.» Laut Dürr erwartet der Kanton zudem im März eine Lieferung des Pfizer-Impfstoffs von rund 13'500 Dosen. Schreibt die Luzerner Zeitung.
Bitte jetzt keine Panik auf diesen alarmistischen Beitrag der LZ (LügenZeitung?).
Luzern hat das angebliche Problem nicht nur längst erkannt, sondern bereits die perfekte Lösung auf dem Tisch.
Mit einer «Sensibilisierungskampagne» wird diese ekelhafte, stets vordrängelnde Risikogruppe der Ü65-Jährigen wesentlich besser vor Corona geschützt als mit einer Impfung.
In extremen Notfällen stehen rund um den Vierwaldstättersee genügend Frischluft-Blasbälge zur Verfügung, um die während Jahrzehnten trotz Warnhinweisen auf den Zigarettenpackungen durchrauchten Seniorenlungen zu belüften.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.2.2021 - Tag der Nullsummen-Abstimmungen
STOP PALMÖL - NEIN zum Freihandelsabkommen mit Indonesien
Wenn es um Palmöl aus Indonesien geht, ist Nachhaltigkeit nur ein leeres Versprechen. Deshalb NEIN zum Freihandelsabkommen mit Indonesien am 7. März. Schreibt STOP PALMÖL auf Facebook.
Nein, nachhaltig ist das wirklich nicht!
Leider fehlt in diesem Aufruf an das Schweizer Stimmvolk der Hinweis auf die wunderbaren Orang-Utans, die durch die exzessive Palmölindustrie ausgerottet werden. Diese hochintelligenten, sanften «Waldmenschen», die zu unseren nächsten Verwandten gehören, haben längst keine Chance mehr. Egal, ob wir das Freihandelsabkommen an der Wahlurne bestätigen oder ablehnen.
In spätestens zwanzig oder dreissig Jahren werden wir Orang-Utans nur noch in den Zoos und indonesischen Auffangstationen entdecken können, wo die Tiere, unbemerkt von uns feinfühligen Menschen, ihren ureigenen Horror erleben. So ist die brutale und ehrliche Faktenlage unabhängiger Experten, auch wenn die Spendenorganisationen und WWF etwas anderes behaupten.
Es ist zu spät! Die seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wider in den westlichen Industrieländern kursierenden Aufrufe, Palmöl-Produkte zu boykottieren, verpufften wirkungslos an unserer Gleichgültigkeit und der unerklärlichen Lust nach dreckbilligen Produkten, die mit Palmöl aufgepeppt werden.
Dabei wär's so einfach gewesen. Das Lebensmittelgesetz zwingt die Produktehersteller, die Verwendung von Palmöl zu deklarieren. Wir wussten alle, dass beispielsweise Nutella nichts anderes als Palmöl-Pampe ist. Oder ein einziger Blick auf die Zutaten-Deklaration der «Luzerner Birnenwegge» von der MIGROS hätte uns aufgeklärt, dass selbst dieses Traditionsprodukt zur Gewinnmaximierung der Tiefpreisstrategie mit dem billigen Palmöl angereichert wird.
Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen. Palmöl wird dank seinem tiefen Preis – und nicht wegen besserer oder höherer Qualität – in unzähligen Produkten (auch jenseits der Lebensmittelindustrie) verwendet. Wir alle wissen das. Aber es kümmert uns nicht, weil wir uns nur dafür interessieren, was das Produkt an der Ladenkasse kostet.
Wir schreien Hurra, beissen in die Luzerner Birnenwegge und geniessen den tiefen Preis und nicht die hervorragende Qualität der Birnenwegge. Denn die fehlt dank Palmöl.
Die Orang-Utans bezahlen dafür mit ihrer Ausrottung.
Die Volksabstimmung wird aber auch rein gar nichts am Einsatz von hochgiftigen Pestiziden, an der Enteignung von Kleinbauern und der Abholzung von Regenwäldern in Indonesien (und Malaysia, ebenfalls ein grosser Player der Palmölproduzenten!) ändern. Diesen Urnengang hätten wir uns sparen können.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
24.2.2021 - Rüeblitag
Bei «Baywatch»-Ikone Pamela Anderson (53) fördert Veganismus die Fleischeslust: Dank Rüebli hat sie besseren Sex
Pamela Anderson (53) gibt intime Einblicke in ihr Eheleben: Sie bekocht ihren Mann vegan und ist überzeugt, dass ihn das zu einem besseren Liebhaber macht.
Am liebsten würde sie das Ehebett gar nicht mehr verlassen: Pamela Anderson (53) hat vor zwei Monaten den Bodyguard Dan Hayhurst geheiratet. «Ich bin genau da, wo ich sein will – in den Armen eines Mannes, der mich wirklich liebt», schwärmte sie über ihre Hochzeit Nummer 6.
Jetzt gibt die ehemalige «Baywatch»-Nixe in einem Videocall-Interview in der britischen Talkshow «Loose Women» intime Einblicke in ihr Eheleben, direkt aus dem Schlafzimmer. «Wir haben seit Heiligabend das Bett nicht mehr verlassen», scherzt Anderson und schwärmt weiter: «Es ist schön, mit einem echten Mann zusammen zu sein, der auch mal eine Glühbirne auswechseln kann.»
Falsche Würstchen für den echten Mann
Den «echten Mann» hält sie mit veganen Würstchen bei Laune, Anderson ist seit Jahren Tierrechtsaktivistin und isst keine Fleisch und keine Milchprodukte. Und sie ist überzeugt: «Veganer sind die besseren Liebhaber.» In ihren letzten Tweets erklärt sie, wie schlecht sich der Fleischgenuss auf die körperliche Liebeslust auswirke insbesondere auf die der Männer. Wegen zu viel Cholesterin und einer Verhärtung der Arterien: «Das verlangsamt die Durchblutung aller Körperorgane.»
Fleischlose Kost und Fleischeslust
Ist da tatsächlich was dran? Laut der Vegan-Unternehmerin Lauren Wildbolz (39) schadet die fleischlose Kost der Fleischeslust jedenfalls nicht: «Uns Veganerinnen wird oft nachgesagt, wir seien spröde und lustlose Wesen, dieser Verdacht liegt in der Annahme, dass die vegane Lebensweise viel Disziplin abverlangt; zu Unrecht! Ein sehr gutes Beispiel sind Spitzensportler, die sich tierfrei ernähren und ihre Leistung steigern konnten.» Von veganen Würstchen hält sie allerdings weniger: «Da sind oft zu viel Zusatzstoffe drin. Vegane Küche kann sehr lustvoll und opulent sein.»
Austern für die Liebesnacht
Ex-Leichtathlet Dave Dollé (51) bevorzugt echte Würste, noch lieber isst er ein Stück Fleisch vom Bio-Bauern oder Wild. «Ich esse einfach keinen Müll», so der Fitnesscoach. Das heisst für ihn keine Fertigprodukte, kein Brot, keine Pasta, Pizza, Milchprodukte oder Süssigkeiten. «Ich habe mich noch nie vegan ernährt, also habe ich da keinen Vergleich. Aber um die Sexualhormone zu steigern, ist Bewegung und Kraft wichtig. Und egal, ob man Bäume im Wald schleppt oder Gewichte im Studio stemmt, dafür braucht es proteinreiche Ernährung.» Für die Liebesnacht empfiehlt er Austern: «Da ist Zink drin, das ist gut für die Bildung von Testosteron.»
Uralter Menschheitstraum
Für die Ernährungswissenschaftlerin Christine Brombach (58) steckt dahinter ein uralter Menschheitstraum: «Aphrodisierende Lebensmittel, die, einmal gegessen, unsere sexuelle Kraft stärken würden.» Aber die ZHAW-Professorin muss leider enttäuschen: «Das grösste Sexualorgan ist unser Gehirn. Es gibt keine Lebensmittel, welche die Potenz steigern.» Wirksam sei die Kraft der Suggestion: «Wenn man an die Wirkung glaubt und es in die Liebesbeziehung eingebunden wird, dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.» Schreibt Blick.
Zu einem infantilen Artikel einen infantilen Kommentar: Es mag ja sein, dass Rüebli die Libido der ehemaligen «Baywatch»-Nixe in höchste Sphären befördern. Würde sie ihrem Liebhaber noch weisse Socken verordnen, wäre der Spass vermutlich noch intensiver. Vom Rüebli-Kanton Aargau lernen bedeutet den ultimativen Orgasmus.
Die sexuelle Anziehungskraft der Aargauer Rüebli ist seit jeher bekannt: Der am 3. Juli 1971 an einer «Overdose» verstorbene Jim Morrison, Sänger der legendären US-Band «THE DOORS», soll sich bei Fotoshootings für die Presse gleich ein Rüebli in die hauteng sitzende Lederhose gesteckt haben. So steht's in der Biografie über Morrison von Stephen Davis geschrieben.
Seit ich diese Biografie gelesen habe, mache ich das als Vertreter der «kindlichen Gesellschaft» auch wie Jim Morrison. Sogar an Tagen ohne Fotoshooting. Und dies mit braunen Manchesterhosen à le Jean Ziegler und Robert de Niro statt Lederhosen! Kein Wunder, wollten die chinesischen Touristinnen in der Stadt Luzern stets ein Selfie mit mir knipsen. Auf «We chat», sowas wie «Facebook» in China, bin ich vermutlich ein Superstar. Also irgendwas muss da an den Rüeblis schon dran sein, was die sexuellen Fantasien der Frauen beflügelt.
Die mit Botox vollgespritzten Lippen von Pamela Anderson lassen die Badeanzug-Ikone allerdings so aussehen, wie ich mir als Kind die böse Hexe aus «Hänsel und Gretel» vorgestellt habe.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.2.2021 - Tag der Luzerner Müllberge
Unschöne Spuren nach Traumwetter : An der Seepromenade in Luzern türmten sich am Wochenende die Abfallberge
Das schöne Wetter lockte am Wochenende Tausende nach draussen. In der Stadt Luzern äusserte sich das nicht nur in Menschenansammlungen, sondern auch beim Abfall, den sie hinterliessen.
«So etwas habe ich in meinen fünf Jahren im Dienst noch nie gesehen», sagt Florian Aschbacher. Der Leiter Betrieb und Strassenunterhalt beim Strasseninspektorat der Stadt Luzern traf am Montagmorgen um 4.30 Uhr bereits zum dritten aufeinanderfolgenden Tag mit seinen Teams auf riesige Müllberge. Dabei wurden Take-away-Verpackungen, Bierflaschen und Alltagsmüll nicht nur achtlos weggeworfen – auch wer seinen Müll pflichtbewusst entsorgen wollte, konnte dies nicht. Die Abfallkübel waren komplett überfüllt. Hotspots waren der Schweizerhof-Quai und das Gebiet rund um den Bahnhof – betroffen waren aber auch viele andere Gebiete in Seenähe.
Mit dem Müll konnten nicht einmal die «Solar-Presshaie» mithalten: «Die modernen Abfalleimer können bis zu sieben Mal mehr Müll schlucken – aber diese Menge konnten auch sie nicht bewältigen», so Aschbacher. Die Solar-Presshaie mit eingebauter Müllpresse wurden in den letzten Jahren an verschiedenen Hotspots installiert, um der zunehmenden Abfallmenge Herr zu werden.
Dank Extra-Effort ist vom Party-Wochenende nichts mehr zu sehen
Während sich die Situation am Schweizerhof-Quai und rund um den Bahnhof am übelsten gezeigt habe, waren auch Bereiche bei der Ufschötti, im Würzenbach-Quartier oder beim Wagner-Museum über das ganze Wochenende hin am Morgen jeweils von Müll übersät. Mit Abfallmengen, die sonst nur an sehr schönen Sommerwochenenden zusammenkommen.
Das abfallreiche Wochenende dürfte mehrere Gründe haben: Zum schönen Wetter hinzu kamen wohl das nahende Ferienende, einsetzende Corona-Müdigkeit und die geschlossenen Restaurants, worauf die vielen Verpackungen von Take-aways schliessen lassen. Gerade Jugendliche, die derzeit wenige Ausgangsmöglichkeiten haben, nutzten die Situation, um sich draussen zu treffen.
Doch spätestens um acht Uhr waren auch an diesem Montagmorgen die Strassen Luzerns wieder sauber herausgeputzt. Das hat auch mit umsichtiger Planung zu tun. «Coronabedingt sind wir zurzeit mit etwas weniger Personal unterwegs. Glücklicherweise haben wir auf dieses Wochenende hin in der Stadt, am See und in Aussenquartieren zusätzliche Leute aufgeboten», sagt Aschbacher. Der Müllberg kam zwar mit Ansage – in seinem Ausmass hat er aber selbst den Profi, der einiges gewohnt ist, beeindruckt. Schreibt ZentralPlus.
Wo Berge sich erheben...
Macht Euch keine Sorgen: Die Luzerner Stadtregierung hat das Problem längst erkannt und will erneut eine «Sensibilisierugskampagne» starten. Wie schon im Jahr 2020 mit «Luzern glänzt». Die ging allerdings fürchterlich in die Hose. Doch wo genügend Geld für teure Kampagnen vorhanden ist – man denke nur an die neuen Müll-Container (ca. 16'000 Franken) auf der Schütti, die jetzt, ein Jahr später, mit hohem Kostenaufwand wieder abgebaut werden – stirbt die Hoffnung zuletzt.
Und, an ZentralPlus: Hört auf Eurem Weg zur schnappatmenden Mutter Thersa der Innerschweizer Internetportale endlich mit dem Bullshit auf, dass sich Jugendliche während der Corona-Krise nirgendwo treffen können. Das ist schlicht und einfach unwahr, wenn man mal von den «Mischkonsum»-Clubs à la «Princesse - The Club» absieht, wo schon der nette Türsteher aus dem Balkan die Besucher*innen darauf hinweist, wo und bei wem Nasenpuder erhältlich ist. Ein Spaziergang über den Europaplatz, das Inseli und die Aufschütti – um nur drei Luzerner Jugend-Hotspots zu nennen – würde Euch eines besseren belehren.
Ganz abgesehen davon, dass die Einschränkungen alle Altersklassen trifft. So kann beispielsweise mein Freund Mani das «Nizza» in Luzern auch nicht mehr besuchen. Wenn Jugendliche mit dieser Corona-bedingten Situation etwas mehr Mühe haben, liegt das nicht selten am familiären Umfeld. Oder um es in Eurem Sozialslang zu sagen: An «prekären» Familienverhältnissen. So viel Wahrheit muss sein.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.2.2021 - Tag des LSD-Gurus Vanja Palmers
Die zugedröhnte Luzerner Gesellschaft - alles hängt mit allem zusammen. Nicht nur mit dem Jahr 2015!
Junge Leute konsumieren vermehrt harte Drogen – das macht sich in der Kriminalstatistik des Kantons Luzern bemerkbar.
2019 hat es gemäss der Kriminalstatistik des Kantons Luzern 3044 Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben. 2168 wurden in der Stadt Luzern und der Agglomeration begangen. Wie die Luzerner Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Kantonsrätin Rahel Estermann schreibt (Grüne), ist die Zahl der Drogendelikte in den letzten sieben Jahren um 20 Prozent angestiegen.
Die Polizei geht gemäss der Luzerner Regierung davon aus, dass «mehr junge Leute harte Drogen wie Kokain, Amphetamin oder Ecstasy» konsumieren. Auch der Konsum von Cannabis mit hohem THC-Gehalt habe bei Minderjährigen stark zugenommen.
«Das vermehrte Einnehmen von Medikamenten unter Jugendlichen kann teilweise dem steigenden Leistungsdruck in der Schule und am Arbeitsplatz zugeschrieben werden.» Der dabei entstehende «sorglose Umgang mit dem sogenannten Mischkonsum unter Jugendlichen ist demnach tendenziell als zunehmend zu betrachten». Estermann fordert deshalb, dass der Kanton niederschwellige Beratungsangebote schafft – insbesondere an Luzerner Gymnasien. Schreibt ZentralPlus.
Die zugedröhnte Luzerner Gesellschaft - alles hängt mit allem zusammen. Nicht nur mit dem Jahr 2015 und den Unterschichten!
Das Innerschweizer Online-Portal «ZentralPlus» veröffentlicht beinahe im Tagesrhythmus Artikel über die Stadt-Luzerner Drogenmisere. Auf verheerende Missstände am Fusse des Pilatus mit triefender Betroffenheit aufmerksam zu machen, ehrt ZP, doch die zwingenden Nachfragen bei Interviews und Artikeln zu diesem erschütternden Thema fehlen und sprechen nicht unbedingt für einen «investigativen Journalismus».
Im Gegenteil: Man lässt einer Luzerner Sozialberaterin die Behauptung durchgehen, dass die Mehrheit der jugendlichen Drogenkonsumenten aus «prekären», sprich «Einkommensschwachen» Familien stammen würde. Das stimmt nur bedingt. Es ist sicher richtig, dass die minderjährigen Drogenkids armer Familien bei der Sozialtante landen.
Diejenigen aus Mittel- und Oberschicht hingegen, und das ist allein schon wegen den hohen Kosten von Kokain etc. eine sehr grosse Gruppe bei den jugendlichen Hardcore-Drogenkonsumenten – was die Verhaftung von 50 Kantischülern*innen nahelegt – geniessen eine adäquate, aber möglichst diskrete Betreuung durch den mit der Familie befreundeten Psychiater. Man will das Problem in diesen Kreisen ja möglichst unauffällig lösen. Wenn überhaupt.
Wir sollten einfach den Mut zur Erkenntnis haben, dass die verheerenden Hardcore-Drogen längst in der breiten Gesellschaft bis hinauf in die höchsten Kreise und Eliten der Stadt Luzern angekommen sind. https://www.zentralplus.ch/mit-lsd-zur-spiritualitaet.../
Wenn der Luzerner Multimillionär und Veganerpapst Vanja Palmers von der Calida-Dynastie in einem Interview mit ZentralPlus, ja Sie lesen richtig: mit ZentralPlus, seinen Müll über die «Spiritualität von LSD», das der noble Guru gerne und oft konsumiert und abstrus verherrlicht, ohne kritische Hinterfragung absondern darf, tönt das für Viele wohl wie ein Freibrief oder die Aufforderung zur Konsumation extremer Drogen. «Mama, das Palmer macht es doch auch.» (Copyright bei Harald Schmidt). Wer möchte denn nicht ein derart «guter» Mensch sein oder werden wie Palmer, der mit seinem «Schweinchenmobil» regelmässig durch die Schweizer Städte tingelt und vor Fleischkonsum warnt?
Eine Schweinskotelette ist in gewissen Kreisen halt gefährlicher als Kokain, Crystal Meth und wie die ganze psychodelische Scheisse heisst. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst diagnostiziert mir mein persönlicher Ethik-, Adobe und Phobienberater Joely Tafanalo nebst der «Islamophobie» noch eine weitere Phobie.
Ein nur annähernd vernünftiger Journalist hätte dem Bartli bei der stumpfsinnigen Verherrlichung seiner Droge gezeigt, wo man den Most holt, ihm das Mikrofon abgestellt und den zugedröhnten Spiritual-Mist gar nicht erst veröffentlicht.
Aber vermutlich verhindern finanzielle Verstrickungen über Inserate oder Beteiligungen der Palmer-Gruppe und ZentralPlus, diesen grotesken Mann aus dem Buddha-Tempel zu werfen.
Wer wundert sich noch über das Dogma der Luzerner Polizei: «Drogen? Das ist halt so in einer Stadt.» Palmer nimmt das jedenfalls wörtlich. ZentralPlus, bei aller gekünstelten Betroffenheit, scheinbar auch.
Dass dies alles auch bei den Drogenkids aus den Kindergärten durchschlägt, ist eigentlich nur eine logische Folge dieses Irrsinns.
Alles hängt eben mit allem zusammen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.2.2021 - Tag der Jungunternehmer
Seon: Raubüberfall – 14-jähriger Täter festgenommen
Mit einem Messer bedrohte ein 14-jähriger Jugendlicher eine Frau und forderte die Herausgabe des Portemonnaies. Verletzt wurde niemand.
Am Samstag, 20. Februar 2021, kurz nach 13 Uhr, meldete eine Drittperson der Notrufzentrale wonach es zu einem Vorfall bei der Post in Seon gekommen sei, bei welchem ein Jugendlicher ein Messer eingesetzt habe.
Die erste Patrouille vor Ort konnte sodann in Erfahrung bringen, dass ein Jugendlicher eine 67-jährige Frau mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Bargeld verlangte. Ohne Beute sei er geflüchtet.
Der Jugendliche konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 14-jährigen Schweizer aus der Region. Gegenüber der Patrouille bestätigte er den Vorfall. Die zuständige Jugendanwaltschaft des Kanton Aargaus eröffnete eine Strafuntersuchung.
Safenwil: Ehepaar bei Raubüberfall gefesselt und leicht verletzt – Zeugenaufruf
Am Samstag wurde ein Ehepaar an deren Wohnort gefesselt und überfallen. Die Geschädigten wurden dabei leicht verletzt. Die Kantonspolizei sucht Auskunftspersonen.
Am Samstag, 20. Februar 2021, kurz vor 10 Uhr meldete ein Anwohner, dass deren Nachbarn vor rund einer Stunde überfallen worden seien. Drei Männer seien an deren Wohnort gekommen und hätten die Bewohner gefesselt und das Haus durchsucht.
Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Kanton und Regionalpolizei aufgeboten.
Vor Ort konnten die beiden leicht verletzten Bewohner angetroffen werden. Diese gaben gegenüber der ersten Patrouille an, dass die Täterschaft mit Bargeld und Wertgegenständen in unbekannte Richtung geflüchtet seien.
Signalement
Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: 20-25-jährig, alle 160-165 cm gross, einer trug eine postähnliche Kleidung. Einer sprach gebrochen Deutsch.
Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.
Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Zentralen Ermittlung (Tel. +41 62/ 835 81 81) in Verbindung zu setzen.
Schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihren Medienmitteilungen.
Ein jüdisches Sprichwort sagt: «Sind die Eltern Narren, werden die Kinder Räuber».
Ein 14-Jähriger Räuber und drei 160-165cm grosse Ganoven, gebrochen Deutsch sprechend, rocken den Kanton Aargau auf ihre Art und Weise. Was sagt uns dies: Die Bonnie's and Clyde's der heutigen Zeit werden immer jünger und körperlich immer kleiner.
Doch bevor wir jetzt mit dem Zeigefinger auf den Kanton Aargau zeigen und unsere mit Traubenzucker und ähnlichen Substanzen gepuderten Nasen über Mitbürgerinnen und Mitbürger rümpfen, die weisse Socken tragen: Das ist in der traumhaften Innerschweiz ähnlich dem Rüeblikanton, nur mit dem Unterschied, dass dank «Sensibilisierungskampagnen» am Fusse des Pilatus keine Räuber ihr Unwesen treiben.
Man wird doch wohl noch einen Witz machen dürfen, oder?
Die süssen kleinen Schätzchen aus der Hardcore-Drogenszene werden trotz «Sensibilisierungskampagnen» auch in der Innerschweiz immer jünger, tragen das Halal-Messer auf sich und sprechen ebenfalls gebrochen Deutsch, called «Balkan Slang». Inzwischen snifffen schon 12- bis 15-Jährige Kids Kokain und Crystal Meth durch ihre zarten Nasenflügel, welches ihnen von den smarten Jungunternehmern von der Luzerner Kanti geliefert wird. Pardon, geliefert wurde.
Die pfiffigen Kantischüler wurden ja zwischenzeitlich (50 Stück an der Zahl, um genau zu sein) von der Luzerner Polizei ausgeschaltet, auch wenn laut Dogma der Luzerner Polizei «Drogen halt zu einer Stadt gehören».
Whatever: Der Nachschub funktioniert auch ohne die Kanti Luzern hervorragend. Dem Balkan sei Dank.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.2.2021 - Tag des Balkans
Albanischer Drogendealer festgenommen
Die Luzerner Polizei hat gestern Donnerstag an der Bahnhofstrasse in Emmenbrücke einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Es konnte mutmassliches Betäubungsmittel (siehe Foto) und Bargeld sichergestellt werden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.
Am Donnerstag, 19. Februar 2021, kurz nach 16:00 Uhr, hat die Luzerner Polizei an der Bahnhofstrasse in Emmenbrücke einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung konnten mehrere hundert Gramm mutmassliches Heroin und Kokain und auch mehrere hundert Franken Bargeld sichergestellt werden. Der festgenommene Mann ist 20-jährig und stammt aus Albanien.
Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.
Schwerpunktkontrollen Zentralschweiz - Fahrfähigkeit lag bei rund 93 Prozent
Auch während der diesjährigen Fasnachtszeit führten die Zentralschweizer Polizeikorps gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrfähigkeit durch. Von den gut 2700 kontrollierten Fahrzeuglenkenden waren 186 nicht fahrfähig und mussten zur Anzeige gebracht werden.
Während der Fasnachtszeit 2021 verzeichneten die Zentralschweizer Polizeikorps bei insgesamt 186 Verkehrsteilnehmenden eine Fahrunfähigkeit, was im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um 35 Beschuldigte bedeutet. Dies obschon in diesem Jahr rund 1600 Verkehrsteilnehmende weniger kontrolliert wurden als 2020.
Mit 116 Beschuldigten gilt der übermässige Alkoholkonsum nach wie vor als Hauptursache für Anzeigen wegen mangelnder Fahrfähigkeit. Rund zwei Drittel der Beschuldigten sind männlich.
44 Personen haben sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt. Das sind zwölf Beschuldigte mehr als im Vorjahr. Mit 40 Anzeigen ist auch hier der Grossteil der Beschuldigten männlich.
Bei zwei Personen war die Fahrfähigkeit wegen Medikamenteneinnahme nicht gegeben (2020: 3 Person). Zwei Fahrzeuglenkende waren übermüdet unterwegs (2020: 5 Personen).
Schreibt die Luzerner Polizei in ihren Medienmitteilungen.
Also sowas! Kaum zu glauben – ein Drogendealer aus Albanien? Die ansonst doch so netten und arbeitsamen Albaner, die stets hipp gekleidet sind, dem alten Grosi über den Fussgängerstreifen helfen, mit «fetten» Autos geräuschlos durch die Stadt cruisen und kein Schweinefleisch essen, weil das so im Heiligen Buch, genannt Koran, steht und damit wie Alkohol «haram» (verboten) ist, sollen mit Drogen handeln und sie womöglich auch noch selber konsumieren? Scheinbar hat ihnen «Allahu akbar» in seiner unermesslichen Güte Heroin, Kokain, Crystal Meth und Marihuana nicht verboten.
Und 44 Personen aus dem Kanton Luzern unter Drogeneinfluss während der Fasnacht am Steuer?
Irgendwie hängt in Luzern wirklich alles mit allem zusammen.
Nur gut, dass es demnächst eine «Sensibilisierungskampagne» von Kanton und Stadt Luzern gegen den Drogenkonsum geben wird. Damit werden wir das Problem dann endgültig wieder los sein. Das wird die Luzerner Polizei freuen. Sicher wird sie sich dann von ihrem Running Gag-Slogan «Drogen? Das ist halt so in einer Stadt» trennen können.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.2.2021 - Tag der westlichen Kriegsgemeinschaft
CDU-Aussenpolitiker fordert bewaffnete Drohnen für Afghanistaneinsatz
Die Nato-Truppen werden voraussichtlich länger in Afghanistan bleiben als geplant. Auch die Bundeswehr ist betroffen. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter fordert nun den Einsatz bewaffneter Drohnen.
Im Fall einer Verlängerung des Afghanistaneinsatzes der Bundeswehr hält der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter den Einsatz bewaffneter Drohnen für unabdingbar. »Ohne bewaffnete Drohne ist eine Fortsetzung des Afghanistaneinsatzes sinnlos, weil wir nicht zu viele Kräfte für den Eigenschutz aufbringen können«, sagte Kiesewetter im Radiosender WDR 5. Nur so seien die Soldaten und die der Bündnispartner bereit, dort »unter schwierigsten Bedingungen« ihre Arbeit zu machen.
Ein Abzug der Nato-Truppen aus dem Land am Hindukusch wäre für Kiesewetter der falsche Weg. Er bezweifelte, dass die Zivilgesellschaft stark genug ist. »Wenn die internationale Gemeinschaft vorzeitig geht, dann werden die Frauen wieder leiden, dann wird die Infrastruktur wieder zerstört«, warnte er.
In Militärkreisen wird Eskalation der Gewalt befürchtet
Eigentlich sollten die internationalen Truppen bis zum kommenden 1. Mai aus Afghanistan abgezogen werden. Nun sieht es aber so aus, dass Tausende Soldaten über dieses Datum hinaus in dem Krisenland bleiben. Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten hatten für diesen Donnerstag Beratungen über das weitere Vorgehen angekündigt.
In Militärkreisen befürchtet man, dass die Gewalt in Afghanistan in den kommenden Monaten schnell eskalieren könnte, da die Taliban die Verschiebung des Nato-Abzugs als Provokation empfinden müssen. Im gesamten letzten Jahr hatte die radikalislamische Miliz die internationalen Truppen nicht mehr angegriffen, da dies bei den Friedensgesprächen mit den USA so vereinbart worden war.
Als die neue US-Regierung allerdings ankündigte, den für den 1. Mai geplanten Komplettabzug zu überprüfen, kündigten die Taliban umgehend die Wiederaufnahme des Kriegs gegen alle ausländischen Truppen an. Insider nehmen die Drohung ernst, da viele Feldkommandeure eine politische Lösung schon lange ablehnen und den Feind, also die Nato, an der Front in die Knie zwingen wollen.
Für die Bundeswehr ist die Lage besonders brenzlig. In internen Papieren warnen die Militärs aus der Abteilung für Strategie und Einsatz, dass die Taliban besonders im Norden des Landes, wo die Deutschen stationiert sind, militärisch am stärksten und aktivsten sind. Auf den Sicherheitskarten sind dabei Masar-i-Scharif und Kunduz stets mit roten Kreisen umrandet, da es hier besonders gefährlich ist.
Zudem warnen die Geheimdienste, dass die Taliban durch die relativ ruhige Phase der Verhandlungen in Doha stärker dastehen als zuvor. Zum einen konnten sie ihre Waffenlager aufstocken. Viel gefährlicher aber ist, dass Hunderte erfahrene Kämpfer und auch Sprengstoffexperten aus Gefängnissen freigelassen wurden. Einige von ihnen beteiligen sich bereits wieder an Bombenanschlägen und Hinterhalten.
Hochrangige Militärs warnten vergangene Woche hinter verschlossenen Türen im Verteidigungsausschuss des Bundestags, dass die Taliban wegen der Aussetzung des Abzugs ihre Attacken auf die Nato-Truppen und deren Camps wie das Bundeswehrlager in Masar schnell wieder aufnehmen könnten. Spätestens dann müsste sich die Bundeswehr wieder robust verteidigen können.
Bisher hat die Bundeswehr nur unbewaffnete Aufklärungsdrohnen vor Ort
Bei Notfällen hatte sich die Bundeswehr bisher stets auf die USA verlassen, die noch immer Kampfjets und bewaffnete Helikopter in Afghanistan stationiert haben. Nachdem aber die USA ihre Truppen bereits auf 2500 Mann reduziert haben, weiß niemand mehr genau, ob dieser Schutz noch voll gewährleistet ist. Die Bundeswehr selbst hat nur unbewaffnete Aufklärungsdrohnen vor Ort. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte die SPD die Bewaffnung der Aufklärungsdrohne »Heron TP« überraschend verweigert.
Bisher sehen die Strategen der Bundeswehr keine Notwendigkeit, das Kontingent in Afghanistan aufzustocken. Zum einen sind derzeit deutlich weniger Soldaten in Nordafghanistan stationiert als im Mandat vorgesehen. Zudem sieht das gültige Mandat bei Gefahrensituationen eine strategische Reserve vor, die schnell aus Deutschland entsendet werden könnte, wenn sich die Lage verschlechtert. Schreibt DER SPIEGEL.
Gebt Afghanistan endlich den Afghanen zurück! Die USA und mit ihr die «westliche Wertegemeinschaft» haben nichts aus dem Vietnamkrieg (1955 bis 1975) gelernt.
Der Vietnamkrieg wie auch der Koreakrieg wurden von den USA und den westlichen Militärallianzen geführt, um einen «Dominoeffekt» in Asien zu verhindern, nachdem Mao nach einem blutigen Bürgerkrieg in China mit seinem kommunistischen Einparteiensystem die Macht übernommen hatte.
Nach dem Abzug der US-Armee aus Vietnam war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Norden Südvietnam besiegte und dem nun vereinten Land ebenfalls das kommunistische Einparteiensystem verordnete.
Jahrzehnte später herrschen sowohl in China und in Vietnam die Kommunisten und pflegen mit ihren Einparteiensystemen inzwischen einen Neoliberalismus, der sogar einem Schweizer FDP-Anhänger abartig erscheinen könnte. China ist zur globalen Weltmacht aufgestiegen und Vietnam einer der boomenden Tigerstaaten Asiens. Mit beiden Ländern pflegt die hehre «westliche Wertegemeinschaft» intensive Handelsbeziehungen.
Was sagt uns das? Die Zahl der vietnamesischen Kriegsopfer, die auf mindestens zwei bis zu über fünf Millionen geschätzt werden, darunter über 1,3 Millionen Soldaten sowie die 58.220 US-Soldaten und 5.264 Soldaten ihrer Verbündeten, die in Vietnam ihr Leben verloren, hätte man sich sparen können. Und da wundern wir uns, wenn die Chinesen und Vietnamesen nur geheimnisvoll über die Scheinheiligkeit lächeln, wenn ihnen der Westen pro Forma und für die Show zuhause die Leviten bezüglich Menschenrechte liest?
Asymmetrische Kriege sind in der Regel nicht zu gewinnen. Vietnam musste den Krieg gegen die stärkste Militärmacht der Welt nicht gewinnen und stand am Schluss dennoch als Sieger da.
Auch der Afghanistan-Krieg, der als purer Rachefeldzug und Vergeltung für die Demütigung Amerikas durch Nine Eleven begann, wird als Desaster für die westliche Militärallianz enden. Wie sagte ein Taliban so treffend: «Ihr (gemeint ist die westliche Militärallianz in Afghanistan) habt die Uhr, wir die Zeit.» Der Westen wird sich wie beim Vietnamkrieg um möglichst wenig Gesichtsverlust bemühen und irgendwann Afghanistan den Afghanen überlassen.
Doch bis es soweit ist, müssen noch ein paar deutsche Drohnen getestet werden und Menschen sterben. Kollateralschäden nimmt man billigend in Kauf. Obschon sich eines der ursprünglichen Ziele zur Legitimierung des Krieges vor der UNO, die Brut- und Ausbildungsstätten für Dschihadisten am Hindukusch auszulöschen, längst von selbst erledigt hat. Die Gotteskrieger treiben ihr Unwesen schon lange in anderen Gefilden. Viele leben mitten unter uns. In Europa, im Nahen und Fernen Osten und in Asien. Nicht selten unterstützt vom NATO-Partner Türkei.
Demokratie und Menschenrechte mit einem Krieg in einem fundamental islamischen Land wie Afghanistan implementieren zu wollen, wird stets das Gegenteil bewirken. Die Radikalen werden noch radikaler. Auch das lässt sich aus vielen Beispielen längst vergangener Geschichte lernen, die einige zarte Pflänzchen eines aufgeklärten Islams zerstört haben. Aufklärung kam noch nie in der Geschichte der Menschheit von den Tyrannen, sondern vom Volk. Es liegt allein in den Händen des afghanischen Volkes, sich von den Steinzeit-Suren aus dem heiligen Buch, genannt Koran, zu lösen. Oder wie Gotthold Ephraim Lessing sagte: «An die Stelle der Religion muss die Überzeugung treten.»
Theodor Fontane beschreibt in seiner Ballade «Das Trauerspiel von Afghanistan» als deutscher Auslandskorrespondent in England (1855 - 1859) über den gescheiterten Feldzug des britischen Empires in Afghanistan wie folgt: «Mit dreizehntausend der Zug begann, einer kam heim aus Afghanistan.» Titel und dieser eine Absatz des Gedichts sagen kurz und bündig alles aus, der Rest der Ballade gehört nicht unbedingt zu Fontanes besten Arbeiten.
PS: Die Gesamtkosten für den deutschen Einsatz in Afghanistan belaufen sich bis heute auf rund 10,2 Milliarden Euro. Das hätte gereicht, um jedes deutsche Kind mit einem vernünftigen Laptop oder PC für das Homeschooling während der Coronapandemie auszustatten. Und es wären erst noch etliche Milliarden Euro übrig geblieben. Ein paar Waffenschmieden hätten allerdings ein paar Milliarden weniger Umsatz erzielt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
18.2.2021 - Tag der Kebab-Buden
Michelin-Stern-Koch wirft hin: Zürcher Spitzenrestaurant schliesst wegen Corona
Das Restaurant 1904 Designed by Lagonda in Zürich schliesst. Zu unsicher ist die Zukunft für Küchenchef Thomas Bissegger (34). Nun muss er sich neu orientieren.
Egal wann der Bundesrat die Beizen wieder komplett öffnet, das noble Restaurant 1904 Designed by Lagonda in Zürich schliesst.
«Infolge des aktuellen Öffnungsverbots der Restaurants und der Unsicherheit, wann der Restaurantbetrieb wieder aufgenommen werden kann, bleibt das Fine-Dining-Restaurant bis auf weiteres geschlossen», schreiben die Betreiber in einer Mitteilung.
1 Stern und 16 Punkte
Das Edel-Lokal unter Küchenchef Thomas Bissegger (34) gibt es erst seit zwei Jahren. In einem halben Jahr erhielt er 16 Gault-Millau-Punkte. Später folgte der erste Michelin-Stern. «Es war mein Herzensprojekt, und ich habe noch viel Potenzial gesehen. Deshalb tut es besonders weh», so Bissegger gegenüber Gault Millau.
Laut den Investoren aus St. Gallen gibt es weiterhin Events, Veranstaltungen oder Präsentationen im Restaurant. Sobald dies wieder möglich ist.
Neuorientierung steht an
Bissegger muss sich nun neu orientieren. «Ich muss nun erst einmal herausfinden, was der Markt überhaupt hergibt.» Seine Zukunft sieht Bissegger aber weiterhin in der gehobenen Gastronomie.
Bissegger ist nicht der erste Spitzengastronom, der dichtmachen muss. Im Juni schloss beispielsweise das Gourmet-Restaurant Didier de Courten vom gleichnamigen Chef in Siders VS. Schreibt Blick.
Meldungen über Lokalschliessungen werden uns noch lange begleiten. Es ist anzunehmen, dass auch nach einer Öffnung der Gastronomie etliche Gastrounternehmen – vor allem in den touristischen Hotspots der Schweiz – ihre Bilanzen bei den Konkursämtern hinterlegen müssen. Nicht weil es ihnen so gut geht, sondern weil schlicht und einfach der notwendige Umsatz fehlt, um unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitskonzepte u.a. die teilweise exorbitanten Mietzinse bedienen zu können. Um nur einen Grund zu nennen.
Betrachten wir als Beispiel die Situation in der Stadt Luzern: In den Jahren vor der Corona-Pandemie fluteten pro Jahr bis zu 300'000 (der vielgeschmähten) Touristen aus China die Leuchtenstadt. Die kommen so schnell nicht wieder. Da stellt sich logischerweise die Frage, wo denn ein Ersatz dieser gewaltigen Touristenmasse herkommen soll? Mir fehlt da die Fantasie zur Beantwortung dieser Frage.
Es wird vermutlich eine Bereinigung in Sachen Gastrolokalen stattfinden, die – wertfrei – auch ohne Corona irgendwann eingetroffen wäre. Die Profiteure dürften die Take Away's und Kebab-Buden sein. Eine Entwicklung, die sich in der Stadt Luzern lange vor Corona schon seit längerer Zeit abzeichnete. Nicht zuletzt durch die Zunahme der Übergewichtigen. Vor allem bei den Kids.
Tja, es hängt eben doch alles mit allem zusammen. Auch ohne Coronavirus.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.2.2021 - Tag der dummen Zitate
Lieber Gast, lieber Freund, liebe Freundin, lieber Lieferant: Gasthof Adler in Emmenbrücke schliesst seine Türen für immer
Schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Gasthaus Adler seine Türen nicht wieder öffnen wird.
Mit einem lachenden Auge blicken wir zurück auf den letzten August, als wir trotz der schwierigen Lage viele Gäste und eine gute Buchungslage verzeichnen konnten. Dies stimmte uns optimistisch, dass wir diese Krise meistern werden. Leider wurde unser Optimismus an diesem verhängnisvollen Tag im Oktober getrübt, als wir – aufgrund der BAG-Bestimmungen – praktisch über Nacht alles absagen mussten.
Seither haben wir gehofft, gebangt und bis zuletzt daran geglaubt, bald wieder für Sie da sein zu können. Nach reiflicher Überlegung sind wir nun aber schweren Herzens zum Entschluss gekommen, unsere Kräfte zu bündeln, um einem finanziellen Kollaps zu verhindern.
Das bedeutet, dass wir uns auf das Catering «tuck-tuck» sowie das Bergrestaurant Ahorn Alp konzentrieren werden. Das Gasthaus Adler wird unter unserem Team seine Tore leider nicht mehr öffnen. Ausgestellte Gutscheine werden ab sofort im Bergrestaurant Ahorn Alp (www.ahorn-alp.ch) sowie bei tuck-tuck Catering (www.tuck-tuck.ch) akzeptiert. Falls dies nicht Ihrem Wunsch entspricht, treten Sie mit uns in Kontakt, sodass wir gemeinsam eine Lösung finden oder Ihnen diesen Betrag zurückzahlen können. (zentralschweiz@tuck-tuck.ch)
Wir danken für Ihr Verständnis, Ihre Treue und die gemeinsame Zeit.
Bleiben Sie gesund & hoffentlich bis bald,
Beat Schmidlin
Natascha & Reto Roos-Schaad & das komplette Adler-Team
Schreibt das Gasthaus Adler in Emmenbrücke.
Es ist zu befürchten, dass das Gasthaus Adler in Emmenbrücke kein Einzelfall bleiben wird.
Während die «systemrelevanten» Fussballclubs mit «à-Fonds-perdu»-Beiträgen (nicht rückzahlbaren Beiträgen) aus der Bundesgiesskanne der Corona-Hilfsgelder bedient wurden, damit auch weiterhin teure Fussballer-Einkäufe getätigt werden können, wurde die Gastrobranche links liegen gelassen.
Wie sagte Frau Bundesrätin Amherd ebenso dumm wie falsch: «Wir haben in der Schweiz kaum Fussballmillionäre».
Wie viele Millionäre*innen hat denn die Schweiz beim Gastropersonal?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.2.2021 - Tag der Gitte
Rüge für Gmür wegen Teilnahme an verbotenem Fasnachtsumzug von Gerhard Pfister, Parteipräsident der «Gitte»
Gerhard Pfister, Parteipräsident der Gitte, hat seinen Parteikollegen Alois Gmür wegen dessen Teilnahme an einem verbotenen Fasnachtsumzug in Einsiedeln im Kanton Schwyz gerügt. Die Teilnahme am Umzug sei Gmürs persönliche Entscheidung. Sie entspreche nicht der Haltung der Partei «Die Gitte». Als Nationalrat habe Gmür eine gewisse Vorbildfunktion, sagte Pfister dem «Tages-Anzeiger» und dem «Blick». Das Verhalten von Gmür entspreche nicht dem, was man der Bevölkerung in Corona-Zeiten leider vorschreiben müsse.
Ähnlich äusserte sich die Gitte-Fraktionschefin Andrea Gmür. Die Fasnacht sei eine Zeit, in der man vor überschäumender Freude manchmal den Geist ausschalte. Aber das solle nichts rechtfertigen. Alois Gmür sei für sein Verhalten selber verantwortlich.
Am Montagmorgen hatten sich in Einsiedeln trotz Veranstaltungsverbot über 1'000 Personen zum traditionellen Sühudiumzug getroffen. Erst als die Polizei Bussen verteilte, löste sich die Versammlung auf.
Schreibt SRF im Corona-Live-Ticker
«Partei der Gitte» - darauf muss man erst kommen.
PS: Die echte «Gitte» Haenning erlebte ich vor (gefühlt) etwa 100 Jahren bei einem Live-Konzert im Luzerner «Casino». Sie war, gnädig ausgedrückt, etwas angesäuselt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.2.2021 - Tag des Schmieröls
Genfer Staatsrat vor Gericht: Der tiefe Fall des Pierre Maudet
Er galt einst als Shootingstar der FDP. Nun steht der Genfer Regierungsrat Pierre Maudet vor Gericht.
Eine geschenkte Luxusreise, ein Lügen-Konstrukt und am Ende ein amtierender Regierungsrat vor Gericht. Die Affäre rund um den Genfer Staatsrat Pierre Maudet beschäftigt die Politik in der Calvin-Stadt inzwischen seit Jahren. Mit dem Prozess, der am Montag startet, kommt sie nun zu ihrem vorläufigen Höhepunkt.
Im Fokus steht eine Luxusreise nach Abu Dhabi inklusive des Besuchs eines Formel-1-Rennens für Maudet, seine Familie und seine engsten politischen Mitarbeiter – eingeladen von den Behörden Abu Dhabis. Kostenpunkt laut Anklageschrift: 50'000 Franken. Hinzu kommt, dass Maudet vor Ort den Kronprinzen traf. Juristisch sei dies problematisch, sagt der emeritierte Strafrechtsprofessor Mark Pieth. «Normalerweise bezahlt ein Magistrat seine Reise selbst. Und wenn es ein Geschenk ist, dann darf es keinen Bezug zum Amt haben».
«Die Wahrheit verschwiegen»
Pierre Maudet erklärte stets, dass die Reise privater Natur und das Treffen mit dem Kronprinzen ein Zufall gewesen war. Doch er geriet zunehmend unter Druck – politisch und medial. Anfang September 2018 gab er schliesslich zu, einen Teil der Wahrheit verschwiegen zu haben. Das Treffen sei kein Zufall gewesen. Laut Anklage hat sich der Genfer Staatsrat damit einer sogenannten Vorteilsnahme schuldig gemacht. Für den Korruptionsexperten Pieth ist klar: «Das ist kein Kavaliersdelikt. Funktionäre nehmen keine Geschenke an.»
Machtmensch Maudet
Pierre Maudets Karriere ging steil bergauf. Mit 29 Jahren wurde er in die Genfer Stadtregierung gewählt, kurze Zeit später in die Kantonsregierung. Eine Karriere, die 2017 schliesslich in einer Bundesratskandidatur mündete. Maudet sei ein Machtmensch, sagt Philippe Reichen. Der Journalist und Buchautor hat sich intensiv mit dem Aufstieg und dem Fall von Maudet befasst. «Bereits als 20-Jähriger hat er zum ersten Mal gesagt, dass er die Macht liebt. Er ist ein ‹anmial politique›. Ein Berufspolitiker, wie man sie in der Schweiz sonst nicht kennt.»
Aufgeben ist kein Thema
Die Affäre Maudet dominierte zunehmend die Genfer Politik. Die Luft für den Regierungsrat wurde dünn. Regierungskollegen und die Partei wandten sich ab. Doch Maudet hielt am Amt fest. Zwar hatte er im vergangenen Herbst seinen Rücktritt angekündigt, gleichzeitig jedoch seine Kandidatur für die eigene Wiederwahl bekannt gegeben.
Inzwischen ist der parteilose Noch-Regierungsrat bereits wieder im Wahlkampf. Zwischenzeitlich hatte er ein kleines Beratungsbüro eröffnet, um Genferinnen und Genfer zu beraten, die wirtschaftlich von der Coronakrise betroffen sind.
Die Ersatzwahl ist auf den 7. März terminiert. Spätestens dann dürfte das Genfer Stimmvolk über das politische Schicksal des einstigen FDP-Shootingstars entscheiden. Das juristische Verdikt – egal wie es ausfällt – dürfte an seinen Plänen, sich zur eigenen Wiederwahl zu stellen, kaum etwas ändern. Schreibt SRF.
Wie die Alten vom Freisinn sungen, singen auch die Jungen.
Allerdings mit dem Unterschied, dass die Alten etwas cleverer vorgingen und sich seltener bei den Mauscheleien erwischen liessen.
Fairerweise sei festgehalten, dass das Handling «schmieriger» Geschäftchen in den Zeiten vor Internet und Social Media etwas einfacher war.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.2.2021 - Tag der Kapitulation
Littau: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Selbstunfall verursacht – niemand verletzt
Vergangene Nacht verursachte ein Autofahrer an der Luzernerstrasse in Littau einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Wert von 0,35 mg/l und ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Resultat.
Am Samstag, 13. Februar 2021, kurz nach 01:45 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Grossmatte in Littau Richtung Kreisverkehrsplatz Matthof. Dabei geriet das Auto rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Garagentor und einen Betonpfeiler des Gebäudes Luzernerstrasse 133. Der Fahrzeuglenker stieg kurz aus und fuhr anschliessend mit dem stark beschädigten Auto Richtung Flurstrasse weiter. Dort konnte er durch eine Polizeipatrouille angehalten und kontrolliert werden. Beim Unfall wurde niemand verletzt.
Eine Atemalkoholprobe beim Autofahrer ergab einen Wert von 0,35 mg/l. Zudem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus.
Der 19-jährige Mann musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen und sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt.
Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 15'000 Franken. Schreibt die Luzerner Polizei.
Wir nähern uns mit rasender Geschwindigkeit dem unsäglichen «American Way of Life»: In der Altersgruppe der unter 50-Jährigen der USA stellen Drogen mittlerweile die häufigste Todesursache überhaupt dar, noch vor Verkehrsunfällen und Waffengewalt.
Es ist weitgehend in Vergessenheit geraten, dass der jugendliche Drogenkonsum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts seinen Ausgangspunkt nicht mit den ideologisierten Drogenkulturen der Beatniks und Hippies nahm.
In den USA war der Gebrauch von illegalen Substanzen zunächst vielmehr ein Unterschichten-Phänomen: Cannabis- und Heroinkonsum waren zuerst Teil devianter Jugendkulturen der Unterschicht. Die Konsumenten rekrutieren sich dabei - vor allem in New York - aus den ethnischen Minderheiten Amerikas.
Das hat sich in Amerika grundlegend geändert. Die Übel der konsumorientierten Wohlstandsgesellschaft sind inzwischen bei einem überwiegenden Teil der US-Bevölkerung bis hinauf zur Oberschicht und den Universitäten, ja selbst bei den Polizei-Institutionen, angekommen. Laut einer im «Journal of the American Medical Association» erschienenen Publikationen sind 68 % der Erwachsenen und 32 % der Kinder und Jugendlichen Amerikas übergewichtig.
ALLES HÄNGT MIT ALLEM ZUSAMMEN
Doch nicht genug damit: Amerikanische Studien gehen davon aus, dass in den USA (vermutlich) über 50 Prozent der Bevölkerung entweder von Medikamenten oder Drogen und Alkohol abhängig sind. Man darf sich fragen, welches der Übel, die inzwischen fliessend ineinander übergehen (siehe Medienmitteilung der Luzerner Polizei oben; der übliche Mix aus Drogen und Alkohol), aus soziologischer Sicht langfristig für eine funktionierende Gesellschaft schlimmer ist.
Und was unternimmt die Luzerner Polizei gegen diese Entwicklung des «American Way of Life» in der Stadt Luzern, dem Schweizer Drogenhotspot Nummer zwei?
SIE KAPITULIERT.
Und widmet sich mit aller Kraft dem von der Regierung verordneten Bussen-Budget. Parkbussen sind wichtiger als Massnahmen gegen eine zugedröhnte Gesellschaft.
Trotz schockierender Zunahme von jugendlichen Drogentoten in der Zentralschweiz, deren Todesursache in den Medienmitteilungen der zuständigen Polizeikorps gerne verschwiegen wird.
Trotz Verhaftung von 50 jugendlichen Hardcore-Drogen-Konsumenten/Dealer aus dem Umfeld der Luzerner Kanti.
Ein besorgter Bürger der Stadt Luzern, seines Zeichens alles andere als ein Hysteriker, beobachtete den öffentlichen Verkauf harter Drogen mitten in der Stadt Luzern. Er rief die Luzerner Polizei an und bekam zur Antwort: «Das ist halt so in einer Stadt. Nein, da kommen wir nicht vorbei.»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.2.2020 - Tag des Sex Appeals
Ems-Chefin wird von Corona-Warnerin zum Öffnungsturbo: «Wir haben eine Diktatur vom Bund»
Sie war die Erste, die im Parlament Maske trug: Magdalena Martullo-Blocher. Die Unternehmerin fordert jetzt aber eine rasche Öffnung der Wirtschaft. Sie findet deutliche Worte.
Eine Stunde dauert die Jahresmedienkonferenz der Ems-Gruppe. Es ist der Auftritt von Ems-Chefin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (51). Sie nutzt das Podium für eine Abrechnung mit der Corona-Politik des Bundes.
BLICK trifft die Unternehmerin im Anschluss zum Interview. Martullo-Blocher ist nicht zu bremsen. «Wir haben eine Diktatur vom Bund», sagt die Unternehmerin. «Im Moment haben wir weniger Wirtschaftsfreiheit als in China.» Europa sei «wie gelähmt».
Martullo-Blocher verteilt Ohrfeigen am laufenden Band. Sie geisselt die Fehler der Armeeapotheke bei der Beschaffung der Schimmelmasken. Und rühmt die eigenen Verdienste bei der Versorgung der Coiffeure mit Ems-Masken.
Weihnachtsfest mit Maske
Sie fordert ein rasches Ende des zweiten Lockdowns. «Ich verstehe nicht, warum es jetzt keine Öffnung mit Schutzkonzepten gibt.»
Wieder führt sie das eigene Unternehmen als Musterbeispiel an. Bei Ems sei es kaum zu innerbetrieblichen Ansteckungen gekommen. Weltweit. Den Masken sei Dank. Und wegen des Desinfektionsmittels. Am Standort in Domat/Ems GR habe das Unternehmen in den letzten Monaten drei Tonnen Ethanol verbraucht.
Sie selbst sei immer noch vorsichtig. «Ich trage Maske, halte Abstand, auch im Parlament», sagt Martullo-Blocher. «Ich bin recht konsequent. Das galt auch für Weihnachten. Meine Eltern hatten eine Maske auf.»
121 Millionen für Martullo-Blocher
Einen Corona-Test hat die Politikerin noch nie gemacht. Dabei ist sie eine grosse Befürworterin von Massentests. Die Ems-Gruppe macht auch mit beim Pilotprojekt in Graubünden. Die Lernenden lassen sich regelmässig und freiwillig testen. «80 Prozent haben sich sofort eingetragen», sagt Martullo-Blocher.
Die Kosten für die Tests übernimmt Ems. Der Betrag ist vernachlässigbar. Die Firma machte im letzten Jahr einen Gewinn von 440 Millionen Franken. Ems spürte zwar den Abschwung im Automarkt, profitierte aber auch vom Homeoffice. Der Absatz von Kaffeemaschinen nahm zu. Dort sind hitzebeständige Ems-Kunststoffe verbaut.
Das Gros des Gewinns geht an die Aktionäre. Die Dividende beträgt 17 Franken pro Aktie. Alleine Martullo-Blocher kassiert 121 Millionen für ihr Aktienpaket. Der gleiche Betrag fliesst in die Taschen ihrer Schwester Rahel (43). Die dritte Blocher-Tochter Miriam Baumann-Blocher (45) erhält knapp über 40 Millionen Franken. Schreibt Blick.
Man muss die Frau ohne Sex Appeal* nicht mögen, aber als Unternehmerin ist sie tüchtig und mit einigen Thesen trifft sie ins Schwarze.
* Wegen frauenfeindlichen «Verbalinjurien» musste der japanische Olympiachef Mori vor ein paar Tagen zurücktreten. Nach alter Samurai-Sitte wäre eigentlich ein Harakiri für solch ein Vergehen unausweichlich gewesen. Wortwörtlich aus dem Japanischen übersetzt, sagte der Sayonara-Machovor laufenden Kameras: «Wenn man die Zahl der weiblichen Mitglieder im Gremium erhöht und deren Redezeit nicht limitiert, kommen sie nur schwer zum Ende, was nervig ist.» Will heissen: Frauen reden zu viel. Also sowas; ich bin schockiert! Sowas denkt Mann, aber Mann spricht es nicht aus.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.2.2021 - Tag des Panikorchesters
Coronavirus-Mutationen und sinkende Fallzahlen: «Der Denkansatz ist falsch»
Die Corona-Fallzahlen sinken in der Schweiz seit Wochen, doch die Anzahl der mutierten Varianten nimmt stetig zu. In Deutschland wurden deswegen gerade die Massnahmen verlängert, in der Schweiz sind Lockerungen per Ende Februar wenig wahrscheinlich. Dabei wird immer wieder auf Modelle verwiesen, nach denen mit den Varianten die Fallzahlen wieder steigen würden. Doch der renommierte deutsche Forscher Klaus Stöhr widerspricht: Dafür gebe es bis jetzt keine Anzeichen.
SRF News: Die Angst vor Corona-Mutationen ist gross und bestimmt in Deutschland wie der Schweiz die Strategie zur Bekämpfung des Coronavirus. Sie beobachten die internationale Entwicklung sehr genau, ist die Angst übertrieben?
Klaus Stöhr: In England haben Epidemiologen und Labortechniker zunächst beobachtet, dass die neue Variante ansteckender ist. Da war die Sorge natürlich gross und berechtigt. Interessanterweise gibt es jedoch keine höheren krankmachenden Eigenschaften, keine höhere Sterblichkeit und auch keine Veränderung in der Altersstruktur der Erkrankten. Das haben inzwischen epidemiologische Untersuchungen ergeben.
In Grossbritannien und Irland war die Furcht vor der Variante besonders gross, die Situation schien schlimmer zu werden?
In Irland hatte man zum Ende des letzten Jahres einen dramatischen Anstieg der Gesamtfälle beobachtet. Dieser wurde von den irischen Gesundheitsbehörden eindeutig auf das veränderte soziale Verhalten der Iren zurückgeführt und hatte nur am Rande mit der Variante zu tun. Erst in den letzten Tagen vor dem Peak ist die Variante vermehrt beobachtet worden, da waren rund 20 Prozent der Variante zuzuordnen. Interessanterweise sind danach die Fälle um 80 Prozent gesunken, gleichzeitig hat sich der Anteil der Variante auf fast 50 Prozent erhöht. Das bedeutet: Die Bekämpfung durch Massnahmen hat funktioniert, trotz der signifikanten Zunahme der Variante.
In Grossbritannien war zum Höhepunkt die Variante bereits für viele Fälle verantwortlich. Doch auch hier sind die Fallzahlen in den letzten Wochen nun um zwei Drittel eingebrochen, obwohl die Variante anteilsmässig noch mehr zugenommen und fast hundert Prozent erreicht hat.
In der Schweiz hatten und haben wir keinen so starken Lockdown wie in Irland und Grossbritannien, was ist hier zu beobachten?
Die Schweiz ist mit Dänemark vergleichbar, was Massnahmen und Fallzahlen angeht. Wir sehen bei beiden Ländern einen linearen Rückgang. Gleichzeitig nehmen auch hier die Varianten sukzessive zu.
Eigentlich wäre es ja logisch, dass nun die Fallzahlen wieder ansteigen, die Variante ist schliesslich ansteckender?
Der Denkansatz ist falsch, dass Mutationen, die im Labor und in den Modellrechnungen ansteckender sind, dies auch in der realen Welt sein müssen. Varianten entstehen immer – und wenn nun die Modelle mit höherer Infektiosität nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen, dann muss man das Modell ändern. Die im Labor beobachtete höhere Ansteckung wirkt sich in der realen Bekämpfung offenbar nicht negativ aus.
Die Modelle, die auch hierzulande gerne zur Illustration gezeigt werden, sind also falsch?
Modelle sind nur so gut wie die Datengrundlage. Und wenn diese unklar ist, können die Modelle auch falsch liegen. Nun haben wir genug empirische Daten gesammelt, wenn man sich die Trends in verschiedenen Länder anschaut, dass man die Modelle nun ganz schnell überdenken sollte.
Die Länder haben unterschiedliche Massnahmen, wie wirkt sich das denn konkret aus?
Es gibt Länder, die nach einem schlimmen Peak harte Massnahmen ergriffen haben, wie England und Irland, und die Massnahmen haben gewirkt, trotz Varianten. In Ländern wie der Schweiz, Deutschland oder Dänemark hat es in den letzten Wochen keine grossen Änderungen in der Bekämpfungsstrategie gegeben, und die Fallzahlen sinken entsprechend weniger ab. Gleichzeitig wird der Anteil der Variante immer grösser – und es passiert nichts.
In Frankreich zum Beispiel sind die Massnahmen weniger streng, die Varianten nehmen signifikant zu und die Fallzahlen nur leicht. Auch hier: keinen Einfluss.
Was müsste den jetzt in Ländern wie Deutschland und der Schweiz passieren?
Ich vertrete hier eine Einzelmeinung, insbesondere was Deutschland angeht. Ich beobachte, dass der wissenschaftliche Diskurs bei der Entscheidungsfindung hier viel zu wenig zum Tragen kommt. Sie brauchen ein Expertengremium mit Epidemiologen, Virologen, Psychologen, Soziologen, Spital-Hygienikern, Schulexperten und vielen anderen, das zusammen Vorschläge unterbreitet, die die Politik dann umsetzen soll. Aus meiner Sicht wäre es notwendig, einen Stufenplan oder ein Ampelsystem zu haben – also zum Beispiel bei steigenden Erkrankungszahlen oder R-Wert ergreift man Massnahmen, und bei fallenden Zahlen die entgegengesetzten Massnahmen. Dies ist auch für die Öffentlichkeit transparent und gibt eine Perspektive.
Ihre Beobachtungen zu den Varianten sind eigentlich gute Nachrichten, kommt das Ende der Pandemie schneller?
Nein, die Variante beendet die Pandemie nicht schneller. Die Pandemie endet erst, wenn alle immun sind. Dies geschieht idealerweise durch eine Impfung, wahrscheinlicher geschieht es aber erst, wenn alle infiziert sind, weil der Impfstoff nur in einem kleinen Teil der Welt verfügbar ist.
Doch auch dann wird es Reinfektionen geben. Was aber richtig ist: Durch die Impfung wird sich die Hauptauswirkung der Pandemie dramatisch verändern – in den nächsten Monaten werden Todes- und Krankenhausfälle dramatisch zurückgehen.
Das Gespräch führte Matthias Schmid.
Stellt Euch vor, es gibt täglich neue Virusmutationen und trotz Alarmismus sinken die Fallzahlen!
Langsam aber sicher wird es selbst für Menschen sehr schwierig, die weder einen Alu-Hut tragen noch irgendwelchen «querdenkenden» Verschwörungstheorien geschweige denn esoterischen SVP-Vollpfosten folgen, dem Berner Panikorchester zu vertrauen. Gedanken über die Hysterie der Coronavirus-Mutationen und dennoch sinkenden Fallzahlen habe ich mir als unbedarfter Mensch nämlich auch gemacht. Habe ja meinen Doktortitel von der Luzerner Staatsanwaltschaft nicht als Virologe erhalten.
Und nun kommt Klaus Stöhr, alles andere als ein Nasenbohrer, und widerlegt bzw. zerlegt den Alarmismus von Bundesrat, BAG und Task Force.
Vertrauen in Regierung und Behörden ist bekannterweise das höchste Gut. Doch dieses Vertrauen schmilzt derzeit dahin wie Schnee an der Sonne. Grobe Schnitzer wie die Aussage von «Mister Corona» Daniel Koch «Gesichtsmasken nützen nichts» begleiten die Corona-Pandemie seit Beginn im Jahr 2020. Hätte der begnadete Selbstdarsteller Koch damals ehrlich kommuniziert, dass die Schweiz trotz einem seit Jahren gültigen Pandemiegesetz keine, bzw. nur vergammelte Schutzmasken besitzt, statt vor laufenden Kameras Stumpfsinn zu verbreiten, hätten wir heute vermutlich weniger Maskenverweigerer*innen.
Kochs Notlüge war sowas wie der Urknall für das Misstrauen gegenüber Bundesrat, BAG, Behörden und Experten.
Irgendwann wird auch die Frage auftauchen, wieso es gestattet ist, in überfüllte Bergbahnen zu steigen, nicht aber in einem Restaurant mit vom Bund verordnetem Schutzkonzept einen Kaffee zu trinken.
Da fällt mir nur noch Herbert Grönemeyers Songtext ein, leicht abgewandelt:
Gebt den Politikern das Kommando
Sie berechnen nicht
Was sie tun
Die Welt gehört in Politikerhände
Dem Trübsinn kein Ende
Wir werden in Grund und Boden gelacht
Politiker an die Macht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.2.2020 - Tag der Fasnachtsexperten
NIEMAND WILL NOCH KINDER – Geburtenzahlen in China fallen drastisch
Trotz Aufhebung der Ein-Kind-Politik geht die Zahl der Geburten in China rapide zurück. Vielen sind die Kosten zu hoch. Die Gesellschaft überaltert. Was bedeutet das für die zweitgrößte Volkswirtschaft?
Die Zahl der Geburten in China ist im vergangenen Jahr drastisch auf einen „alarmierenden“ Tiefstand gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr seien 15 Prozent weniger Neugeborene amtlich gemeldet worden, berichtete das Ministerium für öffentliche Sicherheit in Peking. Die Zahl sei von 11,79 auf 10,04 Millionen gefallen. Experten warnten am Mittwoch vor einer Überalterung im bevölkerungsreichsten Land der Erde, die damit noch deutlich schneller als erwartet voranschreitet. Das werde das Wachstum der zweitgrößten Wirtschaftsnation bremsen.
Die jährliche Geburtenrate hatte nach Angaben des Statistikamtes bereits 2019 den niedrigsten Stand seit Gründung der Volksrepublik 1949 erreicht. Als Gründe wurden die hohen Kosten für Bildung und Wohnungen in China genannt. Auch geht die Zahl der Eheschließungen zurück, während die Scheidungsrate in China hoch ist. Viele Paare warten auch mit der Heirat und gründen erst später Familien.
So langsam wuchs Chinas Wirtschaft seit Jahrzehnten nicht mehr
Die Aufhebung der seit 1979 geltenden Ein-Kind-Politik hatte 2016 nur zu einem leichten Anstieg der Geburten geführt, doch ist die Zahl seither jedes Jahr weiter gefallen. Das genaue Ausmaß des Rückgangs wird sich im April zeigen, wenn das Statistikamt die Zahlen für 2020 vorlegen will. Experten wiesen darauf hin, dass die berichtete Zahl der neu beantragten Wohnortregistrierungen (Hukou) nicht alle Geburten abbilden, da viele Babys auch nicht angemeldet werden.
Doch der besorgniserregende Trend ist klar: „Niemand will noch Kinder haben“, sagte der Familienplanungsexperte und bekannte Autor Yi Fuxian von der amerikanischen Universität von Wisconsin der Deutschen Presse-Agentur in Peking. Die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik habe „das Fruchtbarkeitskonzept der Menschen verändert“. „Die Menschen haben sich daran gewöhnt, nur ein Kind zu haben“, sagte Yi Fuxian. „Das Konzept ist tief verwurzelt und nur schwer zu ändern.“
Auch seien die Ausgaben, um Kinder in China großzuziehen, höher als selbst in fortschrittlicheren Wirtschaftsnationen wie Taiwan oder Südkorea. „Auf der einen Seite ist die Scheidungsrate in China hoch, auf der anderen gehen die Trauungen zurück“, sagte Yi Fuxian. „Das ist sehr beunruhigend.“ Er warnte vor den wirtschaftlichen Folgen der Überalterung und des Rückgangs der arbeitsfähigen Bevölkerung.
„Wenn die Zahl der Arbeitskräfte geringer wird, beginnt der Niedergang der Wirtschaft“, sagte der Experte. Chinas Wachstum werde abflachen. Nach Schätzungen werde der Zuwachs in China in den Jahren 2030 bis 2035 langsamer ausfallen als in den USA, sagte Yi Fuxian. „Es wird unmöglich, die USA als größte Volkswirtschaft abzulösen.“ Experten wiesen auch darauf hin, dass weniger Menschen in Arbeit in China damit immer mehr Ältere versorgen müssen. Heute ist schon jeder fünfte Chinese über 60 Jahre alt.
Die Zeitung „Global Times“, die vom kommunistischen Parteiorgan „Volkszeitung“ herausgegeben wird, sprach von einer „Warnschwelle“, die mit nur noch zehn Millionen gemeldeten Neugeborenen unterschritten worden sei. Schreibt DIE WELT.
Herrlich! Ausgerechnet westliche Experten und ein in die USA exilierter Chinese aus der Steinzeit-Ökonomie des ewigen Wachstums sehen bereits den wirtschaftlichen Untergang Chinas. Es darf angenommen werden, wenn dem so wäre – die Geburtenrate war ja auch in den Jahren zuvor nicht exorbitant höher –, hätte Xi Jinping schon längst die Zwei- oder Drei-Kinder-Order verkündet, was in China ein unmissverständlicher Befehl ist. So wie Mao seinerzeit die Ein-Kind-Politik mit einem einzigen Befehl durchgesetzt hat.
Wieso verordnete Mao die für den Westen so schwer zu verstehende Ein-Kind-Politik? Die Antwort ist so einfach wie Maos ebenso diktatorische wie pragmatische Massnahme zielführend war: Mao wusste ganz genau, dass er bei einer Fortsetzung der (damaligen) Geburtenrate das Volk nicht mehr hätte ernähren können und damit seine Tage als Chinas neuer Kaiser irgendwann mal gezählt gewesen wären.
Es starben Millionen von Menschen in China zur Zeit vor Maos Erlass. Vorwiegend Kinder. Nicht weil es ihnen so gut ging, sondern weil sie schlicht und einfach verhungerten. Ein paar anständige aber mutlose Armeegeneräle, die Mao später dann hinrichten liess, standen längst Gewehr bei Fuss, um die Macht zu übernehmen.
Wir sollten weniger einem (von ALLEN namhaften Medien übernommenen) Bericht einer US-Agentur und dämlichen «Experten» aus der westlichen Hemisphäre vertrauen, dafür umso mehr der langfristigen Weitsicht der Chinesen, die möglicherweise etwas mehr über die Folgen der (kommenden) Robot-Technik 4.0 auf dem Arbeitsmarkt nachdenken als wir. Oder, was anzunehmen ist, etwas mehr darüber wissen als wir. Immerhin ist China weltweit führend in der KI-Technologie. Nicht nur beim Plastikplunder.
Wissen Sie, ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis: Chinas smarter Präsident Xi Jinping will nämlich noch lange an der Macht bleiben. Sehr lange sogar. Da sind kommende Horden von Arbeitslosen nicht unbedingt förderlich. Und geburtenstarke Staaten wie beispielsweise die Philippinen kein Vorbild.
Die Liste geburtenstarker Staaten, ja sogar ganzer Kontinente ohne wirtschaftlichen Erfolg liesse sich beliebig fortsetzen. Westliche Experten hin oder her. Wären deren Expertisen auch nur im Ansatz stimmig, müsste Japan entweder längst bankrott sein, oder der japanische Arbeitsmarkt wäre ausgetrocknet und mit Kim Jong Uns Wanderarbeitern gefüllt. Beides ist bisher nicht eingetroffen.
Das westliche Modell, Wachstum aus purer Angst vor zu wenig «billigen» Arbeitskräften planlos mit unkontrollierter Migration zu fördern und die eigenen Arbeitslosen auf dem Abschiebe-Geleise der Sozialämter versauern zu lassen und zu vernachlässigen, mag zwar für SVP-Nationalrätin Martina Bircher eine Option sein; nicht aber für China.
Ein Millionenheer von Arbeitslosen und unterbeschäftigten Wanderarbeitern existiert nämlich schon im Reich der Mitte. Das ist der Zündstoff für künftige Revolutionen, vor dem sich die chinesische Nomenklatura fürchtet wie der Teufel vor dem Weihwasser. Und nicht vor ein paar Tausend vom Westen hochgejazzten Intellektuellen aus Hongkong. Die hatte und hat China jederzeit im Griff.
Unselige Populisten, wie sie in der «hehren Wertegemeinschaft des Westens» längst ihr erfolgreiches Unwesen treiben, weil ihre Wahlkampfthemen wie beispielsweise «I'll bring back the Jobs from China to the USA» by The Donald eben nicht vom Himmel gefallen sind, lässt China gar nicht erst entstehen. Wozu hat man denn eine Diktatur?
Gällid. Ni Hao.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.2.2021 - Tag der Panikorchester
Eine einzige «Schlagzeile des Tages» aus dem unerschöpflichen Füllhorn der Panikorchester herausstechen zu lassen, wäre zu viel der Ehre für die Apologeten des täglichen Schreckens.
Dafür verlegen wir Deutschland für einmal nach Zofingen.
Die im Geiste der neuzeitlichen Dummheit des Clickbaitings vereinten Panikorchester – formerly called media – haben nebst der Corona-Pandemie das Normalste der Welt als neues Betätigungsfeld für ihre Szenarien des Schreckens entdeckt: Den Schneefall
Das zeigt sich bei diesen von der Bundesgiesskanne mit hunderten von Millionen geförderten, systemrelevanten Panikportalen mit Live-Tickern und atemloser Berichterstattung der Ab-Schreiberlinge*innen über jede einzelne Schneeflocke, die vom Himmel fällt. Ein grauenhaftes Bild des Horrors und Schreckens wird gemalt. Als ob wir davon nicht schon genug hätten.
Notabene sind es die gleichen Leute, die diesen Winter 2021 als «grösste Klimakatastrophe» aller Zeiten herbei schreiben würden, wäre kein Schnee gefallen.
Was nicht heisst, dass ich den Klimawandel leugne; ich betrachte ihn nur mit anderen Augen. Als einer der sich bewusst ist, dass sich der Reussgletscher vor 12'000 Jahren von der Rigi bis hinunter zur Seebodenalp erstreckte. Alles hängt mit allem zusammen.
Es scheint, als hätte die Menschheit vergessen, dass ein Jahr aus vier Jahreszeiten besteht: Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Jede Jahreszeit hat ihre ureigenen Vor- und Nachteile, aber auch ihre Schönheiten, wie sie Heinrich Heine mit «Deutschland. Ein Wintermärchen» in Versform beschrieb.
Heines «Wintermärchen» gehörte zu meiner Zeit auf dem Gymnasium, als es noch kein Internet, keine Handys, keine Non-Stop-Multi-Media-Berieselung rund um die Uhr gab, nebst den altgriechischen Sagen zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht. Auch wenn dies damals keine leicht verdauliche Kost war, so lernten wir doch im Laufe der Zeit die Schönheit von Sprache und der vollkommenen Verse von Heine, Goethe, Schiller und wie sie alle heissen, zu erkennen.
Und das war gut so! Ich schaue ohne Reue, dafür mit viel Freude im Herzen zurück. Danke, Heinrich Heine! Und sollte ich wieder einmal das Wort «Pfaffenstaat» benutzen, denken Sie an Heinrich Heine und den «Pfaffensegen».
Ob ich durch Heine zum überzeugten Atheisten mutiert bin, sei dahingestellt.
Heinrich Heine - «Deutschland. Ein Wintermärchen.» – Caput I
Im traurigen Monat November war's,
Die Tage wurden trüber,
Der Wind riss von den Bäumen das Laub,
Da reist ich nach Deutschland hinüber.
Und als ich an die Grenze kam,
Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen
In meiner Brust, ich glaube sogar
Die Augen begunnen zu tropfen.
Und als ich die deutsche Sprache vernahm,
Da ward mir seltsam zumute;
Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
Recht angenehm verblute.
Ein kleines Harfenmädchen sang.
Sie sang mit wahrem Gefühle
Und falscher Stimme, doch ward ich sehr
Gerühret von ihrem Spiele.
Sie sang von Liebe und Liebesgram,
Aufopfrung und Wiederfinden
Dort oben, in jener besseren Welt,
Wo alle Leiden schwinden.
Sie sang vom irdischen Jammertal,
Von Freuden, die bald zerronnen,
Vom Jenseits, wo die Seele schwelgt
Verklärt in ew'gen Wonnen.
Sie sang das alte Entsagungslied,
Das Eiapopeia vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den grossen Lümmel.
Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiss, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.
Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.
Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was fleissige Hände erwarben.
Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.
Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.
Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,
So wollen wir euch besuchen
Dort oben, und wir, wir essen mit euch
Die seligsten Torten und Kuchen.
Ein neues Lied, ein besseres Lied!
Es klingt wie Flöten und Geigen!
Das Miserere ist vorbei,
Die Sterbeglocken schweigen.
Die Jungfer Europa ist verlobt
Mit dem schönen Geniusse
Der Freiheit, sie liegen einander im Arm,
Sie schwelgen im ersten Kusse.
Und fehlt der Pfaffensegen dabei,
Die Ehe wird gültig nicht minder -
Es lebe Bräutigam und Braut,
Und ihre zukünftigen Kinder!
Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied,
Das bessere, das neue!
In meiner Seele gehen auf
Die Sterne der höchsten Weihe -
Begeisterte Sterne, sie lodern wild,
Zerfliessen in Flammenbächen -
Ich fühle mich wunderbar erstarkt,
Ich könnte Eichen zerbrechen!
Seit ich auf deutsche Erde trat,
Durchströmen mich Zaubersäfte -
Der Riese hat wieder die Mutter berührt,
Und es wuchsen ihm neu die Kräfte.
Bilder «Zofingen» ZVG mit freundlicher Genehmigung von RST
Mehr über Heinrich Heine
https://de.wikipedia.org/.../Deutschland._Ein_Winterm%C3...
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
9.2.2021 - Tag des Winters
Zieht euch warm an – diese Woche wird es eiskalt
Der Winter ist definitiv noch nicht vorbei. Meteorologen prognostizieren ab Morgen wieder Neuschnee und nach Mitte der Woche zweistellige Minustemperaturen.
Nach einem Hauch von Frühling letzte Woche kommt nun die Kehrtwende: Eine herannahende Störung beschert der Deutschschweiz bereits ab Morgen den einen oder anderen Zentimeter Neuschnee, bis Donnerstagmorgen dürften im Flachland sogar bis zu zehn Zentimeter zusammenkommen, schreibt Meteonews in einer Mitteilung. In den Alpen sind es über 30 Zentimeter. Und so weiter...
Wer hätte das gedacht? In China ist ein Sack Reis umgefallen und in der Schweiz fällt Schnee vom Himmel. Das hat der Winter so an sich, dass es ab und zu schneit und die Temperaturen sinken. Oder steigen. Egal, was immer dieser Winter veranstaltet, für eine Story reichts allemal.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
8.2.2021 - Tag des täglichen Corona-Irrsinns
Wie kann der Bundesrat den Lockdown überhaupt noch verschärfen?
Schulen zu, Ausgangssperre, FFP2-Masken: Hier könnte der Bundesrat mit Verschärfungen ansetzen. Für FDP-Nationalrat Marcel Dobler sind solche Überlegungen «inakzeptabel».
Trotz sinkender Fallzahlen und Positivitätsrate kann Gesundheitsminister Alain Berset nicht aufatmen: An den Von-Wattenwyl-Gesprächen am Freitag mit den Parteipräsidentinnen und -Präsidenten hat er Szenarien präsentiert, die auf eine Weiterführung des Lockdowns abzielen.
Das heisst: Einschränkungen für private Treffen, die Schliessung von Läden und Restaurants sowie die Veranstaltungsverbote sollen weitergeführt werden. Laut «SonntagsZeitung» will die SVP gar wissen, dass Berset den Lockdown bis im Sommer weiterführen wolle.
«Situation bleibt schwierig»
Sorgen machen Experten und Berset vor allem die mutierten Corona-Varianten. Deshalb sieht auch Rudolf Hauri, der oberste Kantonsarzt, die Notwendigkeit von Verschärfungen. «Die Situation bleibt schwierig, weil die Aktivität der Virusmutationen trotz einschneidender Massnahmen zunimmt», so Hauri zur «SonntagsZeitung». Könne diese Ausbreitung nicht gebremst werden, laufe es auf weitere Verschärfungen hinaus.
Doch wie könnte der Bundesrat den Lockdown überhaupt noch verschärfen? Ein Blick ins Ausland zeigt, was noch zusätzlich möglich wäre.
Schulschliessungen
In den letzten Wochen häuften sich Ansteckungen an den Schweizer Schulen, vereinzelt mussten Schulen schliessen. Die Website schulcluster.ch hat die Vorfälle gesammelt. Weiterhin gilt jedoch, dass die obligatorischen Schulen offen bleiben.
In Deutschland beispielsweise ist die Präsenzpflicht an Schulen bis am 14. Februar ausgesetzt, um die dortigen Kontakte «deutlich einzuschränken». Auch in Holland gilt ab der Primarstufe Fernunterricht, dort wird jedoch ab Montag wieder gelockert. Auch Österreich hebt einen Teil seines Schullockdowns bald auf. Dafür hatten sich auch führende Kinderärzte wegen der psychischen Belastungen für die Kinder starkgemacht.
Ausgangssperre
Am 23. Januar griff die Niederlande hart durch: Sie erliess eine Ausgangssperre zwischen 9 Uhr abends und 4.30 Uhr morgens. Diese gilt noch bis am Mittwoch. Wer sich nicht daran hält, kassiert eine Busse von 95 Euro. Die Regierung begründete die Massnahme, die für Aufruhr sorgte, damit, dass sich viele bei Familie und Freunden ansteckten und Studien gezeigt hätten, dass Ausgangssperren wirkten.
Auch Deutschland hat stark in die persönlichen Freiheiten eingegriffen: Neben Kontaktbeschränkungen gilt für besonders betroffene Gebiete ein Bewegungsradius von 15 Kilometern. In der Schweiz gilt derweil die Fünf-Personen-Regel. Der Bundesrat hat stets betont, einschneidende Massnahmen wie eine Ausgangssperre passten nicht zur Strategie der Schweiz.
FFP2-MaskenpflichtIn Bayern gilt in Läden sowie im öffentlichen Verkehr eine FFP2-Maskenpflicht. Die Schweiz geht hier weniger weit: Vorgeschrieben ist nur eine Hygienemaske. Auch beim Spitalpersonal sind Hygienemasken weiterhin meist die Norm, obwohl einige Spitäler bereits auf FFP2-Standard umgeschwenkt haben. Die Taskforce des Bundes begründet die Empfehlung für Hygienemasken damit, dass viele FFP2-Masken falsch tragen würden und somit der Schutz nicht gewährleistet sei.
Homeoffice
Derzeit besteht die Homeoffice-Pflicht für alle Arbeitnehmenden, bei denen dies «aufgrund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist». Diese Regelung lässt einen gewissen Spielraum, was sich auch darin zeigt, dass die Mobilität der Bevölkerung nicht so stark zurückgegangen ist wie noch im ersten Lockdown. Auch hier könnte der Bundesrat noch verschärfen – jedoch wehrte sich ein Teil der Wirtschaft bereits gegen die aktuelle Regelung.
Kein Verständnis für weitere Verschärfungs-Ideen hat FDP-Nationalrat Marcel Dobler.
«Alle Zahlen sinken. Auch der der R-Wert wurde nach unten korrigiert», sagt er. Verschärfungen seien inakzeptabel. «Im Gegenteil: Läden sollen geöffnet werden, für deren Schliessung gibt es keine Evidenz.» Dobler kritisiert, dass jetzt der Lockdown verlängert werden soll, weil «man das mit dem Impfen halt nicht so gut hingekriegt hat».
Zur Gefahr der Mutationen sagt er: «Sollten tatsächlich die Infektionen wieder stark zunehmen, kann man Massnahmen prüfen. Da kantonal die Situation sehr unterschiedlich ist, gehört die Kompetenz bei diesen Zahlen zurück zu den Kantonen.» Sicher sei, dass aktuell weitergehende Massnahmen auf grossen Widerstand stossen würden, sagt Dobler. «In meinem Umfeld kann niemand den Bundesrat verstehen.» Schreibt 20Minuten.
Der tägliche Corona-Irrsinn mit den unsäglichen Prognosen; formuliert im Konjunktiv. Mit «könnte» und «würde» dürfen die unseligen Experten so ziemlich alles behaupten, ohne je dafür Rechenschaft ablegen zu müssen. Erinnert stark an das Orakel von Delphi. Oder die «heiligen» Bücher, die der Menschheit ein Paradies oder die Hölle im Jenseits versprechen, ohne je einen Beweis für deren Existenz geliefert zu haben.
Ich persönlich schlage vor (kein Konjunktiv!), dass der Bundesrat, allen voran Alain Berserker, als Verschärfung für kommende Lockdown-Massnahmen als erstes den Konjunktiv verbietet. Clickbaiting der – auch vor Corona schon serbelnden – Medien hin oder her.
Als zweite Massnahme ist die Unterstützung aus der Bundesgiesskanne für «Medienprodukte ohne Zukunft» einzustellen. Die eingesparten Millionen sind notleidenden Unternehmen der Gastro- und Kulturszene zur Verfügung stellen.
Wer braucht denn heute beispielsweise noch eine gedruckte Version der Pendlerzeitung «20Minuten», die dem TAMEDIA-Verlag ohnehin kein Clickbaiting liefert, dafür aber der Umwelt Tonnen von Papiermüll beschert? Niemand!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.2.2021 - Tag der Komplexe
Fux über Sex: «Sie lachten wegen meines Penis»
Ich mache mir Sorgen, weil ich befürchte, einen zu kleinen Penis zu haben, um eine Beziehung zu haben und bei Frauen anzukommen. Ich wurde schon öfters ausgelacht von Personen, die meinen Penis gesehen haben. Mir ist überhaupt nicht mehr wohl in meiner Haut, und ich weiss nicht, was ich machen soll. L. (20, m)
Lieber L.
Viele Männer haben Angst, dass ihr Penis für guten Sex zu klein ist. In den allermeisten Fällen ist das aber nicht mal im Ansatz der Fall. Guter Sex hat nämlich vor allem mit lernbaren Fähigkeiten und einem positiven Verhältnis zum eigenen Körper zu tun.
Zweifel zur Penisgrösse kommen oft daher, dass viele Männer andere erigierte Penisse nur in Pornos sehen. Aber die Penisse dort mit dem eigenen zu vergleichen, ist, wie wenn man Formel 1 schaut und dann denkt, das eigene Auto sei zu langsam.
Es wäre wichtig zu wissen, warum du glaubst, dass dein Penis zu klein ist, und was in diesen schlimmen Momenten passiert ist, als du ausgelacht wurdest. Denn die Chance ist gross, dass es dort ganz einfach darum ging, dir wehzutun, und dass das wenig mit dir und deinem Körper zu tun hatte.
Der wichtigste Schritt ist nun, dass du dich mit deinem Penis wieder wohl fühlen kannst. Denn das wird sich auch in deinem Austausch mit Frauen zeigen. Die allermeisten Frauen suchen nämlich keinen Mann mit einem besonders grossen Penis, sondern einen, mit dem sie Lust, Intimität und einfach auch etwas Besonderes teilen können.
Dein Penis gehört genau wie der Rest deines Körpers zu dir, und ihr seid im Abenteuer Sexualität gemeinsam unterwegs. Verbessere deine Beziehung zu ihm, indem du ihn täglich pflegst und zum Beispiel unter der Dusche berührst und erkundest. Bilde dich durch Podcasts, Bücher oder sogar eine Beratung weiter, um Falschwissen abzulegen und neue Kompetenzen hinzuzulernen.
Auch wenn man sie suchen muss: Es gibt beim Boulevardblättli von der Zürcher Dufourstrasse tatsächlich noch Artikel jenseits des hysterischen Corona-Wahnsinns.
Der guten Frau Fux sei Dank, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert: Mir ist sowas wie der bemitleidenswerte L. es in seinem Hilferuf an die Zürcher Sexualberaterin schildert, noch nie passiert, weil bisher allen stets das Lachen im Halse stecken blieb.
Sollte das jetzt etwas zu starker Tobak für Sie sein, zögern Sie nicht und lesen Sie mir die Leviten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.2.2021 - Tag der Ungläubigen
Bund will «Emir» aus Waadtland den Schweizer Pass entziehen
Der kürzlich in Paris zu 15 Jahren Haft verurteilte Schweizer «Emir» zählt zur Liste jener Doppelbürger unter Terrorismusverdacht, denen das Staatssekretariat für Migration SEM die Schweizer Staatsbürgerschaft entziehen will. Das ergaben Recherchen von SRF News.
Der heute 31-jährige wurde Mitte Januar wegen angeblicher Vorbereitungen von Terroranschlägen in Frankreich und der Schweiz schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sobald die Rechtskraft eintritt, will das SEM offenbar umgehend das Verfahren starten.
Rekurs möglich
Der schweizerisch-bosnische Doppelbürger könnte sich juristisch gegen den angestrebten Bürgerrechts-Entzug zur Wehr setzen, das Bundesverwaltungsgericht müsste darüber entscheiden.
Seit seiner Verhaftung im November 2017 sitzt M. in französischen Haftanstalten – und in die Schweiz soll er auch nach Verbüssen seiner Strafe nicht zurückkehren. Das scheint die Absicht der Schweizer Behörden zu sein, wie Recherchen von Radio RTS und SRF News ergaben.
Zu Einzelfällen will sich das Staatssekretariat für Migration (SEM) nicht äussern, doch bestätigen mehrere Quellen, dass die Behörde das Verfahren zum Entzug der Schweizer Staatsbürgerschaft so weit vorbereitet habe, dass es sofort nach Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils in Frankreich eröffnet werden könne.
Gegen einen SEM-Entscheid könnte M. Rekurs einlegen. Unterliegt der schweizerisch-bosnische Doppelbürger, so würde sogleich der nächste Schritt folgen: Ein Einreiseverbot für das Schweizer Territorium oder gar den gesamten Schengen-Raum durch das Bundesamt für Polizei Fedpol. Auch dort laufen entsprechende Vorbereitungen offenbar bereits.
Teilstrafe soll in der Schweiz verbüsst werden
Grundsätzlich möglich wäre eine Rückkehr des erstinstanzlich verurteilten «Emirs» M. in die Schweiz nach Absitzen der auf 15 Jahre festgelegten Haftstrafe in Frankreich. Dann müsste er Frankreich umgehend verlassen, denn das Gericht in Paris hat den Mann auch mit einem Verbot zum Betreten des französischen Territoriums belegt.
Seine französischen Anwältinnen streben zwar an, dass M. zumindest einen Teil seines Strafvollzugs hierzulande absitzen kann. Damit würde er schon früher in die Schweiz zurückkehren, wenn auch in eine Strafvollzuganstalt. Einer solchen Überstellung müssten aber beide Staaten zustimmen, was derzeit fraglich scheint. Dies auch, weil das Gericht in Paris zwei Drittel der Strafe als Sicherheitshaft festgelegt hat, und während dieser Zeit scheint eine Überstellung in die Schweiz nach französischem Recht nicht möglich.
So scheint derzeit der wahrscheinlichste Verlauf zu sein, dass M. bis auf Weiteres in einem französischen Gefängnis bleibt. Setzen sich die Schweizer Behörden durch und entziehen ihm rechtskräftig das Bürgerrecht und setzen anschliessend eine Einreisesperre fest, so bliebe den französischen Behörden dereinst nur eines: M., dem noch die bosnische Staatsbürgerschaft bliebe, nach Verbüssen seiner Haftstrafe nach Bosnien-Herzegowina auszuschaffen.
Mehrere Fälle hängig
Der angestrebte Bürgerrechts-Entzug im Fall M. reiht sich ein in mehrere Verfahren, die das SEM gestartet hat: Ein erster Fall ist rechtskräftig, betroffen ist eine Frau aus Genf, die ihre Kinder ins IS-Territorium entführt hatte und die heute mit ihren Kindern in einem Camp im Nordosten Syriens interniert ist. Der Bürgerrechts-Entzug war rechtskräftig geworden, nachdem die Frau auf einen Rekurs verzichtet hatte. Ein weiteres Verfahren läuft gegen einen IS-Anhänger aus dem Tessin, es ist vor Bundesstrafgericht hängig – das wäre der erste Fall, der von einem Schweizer Gericht beurteilt würde.
Das SEM hat zudem weitere Entzugsverfahren eingeleitet, so gegen einen Dschihadisten aus Arbon, ein Schweizerisch-Türkischer Doppelbürger, der in der Türkei inhaftiert ist. Das gab das SEM diese Woche im Bundesblatt bekannt, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Rund ein Dutzend weitere Fälle würden geprüft, teilet das SEM heute mit.
Wieso seine muslimische Eminenz, der (vermutlich) selbsternannte «Emir», überhaupt die schweizerisch-bosnische Doppelbürgerschaft besitzt, wird im SRF-Artikel nicht thematisiert. Ist auch besser so. Das könnte ja gewisse Fragen bezüglich der Doppelbürgerschaften auslösen.
In einem früheren Artikel schreibt SRF über die «Obsession» des Emirs, «Ungläubige» töten zu wollen. Er äusserte seine Gewaltfantasien gemäss den (Gerichts-) Akten auch gegenüber seiner Frau. So habe er zu ihr gesagt: «Wer sich über die Religion lustig macht, hat es verdient, dass man ihm den Kopf abschneidet.» Und weiter: Einen Anschlag mittels eines Fahrzeugs oder mit Messern halte er für zu schwach, nötig wären Sturmgewehre, die er angeblich besorgen wollte. Vorbild müssten die Anschläge vom 13. November 2015 in Paris sein.
Sei's drum: Die Schweiz sollte dem islamistischen Emir eine Rückkehr nach Bosnien ermöglichen. Wenn nötig mit einem finanziellen Zückerchen. Auf dem Balkan, der inzwischen von den saudischen Salafisten und der Türkei mit unzähligen Moscheen als grossartige Hilfe für die Balkanstaaten mit den höchsten Arbeitslosenzahlen (Jugendlicher) Europas aufgerüstet wurde, kann er seine martialischen Träume ausleben. Angefangen bei der Scharia bis hin zur Halal-gerechten Tötung Ungläubiger mit dem Schlachtruf (Schlachter-Ruf?) «Allahu akbar». So wie es im Koran geschrieben steht.
Es ist allerdings zu befürchten, dass sich in der Schweiz genügend Leute finden lassen, die mit Demonstrationen und dem üblichen Hinweis auf die «traumatisierte» Kindheit des Emirs, eine allfällige Ausschaffung bekämpfen werden.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.2.2021 - Tag der Sensibilisierungskampagnen
Konsumenten-Gruppe wird jünger – Expertin ist besorgt: Luzerner Jugendliche nehmen während Corona vermehrt Drogen und Xanax
Alkohol, Cannabis oder eine Xanax-Pille: Jugendliche greifen während Corona vermehrt auf Drogen und Medikamente zurück. Eine Luzerner Beraterin ist besorgt, da die Zielgruppe immer jünger wird. Für die Konsumentinnen ist es ein Spiel – das sehr gefährlich enden kann.
«Das ist unser soziales Leben, das geopfert wird» – diese Worte zierten jüngst einen Aushang, gesichtet in einem Luzerner Schulhaus (zentralplus berichtete).
Jugendliche fühlen sich während der Pandemie im Stich gelassen, gefangen in ihren eigenen vier Wänden. Sie dürfen nicht mehr feiern, reisen und auch das Daten ist schwierig. Um sich einen Kick zu verschaffen, konsumieren Jugendliche vermehrt Drogen oder Medikamente wie Xanax, sagt Sibylle Theiler. Sie ist Jugend- und Familienberaterin bei der Jufa – der Fachstelle für Jugend und Familie in Ebikon. Die Sozialarbeiterin berät Jugendliche aus dem ganzen Rontal.
zentralplus: Sibylle Theiler, Jugendpsychiatrien haben bereits gewarnt, dass Jugendliche in der Pandemie vermehrt auf Drogen zurückgreifen. Nehmen Sie diese Entwicklung nun auch im Rontal wahr?
Sibylle Theiler: Ja, der Drogen- und Medikamentenkonsum beschäftigt auch die Jufa. In den Beratungen begleiten wir seit Corona ungefähr zehn Jugendliche in diesem Zusammenhang. Es sind glücklicherweise immer noch Einzelfälle – doch sie nehmen zu. Beängstigend ist, dass die Zielgruppe – ab 12 Jahren – immer jünger wird.
zentralplus: Wie geht es den Betroffenen?
Theiler: Wir begegnen Jugendlichen, die einfach nichts mehr fühlen wollen. Teenager mit depressiven Verstimmungen, ohne Orientierung oder Zukunftsperspektiven. Häufig konsumieren die Betroffenen an den Wochenenden Ecstasy oder MDMA. Um dann herunterzukommen und wieder schlafen zu können, schlucken sie eine Xanax-Pille. Ein Teufelskreis. Gerade der Mischkonsum mit Medikamenten, Ampethaminen und Benzodiazepinen ist besonders gefährlich.
zentralplus: Letztes Jahr wurden einige schockierende Fälle publik, von Jugendlichen, die am Mischkonsum gestorben sind. In Luzern sind mindestens vier Jugendliche gestorben. In Zürich starben zwei 15-Jährige an den Folgen einer Medikamenten-Überdosis. Schrecken diese tragischen Ereignisse die Jugendlichen denn nicht ab?
Theiler: Ich hatte eine junge Frau bei mir, welche die beiden verstorbenen Jugendlichen aus Zürich gekannt hatte. Sie trauerte um sie. Doch sie realisierte nicht, dass sie sich mit ihrem eigenen Drogen- und Medikamentenkonsum genau dem gleichen Risiko aussetzt. Es gibt Jugendliche, die sich während der Pandemiezeit mit Drogen einen Kick verschaffen. Für sie ist es ein Spiel.
zentralplus: Ein Spiel mit dem Leben? Das hört sich schockierend an.
Theiler: Jugendliche sind risikobereiter als Erwachsene, dafür ist die hormonelle Veränderung im Hirn während der Pubertät verantwortlich. Dadurch werden Jugendliche risikofreudiger und loten ihre eigenen Grenzen immer wieder neu aus.
zentralplus: Worin sehen Sie mögliche Gründe, dass Jugendliche diese Medikamente verharmlosen?
Theiler: Ich glaube weniger, dass die Situation verharmlost, sondern vielmehr total unterschätzt wird. Xanax ist nicht ohne Grund ein verschreibungspflichtiges Medikament. Die Hip-Hop-Szene spielt sicherlich auch eine Rolle. Zahlreiche Rapsongs handeln von Medikamenten wie Xanax, was den Eindruck erweckt, solche Tabletten zu nehmen, sei normal. Andere Jugendliche erzählten mir von bestimmten Netflix-Serien, in denen Drogen konsumiert, verkauft oder hergestellt werden. Solche Bilder lösen etwas aus – gerade bei Jugendlichen in einer labilen Situation.
zentralplus: Warum greifen Jugendliche in Krisenzeiten vermehrt auf Drogen und Medikamente zurück?
Theiler: Früher haben sie sich mit Konzerten, Reisen, Sport, Partys, Kinobesuchen oder Treffen mit Freunden abgelenkt. Jetzt sind die sozialen Kontakte zu Peers (Ihresgleichen), die für sie überlebenswichtig sind, eingeschränkt. Ihr Leben ist in die eigenen vier Wände zurückverlegt. Es liegt in der Natur der Jugendlichen, dass sie raus wollen, um gemeinsam mit ihren Peers ihre eigene Identität formen zu können. Können diese natürlichen Entwicklungsschritte nicht gemacht und die Erfahrungen nicht gesammelt werden, kann der Ausweg in die Drogen wie ein Ventil wirken.
zentralplus: Also versuchen Jugendliche, das Rebellische auf andere Arten auszudrücken und greifen deswegen auf Drogen zurück?
Theiler: Manche Jugendliche bestimmt. Kinder und Jugendliche sind aber extrem anpassungsfähig. Die grosse Mehrheit hält sich vorbildlich an die verordneten Regeln und ist solidarisch. Das Coronavirus stellt ihren Alltag auf den Kopf, dabei brauchen sie sich selbst kaum vor dem Virus zu fürchten. Normalerweise würden sie sich diesen Kick im ganz «normalen» Wahnsinn aus dem Alltag holen.
zentralplus: Was sind das für Jugendliche, die Drogen und Medikamente nehmen?
Theiler: Die meisten befinden sich in schwierigen Familiensituationen. Die Eltern arbeiten beispielsweise im niedrigen Lohnbereich. Wegen Corona haben sie Zukunftsängste, sie können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Oder Wohlstandsverwahrlosung – Eltern, die mit sich und ihrer Karriere beschäftigt sind, nur wenig zu Hause sind. Es findet kaum ein Austausch statt, die Kinder sind auf sich alleine gestellt. Oder es herrscht ein Rosenkrieg zwischen den Eltern, eine lieblose und kalte Atmosphäre in der Familie. Andere Jugendliche wachsen in armutsbetroffenen Familien auf, die auf engstem Raum zurechtkommen müssen. Mit Xanax vergessen einige Jugendliche alles rund herum. Es hilft auszuhalten, was man sonst nicht ertragen würde. Auf einmal ist es egal, wenn man alleine zu Hause im Zimmer sitzt und sich nur noch im virtuellen Leben bewegen darf.
zentralplus: Wie reagieren Sie, um gegen diese Entwicklung vorzugehen?
Theiler: Uns bereitet die Entwicklung grosse Sorgen. Wir sind wach. Wir haben uns mit der Kriminalpolizei und anderen Fachgruppen vernetzt und haben im März einen Fachaustausch mit Schulleitungen aus dem Rontal geplant zum Thema Jugend und Drogen. Zudem werden wir zum Thema auch Elternabende durchführen.
zentralplus: Was können Eltern tun, wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Kind etwas konsumieren könnte?
Theiler: Am besten ist es, wenn Eltern ihre Beobachtungen ausdrücken und ansprechen, was sie irritiert. Und dann unbedingt Rückfragen stellen, wie es die Kinder wahrnehmen. Wichtig ist, niemals mit Beschuldigungen auf das Gegenüber einzugehen. Wenn Jugendliche das Gefühl haben, verurteilt zu werden, werden sie abblocken. Es braucht Vertrauen, ein vorsichtiges Herantasten. Eltern, die Medikamente oder Drogen finden, sollten unbedingt die Hilfe von Fachpersonen in Anspruch nehmen, um gemeinsam mit diesen das weitere Vorgehen und die Intervention zu besprechen. Schreibt ZentralPlus.
Ein sehr gutes Interview, das ZentralPlus mit der Sozialarbeiterin Sibylle Theiler führte. Keine Frage. Doch die Luzerner Drogenmisere nun mehr oder weniger allein auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, ist viel zu kurz gesprungen und absolut falsch.
Die Stadt Luzern ist nicht erst seit Beginn der Corona-Krise hinter der Stadt Zürich der Drogenhotspot Nummer Zwei der Schweiz. Und auch die 50 (!) Lehrlinge und Schüler, die an Luzerner Schulen einen grossangelegten Drogenhandel betrieben, wurden bereits im Herbst 2019 verhaftet.
Dass die sozialen Kontakte der Jugendlichen innerhalb ihrer Gruppen (lächerlicherweise im Interview «Peers» genannt) wegen Corona nicht mehr stattfinden können, ist ebenso falsch. Frau Theiler sollte mal am späteren Nachmittag oder am Abend über den Luzerner Europaplatz, das Inseli oder die Aufschütti flanieren. Da würde sie nicht nur ihre Klientel, die jugendlichen Drogenschätzchen, antreffen, sondern in trauter Gemeinsamkeit auch deren «Peers», die sich aus den üblichen Verdächtigen der Luzerner Dealer-Szene, Randständigen, Club- und Disco-Türstehern aus dem Balkan und drogensüchtigen Asylanten zusammensetzt. Nicht zu vergessen, die paar gierig lauernden Schwuchteln, die für eine kleine sexuelle Gefälligkeit auf der Inseli-Toilette den nächsten Sniff für diejenigen finanzieren, bei denen gerade Ebbe im Portemonnaie herrscht. Was besonders bei jungen Asylanten nicht selten der Fall ist.
Die Luzerner Stadtreiniger dürfen dann um Mitternacht oder in aller Herrgottsfrühe am nächsten Morgen die Müllberge der Alkoholflaschenund ALU-Dosen entsorgen. Denn wo die Droge herrscht, sind auch Alkohol und Müll nicht fern. Damit wir uns richtig verstehen: ich rede nicht von Kirschstängeli sondern von harten Alkoholikas wie Vodka, Whisky etc., die den erschreckend jungen Menschen als Verstärker im Nirwana der unendlichen Träume dienen.
Zweifellos hat die Corona-Pandemie einen gewissen Einfluss auf die Luzerner Drogen-Szene. Clubs und Nachtclubs sind geschlossen. Aber anders als beim ersten Lockdown 2020 sind diesmal die üblichen Lieferketten (Spanien, Balkan, allen voran Albanien und Kosovo, Italien, Holland) für Drogen und halluzinierende Substanzen aller Art nicht unterbrochen. Der Nachschub funktioniert in der zweiten Lockdown-Phase 2021 wie geschmiert, selbst für die Billig-Droge Crystal Meth, die sich inzwischen in Form von Pusteln auf der Stirn von erstaunlich vielen jungen Drogenkonsumenten widerspiegelt und beileibe nicht der Pubertät zuzuschreiben sind. Erstaunlicherweise verliert Frau Steiner über diese teuflisch und in Luzern stark verbreitete Droge ausser «MDMA» kein Wort, was leider ein wenig an ihrer Kompetenz bezüglich Hardcore-Drogen zweifeln lässt.
Dass sich unter all diesen glückseligmachenden Präparaten auch verunreinigte finden lassen, die zu einigen Todesopfern führten, war ebenfalls lange vor Corona schon der Fall. Die Stadt Luzern hat ja nicht umsonst eine Drogentest-Stelle eingerichtet.
Wer Schuldige für die Luzerner Drogen-Katastrophe sucht, die sich gravierend auf die Zukunft auswirken wird, kommt am Versagen der Luzerner Stadtregierung nicht vorbei. Die übliche Methode des Luzerner Stadtrats, Probleme mit «Sensibilisierungskampagnen» und einfältigem Toleranzgesäusel statt «Zero Tolerance» zu lösen, hilft da nicht weiter. Kampagnen wie «Luzern glänzt» haben das Luzerner Müll-Problem nicht nur nicht gelöst, sondern im Sommer 2020 sogar noch eklatant verschärft.
Solche Kampagnen sind eher ein Zeichen politischer Hilflosigkeit, um nicht zu sagen politischer Dummheit. Ohne Blick auf die Zukunft. Die Dealer lachen sich einen Schranz in den Bauch und die Luzerner Stadtpolizei gibt sich dem Frust und den Parkbussen hin.
Aus einem seriösen Umfeld erreichte mich folgender Kommentar eines besorgten Luzerner Bürgers: «Als ich mal die Luzerner Polizei anrief, dass da direkt vor mir Koks, Sugar und Crack den Halter wechseln, hiess es «das gehört halt zu einer Stadt, wissen Sie. Da können wir nichts machen. Und nein, wir können nicht vorbeikommen.»
Napoleon hätte diese Aussage der Luzerner Polizei als «Kapitulation vor dem Feind» bezeichnet. Und wie soft, hätte der Franzose damit sogar recht.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.2.2021 - Tag der Umerziehung
Berichte über Vergewaltigungen in Uiguren-Lagern in China
Ein BBC-Bericht stützt sich auf Aussagen von Ex-Insassinnen und einem Aufseher. Indes mehren sich Forderungen nach einem Boykott der Olympischen Spiele in Peking 2022.
Ein BBC-Bericht vom Dienstag hat weitere Informationen über Missbrauch und Vergewaltigungen in Umerziehungslagern für muslimische Uiguren in der nordwestlichen Region Xinjiang ans Tageslicht gebracht. Laut der BBC werden Frauen in den Lagern "systematisch vergewaltigt, sexuell missbraucht und gefoltert". Der Bericht stützt sich auf Aussagen mehrerer früherer Insassinnen und eines Aufsehers. Eine Uigurin schilderte, wie sie in einem Lager im Kreis Xinyuan gefoltert und wiederholt von mehreren chinesischen Männern vergewaltigt worden sei.
Eine Kasachin aus Xinjiang schilderte laut BBC, wie sie als Insassin uigurische Frauen entkleiden und ihnen Handschellen anlegen musste, bevor sie mit Männern zusammengebracht worden seien. Die Chinesen hätten bezahlt, um sich hübsche Uigurinnen aussuchen zu können. Auch Lehrerinnen, die in Lagern Chinesisch unterrichten mussten, berichteten von Schilderungen von Insassinnen über Vergewaltigungen.
Peking hat die Zeugenaussagen am Mittwoch als unwahr zurückgewiesen. Chinas Außenministeriumssprecher Wang Wenbin sagte, die Vorwürfe der interviewten Frauen beruhten nicht auf Tatsachen: "Es sind nur Schauspieler, die falsche Nachrichten verbreiten."
Millionen Uiguren sollen umerzogen werden
Nach Schätzungen von Menschenrechtlern leben hunderttausende Uiguren in Umerziehungslagern, die Peking als "Fortbildungseinrichtungen" beschreibt. Manche Menschenrechtsorganisationen und Forscher gehen davon aus, dass mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in Lagern eingesperrt wurden. Sie werden demnach zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen und teilweise auch misshandelt. US-Präsident Joe Biden sprach vor seiner Wahl von "Völkermord", auch der neue US-Außenminister Antony Blinken sagte bei seiner ersten Pressekonferenz im Amt, er sei der Meinung, dass ein Genozid an den Uiguren begangen werde. Auch sein Vorgänger Mike Pompeo hatte einen Tag vor seinem Ausscheiden aus dem Amt formal festgelegt, "dass die Volksrepublik China in Xinjiang, China, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, die sich gegen uigurische Muslime und Angehörige anderer ethnischer und religiöser Minderheitengruppen richten".
Schätzungsweise zehn Millionen Uiguren leben in China, die meisten in Xinjiang. Das muslimische Turkvolk fühlt sich von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Nach ihrer Machtübernahme 1949 hatten die Kommunisten das frühere Ostturkestan der Volksrepublik einverleibt. Die Regierung wirft uigurischen Gruppen Separatismus und Terrorismus vor.
Gerüchte über Boykott
Das Vorgehen der Regierung gegen die Uiguren sowie auch gegen Tibeter und die Oppositionsbewegung in Hongkong befeuert Gerüchte über einen möglichen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 durch den Westen. Diese sollen in genau einem Jahr in Peking stattfinden. Laut "Wirtschaftswoche" soll die US-Regierung diesbezüglich Überlegungen hegen. "Berater von Biden fühlen aktuell bei europäischen Regierungen vor, ob sie den Boykott mittragen würden", heißt es in der "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Diplomaten.
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, bestätigte die Gerüchte nicht. Sie könne "keine Änderung der Herangehensweise an die Olympischen Spiele in Peking" verkünden. Auch in den europäischen Hauptstädten gab es bisher keine Reaktionen auf die Spekulation.
Protest gegen Menschenrechtsverletzungen
Ein Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erklärte auf Anfrage der deutschen Sportnachrichtenagentur, dass man Spekulationen nicht kommentieren werde. Zuvor hatte IOC-Präsident Thomas Bach bereits versucht, Zuversicht zu verbreiten. "Wir können bereits ein Jahr zuvor sagen, dass alle Wettkampfstätten fertig sind, die Vorbereitungen sind exzellent", sagte Bach Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua. Es sei "fast ein Wunder", dass die Vorbereitungen trotz der Pandemie so glatt liefen.
Bereits im September hatten 160 Menschenrechtsgruppen den IOC-Präsidenten aufgefordert, Peking die Spiele zu entziehen – aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die dortigen Sommerspiele 2008 das chinesische Regime international aufgewertet hätten. "Die Spiele 2022 werden unter Menschenrechtsbedingungen stattfinden, die signifikant schlechter sind als bei den Spielen in Peking 2008", schrieb die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) Mitte Dezember in einem offenen Brief an Bach. Das IOC habe "die Augen vor den weitverbreiteten und systematischen Menschenrechtsverletzungen durch die chinesischen Behörden verschlossen", hieß es in einem weiteren Brief von mehreren Menschenrechtsgruppen, die Tibeter, Uiguren und andere Gruppen aus Hongkong vertreten. Sie forderten das IOC auf, Belege dafür vorzulegen, dass China sich an die Pflicht zur Einhaltung der Menschenrechte hält, die es bei der Vergabe der Spiele 2015 eingegangen ist.
Das chinesische Außenministerium reagierte umgehend und bezeichnete die "politisch motivierten" Aufrufe als "unverantwortlich". Die Spiele würden ein "wunderbares und herausragendes Ereignis" werden. Ein Boykott, da ist sich Sprecher Wang Wenbin sicher, "wird von der internationalen Gemeinschaft nicht unterstützt". Schreibt DER STANDARD.
Jede Medaille hat zwei Seiten. Es wird in den westlichen Medien viel über China und die «Umerziehungslager» der Uiguren geschrieben, seit das «Land der Mitte» zur Weltmacht aufgestiegen ist. Weniger liest man über die islamistischen Anschläge von fanatischen Muslimen, die im Namen Allahs ihre blutigen Spuren in den chinesischen Städten hinterlassen.
https://de.wikipedia.org/.../Liste_von_Terroranschl%C3...
Über die chinesischen Massnahmen gegen die Terrorgewalt der Uiguren kann man geteilter Meinung sein. Dass sich China die islamistischen Allah uakbar-Gemetzel auf die Dauer nicht gefallen lässt, war anzunehmen. Da hilft den Uiguren auch der fanatische Sultan Erdogan nicht weiter. Der sunnitische Machtpolitiker vom Bosporus ist wie der Westen auf China angewiesen. Entsprechend hält er sich auch mit Kritik gegen China zurück. Und schickt sogar uigurische Flüchtlinge, die in der Türkei gelandet sind, return to China. Der Onkel aller sunnitischen Muslime*innen ist sich eben der «Sprengkarft» seiner Glaubensbrüder*schwestern sehr wohl bewusst.
Dass die «westliche Wertegemeinschaft» die Olympischen Winterspiele 2022 in China boykottieren könnte, ist nicht anzunehmen. Zu gross ist die wirtschaftliche Abhängigkeit des Westens von China und die IOC-Funktionäre würden ihre Schmiergelder wohl auch nicht allzu gerne zurückgeben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
3.2.2021 - Tag von SPUTNIK V
Russischer Corona-Impfstoff zeigt Wirksamkeit von 91,6 Prozent
Schon vor einem halben Jahr ließ Russland einen Corona-Impfstoff zu – ohne vertrauenswürdige Daten. Nun wurde eine Studie unabhängig geprüft: Sputnik V zeigt darin eine überzeugende Wirksamkeit.
Der Name »Sputnik V« stand bis vor einem halben Jahr für ein legendäres Raumfahrtprogramm der Sowjetunion. Dann kam die Pandemie und Russland beschloss, auch seinem gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 entwickelten Impfstoff die eingängige Bezeichnung zu verleihen. Seitdem steht Sputnik V bei vielen Wissenschaftlern jedoch vor allem für Intransparenz, Misstrauen und fragwürdige Studiendaten.
Bereits Mitte August 2020 – andere Impfstoffentwickler starteten da gerade ihre klinischen Studien – präsentierte das staatliche Gamaleja-Forschungszentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie in Russland seinen Impfstoff mit dem offiziellen Namen Gam-COVID-Vac und sprach ihm eine hohe Wirksamkeit zu. Umgehend ließ Russland das Präparat im Eilverfahren zu – als weltweit ersten Corona-Impfstoff. Rund einen Monat später wurden Auffälligkeiten in der ohnehin dünnen Datenlage bekannt.
Dennoch hat Russland angeblich bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen mit der Vakzine geimpft. Selbstbewusst kündigte der Kreml darüber hinaus an, die EU im zweiten Quartal mit 100 Millionen Dosen versorgen zu können. Ob das realistisch ist, sei dahingestellt. Beim Streit über Lieferengpässe in der EU kämen ein paar Extra-Impfstoffdosen sicherlich gelegen. Dem MDR zufolge prüft Russland bereits die Produktionsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt, beim Pharmahersteller IDT Biologika.
Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich jedenfalls nicht komplett abgeneigt: Der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« sagte er, man sei auch offen für Impfstoffe aus Russland oder China, wenn sie von der Europäischen Arzneimittelbehörde (Ema) zugelassen worden seien. Einen entsprechenden Zulassungsantrag hatte Russland Ende Januar eingereicht.
91,6 Prozent Wirksamkeit
Die Ema benötigt dafür jedoch sorgfältig erhobene Studiendaten. Nun, rund ein halbes Jahr nach der Notfallzulassung in Russland, gibt es erstmals solche Daten. Im Fachblatt »The Lancet« erschienen erste Zwischenergebnisse einer klinischen Phase-III-Studie von Gam-COVID-Vac. Diese ergaben, dass der Impfstoff eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent gegen einen symptomatischen Verlauf von Covid-19 aufweist. Für die Studie wurden Daten von rund 20.000 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern ausgewertet.
Die Veröffentlichung im »Lancet« kann nun als erster Vertrauensbeweis gewertet werden. Denn die Zwischenergebnisse sind »peer reviewed«, also von unabhängigen Expertinnen und Experten geprüft.
Im Gegensatz zu den mRNA-Präparaten von Biontech und Moderna handelt es sich bei Sputnik V um einen Vektorimpfstoff. Die Vakzine wird also in einer speziellen Transporthülle, einem harmlosen Adenovirus, verabreicht. In diese Impfviren werden Erbgutstücke von dem Erreger eingebaut, gegen den man impfen will. Das ist zwar eine lange erprobte Technik, jedoch kann der Körper gegen die Transporthülle immun werden.
Um das zu verhindern, nutzen die russischen Forscher zwei unterschiedliche Vektoren für die zwei Impfdosen: Für die erste Dosis sei den Teilnehmern ein Adenovirus mit der Bezeichnung rAd26 geimpft worden. Die zweite Dosis folgt im Abstand von 21 Tagen und beinhaltet den Adenovirus rAd5. Den Autoren zufolge führe das zu einer stärkeren Immunantwort, als zweimal denselben Vektor zu nutzen: Es minimiere das Risiko von Resistenzen.
Auch der seit Kurzem in der EU zugelassene Impfstoff von AstraZeneca ist ein Vektorimpfstoff. Er erreichte in Studien jedoch nur eine Wirksamkeit von 70 Prozent, ausreichende Daten zu Personen über 65 Jahren fehlen noch. Daher empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) den AstraZeneca-Impfstoff vorerst nicht für die ältere Bevölkerungsgruppe. Der Sputnik-V-Impfstoff zeigte den Zwischenergebnissen zufolge nun in der Gruppe der über 60-Jährigen (2144 Probandinnen und Probanden) eine ebenfalls hohe Wirksamkeit von 91,8 Prozent.
Vektorimpfstoffe können besser gelagert werden
Die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna zeigten sich ebenfalls hochwirksam gegen schwere Verläufe von Covid-19, auch bei Älteren. Sie haben dennoch einen großen Nachteil: Sie müssen tiefgekühlt gelagert werden, was Transport und Aufbewahrung schwierig macht. Vektorimpfstoffe hingegen halten sich auch bei Temperaturen von zwei bis acht Grad Celsius und können damit in handelsüblichen Kühlschränken gelagert werden.
In der klinischen Phase-III-Studie für Sputnik V wurden rund drei Viertel der 20.000 Probandinnen und Probanden über 18 Jahren mit dem Impfstoff geimpft. Ein Viertel war in der Placebogruppe. Die Studie fand an 25 Kliniken in Moskau statt.
Die bisherigen Ergebnisse zeigten, dass sich in der Impfstoffgruppe 21 Tage nach der ersten Dosis 16 Menschen (0,1 Prozent) mit Sars-CoV-2 infiziert und Symptome entwickelt haben. In der Placebogruppe waren es 62 Menschen (1,3 Prozent).
Die Autoren merken an, dass Covid-19-Fälle während der Studie nur entdeckt wurden, wenn die Teilnehmer selbst Symptome gemeldet hätten. Per PCR-Test wurde dann getestet, ob es sich tatsächlich um eine Infektion mit dem Coronavirus oder eine andere Erkältungskrankheit handelte.
Milde Nebenwirkungen
In der Impfstoffgruppe seien keine ernsthaften Nebenwirkungen aufgetreten, heißt es in der »Lancet«-Veröffentlichung. Bei den meisten gemeldeten Nebenwirkungen (94 Prozent) habe es sich um milde Beschwerden wie etwa Grippe-ähnliche Symptome, Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit gehandelt.
Vier Menschen seien während der Studie gestorben, die Fälle konnten jedoch nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden. Drei der Todesfälle habe es in der Impfstoffgruppe gegeben. Eine dieser Personen sei an den Folgen eines Knochenbruchs gestorben. Die zwei anderen hätten Vorerkrankungen gehabt und seien an Covid-19 erkrankt gewesen. Den Studienautoren zufolge hätten sie sich jedoch bereits vor der Impfung infiziert.
Bei einer Stichprobe von 342 Probandinnen wurde den Daten zufolge bei der großen Mehrheit eine robuste Immunantwort nachgewiesen, sie entwickelten sowohl Antikörper gegen Sars-CoV-2 als auch T-Zellen. Sechs Teilnehmer hätten nach der Impfung keine Immunantwort entwickelt, dies könne mit dem höheren Alter oder individuellen Merkmalen zusammenhängen, heißt es in der Studie.
Einschränkend hieß es gleichzeitig, für die Wirkung der Vakzine gegen asymptomatische Infektionen brauche es weitere Untersuchungen. Auch wie lange die Immunität durch die Impfung anhalte, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da die Folgeuntersuchung bereits 48 Tage nach der ersten Dosis stattgefunden habe. Zudem seien bisher alle Studienteilnehmer weiß gewesen und nicht alle Risikogruppen seien vertreten gewesen. Die Daten sollen nun auf rund 40.000 Probandinnen und Probanden ausgeweitet werden.
Ian Jones von der britischen University of Reading und Polly Roy von der London School of Hygiene & Tropical Medicine, die zu den Expertinnen und Experten gehörten, die die Studiendaten unabhängig begutachteten, schrieben in einem Kommentar: »Die Entwicklung von Sputnik V wurde für die ungemeine Eile, die fehlende Studienlage und die Intransparenz kritisiert. Aber die hier berichteten Ergebnisse sind klar und das wissenschaftliche Prinzip der Impfung wird demonstriert. Das heißt, ein weiterer Impfstoff kann sich jetzt im Kampf gegen Covid-19 einreihen.« Schreibt DER SPIEGEL.
Eigenartig! Als Russland mit dem Impfstoff «Sputnik V» die eigene Bevölkerung zu impfen begann und die «hehre Wertegemeinschaft des Westens» noch nicht mal ihre Impfstoff-Verträge unter Dach und Fach hatte, brach querbeet durch alle Medien Hohn und Spott über den russischen Impfstoff aus. Frei nach der westlichen Überheblichkeit, dass aus dem Lande Putins nichts Gutes kommen kann.
Jetzt, da die «hehre Wertegemeinschaft des Westens» sich verzockt hat und bei den Impfwilligen bis auf die Knochen blamiert, stellt man plötzlich nach der eingehenden Prüfung einer unabhängigen Studie fest, dass der russische Impfstoff eine sehr hohe Wirksamkeit hat und einigen westlichen Impfprodukten sogar überlegen ist. Ungarn setzt «Sputnik V» bereits ein.
«Wo aber Gefahr ist», sagt Hölderlin in Patmos, «da wächst das Errettende auch.»
Es ist anzunehmen, dass andere westliche Staaten dem Beispiel Ungarns folgen werden, bevor ihnen sämtliche Mitglieder der Risikogruppen wegsterben und die privatisierten Gesundheitssysteme um die Ohren fliegen. Sanktionen gegen Russland durch die «westlichen Wertegemeinschaften», allen voran die USA und die EU, wird es keine geben. Ein Impfstoff ist ja etwas anderes als eine Nord Stream 2-Pipeline. So wie Nawalny nicht Khashoggi ist, Putin nicht der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und Russland nicht Saudi Arabien.
So viel zur moralischen Überhöhung der «westlichen Wertegemeinschaft».
Wir können an dieser Stelle einmal mehr den Göttern danken, dass die in ihren Worthülsen der moralischen Blasen gefangenen politischen Eliten der «westlichen Wertegemeinschaft» NUR Staaten lenken und keine Wirtschaftsbetriebe in eigener Verantwortung führen müssen. Die wären bei dieser geballten Inkompetenz nämlich längst beim Konkursamt gelandet.
Wobei derzeit nicht einmal mehr auszuschliessen ist, dass diese gackernde Hühnerschar der Weltenlenker*innen sogar ihre eigenen Staaten ins Verderben führen könnte, was letztendlich auch nichts anderes als Konkurs bedeuten würde. 2015 war ein kleiner Vorgeschmack.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
2.2.2021 - Tag der Emanzipation
Raubüberfall in Rothenburg geklärt: zwei jugendliche Schweizerinnen, 16 und 17 Jahre alt, ermittelt
Die Luzerner Polizei konnte zwei jugendliche Schweizerinnen ermitteln, welche Mitte Januar in Rothenburg einen Tankstellenshop überfallen haben. Die beiden Mädchen sind geständig.
Mitte Januar haben die beiden Mädchen einen Tankstellenshop an der Bertiswilstrasse in Rothenburg überfallen. Dabei haben sie die Angestellten mit einer Waffe bedroht und Bargeld verlangt. Ohne Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Dank intensiven Ermittlungen der Luzerner Polizei konnten die beiden Täterinnen ermittelt werden. Es handelt sich um zwei jugendliche Schweizerinnen (16 und 17 Jahre alt). Zum Motiv gaben sie der Polizei zu Protokoll, dass sie Geld erbeuten wollten, um finanzielle Probleme zu lösen.
Die Untersuchung führt die Jugendanwaltschaft Luzern. Für die beiden Jugendlichen gilt die Unschuldsvermutung. Schreibt die Luzerner Polizei
Frei nach Shakespeare – Es war die Nachtigall und nicht der Lercherich: Raubüberfall in Rothenburg geklärt: zwei jugendliche Schweizerinnen, 16 und 17 Jahre alt, sind von der Luzerner Polizei ermittelt worden
Ein Hauch von Hollywood weht über Rothenburg. Thelma und Louise erobern die letzte von Männern beherrschte Bastion: den Tankstellenraub. Damit ist die Emanzipation der Schweizer Frau endlich vollendet.
Um allfälligen Gerüchten vorzubeugen: Bei der Waffe, mit der die beiden minderjährigen Emanzen die Angestellten vom Tankstellenshop bedroht haben, handelt es sich nicht um eine Kalaschnikow aus dem Balkan.
Die beiden kreativen Jung-Unternehmerinnen heissen auch nicht Valdrina und Xhevahire. Dass sie ihre unmissverständlichen Aufforderungen an das Tankstellenpersonal in Mundart mit leicht albanischem Akzent formuliert haben sollen, sagt überhaupt nichts aus. 90 Prozent aller Jugendlichen in Luzern und Umgebung sprechen inzwischen Schweizerdeutsch mit dem groovenden Balkan-Akzent.
Liebe SVP-Anhänger*innen: Erwähnt sei ebenfalls, dass es sich bei der Gesichtsverhüllung von Thelma und Louise nicht um eine Burka gehandelt hat, wie die Luzerner Polizei bestätigt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
1.2.2021 - Tag der Duschvorhänge
Seit einem Jahr verschwunden: Wo ist die Frau von Kim Jong Un?
Das letzte offizielle Foto von Ri Sol Ju ist über ein Jahr alt. Nordkoreas Diktator Kim Jong Un tritt ohne seine Frau auf. Die Gerüchteküche brodelt.
Seit Monaten kein Lebenszeichen, seit Monaten kein Foto: Ri Sol Ju, die 32-jährige Frau des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, ist abgetaucht. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 25. Januar 2020, war sie zuletzt an einem öffentlichen Anlass im Samjiyon-Theater neben ihrem Mann zu sehen.
Was ist mit der First Lady passiert?
Experten mutmassen, dass Kim Jong Un derzeit das Image als «normales Staatsoberhaupt» zu gelten, egal ist, angesichts der Krisen im Land. Lim Eul Chul, Professor an der Kyungnam-Universität. sagt zu «NK News»: «Jetzt sind für Pjöngjang wirtschaftliche Probleme und echte Erfolge – nicht Formalitäten – am wichtigsten und dringendsten.»
Angst vor Coronavirus?
Oder ist sie krank? Schon in der Vergangenheit kam es vor, dass sie monatelang nicht zu sehen war – um dann plötzlich ohne Erklärung an der Seite ihres Mannes aufzutauchen. Damals spekulierten Medien aber eher in Richtung Schwangerschaft.
Eine naheliegende Erklärung wäre noch die Corona-Krise. «Als Mutter mit kleinen Kindern besteht bei der Teilnahme an öffentlichen Aktivitäten die Gefahr einer möglichen Infektion», sagt Hong Min, Direktor der nordkoreanischen Forschungsabteilung am Korea Institute for National Unification. Er verweist auch auf die Tatsache, dass sogar Kim Jong Un nur wenige öffentliche Auftritte im vergangenen Jahr hatte.
Seit 2018 ist sie die «First Lady»
2018 wurde Ri Sol Ju der Titel «First Lady» verliehen. Es war das erste Mal seit mehr als 40 Jahren, dass der Titel von den Staatsmedien offiziell verwendet wurde. Das Adjektiv «verehrt» war laut der Nachrichtenagentur AFP bislang sogar nur für das nordkoreanische Staatsoberhaupt reserviert.
Zur Verkündung des Titels im Staatsfernsehen wurde damals eigens die legendäre Nachrichtensprecherin Ri Chun Hee aufgeboten – sie wird nur bei besonderen Ereignissen aus dem Ruhestand ins Fernsehstudio gerufen. Schreibt Blick.
Im Haus vis a vis an der Lädelistrasse beobachte ich seit gut einem Jahr ein chinesisches Paar mit meinem Fernglas. Wenn die Storen vom Schlafzimmer mal nicht geschlossen sind, sitzen die beiden meistens auf dem Balkon und rauchen Zigaretten. Er in Unterhosen, während sie mit Vorliebe Unterwäsche mit kitschigen Blumenmotiven trägt, die mich stets an meinen Duschvorhang erinnern. Unterwäsche, wie sie nur noch in Nordkorea getragen wird. Deshalb bin ich mir sicher, dass es sich bei der Frau um Ri Sol-ju, Kim Jong Uns Ehefrau, handelt. Ob ich das der Luzerner Polizei melden sollte?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
31.1.2021 - Tag der Esel
Einst waren sie Verbündete – nun greift Markus Somm mit dem «Nebelspalter» Roger Köppels «Weltwoche» an
Der Publizist Markus Somm kündigt an, dass das neue Online-Portal des «Nebelspalters» ab März Schweizer Politik in den Fokus rückt. Damit tritt Somm in Konkurrenz zur «Weltwoche», für die er lange gearbeitet hat. «Weltwoche»-Chef Roger Köppel reagiert seinerseits mit einer Online-Offensive.
An jedem Werktag um 6 Uhr 30 redet Roger Köppel in eine Kamera. Er spricht manchmal 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde oder noch länger. Er schimpft auf die NZZ, die «infame» Texte über Donald Trump publiziert habe. Kritik am vormaligen US-Präsidenten erträgt Köppel schlecht, hegt er doch tiefe Gefühle für ihn: «Er ist mir ans Herz gewachsen.»
Für die rechtspopulistische Morgenandacht des «Weltwoche»-Chefs gibt es zwei Gründe: Erstens höre Köppel niemanden so gerne reden wie sich selber – sagt ein ehemaliger Redaktor des Wochenmagazins. Zweitens spürt Köppel den Atem von Markus Somm im Nacken. Der langjährige Weggefährte steht kurz vor der Lancierung einer Publikation, die ein ähnliches Publikum ansprechen wird wie die «Weltwoche.»
Im März lanciert Markus Somm den neuen «Nebelspalter»
Köppel konzentrierte sich während Jahren auf das gedruckte Heft und vernachlässigte das Internet. Nun verstärkt er die Online-Aktivitäten. Mit seinem Morgenmonolog erzielt er auf Youtube rund 20 000 Zugriffe pro Tag, eine respektable Zahl. Und er hält seine Redaktoren dazu an, auch kürzere Texte zu schreiben, die nur auf der Website erscheinen, nicht aber im Magazin.
Köppel reagiert damit auf den «Nebelspalter». Chefredaktor Markus Somm will im März loslegen mit dem Online-Portal, und er gibt nun Auskunft über seine Pläne: Drei bis fünf Texte sollen pro Tag erscheinen. Die Satire – bisherige Domäne des «Nebelspalters» – werde nur ungefähr 20 Prozent der Inhalte ausmachen. 80 Prozent seien vorgesehen für Recherchen und Analysen, wobei der Schwerpunkt auf der Schweizer Politik liege.
Somm kündigt ausserdem an, dass er auch die Zeitschrift umbauen werde. Hier soll der Anteil der Satire künftig noch 50 Prozent betragen. Ein «Nebelspalter» mit innenpolitischem Fokus wird zum Konkurrenten der «Weltwoche» – wobei Somm den monatlichen Publikationsrhythmus vorerst beibehält.
Es erstaunt denn auch nicht, dass Somm versucht, Redaktoren von der «Weltwoche» abzuwerben: Florian Schwab prüfte einen Wechsel, lässt es aber bleiben. Über die Zusammensetzung seines Teams schweigt sich Somm aus. Dominik Feusi stösst von Tamedia zur Redaktion, die sich im Stadtzürcher Engequartier niederlässt. Und wie man hört, hat die freie Journalistin und NZZ-Kolumnistin Claudia Wirz zugesagt.
Konsumenten des Online-Portals sollen für einzelne Texte bezahlen können
Wie Köppel will Somm Talkformate lancieren; auf Nebelspalter.ch sind sowohl Video- als auch Audioproduktionen geplant. Dabei ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass immer die gleiche Person spricht. Und Somm überlegt sich den Einsatz einer Technologie, mit der die Konsumenten einfach für einzelne Beiträge bezahlen können. Er will so die Einnahmequellen – Jahresabonnements und Online-Werbung – erweitern.
Bei all den schönen Plänen gibt es ein Problem: Somm und Köppel fischen im gleichen Teich, der nicht übermässig gross ist. Seit Köppel die «Weltwoche» auf einem SVP-nahen Kurs führt, hat sie rund zwei Drittel ihrer Leser verloren – sie kam einmal auf 450 000 Leser, heute sind es noch rund 150 000. Fast alle Zeitungen in der Schweiz haben Leser verloren in den letzten Jahren; bei der «Weltwoche» war der Einbruch aber besonders markant.
Somm war Inlandleiter und Vizechef der «Weltwoche»; er vertritt in nahezu allen wichtigen politischen Fragen die gleichen Positionen wie Köppel, also der SVP. Ab März balgen sich zwei Publikationen um ein Stück Kuchen, das so klein ist, dass es nicht beide ernährt – sieht er dieses Risiko nicht? Somm wehrt ab:
«Wir richten uns nicht gegen die ‹Weltwoche›, sondern gegen Publikationen, die geprägt werden von Langweilern, Konformisten und Angsthasen.»
70 Prozent der Schweizer wählten bürgerlich, fügt Somm hinzu. «Da soll mir niemand sagen, dass in diesem Land kein Platz mehr ist für ein neues Blatt mit dezidiert bürgerlicher Ausrichtung.»
Köppel äussert sich ähnlich: «Es ist gut, dass Markus Somm den bürgerlichen Journalismus aufrüsten will. Es gibt zu viel linke Meinungseinfalt in der Schweiz.» Befürchtet er nicht, dass die Leserschaft seines Blattes noch schneller schmilzt? Die «Weltwoche» entwickle sich erfreulich, Print wie Online, meint er. Sie pflege «grösste Meinungsvielfalt», gebe aber Gegensteuer, wo andere zu einseitig seien.
EU-kritische Haltung überzeugt Somms Investoren
Auf der Redaktion der «Weltwoche» arbeiteten Köppel und Somm eng zusammen; ein Beobachter meint aber, dass sie sich menschlich nie besonders nahe gekommen seien. Somm habe sich zunehmend schwer damit getan, Vize statt Chef zu sein. Dann lotste ihn Christoph Blocher zur «Basler Zeitung».
Nun ist Somm stolz darauf, dass 70 Unternehmer und Manager je 100 000 Franken in sein Medienprojekt investieren. Einige von ihnen überzeugte er mit dem Argument, dass er zur EU und zum Rahmenvertrag eine wesentlich kritischere Haltung einnehme als die grossen Schweizer Zeitungen.
Es ist ein neuer Tag, 6 Uhr 30. Köppel lobt wieder Trump und schimpft auf die NZZ. Somm nimmt hier eine andere Position ein: Nach dem Sturm aufs Kapitol Anfang Januar sagte er sofort, dass sich Trump als Politiker erledigt habe. Vielleicht orientiert sich Somm ein wenig zur Mitte hin, weil er mit dem neuen «Nebelspalter» ein grösseres Publikum erreichen will als die «Weltwoche.» Schreibt die AZ.
Immer wieder herrlich, wenn ein Esel den anderen Esel einen Esel nennt. Und für einmal haben beide recht.
Wobei die wunderbaren Esel aus der wirklichen Tierwelt es nicht verdienen, mit Somm und Köppel verglichen zu werden.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
30.1.2021 - Tag der Frau am Herd
Armee wollte minderwertige Ware loswerden: Schrottmasken für Afrika!
Rund 300 Millionen Masken hat die Armee beschafft. Darunter auch mangelhafte Ware, wie nun verschiedene Fälle zeigen. Die Armee prüfte gar einen Verkauf von Masken, die dem Schweizer Standard nicht entsprechen – nach Afrika.
Rund 300 Millionen Schutzmasken hat die Armeeapotheke seit Beginn der Corona-Pandemie beschafft. Dabei hatte sie nicht immer ein glückliches Händchen. So berichtete der «Tages-Anzeiger», dass die Armee in grossem Stil mutmasslich gefälschte FFP2-Atemschutzmasken eingekauft hatte und wegen der schlechten Qualität teils zerstören musste.
Doch es ist nicht der einzige Fall, in welchem die Armee mit ungenügenden Masken zu kämpfen hatte. Das zeigen zwölf «Statusberichte» von April bis Juni 2020 von Beschaffungskoordinator Markus Näf (53), der vom Bundesrat letztes Jahr temporär als Krisenmanager eingesetzt wurde. BLICK hat die Berichte gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten.
Qualitätskontrolle schwierig
Schon in seinem ersten Bericht von Anfang April legt Näf den Grundsatz fest, dass «nur zertifizierte/zugelassene Produkte» beschafft werden, bei denen eine Qualitätssicherung möglich ist. Ein Grundsatz, der nicht immer eingehalten werden kann. Denn die Maskenbeschaffung aus dem Ausland «ist äusserst schwierig», stellt Näf später fest. Die Zertifizierungsvorschriften würden im internationalen Handel «nicht überprüfbar eingehalten» – so werde die Ware als zertifiziert taxiert, angeschrieben und verkauft. «Sie ist es aber oft nicht.»
Andernorts spricht er davon, dass die «Qualitätskontrolle entlang der Lieferkette» – die meisten Masken stammen aus China – eine Herausforderung sei. Und er macht klar, dass man gewisse finanzielle Risiken, etwa bezüglich Vorauszahlungen, eingehen müsse: «Die Verkäufer sind zurzeit in der Lage, die Marktbedingungen zu diktieren.»
Dies hat Näf zu einem Zeitpunkt geschrieben, als die Armeeapotheke beinahe selbst auf einen Schrottmasken-Anbieter hereinfiel: Im April bewahrte das Aussendepartement von Ignazio Cassis (59) die Armee vor einem 120 Millionen Franken teuren Masken-Flop.
Ungenügende Masken für Afrika?
Der Krisenmanager verweist in seinen Berichten gleich mehrfach auf problematische Lieferungen. Eine Passage im 10. Statusbericht von Mitte Juni lässt besonders aufhorchen, denn darin geht es darum, ungenügende Masken wieder loszuwerden: «Wir prüfen derzeit ein Angebot, alle unsere FFP2-Masken, die nicht dem Schweizer Standard entsprechen, über einen Händler in den afrikanischen Markt zu verkaufen.» Man sei bereit, diese Masken unter dem Einstandspreis abzugeben, da sie nach dem Auslaufen der entsprechenden Covid-Verordnung «nicht mehr in der Schweiz in Verkehr gebracht werden können». Der Vorrat könne «problemlos mit qualitativ einwandfreien und in der Schweiz zugelassenen Masken wieder aufgestockt werden».
Ob der Deal zustande kam, lässt die Armee auf Anfrage von BLICK offen. Stattdessen verweist sie auf eine von Verteidigungsministerin Viola Amherd (58) in Auftrag gegebene Aufarbeitung durch die interne Revision des VBS, welche im Frühjahr abgeschlossen werden soll. Daher könne man «leider nicht vertieft antworten», so Armeesprecher Stefan Hofer.
Risikohafte Vorauszahlungen in Millionenhöhe
Näf schildert in seinen Berichten aber verschiedene heikle Fälle. In seinem letzten Bericht von Ende Juni beispielsweise schreibt er von «nicht brauchbarer» sowie «qualitativ ungenügender» Ware, für welche aber bereits elf Millionen Franken im Voraus bezahlt wurden – um welche Produkte es sich handelt, ist unklar. Die Stellen sind geschwärzt.
In einem früheren Bericht schreibt der Krisenmanager zudem: «Die angelieferten OP-Kittel weisen Qualitätsmängel auf.» Was der Lieferant allerdings bestreite. Da auch hier eine Anzahlung von 4,7 Millionen Franken geleistet wurde, «sind wir bei unbrauchbaren Waren im Risiko».
Im Mai wiederum wird eine Anlieferung von 100 Millionen Hygienemasken erwähnt, bei welchen «Qualitätsmängel festgestellt» und welche daher zurückgewiesen wurden. Immerhin klappte hier die Kontrolle. «Da wir aktuell eine sehr gute Versorgungssituation haben, gehen wir bei den Qualitätsstandards keine Kompromisse ein und verfolgen Anbietern gegenüber eine harte Linie», so Näf.
In einem anderen Fall berichtet Näf von einem Deal, bei welchem man «nach mehreren Fehllieferungen» aus einem Vertrag aussteigen wollte. Schliesslich einigte man sich auf einen Vergleich: Statt 40 Millionen Hygienemasken des Typs II sollte die Firma 60 Millionen Hygienemasken des Typs II liefern, zu 42 Rappen pro Stück. Der Name der Firma ist geschwärzt – im öffentlichen Beschaffungsbericht vom Dezember treffen die Angaben auf die Firma MJ Steps in Volketswil ZH zu.
Armee schweigt zu finanziellen Verlusten
Wie die Problemfälle ausgegangen sind und welche finanziellen Verluste dem Bund durch ungenügende oder mangelhafte Schutzmaterialien entstanden sind, bleibt vorerst offen. «Die Beschaffungen mussten unter hohem Zeitdruck und einem von der Krise geprägten, volatilen Markt mit stark schwankenden Preisen sowie zahlreichen unseriösen Angeboten erfolgen», antwortet Armeesprecher Hofer nur allgemein. Die Armeeapotheke habe auf den Weltmärkten auftragsgetreu innert kurzer Zeit enorme Mengen an Schutzmaterial beschafft, um eine Unterversorgung in der Schweiz zu verhindern.
Ob angemessene interne Kontrollen im Prozess der Maskenbeschaffung eingebaut waren, werde nun durch die interne Revision aufgearbeitet, so Hofer. «Zudem wird beurteilt, ob der Preis der erworbenen Schutzmasken marktgerecht war, die Qualität der erworbenen Schutzmasken den gängigen Standards entsprach und die mit den Lieferanten vertraglich vereinbarten Konditionen eingehalten wurden.» Schreibt BLICK.
Bundesrätin Viola Amherds von den Medien hochgejazzter Glanz bröckelt langsam aber sicher. Nachdem sie während der ersten Phase der Corona-Pandemie (2020) eines der dümmsten Zitate absonderte, um die «A fonds perdu» («nicht rückzahlbar») verlochten Hilfsgelder an Fussballclubs zu rechtfertigen(«Es gibt bei uns kaum Fussballmillionäre»), scheint sie auch ihren Laden nicht mehr im Griff zu haben.
By the way: Geschwärzte Stellen in einem Bericht entsprechen nicht unbedingt der vom Bund beinahe täglich beschwörten Transparenz. Sowas müsste eigentlich in einer Demokratie ein No Go sein, will man sich nicht den Ruf einer Bananenrepublik einhandeln.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
29.1.2021 - Tag der chinesischen Innovation
«Erhöhte Nachweisrate»: China testet per Anal-Abstrich auf Coronavirus
In China wird eine neue Art von Corona-Tests gemacht: Mittels Anal-Abstrich. Diese soll laut Ärzten effizienter sein, sorgt bei den Patienten aber vor allem für böse Sprüche.
Die chinesischen Behörden nehmen Corona-Tests nun auch per Anal-Abstrich vor. Diese Methode könne «die Nachweisrate bei infizierten Personen erhöhen», da das Virus im Anus länger nachweisbar sei als in den Atemwegen, sagte Li Tongzeng, ein leitender Arzt des You'an Krankenhauses in Peking, dem staatlichen Fernsehsender CCTV. Dem Sender zufolge wird jedoch weiterhin grossteils per Rachen- und Nasen-Abstrich getestet, da die Anal-Methode nicht sehr «angenehm» sei.
Der Anal-Abstrich kommt demnach vor allem bei Menschen, bei denen ein hohes Risiko einer Coronavirus-Infektion besteht, zum Einsatz. Vergangene Woche war dies laut CCTV bei Bewohnern mehrerer Viertel Pekings mit bestätigten Corona-Infektionen der Fall. Auch Bürger in Quarantäne wurden demnach auf diese Weise getestet.
Massentests in mehreren chinesischen Städten
Die Internetnutzer reagierten mit schwarzem Humor auf das neue Test-Vorgehen. «Ich habe zwei Anal-Abstriche gemacht, jedes Mal musste ich danach einen Rachen-Abstrich machen - ich hatte solche Angst, dass die Krankenschwester vergisst, ein neues Stäbchen zu benutzen», scherzte ein Nutzer auf der Plattform Weibo.
In den vergangenen Wochen wurden wegen vereinzelter kleiner Ausbrüche mehrere Städte im Norden Chinas abgeriegelt und Massentests vorgenommen. Wegen der weltweit steigenden Infektionszahlen hat China zudem seine Einreiseregeln verschärft. Alle Reisenden müssen bei ihrer Ankunft mehrere negative Test-Ergebnisse vorweisen und sich mindestens 14 Tage in Quarantäne begeben. Schreibt Blick.
Also das muss man unseren Freunden aus dem Reich der Mitte lassen: Innovativ sind sie! Und sie machen nicht nur vor nichts Halt, sondern auch nichts ohne Plan.
Vermutlich wollen sie der westlichen Wertegemeinschaft in Zukunft ihre Corona-Anal-Abstrich-Stäbchen (aus Bambusholz mit einem Wattebausch an der Spitze) verkaufen.
Aber warum fällt mir jetzt schon wieder ausgerechnet der Innovationsbeauftragte der FDP und Luzerner Ständerat Damian Müllerund das uralte Lied «Des Müllers Lust» ein?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
28.1.2021 - Tag der Apotzheken
Coronavirus: Bund übernimmt Testkosten für Personen ohne Symptome und übernimmt Kosten für Impfung in Apotheken
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 27. Januar 2021 eine Reihe von Beschlüssen zur Eindämmung und Bewältigung der Corona-Epidemie gefasst. Der Bund übernimmt neu die Kosten für Tests an Personen ohne Symptome, um besonders gefährdete Menschen besser zu schützen und lokale Infektionsausbrüche frühzeitig zu bekämpfen. Zudem passt er die bisherige Quarantäneregelung an: Die zehntägige Quarantäne kann verkürzt werden, falls sich die betroffene Person nach sieben Tagen testen lässt und das Resultat negativ ist. Ausserdem regelte der Bundesrat, dass Ordnungsbussen verhängt werden können, wenn bestimmte Massnahmen nicht eingehalten werden. Damit Impfungen auch in Apotheken möglich sind, übernimmt der Bund auch dort die Kosten.
Mehr als die Hälfte der Covid-19-Übertragungen dürfte durch Personen ohne Symptome stattfinden, die gar nicht merken, dass sie infiziert sind. Der Bund hat deshalb Mitte Dezember das Testen von Personen ohne Symptome im Rahmen von Schutzkonzepten, etwa in Alters- und Pflegeheimen, Hotels oder am Arbeitsplatz zugelassen. Um den Anreiz für solche Tests zu erhöhen, übernimmt der Bund neu die Kosten dafür. Die Tests können vom Personal selbst vor Ort vorgenommen und negative Resultate dieser Schnelltests müssen nicht gemeldet werden. Wird jemand positiv getestet, muss ein PCR-Test durchgeführt und das Resultat gemeldet werden.
Die erweiterte Teststrategie soll auch dazu beitragen, lokale Infektionsausbrüche frühzeitig zu erkennen und einzudämmen, etwa in Schulen. Dies nicht zuletzt auch, weil sich die neuen, ansteckenderen Varianten des Coronavirus in der Schweiz weiter verbreiten. Der Bund übernimmt auch in diesen Fällen die Kosten für die Testung von Personen ohne Symptome. Der Kanton muss dem BAG ein Konzept vorlegen, etwa dazu wo, wer und wie oft getestet wird sowie welche Tests verwendet werden.
Die Testkriterien des Bundesamts für Gesundheit werden entsprechend angepasst. Die erweiterte Teststrategie erfordert eine Änderung der Covid-19-Verordnung 3, die morgen Donnerstag, 28.1.2021 in Kraft tritt.
Quarantäneregel angepasst
Die bisherige Regelung der Kontaktquarantäne wird durch eine Test- und Freigabestrategie ergänzt. Gemäss der bis anhin geltenden Regelung muss sich eine Person ab dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person in eine 10-tägige Quarantäne begeben. Neu kann die Quarantäne mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde vorzeitig beendet werden, wenn die betroffene Person ab dem 7. Tag einen Antigen-Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse (PCR-Test) durchführt und das Resultat negativ ist. Die Testkosten muss die Person selber tragen. Bis zum eigentlichen Ablauf der Quarantäne (10. Tag) muss die Person jederzeit eine Gesichtsmaske tragen und den Abstand von 1.5 Metern gegenüber anderen Personen einhalten, ausser sie hält sich in der eigenen Wohnung oder Unterkunft (z.B. Ferienwohnung, Hotel) auf. Bei einem positiven Test muss sich die Person unverzüglich in Isolation begeben.
Verkürzte Reisequarantäne
Die neue Test- und Freigabestrategie gilt auch für Einreisende aus Staaten oder Gebieten mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko. Sie müssen künftig bei ihrer Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Anschliessend begeben sie sich wie bisher in eine 10-tägige Quarantäne. Sie können diese jedoch ab dem 7. Tag verlassen, falls ein negatives Resultat eines Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests vorliegt. Bei Flugreisen aus Ländern, die nicht zu den Risikogebieten zählen, ist ebenfalls ein negatives PCR-Testresultat vorzuweisen. Die Kontrolle erfolgt vor dem Einsteigen ins Flugzeug.
Breitere Erfassung der Kontaktdaten
Bisher werden nur die Kontaktdaten von Personen aus Risikostaaten oder -gebieten bei ihrer Einreise in die Schweiz erfasst. In Zukunft müssen auch Einreisende aus Staaten oder Gebieten ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko ihre Kontaktdaten angeben, falls sie per Flugzeug, Schiff, Bus oder Zug einreisen. Sämtliche Kontaktdaten werden neu mittels eines elektronischen Einreiseformulars erfasst. Dadurch können Ansteckungen einfacher und schneller zurückverfolgt und Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden.
Die vom Bundesrat beschlossenen Quarantäne- und Einreiseregeln erfordern eine Anpassung der betreffenden Covid-19-Verordnungen. Sie treten am 8. Februar 2021 in Kraft.
Ordnungsbussen: Straftatbestände explizit aufgeführt.
Ab dem 1. Februar 2021 werden Widerhandlungen gegen Massnahmen zur Bekämpfung der Epidemie explizit als Straftatbestände aufgeführt und können teilweise mit Ordnungsbussen bestraft werden. Die Höhe der Busse beträgt je nach Delikt zwischen 50 und 200 Franken. Mit einer Ordnungsbusse gebüsst werden kann etwa, wer im öffentlichen Verkehr sowie in den Bahnhöfen und an den Haltestellen oder in und vor öffentlich zugänglichen Einrichtungen keine Maske trägt. Ordnungsbussen sind zudem möglich für Teilnahme an unzulässigen Veranstaltungen oder die Durchführung einer verbotenen privaten Veranstaltung. Die unmittelbare und rasche Bestrafung mit einer Ordnungsbusse soll die Einhaltung der Massnahmen in der Gesellschaft fördern und die Strafverfolgungsbehörden entlasten.
Bund übernimmt Kosten für Impfung in Apotheken
Der Bund übernimmt ab dem 1. Februar auch die Kosten für Impfungen durch Apothekerinnen und Apotheker und zwar zu denselben Bedingungen wie für Impfungen in Impfzentren. Dies erlaubt den Kantonen, die Apotheken in ihre Impforganisation zu integrieren.
Prüfung von Atemschutzmasken
Atemschutzmasken mit möglicherweise ungenügendem Sicherheitsnachweis in Lagerbeständen des Bundes oder der Kantone, sollen nachträglich geprüft werden können. Erfüllen diese Atemschutzmasken die nachträgliche Prüfung nicht, dürfen diese nicht benutzt werden. Der Bundesrat hat heute die Covid-19-Verordnung 3 entsprechend geändert. Zu Beginn der Covid-19-Pandemie wurden wegen des hohen Bedarfs beim Gesundheitspersonal in grossen Mengen Atemschutzmasken mit möglicherweise ungenügendem Sicherheitsnachweis eingekauft.
Nur langsame Abnahme der Fallzahlen
Die epidemiologische Lage entspannt sich in der Schweiz nur langsam, insbesondere bei der Zahl der Neuansteckungen. Deutlicher ist die Abnahme bei den Hospitalisationen und den Todesfällen. Auf den Intensivstationen bleibt die Belastung allerdings unverändert hoch. Der Anteil der neuen Virusvarianten verdoppelt sich nach wie vor jede Woche. Der Bundesrat verfolgt diese Entwicklung mit Sorge. Sein Ziel bleibt eine rasche und deutliche Abnahme der Fallzahlen.
Ausfallentschädigung für Kulturschaffende
Der Bundesrat hat zudem heute entschieden, dem Parlament zu beantragen, dass Kulturschaffende rückwirkend auf den 1. November 2020 Ausfallentschädigungen erhalten sollen. Dadurch soll eine Unterstützungslücke vermieden werden. Kulturschaffende können ihr Gesuche einreichen, sobald die gesetzlichen Grundlagen in den für die Umsetzung zuständigen Kantonen bestehen. Schreibt das Bundesamt für Gesundheit.
Der Bund übernimmt ab dem 1. Februar auch die Kosten für Impfungen durch Apothekerinnen und Apotheker und zwar zu denselben Bedingungen wie für Impfungen in Impfzentren. Dies erlaubt den Kantonen, die Apotheken in ihre Impforganisation zu integrieren. Schreibt da BAG.
Das sind doch gute Nachrichten. Jeder Defätismus ist fehl am Platz.
Dumm nur, dass es viel zu wenig Impfdosen gibt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
27.1.2021 - Tag des politischen Lobbyismus
Ibiza-Drahtzieher Julian H.: "Es war unglaublich leicht", Strache in die Finca zu locken
Julian H. "erfand" die falsche Oligarchennichte Alyona Makarowa, auf der Finca spielte er deren Vermittler. Nun erzählt er erstmals über die Hintergründe und Folgen des Videos
Das ganze Interview lesen Sie auf DER STANDARD.
Ein spannendes Interview und ein «Sittengemälde der Verwahrlosung», wie der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen sagte, als der Skandal um das Ibiza-Video 2019 aufflog.
Das Ibiza-Video deckt aber auch Abgründe von Parteien und Polit-Eliten auf. Skrupellos offenbart Strache, ehemals Vizekanzler der Republik Österreich, die Käuflichkeit seiner eigenen Partei und von Politikern.
Genüsslich zeigten die Medien querbeet in ihren Berichterstattungen und Leitartikeln über den «Ibiza-Skandal» mit dem Zeigefinger auf die sogenannten Populisten.
Vor lauter Häme vergassen die Journalisten, dass Korruption, genannt «Lobbyismus», im politischen Alltag so ziemlich bei allen Parteien gang und gäbe ist. Nicht nur in Österreich.
Allerdings sind nicht alle Politiker*innen so blöd wie die beiden Österreicher Strache und Gudenus, sich mit weissen Nasen und zugedröhnt von irgendwelchen halluzinierenden Substanzen, von einer drittklassigen «Schauspielerin» wie hirnlose Vollidioten über den Tisch ziehen zu lassen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
26.1.2021 - Tag der Sure 2, Vers 191 aus der Anleitung zum Töten Ungläubiger
GENERAL CHARLES GORDON: Sein abgeschlagener Kopf war zwischen zwei Bäume gespannt
Er wolle nicht vor „stinkenden Derwischen“ fliehen, begründete der britische General Gordon 1884 seine Weigerung, sich aus Khartum zurückzuziehen. Aber die fanatischen Anhänger des Mahdi machten mit ihm kurzen Prozess.
Charles George Gordon war ein Offizier, wie ihn die britischen Zeitgenossen liebten. Der Sohn eines Generals hatte am Krimkrieg (1853–1856) und am Zweiten Opiumkrieg (1856–1860) in China teilgenommen, dort anschließend eine Fremdenlegion gegen die Taiping geführt. Im Dienst des osmanischen Vizekönigs von Ägypten stieg er zum Gouverneur des Sudan (1877–1880) auf. Und er war gebildet. Nach einem Besuch Jerusalems behauptete er, den wahren Ort der Kreuzigung Jesu entdeckt zu haben.
Dieser Kriegsheld schien der britischen Regierung 1884 der geeignete Mann zu sein, die Katastrophe abzuwenden, die sich in den neuen Erwerbungen des Empire im langen Niltal abzeichnete. Um die französische Konkurrenz auszustechen, waren britische Truppen zwei Jahre zuvor in Ägypten und den Sudan einmarschiert, die formal noch dem Osmanischen Reich unterstanden, durch die Politik der faktisch autonomen Vizekönige in Kairo aber in finanzielle Abhängigkeit von den beiden Westmächten geraten waren.
Einen ersten Aufstand hatten die Briten schnell niederschlagen können. Doch die Wut über ihr Regime trieb einem ebenso charismatischen wie fanatischen Prediger zahlreiche neue Anhänger zu. Dieser Muhammad Ahmad war zwar ein vom Sufismus geprägter Sunnit, der sich aber als Mahdi ausgab, den von den Schiiten am Ende aller Zeiten erwarteten Erlöser.
Nachdem die Mahdi-Anhänger ein britisches Kontingent über den Haufen gerannt hatten, konzentrierte London alle Kräfte auf die Verteidigung Ägyptens und setzte Gordon in Marsch, die britische Kolonie in Khartum zu sichern und zu evakuieren. Der erreichte im Februar 1884 die sudanesische Metropole und organisierte den Transport von Frauen, Kindern und Versehrten nach Norden. Den Abzug der 7000 Mann starken Garnison aber verweigerte er. Der Sudan solle nicht „von einer schwachen Ansammlung stinkender Derwische“ tyrannisiert werden, kabelte Gordon nach London.
Mitte März blockierte Abdallahi Bin Muhammad im Namen des Mahdi mit 50.000 Kämpfern die Stadt. Da Gordon den Ausbruch nach Norden immer noch verweigerte, musste London zähneknirschend ein Expeditionskorps in Marsch setzen. Das war allerdings erst zum Jahresende einsatzbereit und rückte langsam nach Süden vor.
Gordons vollmundige Versicherung, er „könnte jahrelang durchhalten“, erwies sich jedoch bald als Trugschluss. Die Vorräte gingen dramatisch zur Neige, und als das Nilhochwasser zurückging, begannen die Mahdisten am Ende Januar 1885 auch vom Wasser aus mit dem Sturmangriff. Am 26. fiel Khartum und mit der Stadt Gordon und alle seine Leute.
Als zwei britische Kanonenboote zwei Tage später die Stadt erreichten, fanden sie zahllose Leichen vor. Gordons abgeschlagener Kopf war zwischen zwei Bäumen über die Hauptstraße gespannt. Es sollte bis zum September 1898 dauern, bis eine anglo-ägyptische Armee unter Horatio Herbert Kitchener die Mahdisten bei Omdurman vernichtend schlagen konnte. Schreibt die WELT.
Ein abgeschlagener Kopf ist kein schöner Anblick. Aber General Charles Gordon wurde immerhin Halal-gerecht ins Jenseits befördert. Wie's in der «Anleitung zum Töten», genannt Koran, für alle Ewigkeit festgeschrieben ist: Sure 2, Vers 191 – «Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben, denn Verfolgung ist schlimmer als Töten! Kämpft jedoch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort (zuerst) gegen euch kämpfen. Wenn sie aber (dort) gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcherart ist der Lohn der Ungläubigen.»
Oder Sure 9, Vers 5: «Sind die heiligen Monate abgelaufen, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie, und lauert ihnen auf aus jedem Hinterhalt.»
Fairerweise sei festgehalten, dass im Alten Testament ebenfalls zum Töten aufgerufe wird: «Auge um Auge, Zahn um Zahn.» Doch in den so genannten «Antithesen der Bergpredigt» (Mt 5,1–7.28f.) soll Jesus von Nazareth gepredigt haben: «Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.» Das wäre dann immerhin die perfekte Anleitung zum Masochismus.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
25.1.2021 - Tag der politischen Dummheit
Irène Kälin: «Ist es richtig, zuerst alle über 75-Jährigen zu impfen und erst später jüngere Risikopersonen?»
Irène Kälin ist oberste Aargauer Gewerkschafterin und wird nächstes Jahr als Nationalratspräsidentin «höchste Schweizerin. Im Gespräch erklärt die 33-Jährige, warum sie eine alternative Impfstrategie wünscht, was sie an der Coronapolitik in der eigenen Partei stört und und wie Homeoffice mit einem Journalisten geht.
Irène Kälin, Sie schrieben in einer Kolumne, wie sehr Sie den Körperkontakt, das Händeschütteln und das Küssen von Freunden vermissen. Wann haben Sie das letzte Mal jemanden ausser Ihrem Partner und Ihrem Kind geküsst?
Irène Kälin: (überlegt) Vorgestern, meine Mutter. Ja, mir war vor Corona tatsächlich nicht bewusst, wie gerne ich Hände schüttle und Menschen küsse. Und wie fest mir der erste Körperkontakt bei einer Begrüssung fehlt. Zuhause gehe ich mit Bekannten gleich um wie vorher: Wenn sie mich besuchen, küsse ich jene, die ich schon vorher küsste und umarme diejenigen, die mich ebenfalls umarmen wollen.
Das Virus nimmt aber keine Rücksicht, wie gut man einen Menschen kennt.
Das stimmt, aber wenn wir zu viert bei mir zu Hause einen Abend verbringen und am Tisch essen und trinken, kommt es auf diese Berührung auch nicht mehr an.
Täuscht der Eindruck oder hört man die Grünen in der Coronakrise eher wenig?
Klar, um unsere Kernthemen Klima- und Umweltschutz ist es zwangsläufig ruhiger geworden, weil sich die ganze Welt auf die Bekämpfung der Pandemie konzentriert. Aber wir haben uns federführend dafür eingesetzt, dass niemand in den Unterstützungsmassnahmen vergessen geht.
Aber betreffend Covid-Impfungen halten sich die Grünen auffällig zurück. Aus Rücksicht auf die möglicherweise vielen impfkritischen Stimmen an der Basis?
Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Partei sich hier zurückhält. Im Gegenteil: Mehrere Nationalrätinnen und Nationalräte haben - leider, und das betone ich - Anfang Jahr «Impfwerbung» gemacht, indem sie öffentlich bekundeten, dass sie sich impfen lassen würden.
Wo ist das Problem?
Ich bin da ganz bei FMH-Präsidentin Yvonne Gilli: Impfen ist Privatsache. So habe ich auch kein Verständnis dafür, dass man auf das Pflegepersonal Druck ausübt, sich impfen zu lassen. Auf jene also, die durch die Krise sowieso schon sehr unter Druck stehen. Es widerspricht meinen Werten, eine derart persönliche Entscheidung zu politisieren. Deshalb werde ich auch die Frage nie beantworten, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Dass man mich richtig versteht: Ich erachte die Impfung generell als sinnvoll und bin dankbar dafür, dass sie nun verfügbar ist.
Die Impfung ist doch eine politisch relevante Frage. Sie ist das effizienteste Mittel, um die Menschen zu schützen, die Pandemie zu besiegen und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen wieder aufzuheben.
Ich hoffe, dass die Impfung das bewirken wird, was sie verspricht. Und uns aus der Krise hilft. Trotzdem ist die politische Frage nicht, ob ich mich impfen lassen will oder nicht. Vielmehr geht es um die Verteilung des Impfstoffes, der weltweit noch knapp ist. Ist es richtig, dass ärmere Länder mit einem schlechten Gesundheitssystem länger warten müssen? Und hier in der Schweiz ist die Priorisierung auch eine Diskussion wert: Ist es richtig, zuerst alle über 75-Jährigen zu impfen und erst später 65- oder 40-Jährige mit schweren Vorerkrankungen?
Was wäre für Sie denn die richtige Priorisierung?
Ich hätte mir vorstellen können, dass wir jüngere Risikopersonen vorziehen bevor wir generell alle alten Menschen impfen.
Eine solche Forderung hören wir zum ersten Mal.
Genau, und das ist es, was mich etwas erschreckt. Wenn sich Politiker lieber darauf konzentrieren, zum Impfen aufzurufen, statt sich die Verteilungsfrage eines momentan sehr knappen Impfstoffes zu stellen.
Ihre Kritik an den Impfprioritäten wird sicher auf Gegenkritik stossen. Grossratspräsident Pascal Furer beklagt, man dürfe nicht mehr alles diskutieren im Zusammenhang mit Corona und stritt sich jüngst mit einem Chefarzt zum Thema Impfung und Virusübertragung. Verstehen Sie ihn?
Ich finde, man muss Massnahmen kritisch hinterfragen können. Das tue ich ja auch. Aber Halbwissen zu wissenschaftlichen Themen verbreiten ist etwas anderes.
Furer ist dieses Jahr der höchste Aargauer und damit in einer besonderen Funktion. Sie selber werden voraussichtlich 2022 als Nationalratspräsidentin höchste Schweizerin. Nehmen Sie sich jetzt schon als Vizepräsidentin politisch zurück?
Es gehört bereits jetzt zu meinen Aufgaben, ein offenes Ohr für alle Lager zu haben und ich mache sicher nicht die gleichen zugespitzten Aussagen wie als normale grüne Nationalrätin. Als Mitglied der Verwaltungsdelegation, die die Sicherheit der Parlamentarierinnen und der Mitarbeitenden des Parlaments gewährleisten muss, spüre ich die Spannung, die zur Zeit herrscht im Bundeshaus: Es gibt Nationalräte, die noch strengere Massnahmen fordern und jene, die am liebsten maskenlos im Nationalratssaal singen würde.
Ihre Karriere ist rasant. Ende 2017 für Jonas Fricker in den Nationalrat nachgerutscht und bald höchste Schweizerin. Ist es in erster Linie Glück, Ambition oder harte Arbeit?
Für mich persönlich ist es pures Glück. Dass eine grüne Parlamentarierin aber überhaupt das Anrecht hat, den Nationalrat zu präsidieren, hat mit der langjährigen und hartnäckigen Arbeit meiner Partei zu tun. Dass ich es geworden bin, ist Zufall, wie sehr vieles in meiner politischen Karriere.
Etwas zufällig war sogar Ihre Parteiwahl: Sie haben auch schon erzählt, dass Sie sich wegen Cédric Wermuth für die Grünen und nicht für die SP entschieden haben.
Ja, diese Geschichte werde ich nicht mehr los, sie ist aber wahr. Ich war eine junge Linke und habe in Lenzburg als Listenfüllerin für die Grünen kandidiert, weil sie dort zum ersten Mal eine Liste hatten. Hätte mich die SP angefragt…
...nochmals für die Geschichtsbücher: Weshalb war Wermuth ein Hindernis, in die SP einzutreten?
Cédric hatte damals in seinem Umfeld sehr viele junge Frauen in meinem Alter, die ihm ihre Ideen gaben und die er dann als Juso-Shootingstar verkaufte. Das entsprach mir nicht. Ich wollte mit meinen Ideen auf eigenen Beinen stehen.
Sind Sie im Grunde genommen mehr links als grün?
Ich glaube, das ist kein Widerspruch.
Dem würden Grünliberale oder sogar Leute in ihren eigenen Reihen widersprechen.
Sagen wir es so: Es gibt sicher Grüne, die weniger links sind als ich. Und es gibt auch Grüne, die weniger liberal sind als ich.
Könnten Sie sich mal vorstellen, auch einmal ein Exekutivamt einzunehmen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich konnte es mir jahrelang nicht vorstellen. Mittlerweile stelle ich fest, dass es doch interessant ist, wenn man in seiner Gemeinde beispielsweise ganz konkret gestalten und mitbestimmen kann: Wo der neue Brunnen stehen soll, wie viel ein Schwimmbadeintritt kostet, statt Inputs einzubringen, die, gerade bei grüner Politik, vielleicht erst in 40 Jahren Früchte tragen.
Gerade in grünen Kernthemen geht vieles nur langsam voran. Verzweifeln Sie manchmal daran?
Verzweifeln wäre der falsche Ausdruck. Unterdessen hat sich einiges getan: Die Energiewende kommt voran, das CO2-Gesetz ist viel fortschrittlicher, als ich es mir vor einigen Jahren hätte vorstellen können. Dass die Schweizer Demokratiemühlen langsam mahlen, erfüllt mich nach wie vor mit Ungeduld, aber mittlerweile habe ich es akzeptiert. Wichtig ist, dass wir in die richtige Richtung steuern.
Sie sind auch Präsidentin des gewerkschaftlichen Dachverbandes “Arbeit Aargau”. Wie beurteilen Sie die Coronasituation auf dem Bau? Im ersten Lockdown kritisierten die Gewerkschaften, die Sicherheitsabstände könnten nicht eingehalten werden und verlangten deshalb Baustellen-Schliessungen.
In der ersten Welle ergab sich dann eine Lösung mit dem Kanton. Wir konnten sozialpartnerschaftlich mehr Kontrollen durchführen. Das hat eine evidente Verbesserung herbeigeführt und hatte eine präventive Wirkung. Jetzt ist die Kontrollfrequenz wieder stark zurückgegangen. Denn die Unterdotierung der Arbeitsinspektorats im Aargau ist generell ein Problem. Es fehlen über 2000 Stellenprozente, um den Vorgaben der internationalen Arbeitsorganisation zu entsprechen. So erhalten wir nun logischerweise wieder viele negative Rückmeldungen über die Situation auf Baustellen.
Was tun die Gewerkschaften dagegen?
Wir würden gerne mit dem Kanton die Zusammenarbeit wieder aufnehmen, aber bis jetzt sind wir nicht auf offene Ohren gestossen. Wir hoffen, dass mit der Homeoffice-Pflicht der Kanton wieder mehr daran denkt, dass es andere Arbeitnehmende gibt, die sich völlig vergessen fühlen. Bauarbeiter schütteln den Kopf, weil in einem Grossraumbüro Maskenpflicht gilt, obwohl sämtliche Abstände eingehalten werden können, während für sie Abstandhalten undenkbar ist. Seit der Schliessung der Restaurants verbringen sie ihre Pausen in ihren Baracken, aber es gibt nicht mehr davon als vorher, und Toi-Toi-WCs waren auch vor der Pandemie kein hygienischer Ort.
Haben Sie als Gewerkschaften nicht auch weggeschaut? Man hat das Gefühl, das Lobbying hat sich sehr stark auf das Pflegepersonal konzentriert.
Als Dachverband ArbeitAargau haben wir auch das Gefühl, dass der Fokus sehr stark auf das Pflegepersonal gelegt wurde. Die Probleme der verschiedenen Branchen sind so derart unterschiedlich. Nach dem ersten Lockdown hegten wir die Hoffnung, dass diese vermehrten Kontrollen im Bauwesen langfristig sichergestellt werden. Die Rückmeldung, die wir jetzt erhalten, weist aber auf das Gegenteil hin. Es muss nun einen Ruck geben im Kanton, dass alle Branchen mitberücksichtigt werden.
Noch eine Frage zum Homeoffice: Die Sendung des SRF Kassensturz Espresso erhielt viele Rückmeldungen von Arbeitnehmenden, deren Arbeitgebenden Homeoffice nicht zulassen. Erhalten Sie ähnliche Feedbacks? Was könnten Gewerkschaften dagegen unternehmen?
Als noch die Home-Office-Empfehlung galt, war es sehr wohl der Fall. Nun ist es etwas früh, die Situation in der aktuellen Home-Office-Pflicht zu beurteilen. Es wird aber auch unabhängig von der Bereitschaft der Arbeitgeber Herausforderungen geben, je nach dem wie man lebt.
Wie ist es für Sie? Arbeiten Sie als Politikerin und ihr Partner als Co-Chefredaktor der Schweizer Illustrierte beide im Homeoffice?
Mein Partner geht nach wie vor ein paar Tage die Woche ins Büro. Auch weil unser Sohn dort in die Kita geht und wir so oder so von Oberflachs nach Altstetten fahren müssten. Ich bin dankbar dafür, denn Zuhause wäre es nicht ganz einfach, zu zweit im Homeoffice, da wir sozusagen ein Einraumhaus haben. Wir gehen uns schnell auf den Wecker, wenn wir gleichzeitig im Homeoffice sind.
Sie haben ein zweieinhalbjähriges Kind. Welchen Einfluss hat Corona diesbezüglich auf Ihren Alltag?
Es ist nicht ganz einfach, weil so viele Freizeitaktivitäten geschlossen sind. Mir gehen langsam die Ideen aus, was man noch spielen oder basteln könnte. Und die 5-Personen-Regel ist sowieso familien- und kinderfeindlich.
Was tun Sie dann?
In den letzten Tagen hat der Schnee uns begeistert. Aber sonst ist Einkaufen mittlerweile eine der letzten Abwechslungen ausser Haus. Ich nehme meinen Sohn immer mit, manchmal zum Ärger anderer. Da hat sich ein weiterer Graben in unserer Gesellschaft geöffnet und es ist eine Müdigkeit spürbar. Es gibt jene, die Verständnis dafür haben, dass man sein Kind mitbringt und die anderen, die sich daran stören und mir despektierlich nachrufen, was diese «Virenschleuder» ohne Maske hier zu suchen habe.
Was verändert sich gesellschaftlich nach Corona? Was wünschen Sie sich?
Dass die systemrelevanten Berufe mehr wertgeschätzt und entsprechend besser entlöhnt werden. Aber insgesamt habe ich wenig Illusionen, dass wir uns wesentlich verändern werden. Ich hoffe wir schätzen Dinge, die für uns früher selbstverständlich waren - Konzerte, Fussballspiele, Umarmungen – wieder mehr in Zukunft. Schreibt die Aargauer Zeitung.
«Ist es richtig, zuerst alle über 75-Jährigen zu impfen und erst später jüngere Risikopersonen?»
Eine dümmere Frage, die sich nach einem einzigen Blick auf die Alters-Statistik der Schweizer Corona-Toten (92,1 Prozent über 70 Jahre alt) für einen normal begabten Menschen überhaupt nicht stellt, kann man sich kaum vorstellen. Und dies ausgerechnet von der Dame, die nächstes Jahr das Amt der «höchsten Schweizerin» bekleiden wird. Da drängt sich die Frage auf, ob die Höhe der höchsten Schweizerin inzwischen nach der grenzenlosen Dummheit dieser Dame bemessen wird.
Das Ausspielen der einen Generation gegen die andere ist bei den Grünen seit Greta ja zum Geschäftsmodell avanciert, egal wie kindisch die weltfremden Seifenblasen-Wahrheiten auch immer sein mögen. Robert Bly hat dazu ein gutes Buch geschrieben: «Die kindliche Gesellschaft».
Wer hat die nur gewählt, fragen sich jetzt vermutlich viele. Die Antwort ist einfach zu beantworten: Die 54,9 Prozent der Schweizer Stimmberechtigten, die 2019 nicht gewählt haben. So kommt es halt, wenn eine Mehrheit des Wahlvolks frustriert oder schlicht und einfach zu faul ist, das Wahlrecht auszuüben. Da werden von einer Minderheit dank Medienhype exotische Menschen in das «Hohe Haus» von Bern gewählt, deren Intelligenzquotient diametral zur Höhe dieses ach so hohen Hauses einzuordnen ist.
«Politische Dummheit ist die Königin der Dummheit» sagte einmal der deutsche Philosoph Manfred Hinrich. In Bezug auf dieses Grüne Juwel aus dem Aargau mit dem Cedric-Wermuth-Syndrom, das vermutlich von einem Psychiater als Psychose der unbewältigten Vergangenheit eingeordnet würde, kann man Hinrich nur beipflichten.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
24.1.2021 - Tag der Prominutten
Spätes Debut als Politiker: Warum der ehemalige Fernsehmoderator Kurt Äschenbecher gegen den EU-Rahmenvertrag kämpft
Bisher äusserte sich der 72-jährige Moderator politisch nicht. Nun ändert sich das: Kurt Aeschbacher engagiert sich neben anderen prominenten Gesichtern für das Komitee «Kompass Europa» und damit gegen das EU-Rahmenabkommen.
Einige dachten an einen Scherz, als das Komitee «Kompass Europa» vor Tagen mitteilte: Kurt Aeschbacher und Bernhard Russi machen mit im Kampf gegen das EU-Rahmenabkommen. Aeschbacher und Russi? Haben sich der vormalige Fernsehmoderator und der vormalige Skirennfahrer je in der Öffentlichkeit politisch geäussert?
Das haben sie nicht. Russi scheint die Sache nicht ganz geheuer. «Ich glaube, dass dieses Abkommen besser verhandelt werden muss», teilt er mit. Weiter will er sich nicht äussern, denn es solle nicht der Eindruck entstehen, dass er auf einmal etwas von Politik verstehe.
Aeschbacher, wie Russi 72 Jahre alt, gibt sich selbstbewusster: «Wenn man für das Fernsehen im Showbereich tätig ist, bedeutet das nicht, dass man kein Hirn hat.»
Er habe sich immer für Politik interessiert. Seine Verträge mit dem Schweizer Fernsehen hätten aber öffentliche politische Stellungnahmen ausgeschlossen. Daran habe er sich gehalten.
Aeschbacher hörte 2018 als Moderator seiner wöchentlichen Talkshow auf. Er tat das unfreiwillig, wie er verschiedentlich zu verstehen gab. Der damalige Fernsehchef Rudolf Matter war nicht als Ausbund an Einfühlsamkeit bekannt. Er teilte Aeschbacher, der zu den bekanntesten Fernsehgesichtern gehörte, die Absetzung seines Programms am Telefon mit. Und befand sich dabei auf dem Flughafen Wien. Selbst Aeschbachers Kritiker, die seinen Moderationsstil für betulich hielten, fanden das stillos.
Eine Freundschaft hat zum Engagement geführt
Der Berner moderiert nun Veranstaltungen – die seit dem Ausbruch der Pandemie aber eine nach der andern abgesagt werden. Langweilt sich Aeschbacher? Schliesst er sich einem politischen Komitee an, weil er das Rampenlicht vermisst?
«Ich bin seit langem befreundet mit der Familie Gantner. Es gibt immer wieder spannende Gespräche mit Fredy Gantner», sagt er. So sei es dazu gekommen, dass er sich beim «Kompass Europa» engagiere.
Fredy Gantner ist Mitgründer der milliardenschweren Partners Group, einer Gesellschaft, die auf Vermögensverwaltung spezialisiert ist und ihren Sitz im zugerischen Baar hat. Gantner lehnt das EU-Rahmenabkommen ab. Er hält dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse vor, dass er vor allem die Interessen multinationaler Konzerne wahrnehme und darum den Vertrag befürworte. Gantner kündigte im vergangenen Herbst an, dass er ein Komitee aus Wirtschaftsleuten zusammenstelle, die sich gegen das Abkommen aussprächen.
Überraschenderweise präsentierte der «Kompass Europa» vor wenigen Tagen auf seinem Onlineportal dann nicht nur Unternehmer und Manager, sondern auch bekannte Figuren aus anderen Bereichen. Den Schriftsteller Rolf Dobelli zum Beispiel. Den Musiker (und Unternehmer) Dieter Meier. Den Kunsthändler und Galeristen Iwan Wirth. Und eben Bernhard Russi und Kurt Aeschbacher.
«Cassis hat den Resetknopf nicht gefunden»
Nun denn, Herr Aeschbacher, was stört Sie am institutionellen Rahmenabkommen? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: «Bundesrat Cassis erklärte, er betätige in der Europapolitik den Resetknopf. Leider scheint er ihn nicht gefunden zu haben. Der Bundesrat machte einen riesigen Fehler, als er im Sommer 2019 erklärte, es brauche nur noch Klärungen beim Lohnschutz, der Unionsbürgerrichtlinie, den staatlichen Beihilfen. Dabei ist das Kernproblem des Rahmenabkommens die dynamische Rechtsübernahme und die vorgesehene Rolle des Europäischen Gerichtshofs. Das schränkt den Handlungsspielraum der Schweiz extrem ein.»
Uff! Aeschbacher redet weiter ohne Punkt und Komma, kritisiert die ausgeweitete Guillotineklausel und fügt an, mit dem jetzigen Rahmenvertrag könnte die Schweiz «grad so gut der EU beitreten.» Das ist eine gewagte Aussage. Es ist aber unverkennbar, dass sich der Moderator vertieft mit der Materie auseinandersetzt. Er kennt die Tücken des Vertrages. Und es wirkt nicht aufgesetzt, wenn er betont: «Die Einschränkung der Handlungsfreiheit der Schweiz betrifft mich als Bürger dieses Landes.»
Bekommt er Geld? «Niemals. Das wäre eine Todsünde»
Befürchtet er nicht, Moderationsaufträge zu verlieren, wenn er sich politisch positioniert? «Jä nu, das nehme ich in Kauf. Wir leben in einem Land der freien Meinungsäusserung.» Hat Herr Gantner ihm etwas bezahlt dafür, dass er beim Komitee mittut? «Das wäre eine Todsünde. Ich liesse mich doch nie kaufen für politische Haltungen.»
Aeschbacher versuchte als Moderator stets, seine Gäste mit Empathie zum Reden zu bringen. Ein Politiker darf vor der Konfrontation nicht zurückschrecken. Es ist darum unklar, ob Aeschbacher als Politiker reüssieren würde. Anderseits formuliert er geschliffen – und er ist sechs Jahr jünger als der neue Präsident der USA. Er sollte es vielleicht versuchen. Für welche Partei? Die SVP? Für Aeschbacher kommt das nicht in Frage: «Wenn jemand behauptet, ich stehe der SVP nahe, ist das eine boshafte Unterstellung. Ich vertrete liberales Gedankengut.» Schreibt die Aargauer Zeitung.
Wie schon Napoleon Bonaparte treffend bemerkte: «Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt.»
Das gilt auch für ehemalige Prominutten des Zwangsgebührensenders wie Kurt Äschenbecher und Visilab-Bernhard Russi, die scheinbar Mühe damit bekunden, nach der Pensionierung nicht mehr im täglichen Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen.
Das Marco-Rima-Syndrom scheint sie alle einzuholen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
23.1.2021 - Tag der Onlineshops
Geprellte Kunden sind «stinksauer»: Drei Frauen über ihre Erlebnisse mit der BHS Binkert Schweiz
Eine Vielzahl an Betreibungen laufen gegen die seit Montag konkursite BHS Binkert Schweiz GmbH mit Sitz in Frick. Der Online-Händler um Geschäftsführer Michael Binkert hat mit seinem Shop «Techniworld.ch» eine Flutwelle der Entrüstung geprellter Kunden auf sich gezogen. Der Tenor auf mehreren Bewertungsportalen im Netz: Kunden haben ihre bestellte Ware im Voraus bezahlt, diese aber nicht erhalten; ebenso wenig wie ihr Geld zurück.
Eine dieser geprellten Kunden ist Ekaterini Markopoulos aus Basel-Stadt. Im Juli 2020 bestellte sie für ihre Mutter eine Dunstabzugshaube und bezahlte rund 300 Franken im Voraus. Nur: Die Dunstabzugshaube kam nie an. Auf die Rückerstattung des Geldes wartet sie noch heute. «Ich bin stinksauer», sagt Markopoulos. «Nie hätte ich gedacht, dass in der Schweiz und so nahe bei mir, solch ein Betrug stattfinden kann», schiebt sie nach.
Online-Händler vertröstet immer wieder
Bestellt hat sie über «Techniworld.ch», weil der Shop mit einer kurzen Lieferzeit warb und ihre Mutter die Dunstabzugshaube dringend benötigte. Mit «Lieferschwierigkeiten wegen Corona», habe sie der Online-Händler abgespeist. Nach der Stornierung der Bestellung und der Rückforderung des Geldes, sei sie vom Kundenservice immer wieder vertröstet worden. Es hiess, dass man sich für die Verzögerung der Rücküberweisung entschuldige und man meine Kontodaten nochmals an die Buchhaltung weitergegeben habe, so dass ich in den nächsten sieben Tage mit der Überweisung rechnen könne, erzählt sie.
Schliesslich hat Markopoulos den Online-Händler betrieben – obwohl sie davon ausgeht, ihr Geld nicht mehr wieder zu sehen. «Es geht mir ums Prinzip. Ich habe mir gedacht, vielleicht wird ihm das eine Lehre sein, andere Leute nicht mehr abzuzocken», sagt Markopolous.
Die Geschäftsmachenschaften des Online-Händlers stiessen auch Daniela Obradovic aus dem Raum Zürich sauer auf. Einen Drucker für 268 Franken wollte sie sich bei «Techniworld.ch» bestellen. Nur: Als sie den Drucker via Smartphone bezahlen wollte, kam es während des Traktionsprozesses zum Abbruch – gleiches passierte beim zweiten Versuch.
«Am nächsten Tag habe ich gesehen, dass mir die 268 Franken zwei Mal von meinem Konto abgebucht wurden», sagt Obradovic, die kurz nach ihrer Bestellung vom Online-Händler eine E-Mail erhielt, dass ihr Drucker nicht lieferbar sei.
Eine Mitarbeiterin vom Payment-Service hätte Obradovic daraufhin gesagt, dass man ihre IBAN-Nummer hätte und ihr den Betrag in wenigen Tagen zurückerstatten würde – dazu kam es aber bis heute nicht. «Die Kommunikation des Online-Händlers läuft professionell und freundlich ab, doch in Wahrheit wird man hinters Licht geführt», enerviert sich Obradovic, die es «eine Schweinerei» findet, «Geld abzukassieren», aber dafür keine Gegenleistung zu erbringen.
Unter Zugzwang wegen ausbleibender Lieferung
Gar auf eine Rückerstattung von fast 900 Franken von der BHS Binkert Schweiz GmbH wartet Maria Luise Kleindienst, die in Schöftland ein Geschäft führt. Bestellt hat sie sich einen Kühlschrank und einen Geschirrspüler. «Eine Schweizer Firma mit einem seriösen Auftritt – das hat für mich zunächst gepasst», sagt Kleindienst. Doch auch sie sei vom Online-Händler «x-mal vertröstet» worden.
Als sie schliesslich damit drohte, einen Anwalt einzuschalten, habe sich das Unternehmen gemeldet und gesagt, sie solle doch mit dem Anwalt warten, denn man bemühe sich ja mit der Auslieferung, habe die Ware aber selbst noch nicht vom Zulieferer erhalten, erzählt Kleindienst. «Wieso kann das Unternehmen eigentlich nicht gleich ehrlich sein und sagen, was los ist», fragt sie sich.
Ärgerlich für Kleindienst: Dadurch, dass der Kühlschrank und der Geschirrspüler auf sich warten liessen, kam es zu Verzögerungen in der Herrichtung ihrer Bed & Breakfast-Wohnung. «Ich musste deswegen selbst meinen Küchenbauer immer wieder vertrösten und bin gegenüber meinen Kunden in Zugzwang gekommen», sagt Kleindienst. Über die Geschäftspraktiken des Online-Händlers kann sie nur den Kopf schütteln. Schreibt die Aargauer Zeitung.
Tja, das Mitleid mit den geprellten Damen aus dem Kanton Aargau bzw. Basel hält sich in Grenzen. Internet ist und bleibt eine Wundertüte und Spielwiese für Klein- und Grosskriminelle. Das ist inzwischen hinlänglich bekannt.
Ohne den Aargauerinnen jetzt «Geiz ist geil» zu unterstellen: Das World Wide Web verleitet einen dazu, nach dem günstigsten Angebot zu suchen. Und da landet man nicht selten auf Websites von unbekannten, möglicherweise zwielichtigen Webshops.
Dabei liegt das Gute speziell im Kanton Aargau mit dem führenden Schweizer Webshop auf der Hand: www.brack.ch. Brack ist niemals der «billigste» Webshop, dafür aber der beste. Da stimmt auch der Kundendienst, falls mal eine Reklamation ansteht! Ich spreche aus eigener Erfahrung seit beinahe 20 Jahren.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
22.1.2021 - Tag des Pfahlwurzelgeldes
Letztes Jahr wurden im Aargau 262 Millionen Franken Schwarzgeld offengelegt – der Anstieg überrascht
Die schweizweit seit 2010 gültige kleine Steueramnestie, aufgrund der sich jeder und jede einmal im Leben selbst anzeigen kann, bringt dem Kanton Aargau auch heute noch Jahr für Jahr spürbare Mehreinnahmen. 619 Personen legten 262 Millionen Franken offen.
Erstaunlich ist dies, weil die straflose Selbstanzeige bei bisher nicht deklarierten Vermögen in 71 Ländern nicht mehr funktioniert, seit die Schweiz mit diesen den Automatischen Informationsaustausch (AIA) praktiziert. Für Vermögen in der Schweiz selbst gilt dies aber weiterhin.
So zeigten sich letztes Jahr nach Angaben des Kantons beim kantonalen Steueramt 619 Personen wegen Steuerhinterziehung selbst an. Zur Nachbesteuerung angemeldet wurden dabei Vermögen mit einem Gesamtwert von 262 Millionen Franken. Das ist sogar etwas mehr als im Vorjahr (vgl. Grafik unten). Für den Kanton und die Gemeinden resultierten daraus zusätzliche Steuereinnahmen in der Höhe von 22,5 Millionen Franken und für den Bund von rund 5,6 Millionen Franken. Grösstenteils sind kleinere Vermögenswerte betroffen.
Erstaunen beim Steueramt
Beim Kanton hatte man eigentlich erwartet, dass die Selbstanzeigen im Jahr 2020 abnehmen würden, da der AIA von anfänglich 38 auf 33 weitere Staaten ausgeweitet worden ist. Dadurch können nicht gemeldete Konti und Wertschriftendepots aus diesen Ländern ebenfalls nicht mehr straffrei nachgemeldet werden. Da erstaunt es den kantonalen Steueramtsvorsteher Dave Siegrist, dass immer noch so viele Vermögenswerte nachgemeldet und auf diesem Weg legalisiert werden. Für ihn ist klar: «Die kleine Steueramnestie in der Schweiz ist weiterhin sinnvoll.»
Eine Zwischenbilanz seit Gültigkeit der Steueramnestie ab 2010 zeigt: Bisher wurden allein im Kanton Aargau dem Fiskus Vermögenswerte im Gesamtwert von 2,03 Milliarden Franken zur straffreien Nachbesteuerung angemeldet.
Kanton führt auch von sich aus Verfahren durch
Der Kanton wartet übrigens nicht einfach, bis sich jemand meldet, sondern wird auch von sich aus aktiv. Letztes Jahr führte das Kantonale Steueramt – abgesehen von den Selbstanzeigen – rund 500 Nachsteuer- und Bussenverfahren durch. Allein daraus resultierten rund 5,5 Millionen Franken Nachsteuern und Verzugszinsen sowie rund 3,1 Millionen Franken Bussen.
Steueramnestie nur noch für inländische Guthaben
Wer die kleine Steueramnestie nutzt, zahlt dann zwar Nachsteuern und Verzugszinsen, jedoch keine Bussen. Dies gilt weiterhin, wenn jemand in diesem Jahr ein inländisches Vermögen oder Einkommen legalisieren will, und noch nie von der kleinen Steueramnestie profitiert hat.
Es gilt aber seit Herbst 2018 beziehungsweise 2019 nicht mehr für ausländische Bankguthaben und Wertschriftendepots in den 71 Staaten, die im Rahmen des Automatischen Informationsaustauschs (AIA) ihre Finanzdaten mit der Schweiz ausgetauscht haben. Da sind keine straffreien Selbstanzeigen mehr möglich. Das betrifft beispielsweise alle EU-Mitgliedsländer, also auch alle Nachbarländer der Schweiz inklusive Liechtenstein, die USA, Kanada, Russland und China.
Fast 10 Milliarden kamen schweizweit allein 2018 zum Vorschein
Die kleine Steueramnestie wirkt in allen Kantonen. Am meisten zuvor vor dem Fiskus versteckte Gelder sind bisher im Kanton Zürich offengelegt worden. Allein bis 2019 waren es 8 Milliarden Franken, also markant mehr als im Aargau. Gesamtschweizerisch sind allein im Jahr 2018 – noch bevor der Automatische Informationsaustausch in Kraft trat – laut NZZ fast 10 Milliarden Franken offengelegt worden. Schreibt die AZ.
Ich bin schockiert! Nicht über die Milliarden von Schwarzgeld, die in der Schweiz jeweils von einer Amnestie bis zur nächsten gewinnträchtig gehortet werden. Nein, sowas löst bei mir keinen Schock aus. Wer hat denn nicht ein paar Hunderternoten unter dem Kopfkissen? Alles halb so wild.
Blankes Entsetzen verursacht mir einzig und allein das Wort «Schwarzgeld». Ist dieses Wording seit der «Mohrenkopf»-Affäre nicht toxisch beladen? Die MIGROS soll laut Insiderinformationen der Enthüllungsplattform «Insideparadeplatz»ab kommendem Frühjahr die «Schwarzwurzel» in «Korbblütler» umbenennen. Es wäre somit mehr als angebracht, das Wort «Schwarzgeld» in «Pfahlwurzelgeld» umzubenennen!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
21.1.2021 - Tag der Badewanne
Enthüllungen zum Party-Skandal: Embolo soll sich in der Badewanne versteckt haben
Breel Embolo bestreitet, an einer illegalen Party teilgenommen zu haben. Die Polizei aber erhöht mit neuen Aussagen den Druck auf den Nati-Stürmer.
Jetzt könnte es eng werden für Breel Embolo!
Neue Aussagen der Polizei im Zuge der illegalen Party in der Nacht auf Sonntag belasten den Gladbach-Stürmer schwer.
Wie die «Frankfurter Allgemeine» schreibt, hat ein Polizei-Sprecher am Mittwoch mit seiner Schilderung des Ablaufs einen Bericht der «Bild», wonach Embolo vor den Beamten geflohen sei, bestätigt.
Der Sprecher erklärte die Szenen aus der Nacht auf Sonntag wie folgt, wie die «FAZ» schreibt: «Beim Eintreffen der Polizei sei aus dem coronabedingt geschlossenen Lokal am Essener Baldeneysee eine Person durch ein Fenster aufs Dach geflohen. Die Person sei über das Dach zu einer angrenzenden Wohnung gerannt und habe die Wohnung durch ein weiteres Fenster betreten. Die Polizei habe sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und dort eine einzelne Person angetroffen.» Diese Person sei Embolo gewesen, so der Sprecher, der ausführt: «Er war allein in der Räumlichkeit.»
Embolo in der Badewanne?
Eine Möglichkeit, die Wohnung unerkannt zu verlassen, habe es nicht gegeben, weil die Polizei das Lokal umstellt hatte: «Deshalb gehen wir davon aus, dass der Mann, der über das Dach geflohen ist, Embolo war.»
Wie die «Bild» am Mittwochabend berichtet, soll sich der Nati-Star in der Badewanne vor der Polizei versteckt haben. Die Zeitung berichtet weiter, dass Embolo vorschlug, Geld für einen guten Zweck zu spenden. Er soll deshalb bei Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen nach einem Termin gefragt haben.
Die Polizei hatte bei der Party 23 Personen vorgefunden – 15 leicht bekleidete Frauen und 8 Männer. Ohne Masken. Und das mitten in der Corona-Pandemie.
Schon am Montag bestätigte die Polizei, dass unter den 23 Personen zwei mit Schweizer Staatsbürgerschaft waren.
Embolo hingegen streitet ab, an der Party teilgenommen zu haben – und behauptet, in der Nähe des Lokals mit zwei Freunden am TV Basketball geschaut zu haben.
Was macht Gladbach?
Wie reagiert jetzt Gladbach? Wurde der Verein von Embolo angelogen? «Solange es kein anderes Ermittlungsergebnis gibt von der Polizei, glauben wir Breel Embolo», meint ein Sprecher des Klubs zu den neuen Aussagen der Polizei.
Schon zuvor hatten die Gladbacher erklärt, der Stürmer habe glaubhaft versichern können, nicht an der illegalen Feier dabei gewesen zu sein. Trainer Marco Rose hat zunächst erklärt, Embolo fürs Spiel gegen Dortmund vom Freitag aufzubieten.
Ob das nach der jüngsten Darstellung der Polizei nach wie vor so ist? Schreibt Blick.
«Wer unter Euch sich noch nie in einer Badewanne versteckt hat, werfe den ersten Stein.» Soll Jesus gesagt haben. So steht's jedenfalls geschrieben in den Versen 7,53–8,11 des Johannesevangeliums.
Nehmt Euch das zu Herzen, die Ihr jetzt den armen Embolo steinigt!
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
20.1.2021 - Tag der Naturgesetze
Wieder Ausschreitungen in Tunesien
Zehn Jahre nach dem Arabischen Frühling, kam es vor allem in ärmeren Stadtteilen von Tunis zu gewaltsamen Konfrontationen. In Tunesien ist es die fünfte Nacht in Folge zu Zusammenstößen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Bereits tagsüber skandierten Protestierer in Tunis die Parole: "Das Volk will den Fall des Regimes". Vor allem in ärmeren Stadtteilen von Tunis kam es zu gewaltsamen Konfrontationen.
Die Ausschreitungen folgten dem zehnten Jahrestag einer Revolution, die dem Land Demokratie bescherte, aber kaum zu wirtschaftlichen Fortschritt führte. 2011 waren Proteste in Sidi Bouzid eine der Initialzündungen des Arabischen Frühlings. In mehreren Staaten kam es zu Massenkundgebungen gegen autokratische Regierungen und Forderungen nach mehr Demokratie. Am Dienstag kam es auch wieder in Sidi Bouzid zu Protesten. Augenzeugen sagten Reuters, die Polizei habe Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt, die Parolen gegen die Herrschenden riefen. Schreibt DER STANDARD.
Es ist und bleibt ein Naturgesetz: Nach jedem Frühling folgt irgendwann ein Winter. Das sollten die Geheimdienste und NGO der westlichen Wertegemeinschaft stets bedenken, bevor sie planlos eine Revolution anzetteln.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
19.1.2020 - Tag er schrillen Forderungen
Nach fest kommt ab
Obwohl das Impfen anläuft, entgleitet die Krise dem Griff der Politik: Die Forderungen werden immer schriller, die Umsetzung immer löchriger.
Im Kanzleramt, so erzählt man sich, kursiert ein Rechenspiel: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen könnte auf absolut null gedrückt werden, wenn wir alle 14 Tage (allein) ins Bett gingen und die Decke über den Kopf zögen: Deutschland, ein Winterschlaf, der gesamtgesellschaftliche reset. Das ist selbstredend kein Plan der Bundesregierung, aber es ist ein mindset. In diesem set agiert auch die neue Bewegung #zerocovid, die ein europaweit vollständiges Herunterfahren der Wirtschaft fordert und es als »Null-Lösung« auf die Seite eins der »taz« geschafft hat.
Ich will niemandem zu nahe treten oder ihm die Angst vor Corona absprechen, aber ich werde den Verdacht nicht los, dass bei #zerocovid ein paar Rechnungen mitkommen, welche die einschlägigen Milieus endlich beglichen sehen möchten: die mit Kapitalismus und Konsum etwa oder mit den Reichen an und für sich. Die Kosten für das Schließen von »Fabriken, Büros, Baustellen und Schulen« sollen nämlich über eine Abgabe auf hohe Einkommen und Vermögen hereingeholt werden. Was Aktivisten halt so einfällt.
Schlechte Nachrichten also zu Beginn dieser Woche: Corona wird zusehends zum Aktionsfeld der 150-Prozentigen, der pragmatische Konservative betrachtet es mit Argwohn. Morgen im Kanzleramt sucht Deutschland den Superlockdown, und mit Blick auf die Runde der Ministerpräsidenten bei der Bundeskanzlerin möchte ich an jene Worte erinnern, die am Mahnmal des unbekannten Hobbyklempners prangen: »Nach fest kommt ab!«
• Zum Beispiel wäre es ja nicht abwegig, erst einmal jenen »harten Lockdown« durchzusetzen, den wir seit mehreren Wochen schon haben, beschlossen zwar, aber nur löchrig vollzogen. So überschreitet Winfried Kretschmann, Landesvater BaWü, die Grenze zur Dreistigkeit, wenn er bereits jetzt nach einem härteren Lockdown ruft, obwohl er die beschlossene 15-km-Radius-Beschränkung in besonders betroffenen Regionen gar nicht anwenden lässt. Dasselbe gilt für den Umgang mit Schulen und Kitas. Auch hier gelten die Beschlüsse grundsätzlich für alle 16 Länder – und wurden von eben diesen 16 Ländern an 16 verschiedenen Stellen wieder aufgeribbelt.
• Man könnte zunächst auch einige Ungereimtheiten begradigen, die umso mehr an der Disziplin nagen, je härter die Eingriffe in den Alltag ausfallen. Nur ein Beispiel: Nach den geltenden Regeln zur Kontaktbeschränkung darf ein (erwachsenes) Kind seine Eltern daheim besuchen, nicht aber die Eltern das (erwachsene) Kind in dessen Zuhause. Kann mir irgendjemand erklären, warum?
• Stand Sonntag sind in Deutschland mehr als eine Million Menschen geimpft, es könnte schneller gehen, andere Staaten sind weiter. Doch warum in die Ferne schweifen, aus Nordosten kommt das Licht. Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten sollten ergo beschließen, dass ab sofort alle Bundesländer so verfahren wie Mecklenburg-Vorpommern, das fast doppelt so viel impft wie der Bundesschnitt und damit einen europäischen Spitzenplatz hat. Außerdem sollten sich Angela Merkel, das gesamte Kabinett und der Bundespräsident vor laufender Kamera impfen lassen, um ein Zeichen der Zuversicht zu setzen. In einschlägigen Internetforen werden bereits Fragen herumgereicht, warum sie das nicht tut. Weil sie ein Echsenmensch ist? Von Bill Gates schon vor 15 Jahren gechipt wurde? Selbst diese Geister sollte man nicht allein lassen.
• Und schließlich müssen wir uns vorsichtig der Frage nähern, ob die Inzidenzzahl von 50 das allein kursbestimmende Ziel bleiben soll oder wir auch mit höheren Infektionszahlen leben könnten, wenn sie sich nicht mehr in überlasteten Intensivstationen und hohen Sterbezahlen niederschlagen. Die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, das ist schließlich keine medizinisch begründete Zahl, sondern eine, die behördliche Belastungsgrenzen markiert, peinlich genug. Wenn aber ein besserer Außenschutz der Altenheime sowie die fortschreitende Impfung der Bewohner gerade jene Gruppe gegen einen schweren Verlauf der Infektion absichert, die mit Abstand die meisten Todesopfer zu beklagen hat – dann büßt die Inzidenzzahl 50 ihre existenzielle Bedeutung ein. Dann wird die Kettenreaktion unterbrochen, die bis dato unausweichlich von der eintretenden Überforderung der Gesundheitsbehörden über die Altenheime auf die Intensivstationen und Friedhöfe eskaliert. Wer geimpft ist, kann sich vielleicht noch anstecken. Aber nicht mehr an Corona sterben.
Das scheint mir einer frühen Debatte und Abwägung wert, nicht zuletzt, damit die Politik bei der Abkehr von der 50 nicht wirkt wie der Fuchs in der Fabel, dem die Trauben zu sauer sind. Ich halte diese Abkehr von der 50 für wahrscheinlich, weil ein Superlockdown, der auch ohne die Hilfe frühlingshafter Temperaturen das Infektionsgeschehen unter die Inzidenz von 50 drückt, mit sozialen, wirtschaftlichen und politischen Kosten erkauft werden müsste, die weit über denen des ersten Lockdowns lägen. Dabei sehen mehrere Kennzahlen der Krise besser aus als vor ein oder zwei Wochen.
Die Bundeskanzlerin will trotzdem härtere Beschränkungen, weil sie die ausbreitungsstarke, britische Mutation des Virus fürchtet. Und ja, mit früheren Warnungen hat sie mehrfach recht behalten. Aber das sollte sie nicht stur machen, sondern souverän und offen für einen neuen Lösungsmix. Nur für eine, die nichts als einen Hammer hat, sehen alle Probleme aus wie Nägel. Schreibt SPIEGEL-Kolumnist Nikolaus Blome.
Wie wahr! «Die Forderungen werden immer schriller.» Und zwar in beide Richtungen: Die einen bekommen nicht genug Hardcore-Lockdown-Massnahmen, während den andern schon ein Stoff-Fetzen im Gesicht die Menschenrechte aufs Gröbste verletzt.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
18.1.2021 - Tag der bildungsfernen SP-Mitglieder*innen
Neues Buch zur Abstimmung vom 7. März – Luzerner Islam-Experte zum Burkaverbot: «Es sind keine unterdrückten Frauen»
In der Zentralschweiz lebt kaum eine verhüllte Frau, wie das neue Buch von Andreas Tunger-Zanetti zeigt. Der Luzerner Religionsforscher sagt, was wirklich hinter der Burka-Debatte steckt und wie die alltäglich gewordenen Corona-Masken die Abstimmung am 7. März beeinflussen könnten.
Warum diskutiert die Schweiz seit 15 Jahren über ein Kleidungsstück, das praktisch nie anzutreffen ist?
Diese Frage stellt der Luzerner Religionsforscher Andreas Tunger-Zanetti, der gemeinsam mit fünf Studentinnen das Buch «Verhüllung» verfasst hat. Es erscheint pünktlich zum Abstimmungskampf über die Burka-Initiative, die am 7. März an die Urne kommt.
Das Buch liefert interessante Erkenntnisse, etwa was die Zahlen betrifft. Gemäss Tunger-Zanetti tragen wahrscheinlich zwischen 20 und 30 Frauen den Nikab – ein Gesichtsschleier, der die Augenpartie freilässt (im Unterschied zur noch strengeren Ganzkörper-Verschleierung Burka, der im Bereich der Augen eine Art Sichtfenster hat). In der Zentralschweiz könne man davon ausgehen, dass es keine oder höchstens eine sei. Laut dem Buch sind verhüllte Frauen in der Schweiz also ein absolutes Randphänomen.
Wieso irritiert uns der Schleier?
Und dennoch: Wer auf eine verschleierte Frau trifft, reagiert oft mit Befremden. «Klar, das ist auch für mich irritierend, denn wir sind uns das nicht gewohnt», sagt Tunger-Zanetti. Wobei sich das mit den Corona-Gesichtsmasken nun ändert, aber dazu später mehr. Den Frauen, die sich für die Verhüllung entscheiden, sei die Irritation sehr wohl bewusst. Wieso entscheiden sie sich trotzdem dazu?
Bei dieser Frage räumen die Autoren des Buchs mit einem oft gehörten Vorurteil auf. «Frauen in Westeuropa verhüllen sich nicht, weil sie von einem Mann dazu gezwungen werden», stellt Andreas Tunger-Zanetti klar. «Typischerweise sind sie im Westen sozialisiert, durchschnittlich bis sehr gut gebildet – und tragen den Nikab aus eigener Überzeugung, oft sogar gegen den Willen ihrer Familie.» Denn für Angehörige bedeutet das oft schwierige, unangenehme Situationen. Auch die Frauen selber erlebten oft negative Reaktionen und würden verbal oder sogar tätlich angegriffen – was das Sicherheitsargument in der Debatte ins Gegenteil verkehrt.
Insofern ist laut Andreas Tunger-Zanetti das Tragen des Gesichtsschleiers für die Betroffenen mit einem hohen Kraftaufwand verbunden. «Es sind keine unterdrückten Frauen, aber ihr Entscheid ist eine Form der Selbstausgrenzung.»
Das veranschaulicht das Gespräch mit einer Schweizer Nikab-Trägerin, die im Buch zu Wort kommt. Bei ihr waren mehrere Gründe ausschlaggebend für die Verhüllung: Einerseits der Wunsch, sich gegenüber Männern abzugrenzen. «In der Gesellschaft vertrete ich oft vielleicht nicht das, was die grosse Allgemeinheit vertritt: mit unserer Körperkultur, unserer Nacktheit, mit dem lockeren Umgang gegenüber dem anderen Geschlecht», wird sie zitiert. Ihr Aussehen solle dem eigenen Mann vorbehalten sein.
Gleichzeitig versteht sie die Verschleierung für sich als Möglichkeit, ihre Gottesfurcht auszudrücken – ohne das auch von anderen Musliminnen zu erwarten.
Wer hat Angst vor Fakten?
Solche Stimmen von Direktbetroffenen hört man in der öffentlichen Debatte selten. Bis auf die im März 2020 verstorbene Nora Illi vom Islamischen Zentralrat kamen Nikab-Trägerinnen in den Medien kaum je selber zu Wort.
Für Tunger-Zanetti ein Indiz, dass die Debatte losgelöst von der individuellen Realität der Betroffenen geführt werde. Ohnehin dringen Fakten in der Debatte zu wenig durch, so das Fazit der Buchautoren nach einer Medienanalyse im zweiten Teil des Buches. Aufgrund des Wandels in der Medienlandschaft gebe es auf den Redaktionen immer weniger Fachkompetenz, um religiöse Phänomene adäquat einzuordnen.
Stattdessen prägten plakative Bilder und Emotionen den Diskurs. «Und weil die Diskussion von Emotionen lebt, stört das auch kaum jemanden, im Gegenteil: Weil es im Kern gar nicht um die Frage der Kleidung, sondern um Entwürfe für die Gesellschaft geht, sind es eher die konkreten Fakten, die stören», analysiert der Religionswissenschaftler.
Argumente für ein Burka-Verbot sucht man im Buch vergebens. Es gebe schlicht keine, sagt Andreas Tunger-Zanetti. Er macht aus seiner persönlichen Haltung kein Geheimnis, sondern weist sie in der Einleitung transparent aus. Gleichwohl ist es kein politisches Buch, sondern das populäre Sachbuch eines Sozialwissenschaftlers. «Ich verstehe mich nicht als politischen Akteur, sondern als Wissenschaftler, der auch eine gewisse Verpflichtung hat, gesellschaftlich relevante Erkenntnisse seiner Arbeit in eine öffentliche Debatte einzubringen.»
Und plötzlich sind alle verhüllt
Und diese Debatte geschieht nun pikanterweise genau während der Coronakrise. Ob im Bus, im Laden oder am Arbeitsplatz: Verhüllte Gesichter sind zum Standard geworden. Die Initianten rund um das «Egerkinger Komitee» betonen, dass Covid-19 die Initiative nicht tangiere. Der Initiativtext sehe Ausnahmen vor, wenn gesundheitliche Gründe für eine Verhüllung des Gesichts vorliegen (oder auch wenn man Skifahren oder an die Fasnacht will).
Andreas Tunger-Zanetti ist derweil überzeugt, dass die Maskenpflicht während der Coronakrise einen Einfluss auf die Burka-Debatte hat. Die für das Buch befragte Nikab-Trägerin gab zu Wort, dass sie bereits positive Auswirkungen spüre – die Anfeindungen seien stark zurückgegangen. «Vielleicht hat in den Köpfen der Leute ein Umdenken stattgefunden», sagt sie im Buch.
Auch die politische Debatte ist davon nicht ausgenommen. «Das Argument, man könne wegen des verdeckten Gesichts nicht kommunizieren, dürfte weniger Gewicht haben», so der Luzerner Islamwissenschaftler. «Und vielleicht wird das Thema angesichts der Coronakrise heute eher als unwichtig wahrgenommen.» Schreibt ZentralPlus.
«In der Zentralschweiz lebt kaum eine verhüllte Frau» schreibt Andreas Tunger-Zanetti in seinem Buch «Verhüllung. Die Burka-Debatte in der Schweiz». Das ist richtig. Als in der Zeit vor Corona noch Touristen*innen die Stadt Luzern besuchten, sah man ab und zu Gruppen vollverhüllter Damen vorwiegend bei Bucherer am Schwanenplatz oder auf dem Rückweg zum Reisebus auf dem Europaplatz. Dabei handelte es sich in der Regel um vermögende Salafistinnen aus Saudi Arabien.
Persönlich kenne ich in der Zentralschweiz tatsächlich auch nur eine einzige vollverschleierte Frau, die das islamische Kleidungsstück mit den leicht skurrilen Sehschlitzen selbst in der öffentlichen Badeanstalt zur Schau stellt.
Notabene die Ehefrau eines jungen Secondos türkischer Abstammung, der in der Schweiz geboren ist und seine Gattin aus Anatolien in die Schweiz holte. Die Kinder des Ehepaars werden Korangetreu erzogen und geniessen trotz himmeltraurigen Deutschkenntnissen Nachhilfeunterricht in der türkischen Sprache.
So viel zur Integration von strenggläubigen Muslimen*innen der zweiten Generation. Das sollte uns zu denken geben und nicht eine stupide, von der SVP initiierte Volksabstimmung über die Burka. Die Argumente der SVP über die «unterdrückten Musliminnen» sind hirnrissig und verlogen. Die Abstimmung dient lediglich der Befriedigung des bildungsfernen Partei-Fussvolkes.
Nicht WIR entscheiden über die Bekleidung muslimischer Frauen, sondern einzig und allein die Musliminnen. Wenn diese mit ihrem von irgendwelchen vorsintflutlichen Propheten verordneten Fastnachtskostüm, das sie laut SVP-Meinung einzig und allein auf Befehl ihrer Ehemänner tragen MÜSSEN, nicht mehr einverstanden sind, liegt es einzig und allein an den Musliminnen, dies mit einem «Lieber Ali, steck dir deine Burka in den Allerwertesten» (oder so ähnlich) zu ändern.
So wie die SCHWEIZER FRAUEN vor noch gar nicht so langer Zeit (1971!) ihr Stimmrecht ebenfalls selbst erkämpfen mussten. Kantonal dauerte es sogar noch länger: Appenzell Innerrhoden musste durch einen Bundesgerichtsentscheid (November 1990 !) als letzter Kanton das Stimmrecht für Frauen auf kantonaler Ebene einführen. Und dies entgegen einem Mehrheitsentscheid der Männer an der Landsgemeinde am 29. April 1990. Es darf vermutet werden, dass bei diesem Mehrheitsentscheid nicht wenige SVP-Männer gegen ihre eigenen Ehefrauen abgestimmt haben.
Diese widersinnige und absolut unnötige Volksabstimmung verschafft den Hardcore-Islamisten einmal mehr die Gelegenheit, sich als Opfer zu stilisieren. Kommt hinzu, dass die Vollverschleierung im amtlichen Raum (Schulen, Gerichte etc.) längst gesetzlich geregelt ist.
Das war schon bei der ebenfalls von der SVP initiierten Abstimmung über Minarette in der Schweiz der Fall: Nicht ein einziges der vier oder fünf (!) damals geplanten Minarette, über die ein ganzes Volk abstimmen musste, hätte je gebaut werden können. Die bestehenden Schweizer Baugesetze hätten jedes einzelne Minarett verhindert.
Eine Frage an die SVP sei zum Schluss erlaubt: Haben wir wirklich keine anderen Probleme als die Steinzeit-Mode muslimischer Frauen?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
17.1.2021 - Tag der Big Tech-Narrenfreiheit
Darf Big Tech Kickl und Trump einfach abdrehen?
Die Plattform Youtube hat nun eine Parlamentsrede von Herbert Kickl, dem Klubobmann der FPÖ im Nationalrat, gelöscht, weil sie "gegen die im Falle medizinischer Falschinformationen geltenden Regeln" verstoße.
Die FPÖ ist de facto die einzige Impfgegner- und Corona-Leugner-Partei Österreichs. Kickl gibt zu diesen Themen haarsträubenden bis bösartigen Unsinn von sich. Und doch: Er ist immerhin Klubchef einer Parlamentspartei, und da dreht man ihm die im Hohen Haus gehaltene Rede so einfach ab? Die Rede war auf dem FPÖ-Kanal auf Youtube erschienen.
Youtube, ein Megakonzern (und Tochter des Gigakonzerns Google), darf entscheiden, was von einem gewählten Volksvertreter eine breitere Öffentlichkeit erreicht oder nicht? Und ausgerechnet Youtube, dessen Geschäftsmodell – wie bei allen anderen "Big Tech"-Konzernen und -Plattformen (Twitter, Facebook) – es auch ist, eine "Erregungsmaschine" zu sein? Die Algorithmen von Big Tech sind darauf angelegt, die Emotionen anzustacheln und so die User möglichst lange bei sich zu behalten.
Die Problematik wird gerade heiß diskutiert, denn in einer gewaltigen Kehrtwendung haben Twitter, Facebook und Youtube gerade den auslaufenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, gesperrt. Dies, obwohl er 88 Millionen Follower auf Twitter und 35 Millionen auf Facebook hatte – und sie ihm jahrelang, schon vor seiner Präsidentschaft, alles durchgehen ließen. Motiviert war der Entschluss übrigens auch durch eine Revolte der eigenen Mitarbeiter.
Youtube begründete seine Entscheidung, Kickl rauszukicken, übrigens mit einem Verstoß gegen die eigene "Richtlinie zu medizinischen Fehlinformationen über Covid-19". Diese Richtlinien untersagen die Verbreitung von Falschinformationen über Behandlung, Prävention, Diagnose und Übertragung von Covid-19.
"Lockdown-Fetischismus"
Kickl hat zweifellos polemischen Unsinn, gepaart mit Unwahrheiten, in seiner Rede (und nicht nur dort) in die Welt geschleudert. Er sprach von "Impfzwang im Klassenzimmer", "Lockdown-Fetischismus", "Unfreiheit und Totalitarismus". Dinge, die tausendfach und noch viel ärger von anderen "Querdenkern" verbreitet werden. Es ist nicht sicher, ob er dafür vor einem Gericht verurteilt würde (wegen Hetze oder Verleumdung). Die österreichische Judikatur erlaubt auch harte "kritische Werturteile", solange sie durch ein hinreichendes Tatsachensubstrat gedeckt und in Relation zu diesem nicht exzessiv sind und sich nicht in bloß formalen Ehrenbeleidigungen erschöpfen.
Andererseits: Zu viel ist zu viel. Zu diesem Schluss sind auch die Big-Tech-Konzerne gekommen, nachdem sie Trump gezählte 20.000 Lügen und ungezählte Beleidigungen in vier Präsidentenjahren hatten durchgehen lassen. Auslöser war laut Twitter die Gefahr, dass er neuerlich zu Gewalt aufrufen könnte, wie beim Sturm aufs Kapitol.
Doch es bleibt das Unbehagen in Bezug auf die Willkür von Big Tech, die einmal so und dann wieder so ausfallen kann (ganz abgesehen davon, dass nun die ebenfalls gesperrten rechten Plattformen in den Untergrund wandern). Auf den Punkt gebracht hat es Angela Merkel, die zur Twitter-Sperre von Trump bemerkenswerterweise sagt, die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut und Eingriffe könne es nur auf der Basis von Gesetzen geben, nicht auf Beschluss von Netzwerkbetreibern.
"Auf der Basis von Gesetzen". Das bedeutet wohl eine Riesenarbeit, die Macht von Big Tech in einer Regulierung einzufangen. Schreibt DER STANDARD.
Eine selten dämliche Frage von Hans Rauscher. Natürlich darf Big Tech abschalten, was immer Big Tech abschalten will. Warum? Weil sie es können und weil sie bei allen Regierungen worldwide live Narren- und Steuerfreiheit geniessen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
16.1.2021 - Tag der Blick-Leser*innen
Sogar im Bordell herrscht Föderalismus: Puff um Puffs
Laut dem Bund können die Bordelle in der Schweiz offen bleiben. Die Nachricht hat sich in Europa wie ein Lauffeuer verbreitet. Zahlreiche Sexarbeiterinnen wollen bei uns ihre Dienste anbieten – beispielsweise in Zürich. Doch hier sind die Bordelle geschlossen.
«In der Schweiz sind die Erotikstudios weiterhin offen.» So ähnlich lautete auch die Schlagzeile, die auf Blick.ch zu lesen war. Doch manche Kantone gehen beim Lockdown auch bei den Studios weiter als der Bund.
«Ich bedaure sehr, dass Zürich und andere Kantone die Erotikstudios geschlossen haben – und wir nun auch hier unter einem föderalistischen Flickenteppich leiden», sagt Beatrice Bänninger, Geschäftsführerin der Zürcher Stadtmission.
Denn: «Das Telefon unserer Beratungsstelle läuft Sturm, seit Blick.ch titelte, dass Erotikstudios offenbleiben dürfen.» Selbst aus dem Ausland habe man zahlreiche Anrufe erhalten, ob das stimme, dass Sexarbeiterinnen bei uns noch ihre Dienstleistungen anbieten dürfen. Doch allen musste man sagen, dass im Kanton Zürich die Bordelle geschlossen bleiben.
«Prostitution findet so oder so statt»
Für Bänninger macht die Schliessung keinen Sinn. Das hätte man schon beim ersten Lockdown im Frühling gesehen. «Die Prostitution findet so oder so statt. Es gibt dann einfach extrem viele Kontrollen und horrende Bussen.» Sie ist überzeugt, der Bund habe «weise gehandelt hat», als er die Erotikstudios offen liess.
Untersage man die Ausübung von Prostitution, wanderten die Sexarbeiterinnen in die Illegalität ab. Schliesslich müssten sie ja irgendwie überleben. Bänninger: «Mit einem Verbot lässt sich die Prostitution aber nicht mehr kontrollieren und die Gesundheitsprävention kann nicht mehr funktionieren.»
Puffs sind kein Treiber der Pandemie
Doch gerade aus gesundheitlichen Gründen sieht die Geschäftsführerin der Stadtmission keine Veranlassung, weshalb in Zürich offiziell tote Hose herrschen soll: «Auf den ersten Blick mag man vermuten, dass es wegen der Pandemie keinen Sinn macht, die Prostitution zu erlauben.» Abstand halten sei hier ja schwierig. «Die Prostitution ist aber kein Treiber der Pandemie, sagen die Experten, da Corona via die Atemwege übertragen wird», betont sie.
Für die Bordelle gibt es Schutzkonzepte, so wie andernorts auch. Nach jedem Freier muss die Bettwäsche ausgewechselt werden, es gilt eine Maskentragepflicht, und die Kunden müssen sich registrieren.
Bänninger nennt aber noch einen weiteren Grund, weshalb die Schliessungen für sie in Zürich keinen Sinn machen: «In der Stadt Zürich haben wir 138 Sexbetriebe und im restlichen Kanton nochmals etwa 140 Erotikunternehmen. Diese fallen kaum ins Gewicht im Vergleich zu den vielleicht 3000 Gastrobetrieben oder so, die es vermutlich in unserem Kanton gibt.»
50 Prozent mehr Sexarbeiterinnen in Bern
Sie bemängelt weiter, «wir haben keinen Überblick darüber, was für eine Sexdienstleistung in welchem Kanton, zu welcher Uhrzeit erlaubt ist und welche nicht.» Man wisse in Zürich nur: «Bei uns ist alles verboten.» In anderen Kantonen müssten die Bordelle abends schliessen. «Ich weiss nicht, wer hier noch den Überblick hat.»
Neben Zürich haben beispielsweise auch Aargau, Genf, Luzern, Solothurn und Thurgau Verbote erlassen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die anderen Kantone, die keine Schliessungen verordnet haben.
So sagt Alexander Ott, Vorsteher der Fremdenpolizei der Stadt Bern: «Wir verzeichnen seit Montag alleine in der Stadt eine Zunahme der Personen im Sexgewerbe von rund 80 auf etwa 120 Personen.» Das sei sicher Prostitutionsverboten in anderen Kantonen geschuldet. Die Auswirkungen für Kantone wie Bern sind klar: «Damit wächst der Druck auf die Arbeitstätigen im Rotlichtmilieu enorm.»
Geschäftlicher oder privater Beischlaf?
In Kantonen wie Bern, die für die Erotikbranche keine schärferen Massnahmen haben als die vom Bund getroffenen, gilt, dass die Studios zwar ab 19 Uhr über Nacht bis um 6 Uhr morgens geschlossen sein müssen.
Dabei gibt Ott zu bedenken: «Sie können nicht das ganze Leben regeln.» Wie beispielsweise wolle man beweisen, dass es sich bei einer Escortdame, die bei jemandem nächtigt, um die Ausübung einer sexuellen Dienstleistung handelt? «Vielleicht hat sie auch nur einen Bekannten besucht und ist halt über Nacht geblieben.» Schreibt Blick.
Dieser Artikel landete heute (Stand 08.52 Uhr) als Hauptaufmacher der täglichen Corona-Horrormeldungen auf der Frontseite von Blick online. Das sagt uns wenig über die Pandemie aus, dafür aber umso mehr über die Leser*innen des grössten Schweizer Medien-Online-Portals.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
15.1.2021 - Tag der Organisationen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte
Initiative will Europas Wirtschaft komplett runterfahren – bis null Neuinfektionen
Mit dem Aufruf „#ZeroCovid“ ist in den sozialen Netzwerken eine Initiative angelaufen, die einen umfassenden Lockdown fordert. Europaweit solle die Wirtschaft heruntergefahren werden. Die Kosten sollen mit Abgaben auf hohe Einkommen und Vermögen gestemmt werden.
Eine Initiative von Wissenschaftlern, Aktivisten und Gesundheitspersonal fordert angesichts der Corona-Krise ein europaweites Herunterfahren auch für die Wirtschaft. „Shutdown heißt: Wir schränken unsere direkten Kontakte auf ein Minimum ein – und zwar auch am Arbeitsplatz!“, heißt es in dem Aufruf der Initiative „#ZeroCovid“.
„Wie viele andere Menschen auch wollen wir nicht länger diesen ewigen Lockdown light oder dieses ständige Hin und Her zwischen Verschärfungen und Lockerungen mittragen“, sagte Sprecher Oliver Kube am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Daher sei ein solidarischer „Shutdown aller nicht lebenswichtiger Bereiche, insbesondere der Wirtschaft“ nötig.
Dabei sei es ihnen besonders wichtig, dass die Schwächeren und Schwächsten nicht auf der Strecke blieben, sagte Kube. Um das zu gewährleisten, fordert die Initiative europaweite Covid-Solidaritätsabgaben auf hohe Vermögen oder Unternehmensgewinne. Etwaige Lohnausfälle sollen durch ein breit aufgestelltes soziales Rettungspaket aufgefangen werden.
„Die Initiative hält die bisherigen Versuche, die Pandemie zu kontrollieren, für gescheitert“, hieß es in dem Aufruf. Die Maßnahmen schränkten das Leben dauerhaft ein und hätten dennoch Millionen Infektionen und Zehntausende Tote gebracht. Durch Mutationen breite sich das Virus nun noch schneller aus. Die Infektionszahlen auf null zu drücken sei Voraussetzung, um die Krise bewältigen zu können. „Crush the Curve statt Flatten the Curve“ (Deutsch: Die Kurve brechen statt abflachen), forderte die Initiative.
Zu den Erstunterzeichnern gehören nach Angaben der Initiative etwa die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die Autorinnen Margarete Stokowski und Teresa Bücker sowie der Sea-Watch-Aktivist Ruben Neugebauer. Auch viele Wissenschaftler und Angestellte aus dem Gesundheitsbereich hätten demnach unterschrieben.
Margarete Stokowski schrieb auf Instagram, sie wünsche sich, dass der Aufruf „einfach zack sofort umgesetzt wird“. Auch Luisa Neubauer rief auf Twitter dazu auf, unter dem Hashtag #ZeroCovid zu diskutieren.
Die Kritik, ein solidarischer und umfangreicher Shutdown sei in Deutschland nicht möglich, hält der Sprecher für unberechtigt. „Wenn es mehrere andere Staaten gibt, die das bereits erfolgreich getan haben, dann ist das keine Frage der prinzipiellen Machbarkeit, sondern der machtpolitischen Durchsetzung.“
In Australien und Neuseeland ist das Vorhaben „Zero Covid“ auf Erfolg gestoßen, Wissenschaftler machen dafür eine harte Shutdown-Strategie verantwortlich. Schreibt DIE WELT.
Ich werde das etwas mulmige Gefühl nicht los, dass das Corona-Virus Hirnzellen zerstört, ohne dass man/frau/es damit infiziert sein muss. Immer vorausgesetzt, dass bei denen, die ich meine, überhaupt Hirnzellen vorhanden sind.
Bei der vergnüglichen Party dabei: Sea-Watch-Aktivist Ruben Neugebauer. Sea-Watch? Ist das nicht die Organisation, die das lukrative Geschäft der Schlepper mit Flüchtlingen beflügelt?
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
14.1.2021 - Tag der Polit-Eliten
Italiens Regierungskrise: Absurd und surreal
Die politische "Elite" Italiens hat in diesen Tagen wieder einmal ihre bekannten Mängel und Grenzen offenbart.
Mitten in der Covid-Pandemie, mitten im schlimmsten Gesundheitsnotstand seit dem Bestehen der italienischen Republik eine Regierungskrise anzuzetteln: Was am Mittwoch in Rom passierte, wirkt nur noch absurd und surreal. Die meisten Italiener haben derzeit andere Probleme: Millionen von ihnen droht der Abstieg in die Armut, zehntausende von Betrieben stehen vor dem Aus. Und etliche EU-Partner dürften sich allmählich fragen, ob es denn tatsächlich sinnvoll sei, Italien Wiederaufbauhilfen im Umfang von sagenhaften 209 Milliarden Euro zu gewähren.
Die politische "Elite" Italiens hat in diesen Tagen wieder einmal ihre bekannten Mängel und Grenzen offenbart: chronische Realitätsferne, Selbstbezogenheit, weitgehend fehlender Sinn für das Gemeinwohl, in Kombination mit einem offenbar unbezwingbaren Hang zur Personalisierung und zum Melodrama. Beim Showdown zwischen dem früheren und dem aktuellen Premier, zwischen Matteo Renzi und Giuseppe Conte, ging es zwar vordergründig auch um Inhalte – aber letztlich hat es sich von Beginn weg um einen Hahnenkampf zwischen zwei eitlen Leadern gehandelt, die sich selber für unersetzlich halten.
Allerdings: Es wäre verkürzt, den Bruch allein auf die persönlichen Eitelkeiten und Animositäten zwischen Renzi und Conte zurückzuführen. Die politische Krise in Rom ist letztlich auch die Folge der Zerstrittenheit und der ideologischen Gegensätze innerhalb der Koalition aus Fünf-Sterne-Protestbewegung und ihren drei linken Juniorpartnern PD, IV und Leu. Die Regierung war im September 2019 nur aus der Taufe gehoben worden, um die von Lega-Chef Matteo Salvini angestrebten Neuwahlen und dessen Marsch an die Spitze der Regierung zu verhindern. Ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Vision für Italien haben die Koalitionspartner nie entwickelt.
So gesehen könnte die irrwitzig anmutende politische Krise – sofern sich Renzis gestriger Austritt aus der Regierung am Ende nicht als Sturm im Wasserglas herausstellen wird – sogar noch zur Chance für Italien werden: Dann nämlich, wenn sich unter der Regie von Staatspräsident Sergio Mattarella die Parteien ihrer Verantwortung für das Land bewusst würden und Hand böten zu einer Regierung der nationalen Einheit, möglicherweise unter der Führung eines anerkannten Experten wie Ex-EZB-Chef Mario Draghi. Die Herausforderungen, die in den kommenden Wochen und Monaten auf das Land warten, wären groß genug. Schreibt DER STANDARD.
Dass Renzi gerne die Karte «maximales Risiko» spielt, ist längst bekannt. Als typischer Vertreter der jüngeren Politikergeneration versteckt er seine persönlichen Ziele stets mit den gleichen salbungsvollen Worten hinter angeblich hehren Absichten fürs «Volk».
Dass er selbst während einer weltweiten Krise, die auch Italien hart trifft, seine persönlichen Befindlichkeiten vor diejenigen des von ihm stets zitierten «Volkes» stellt, sagt alles über den Charakter dieses Politikers der typischen Polit-Elite aus.
Und da wundert sich noch jemand, dass Populisten und irrlichternde Verschwörungstheorien in gestandenen Demokratien Zulauf erhalten wie nie zuvor?
Trump & Konsorten fallen nicht einfach so vom Himmel. Dafür gibt es Gründe. Der Typus «Renzi» ist einer davon.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
13.1.2020 - Tag der ungelösten Probleme
KIFFER-HAUPTSTADT BERLIN: «Manche konsumieren sieben Gramm Cannabis am Tag»
Nirgendwo in Deutschland ist das Einstiegsalter für den Cannabis-Konsum niedriger als in Berlin. Während Rot-Rot-Grün in der Hauptstadt über eine Legalisierung diskutiert, warnen Suchtexperten vor einer Verharmlosung – und den Folgen für die Gehirnentwicklung.
Ein Park im bürgerlichen Berlin-Zehlendorf. Zwei Bänke. Ein paar lachende Jugendliche. Und der untrügliche Geruch von Cannabis, der seit dem Lockdown durch die Grünanlagen der Hauptstadt wabert, als gehöre er so selbstverständlich dazu wie der Geruch von moderndem Rasenschnitt und Hundehaufen.
Statistiken, die den Eindruck mit Zahlen bestätigen würden, dass in Corona-Zeiten mehr gekifft werde, gibt es noch nicht. Psychologen wissen allerdings, dass der allgemeine Ausnahmezustand – das Pausieren von Sportvereinen, die Schwierigkeit, Freunde zu treffen, das enge Zusammenleben in der Familie – Spannungen erhöht und somit das Risiko, sich mit Drogen Entspannung zu suchen.
Eines aber macht der Lockdown ganz sicher: Er verlagert nach außen, was sonst in Bars, Clubs und Kinderzimmern geschieht – und Suchtexperten schon seit Längerem Sorgen bereitet.
Eine Tonne Cannabis im Jahr - im Auftrag der BRD
Während dem aktuellen Drogenbericht zufolge Jugendliche so wenig rauchen und Alkohol trinken wie nie, nimmt der Cannabiskonsum deutlich zu und beginnt immer früher. Waren es 2011 noch 4,6 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen, die bei einer Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung angaben, Cannabis zu rauchen, sind es mittlerweile 10,4 Prozent dieser Altersgruppe.
Kiffer-Hauptstadt Berlin
Am alarmierendsten aber sind die Berliner Zahlen. Die Fachstelle für Suchtprävention, die mit Unterstützung der Senatsgesundheitsverwaltung Maßnahmen entwickelt und koordiniert, hat 2019 im Rahmen von Aufklärungsseminaren an Schulen 1725 Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren anonym befragt.
Demnach hatte gut ein Drittel Cannabis-Erfahrungen. 21 Prozent der Befragten war beim ersten Joint jünger als 14. Im Schnitt sind Jugendliche in der Hauptstadt 14,6 Jahre alt, wenn sie zum ersten Mal konsumieren und damit 1,8 Jahre jünger als der Bundesdurchschnitt. 27 Prozent der Konsumenten gaben an, mehrmals in der Woche zu kiffen, häufig auch schon morgens vor Schulbeginn.
„Das wirkt manchmal schon wie ein Stück Normalität“, sagt Christina Schadt aus dem Leitungsteam der Fachstelle für Suchtprävention. „Wir haben Handlungsbedarf.“
Die Experten sehen ihre Aufgabe in der Förderung von sogenannter Risikokompetenz. „Alle Kinder lernen, über die Straße zu gehen, weil das wichtig im Alltag ist. So sollten sie auch lernen, mit dem Risiko Sucht umzugehen.“ Dafür sei es wichtig, Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln, zu lernen: Ich kann auch Nein sagen.
Dass das in Berlin besonders wichtig ist, hat nicht zuletzt mit der großen Partyszene zu tun. Eine 2018 im Auftrag des Senats durchgeführte Umfrage unter Clubbesuchern ergab, dass für mehr als die Hälfte der Befragten Drogen zum Feiern einfach dazugehörten.
Für Burkard Dregger, innenpolitischer Sprecher und Fraktionschef der Berliner CDU, ist es kein Zufall, dass die Hauptstadt für Dealer und Konsumenten so attraktiv ist. Dregger verweist darauf, dass Berlin als einziges Bundesland 15 Gramm Cannabis als Eigenbedarf toleriert. Die Staatsanwaltschaft muss nicht, kann aber bei dieser Menge das Verfahren wegen Drogenbesitzes einstellen. In den meisten Bundesländern liegt die Eigenbedarfsgrenze bei fünf bis sechs Gramm.
15 Gramm, so Dregger, seien aber kein Eigenbedarf, sondern eine Monatsration beziehungsweise eine Menge, mit der sich das Dealen lohne. „Das organisierte Verbrechen freut sich über diese Beihilfe der rot-rot-grünen Koalition“, so Dregger.
„Drogendealer aus ganz Europa haben ihren Weg nach Berlin gefunden.“ Damit die Stadt nicht länger Magnet für Drogenhändler sei, müsse die Eigenbedarfsgrenze auf unter sechs Gramm herabgesetzt und mit harten Restriktionen durchgesetzt werden.
Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) beobachtet die wachsende Zahl jugendlicher Drogenkonsumenten mit großer Sorge. Eine erhöhte Polizeipräsenz an den Drogen-Hotspots sei allerdings kein Allheilmittel, sondern führe zur Verdrängung. „Wir sehen, dass die Dealer mobil sind, per U-Bahn oder Fahrrad Stoff zu den Leuten bringen“, sagt Benjamin Jendro, GdP-Pressesprecher.
Weil weder Verbote noch Strafverfolgung den Cannabiskonsum einschränken, werden immer wieder Forderungen von Grünen, Linken und SPD nach einer Legalisierung für Erwachsene laut. Das Vorhaben des Berliner Senats, wissenschaftlich ermitteln zu lassen, ob eine staatlich kontrollierte Abgabe das Konsumverhalten risikoärmer mache, scheiterte allerdings am zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das die Genehmigung verweigerte.
„Eltern müssen richtig Rabatz machen“
Während Politiker über das Für und Wider einer Entkriminalisierung debattieren, kiffen Berlins Jugendliche fröhlich weiter. Und zwar in allen Bezirken und Milieus. Gerade in den bürgerlichen. „Drogenkonsum kann auch ein Symptom von Luxusverwahrlosung sein“, sagt Ottmar Hummel, Leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den DRK-Kliniken Berlin Westend. Viele Eltern, die wenig Zeit haben, weil sie viel arbeiten, beruhigten mit einer materiellen Überversorgung ihr Gewissen.
In einem solchen Lebensstil aber komme der Begriff des Aufschiebens von Bedürfnissen gar nicht mehr vor, so Hummel. Dabei sei es genau das, was einem Menschen Glück bringe: Sich selbst anstrengen, um etwas zu erreichen. Luxusverwahrlosung entwöhne den Menschen, seine Ziele selbst zu verfolgen, und nehme ihm so das normale Glückskonzept. „Die Versuchung, zur Pille zu greifen, die ein schönes Leben verspricht, liegt da relativ nahe.“
Ein Problem seien auch Eltern, die Drogenprobleme herunterspielen, weil sie in ihrer Jugend selber gekifft haben und sich jetzt sagen, dass aus ihnen ja auch was geworden sei. Aber Drogenkonsum in den 80er- und 90er-Jahren lasse sich nicht mit der heutigen Situation vergleichen.
„Früher“, so Hummel, „ging ein Joint in einer Gruppe von 20 Leuten herum, und alle waren selig. Heute habe ich Patienten, die konsumieren sieben Gramm Cannabis am Tag und zwar allein. Zudem sind die Sorten, die jetzt auf dem Markt sind, viel höher dosiert.“ Der Gehalt an der psychoaktiven Substanz THC in Cannabis hat sich seit 2006 verdoppelt.
Ottmar Hummel behandelt bei Kindern und Jugendlichen die Folgen für die Entwicklung des Gehirns. Und die können fatal sein. „Wer als Jugendlicher anfängt, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, läuft Risiko, mit 20 irgendwo stehen geblieben zu sein. Diese jungen Erwachsenen sind oft sehr infantil, larmoyant, selbstmitleidig, verlangen von anderen, dass sie sie versorgen, wollen selber nichts machen.“
Drogen, so Hummel, verändern den Menschen, machen weniger ängstlich und nehmen der Frage nach der Zukunft die Bedeutung. Jugendliche aber müssten lernen, aus eigenem Antrieb ihr Leben zu gestalten. Diese Fähigkeit werde durch Suchtstoffe gehemmt.
Wenn Eltern feststellen, dass ihr Kind Drogen nimmt, und nach einem Ausweg suchen, müssten sie schnell reagieren, erklärt Hummel. „Eltern müssen richtig Rabatz machen: Regeln klar setzen, Taschengeld entziehen. Und dann auch wirklich das Problem verstehen, das dahintersteckt. Aber nicht nach dem Motto: Du armes Kind musst wegen Problemen Drogen nehmen.“
Tatsächlich aber würden die Eltern oft als Erstes lesen, dass Probleme der Grund für den Konsum seien, und daraus schlussfolgern: Ich suche mir einen Psychotherapeuten, und der löst das Problem.
Aber dass mit einer wöchentlichen Sitzung der Jugendlichen dazu gebracht werde, nicht mehr zu konsumieren, sei ziemlich unwahrscheinlich. „Man verliert also oft Zeit. Aber das ist das Problem.“ Empfehlenswert sei, gezielt zu einer Drogenberatungsstelle zu gehen, um mit möglichst vielen Verbündeten und auch anderen Eltern zu versuchen, schnell etwas zu verändern.
Denn Cannabis erhöhe die Häufigkeit von Krankheiten wie Psychosen. So wie bei dem 18-Jährigen, der zu Hummels Patienten gehört. Er litt unter Verfolgungswahn, redete wirr, konnte nicht mehr schlafen. Seine Eltern bekamen schließlich heraus, dass er Cannabis konsumiert. Nach einer Therapie konnte er wieder in die Schule gehen.
„Aber er ist rückfällig geworden, konsumiert jetzt auch Amphetamine“, sagt Hummel. „Er ist aggressiv, schlaflos, die Eltern, die sich seit Jahren um ihn bemühen, können ihn zu nichts mehr bewegen.“ Schreibt DIE WELT.
An der Luzerner Kanti sollen es inzwischen bereits zehn Joints sein, die manche unserer zukünftigen Elite pro Tag während der Schulzeit konsumieren. Flüsterte mir kürzlich eine Kantischülerin (im Beisein ihrer Mutter, einer habilitierten Lehrerin mit Doktortitel, wohlverstanden!) ins Ohr, die sich (noch) mit einem Joint begnügt.
Und diese Cannabis-Orgien finden bei einem 10 mal höheren THC-Gehalt (in Luzern nicht selten bis 20 mal höher) als noch vor 20 Jahren statt. Wahre A-Bomben also! Das würde reichen, um einen Beduinen vom Kamel zu hauen.
Was das mit den Oberstübchen junger Menschen langfristig anstellt, weiss niemand so genau, weil es bis jetzt keine Langzeitstudien gibt. Und die mehr oder weniger unbehelligte Luzerner Balkan-Mafia, die den Innerschweizer Drogenhandel kontrolliert, interessiert sich logischerweise nur für den Cash Flow und nicht für Gesundheitsstudien.
Dafür gibt es inzwischen Eltern, die solche Missstände an Luzerner Eliteschulen nicht länger verharmlosen ("Esch jo nor äs Tschointli") und sich prophylaktisch weigern, ihre Kinder an der Luzerner Kanti unterrichten zu lassen. Das flüsterte mir kürzlich die Innerschweizer Mutter (ohne Doktortitel, dafür mit einem gesunden Menschenverstand) eines 16-jährigen Sohnes – immerhin Klassenprimus – ins Ohr und liess ihrem Flüstern Taten folgen. Der Jüngling macht jetzt eine Berufslehre und wird, sofern er dann noch will, später eine Berufsmatura absolvieren. Aber definitiv nicht in Luzern. Ist wohl auch besser so.
Der Artikel von SRF («Schüler-Drogenring ausgehoben – Betroffener Teenager: "Wir haben uns richtig abgeschossen"») scheint einen mittleren Schock ausgelöst zu haben. Vielleicht, weil dieser SRF-«Schocker» auch sehr viel über die versniffte Luzerner Gesellschaft aussagt? Möglicherweise über das Versagen der Eltern, die anscheinend nicht bemerken (wollen), dass da mit ihren zugedröhnten Goldschätzchen etwas verdammt falsch läuft?
Liebe Berlinerinnen und Berliner, alles halb so wild. Ihr seid mit Euren mickrigen 7 Grämmchen noch meilenweit von Luzerner Verhältnissen in Sachen Drogen an Euren Schulen entfernt. Und das will bei einer "linken" Regierung (SPD, Grüne, Die Linke) was heissen!
In Luzern kann man seit drei Monaten nach dem ersten Lockdown gratis illegale Drogen testen lassen, damit unsere Goldschätzchen nicht gerösteten Himbeerstaub statt reines Crystal Meth in die Nase pudern. Ja, soweit sind wir inzwischen in Luzern! Trotz Lockdown im Nachtleben (Oh heilige Maria Mutter Gottes! «Princesse - The Club» mit dem netten Türsteher aus dem Balkan, der immer weiss, wo's was zu Naschen gibt und seinen jungen Instagram-Followern*innen Küsschen und süsse Herzchen schickt, ist ja geschlossen) soll das neue Angebot bereits öfter ausgebucht sein – und es gab bereits erste Warnungen.
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/reportage-reines-kokain-aus-kolumbien-im-neuen-luzerner-drug-checking-erleben-manche-partygaenger-ihr-blaues-wunder-ld.2073586?reduced=true&fbclid=IwAR1TFCNTKnnuCYrHmGOAraIVHHpIOlZckRVWPMDXFpgTRERCfDDyLPCstZM
Nein, ich übertreibe nicht masslos. Es waren tatsächlich 50 Kanti-Schüler*innen.
https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/schueler-drogenring-ausgehoben-betroffener-teenager-wir-haben-uns-richtig-abgeschossen?fbclid=IwAR2-Cb2CBnooQsdO9iU-_WYnBIpB-FDf__LwGCquxrIr1rZvbkhWnO59AQs
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
12.1.2020 - Tag der «Menschenrechte» für Drogen
Stadt Luzern: Zwei Asylbewerber (Libyen und Algerien) wegen Taschendiebstahl beim Inseliquai festgenommen
Die Luzerner Polizei hat am Samstagabend zwei Asylbewerber festgenommen. Die beiden Männer haben zuvor in der Stadt Luzern zwei Frauen die Handtaschen entwendet.
Am späten Samstagabend (9. Januar 2021), kurz vor Mitternacht, haben die Männer zwei Frauen beim Inseliquai die Handtaschen entwendet. Danach wurden die Opfer von den Männern geschlagen. Die Luzerner Polizei konnte die beiden mutmasslichen Täter Dank guten Signalementsangaben festnehmen. Die beiden Männer sind 26 und 29 Jahre alt und stammen aus Libyen und Algerien und wohnen im Kanton Nidwalden. Nach der Festnahme haben sich die beiden Männer unkooperativ verhalten. Einer der Männer hat die Polizei mit Füssen getreten.
Die Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft Luzern.
Quelle: Luzerner Polizei
Wie die Lebensqualität in der Stadt Luzern unaufhaltsam zerfällt
Es geschah im Sommer 2020, als ein Asylbewerber aus Algerien am helllichten Tag auf dem Luzerner «Inseli» einer alten Frau die Handtatsche entriss und trotz einer Hundertschar von Zuschauern*innen auf die «Aufschütti» fliehen konnte, wo ihn die Luzerner Polizei dank Signalementsangaben verhaftete. Nun passierte es wieder um Mitternacht, diesmal beim Inseliquai. Einige werden sich nun fragen, was haben denn die zwei Frauen um Mitternacht in dieser Problemzone der Stadt Luzern zu suchen?
Die Frage ist unangebracht. Möglicherweise hatten die beiden Opfer dort ihr Fahrzeug parkiert. Es sollte uns nicht interessieren, aus welchen Gründen jemand auf dem Inseliquai um Mitternacht unterwegs ist. Problemzone hin oder her. NO GO-Areas dürften überhaupt nicht existieren!
Viel wichtiger ist die traurige Feststellung, dass in der Stadt Luzern die Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger längst nicht mehr gewährleistet ist. Und dies nicht nur rund um die Drogen-Hotspots und NO GO-Areas.
Dass sich der Europaplatz, das Inseli und die Aufschütti überhaupt zu Eldorados für Drogensüchtige und Drogendealer und zur eigentlichen Heimstatt von Asylanten der Zentralschweiz (und weit darüber hinaus) entwickeln konnte, hat Gründe. Laissez-faire ist einer davon. Blindheit unserer Behörden auf einem Auge und falsche Toleranz gegenüber Drogen ein anderer.
Wir sind sehr schnell bereit, für diese Misere, die langsam aber unaufhaltsam die Lebensqualität in der Stadt Luzern nicht nur beeinträchtigt, sondern langfristig sogar zerstört, die Polizei verantwortlich zu machen.
Falsch! Die Luzerner Polizei macht einen guten Job. Doch leider erhält sie von der Luzerner Politik kaum Unterstützung. Luzerner Polizisten und Polizistinnen müssen sich vorwiegend mit Kleinkram wie Park- und Verkehrsbussen herumschlagen, statt sich um die eigentlichen Probleme zu kümmern, fordert doch der Kanton Luzern von seiner Polizei die im Jahres-Budget zum voraus festgelegten Einnahmen aus dem Luzerner Bussenkatalog. Ein Budget, das beinahe 30 (in Worten: dreissig) Millionen beträgt. Wehe, die Budgetzahlen werden nicht erreicht!
Wundert sich da noch jemand, dass sich die Stadt Luzern hinter Zürich in derart kurzer Zeit zum Drogen-Hotspot Nummer zwei der Schweiz entwickelte? In Lucerne-City scheint ja inzwischen sowohl Drogenkonsum wie auch Drogenhandel ein «Menschenrecht» zu sein. Das wird jedenfalls der Polizei bei Kontrollen von Verdächtigen stets unter die Nase gerieben.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
11.1.2020 - Tag des Städtebaus
Asylwesen sparte 160 Mio dank Corona – doch Migrationschef Gattiker (64) warnt: «Gehen von deutlicher Zunahme der Asylzahlen aus»
Der höchste Schweizer Asylchef, Mario Gattiker (64), kann aufatmen. Die Asylzentren kamen 2020 recht gut durch die Pandemie. Doch Corona dürfte auf die Migration nach Europa für die Zukunft noch weitreichende Auswirkungen haben, sagt der Staatssekretär am Telefon.
BLICK: Herr Gattiker, die Schweiz verzeichnet für 2020 vielleicht 11’000 Asylgesuche. Das sind so wenige wie seit 2007 nicht mehr. Sind Sie überrascht?
Mario Gattiker: Wir verbuchten 11’033 Asylgesuche. Anfang Jahr waren wir von 15’000 bis 16’000 Gesuchen ausgegangen. Die Abweichung führen wir auf die Corona-Pandemie zurück. Dadurch haben wir im Asylbereich gegenüber dem Budget 2020 ungefähr 160 Millionen Franken eingespart. Wir gehen davon aus, dass Corona auch weiterhin ein Faktor bei der Asylmigration bleibt.
Sie werden also auch nächstes dieses Jahr tiefe Kosten haben?
Vermutlich schon noch, eine klare Aussage ist schwierig. Derzeit erarbeiten unsere Fachleute die neuste Prognose. Bis diese steht, gehe ich persönlich von Zahlen aus, wie wir sie 2019 hatten. Also von wieder etwa 15’000 Gesuchen. Danach allerdings dürfte sich die Lage verändern.
Und wie?
Wegen des coronabedingten wirtschaftlichen Abschwungs in vielen Regionen und wegen daraus resultierender innenpolitischer Spannungen dürfte es zu vermehrter Abwanderung kommen. Mittelfristig müssen wir also von einer deutlichen Zunahme der Asylzahlen in ganz Europa ausgehen. Und damit auch von steigenden Kosten. Ich rede hier von den Jahren 2022 bis 2025.
Sie glauben also an eine Asylwelle wegen Corona?
Wir müssen mit klar höheren Zahlen rechnen, ja. Das Staatssekretariat für Migration steht mit dieser Einschätzung nicht alleine. Zahlreiche internationale, im Migrationsbereich tätige Organisationen erwarten eine solche Zunahme nach dem Ende der Pandemie. Wie gross diese ausfallen wird, ist heute schwierig einzuschätzen. Wir müssen das aber im Auge behalten und uns darauf gut vorbereiten. Dazu gehört auch die konsequente Fortführung unserer Politik, die auf beschleunigten Asylverfahren basiert und dafür sorgt, dass wir weiterhin kein bevorzugtes Zielland sind für Menschen ohne echte Asylgründe.
Sie hätten doch Zeit.
Dank guter Unterstützung durch Kantone und Gemeinden konnten wir 2020 fünf zusätzliche Asylunterkünfte eröffnen. Dafür sind wir dankbar. Diese brauchten wir trotz der tiefen Asylzahlen, um die Corona-Mindestabstände auch in den Bundesasylzentren jederzeit zu gewährleisten. Wir lasten die Zentren darum nur zu gut 50 Prozent aus. Damit wir diese Corona-Vorgaben auch künftig sicher einhalten können, suchen wir schon jetzt Unterkünfte. Wir können nicht erst Kapazitäten aufbauen, wenn die Asylsuchenden in der Schweiz sind.
Wie viele Betten brauchen Sie?
Derzeit verfügen wir über 2500 Plätze, dank deren wir übers Jahr 15’000 Asylgesuche bewältigen können – es gibt ja immer wieder Abgänge, sodass Betten frei sind und wieder neu besetzt werden können. Es braucht eine Reserve, falls die Migration wieder zunimmt. Das Notfallkonzept sieht je nach Szenario bis zu 8000 Unterbringungsplätze beim Bund vor. Damit können wir auch hohe Eingänge bei über 30'000 Asylgesuchen auffangen.
Plätze werden frei, weil Sie abgewiesene Asylbewerber in die Herkunftsländer zurückschicken. Das ist zu Corona-Zeiten nicht unumstritten.
In der ersten Welle bis im Sommer haben wir kaum jemanden in seine Heimat zurückgeführt. Aber als über die Ferienzeit die Reisebeschränkungen gefallen sind und auch wieder Flüge zur Verfügung standen, konnten wir unseren Rückführungsauftrag wieder konsequenter wahrnehmen. Das Staatssekretariat für Migration ist nicht legitimiert, einfach nach eigenem Gutdünken die Rückführungen zu stoppen. Gerade Überstellungen nach den Dublin-Regeln, wonach Asylsuchende in jenes europäische Land zurückmüssen, in dem sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten haben, waren in den Sommermonaten wieder möglich. Inzwischen verzeichnen wir bei der Zahl der Ausreisen in aussereuropäische Länder wieder 60 Prozent des Vorjahresniveaus.
In den Asyllagern auf Samos und Lesbos herrschen schlimme Zustände.
Ja, Griechenland hat humanitär eine schwierige Situation. Die Bilder, die wir sehen, lügen leider nicht. Die Lösung für die Probleme liegen aber in Griechenland selber.
Machen Sie es sich hier nicht zu einfach? Die Schweiz tut nichts und sagt, die Griechen sollen selbst schauen.
Halt, die Schweiz unterstützt Griechenland seit Jahren, und zwar engagiert und sehr konkret. Unser Land nimmt unbegleitete minderjährige Asylsuchende ohne Eltern aus Griechenland auf, wenn sie einen Bezug zur Schweiz haben. In diesem Jahr waren das immerhin rund 90 Minderjährige. Und wir leisten humanitäre Hilfe vor Ort und unterstützen die griechischen Behörden seit Jahren mit verschiedenen Projekten, etwa im Bereich der Strukturen für Familien und Kinder. Die Schweiz hat auch die Trinkwasserversorgung für Kara Tepe aufgebaut, also fürs Nachfolgelager des abgebrannten Moria-Lagers.
Mit der Aufnahme einiger Kinder mit Verwandten in der Schweiz helfen wir nur wenigen.
Immerhin gehört die Schweiz zu jenen europäischen Staaten, die am meisten Minderjährige aufgenommen haben. Eine Umverteilung der Asylsuchenden in Griechenland auf andere Staaten ist jedoch keine Lösung. Die Griechen müssen die notwendigen Unterbringungsstrukturen selber zur Verfügung stellen und funktionierende Asylverfahren garantieren. Europa, und auch die Schweiz, unterstützen sie dabei. Wir haben nicht mehr die Situation wie 2015 und Anfang 2016, als über eine Million Menschen anlandeten und Griechenland dringend auf die Solidarität aller Schengenstaaten angewiesen war. Für 2020 dürfte Griechenland etwas über 15’000 Anlandungen verzeichnen, noch 2019 waren es 75’000.
Zurück in die Schweiz. Wie viele Asylsuchende steckten sich mit Corona an?
Wir hatten erstaunlich wenige Ansteckungen. Die Asylbetreuungsorganisationen und unsere Mitarbeitenden haben in den Bundesasylzentren hervorragende Arbeit geleistet und den Asylsuchenden die Corona-Regeln verständlich gemacht. Das war anspruchsvoll. So hatten wir nur 230 Ansteckungen und glücklicherweise keinen einzigen Todesfall. Ich verhehle nicht, dass mir Corona Anfang Jahr wegen unserer Kollektivunterkünfte sehr, sehr grosse Sorgen gemacht hat.
Sorgen machte sich die Schweiz auch, als bekannt wurde, dass man mit China ein Migrationsabkommen geschlossen hat. Das Abkommen wurde bloss einmal angewandt. So wichtig kann es nicht sein, oder?
Ich habe Verständnis für diese Frage. Sie bringt die Verwirrung zum Ausdruck, die die zahlreichen Falschmeldungen zu diesem Thema ausgelöst haben.
Was ist denn falsch?
Zuerst mal hiess es, es sei ein Geheimvertrag. Stimmt nicht, das Parlament wurde 2016 darüber in Kenntnis gesetzt, auf Anfrage haben wir den Vertrag jederzeit herausgegeben. Es hiess, wir würden damit chinesische Spionage unterstützen, was von reichlicher Naivität zeugt. Ebenso falsch ist es, dass Personen befragt würden, die bei einer Rückkehr gefährdet wären.
Worum geht es denn bei dieser Vereinbarung?
Kein Staat dieser Welt nimmt Personen zurück, ohne vorher nicht festgestellt zu haben, dass es sich um eigene Staatsbürger handelt. Deshalb regelt diese Vereinbarung die Zusammenarbeit mit chinesischen Migrationsbehörden zur Identifikation von Personen, die zwar mutmasslich aus China stammen, aber beispielsweise keine Ausweispapiere haben und deshalb nicht zurückgeführt werden können. Das ist im Interesse der Schweiz! Es geht ausschliesslich um Personen, bei denen in einem rechtsstaatlichen Verfahren festgestellt wurde, dass sie bei einer Rückkehr nicht gefährdet sind und daher die Schweiz zu verlassen haben.
Es geht hier also um abgewiesene Asylbewerber.
Nicht nur! Es geht beispielsweise auch um Schwarzarbeiter, die kein Asylgesuch gestellt haben, sich aber illegal in der Schweiz aufhalten und diese verlassen müssen. Dass wir Wegweisungen vollziehen können, gehört zu den Grundpfeilern einer glaubwürdigen Migrationspolitik.
Aber bei China ist es ein solches Abkommen natürlich heikler als bei Deutschland oder Liechtenstein.
Interessant ist, was mehrere hochrangige Vertreter des UNHCR dazu sagen: Sie bestätigen klipp und klar, dass solche Abkommen asylrechtlich unbedenklich und internationaler Standard sind. Es geht bei dieser Vereinbarung eben ausschliesslich um Personen, die nach einer Rückkehr nichts zu befürchten haben. Tibeter sind wie gesagt nicht betroffen, und auch sonst niemand, dem Verfolgung drohen könnte. Unsere Gesetzgebung erlaubt die Einladung ausländischer Delegationen zwecks Klärung der Identität explizit. Die Vereinbarung regelt Modalitäten und Abläufe, was für die Schweiz mehr Rechtssicherheit schafft. Wir sind aber nicht dringend auf dieses Abkommen angewiesen. Es ist ja inzwischen abgelaufen.
Und warum wollen Sie dennoch eine Neuauflage des Abkommens?
Nochmals: Wir sind nicht darauf angewiesen, weil die Identifikation auch ohne Vereinbarung funktioniert. Aber die Vereinbarung liegt im Interesse der Schweiz, weil sie rechtsstaatlich unbedenklich ist und die Identifikationsprozesse langfristig sichert. Was wir hier mit China vereinbart haben, ist internationaler Standard.
Anderes Thema. Die Abstimmung zur Begrenzungs-Initiative dürfte Ihnen mehr Freude gemacht haben: 62 Prozent der Stimmenden schickten sie bachab. Wie schätzen Sie das ein?
Es hat gezeigt, dass die Schweiz in dieser unsicheren Zeit keine Experimente eingehen will. Und dass sich unsere Bevölkerung hinter die Personenfreizügigkeit und die Migrationszusammenarbeit mit der EU stellt. Bei den Grenzschliessungen wegen Corona haben wir zum Beispiel äusserst gut mit unseren Nachbarstaaten zusammengearbeitet.
Gab es Probleme mit London, dass die Schweiz die Personenfreizügigkeit wegen Corona vor dem 31. Dezember gekappt hat?
Nein. London ist genauso an der Eindämmung des mutierten Virus interessiert wie Brüssel, Berlin und Bern. Zudem ging es nur um wenige Tage. Wir verhängten ja ein Einreiseverbot mit Ausnahmen für begründete Einreisen – also beispielsweise wenn ein Engländer in einem Zürcher Spital arbeitet. Ohnehin ist UK am 1. Januar 2021 als Folge des Brexits für die Schweiz zu einem Drittstaat geworden. Es gilt ein Einreiseverbot mit Ausnahmen, da das Königreich ein Corona-Risikoland ist.
Ist mit dem Vereinigten Königreich für die Zeit nach dem Brexit alles geregelt?
Für die etwa 40’000 Schweizer, die im Vereinigten Königreich sind, und die etwa gleich vielen Briten, die schon bei uns leben, ist alles in Zusammenhang mit Einreise und Aufenthalt geregelt. Fürs Jahr 2021 haben wir Sonderkontingente für Erwerbstätige aus UK bereitgestellt. Ob es danach separate bilaterale Regeln mit UK beispielsweise für Arbeitnehmer oder Studierende geben soll, wird noch zu verhandeln sein. Das hängt mitunter auch vom Verhältnis zwischen UK und der EU ab.
Das Vereinigte Königreich hat ja jetzt einen Handelsvertrag mit der EU geschlossen. Dieser kennt keine fremden Richter. Beim Rahmenabkommen mit Brüssel müssten wir solche aber akzeptieren. Muss die Schweiz hier nachverhandeln?
Hier kann ich bloss bestätigen, dass wir mit der EU im Gespräch sind, um die drei vom Bundesrat definierten Punkte zu klären: Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz und die Frage der staatlichen Beihilfen. Der Bundesrat hat seine Position am 11. November beschlossen und festgelegt, weiter nicht zu kommunizieren. Daran halte ich mich.
Aber nach dem Brexit ist die Situation eine andere: UK muss sich nicht dem Europäischen Gerichtshof unterstellen, wir aber sollen ihn akzeptieren. So sieht das Rahmenabkommen noch schlechter aus.
Sie können es gerne noch einige Male versuchen. Ich halte mich daran, nichts dazu zu sagen. Schreibt Blick.
11’033 Asylgesuche im Corona-Jahr 2020 tönt nach 2015 wie ein Seufzer der Erleichterung. Doch bei aller sentimentalen Verharmlosung: Das sind immerhin 2'343 Personen mehr als die Stadt Sursee an Einwohnern*innen zählt (8'690).
Verdoppeln wir gnädiger Weise die Zahl der Asylgesuche auch unter Berücksichtigung, dass ein paar wenige davon abgelehnt werden, wegen der gesetzlich geregelten, absolut legitimen und erfahrungsgemäss zu erwartenden Familienzusammenführung muslimischer Grossfamilien* innerhalb weniger Jahre auf lediglich ca. 22'000 Personen, sind wir schon sehr nahe bei der Einwohnerzahl der Stadt Kriens (27'522).
Die Planer-Büros für Moscheen und Immobilien-Mogule wird's freuen. Die Sozialämter vermutlich etwas weniger.
* Die überwiegende Mehrheit der Asylgesuche 2020 stammen von Asylanten*innen aus muslimischen Ländern.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
10.1.2021 - Tag von Copy & Paste
Österreichische Arbeitsministerin Aschbacher tritt nach Plagiatsvorwürfen zurück
Die ÖVP-Politikerin bezeichnet die Vorwürfe rund um ihre Diplom- und Doktorarbeit als "Unterstellungen". Sie legt aber zum "Schutz meiner Familie" ihr Amt zurück. Kanzler Kurz respektiert den Entschluss und kündigt Nachbesetzung für Montag an.
Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ist nach einer Plagiats-Affäre zurückgetreten. In einer Aussendung beklagte die 37-jährige eine Vorverurteilung durch "die Medien und die politischen Mitstreiter". Ihren Nachfolger als Arbeitsminister will Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag vorstellen. Zuvor waren Vorwürfe laut geworden, dass Aschbacher Teile ihrer 2020 in Bratislava eingereichten Dissertation kopiert hatte, ohne die Quellen ordentlich auszuweisen. All diese Vorwürfe "sind Unterstellungen und weise ich zurück", betonte Aschbacher Samstagabend.
"Zum Schutz meiner Familie"
Sie habe sowohl ihre Dissertation als auch ihre ebenfalls unter Plagiatsverdacht stehende Diplomarbeit an der Fachhochschule Wiener Neustadt "nach bestem Wissen und Gewissen" verfasst. Leider habe man ihr ein faires Verfahren der Überprüfung aber nicht zugestanden: "Die Anfeindungen, die politische Aufgeregtheit und die Untergriffe entladen sich leider nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Kinder, und das mit unerträglicher Wucht. Das kann ich zum Schutz meiner Familie nicht weiter zulassen. Aus diesem Grund lege ich mein Amt zurück."
Aschbacher ist nach Grünen-Staatssekretärin Ulrike Lunacek das zweite Mitglied der türkis-grünen Regierung und die erste Ministerin, die – fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrer Angelobung am 7. Jänner 2020 – die Politik verlassen muss.
Plagiatsvorwürfe
Der als "Plagiatsjäger" bekannte Sachverständige Stefan Weber hatte Aschbacher zuvor vorgeworfen, zumindest ein Fünftel des Textes ihrer Dissertation ohne ordentliche Kennzeichnung aus anderen Quellen kopiert zu haben. Die Ministerin hatte die Arbeit im Mai des Vorjahres an der Technischen Universität Bratislava eingereicht. Auch der Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 attestierte Weber "Plagiate, falsche Zitate und mangelnde Deutschkenntnisse". Die Fachhochschule Wiener Neustadt, wo Aschbacher von 2002 bis 2006 studiert hatte, kündigte daraufhin eine Prüfung an.
Für ihre Dissertation unter dem Titel "Entwurf eines Führungsstils für innovative Unternehmen" hatte Aschbacher unter anderem einen Artikel des Forbes-Magazins aus dem Englischen übersetzt. Darin erklärt der Autor, er habe seine Ideen über den Führungsstil innovativer Unternehmen in seiner Arbeit mit hunderten Teams gewonnen. In ihrer Dissertation führte Aschbacher den Artikel zwar als Referenz an, erweckt aber den Eindruck, sie selbst habe für die Abschlussarbeit "mit Hunderten von Teams" zusammengearbeitet.
Nachfolge aus der Industriellenvereinigung?
Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) respektiert den Entschluss seiner Parteikollegin, wie er in einer ersten Reaktion erklärt. Er bedankte sich für Aschbachers Einsatz "im letzten, sehr herausfordernden Jahr". Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) respektiere den Schritt Aschbachers und bedankte sich für die "gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten". Ihr Nachfolger in der Funktion als Arbeitsminister werde am Montag präsentiert, sagte Kurz. Ob das bedeutet, dass die Agenden der Familienministerin an eine der verbleibenden ÖVP-Ministerinnen gehen, blieb auf Nachfrage im Kanzleramt offen.
In der steirischen ÖVP hieß es, man gehe natürlich davon aus, wieder zum Zug zu kommen. Diversen Medienberichten zufolge soll der nächste Arbeitsminister aber Helwig Aubauer heißen. Er ist für den Kanzler kein Unbekannter. Der Bereichsleiter für Arbeit und Soziales in der Industriellenvereinigung verhandelte 2017 bei den Koalitionsverhandlungen mit den Freiheitlichen auf Seiten der ÖVP mit. Zuvor arbeitete Aubauer auch in den Kabinetten der beiden Ex-Minister Martin Bartenstein und Reinhold Mitterlehner (beide ÖVP).
SPÖ: "Logische Konsequenz"
Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist Aschbachers Rücktritt die "logische Konsequenz". Die Kurz-Regierung schlittere von einem Chaos ins andere. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit aufgrund der Corona-Pandemie sei der Zeitpunkt "besonders fatal".
Für FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer ist Aschbachers Entscheidung "zu respektieren. Dennoch ist eine Überprüfung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten durch die zuständigen Hochschulen unumgänglich". Für die Nachbesetzung erwarte er sich nun einen "wirklichen Experten, der innerhalb der Regierung größeres Gewicht hat".
Neos-Generalsekretär Nikola Donig lobte Aschbachers "rasche Konsequenz". Dies sei ein notwendiger Schritt für die Integrität der Politik. Von Kurz erwarte er sich eine rasche Nachbesetzung.
Akademische Konsequenzen offen
Aschbacher selbst könnte noch ein akademisches Nachspiel erwarten: Unklar ist nämlich, ob ein allfälliges Plagiat überhaupt zu einer Aberkennung eines im Vorjahr in der Slowakei erlangten Doktortitels führen kann. In dem Nachbarland ist die Aberkennung erschwindelter akademischer Grade erst seit heuer und nicht rückwirkend möglich.
Die Slowakische Technische Universität (Slovenská technická univerzita – STU) will die Dissertation Aschbacher jedenfalls prüfen, berichteten slowakische Medien am Samstag. Die wissenschaftliche Arbeit sei mit dem staatlichen Anitplagiat-System überprüft worden, dabei wurde eine Übereinstimmung mit fremden Texten von 1,15 Prozent gefunden, erklärte ein Sprecher der STU. In der Datenbank des staatlichen Systems befinden sich vor allem slowakische Texte aus Lehrbüchern und dem Internet, mit denen Arbeiten verglichen werden. Ausländische und deutsche Texte liegen nur wenige vor. Die STU versprach, Aschbachers Dissertation gründlich zu kontrollieren und über die Ergebnisse zu informieren. Schreibt DER STANDARD.
Tja, so ist das halt nun mal mit den in der Slowakei und anderen osteuropäischen Staaten with a little Help from Copy & Paste «gekauften» Doktortiteln für Leute, die ebenso dumm wie eitel sind. Dass es sich dabei vorwiegend um Vertreter*innen der Polit-Elite handelt, sagt auch einiges ausüber die sogenannten Eliten. Dummheit und Stolz wachsen bekannterweise auf dem gleichen Holz.
Da habe ich es mir doch etwas einfacher gemacht: Ohne je eine Doktorarbeit zu schreiben, was vermutlich auch besser war, wurde mir der Doktortitel von der Luzerner Staatsanwaltschaft Summa cum Lauda verliehen. Der Klage wegen eines öffentlichen Artikels von mir durch eine einfältige Basler-Schwuchtel mit Botox-Lippen sei Dank.
Herzlichst, Euer Doktor.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
9.1.2020 - Tag der ewigen Liebe
FDP-Nationalrätin Doris Fiala (63) und Ex-SRG-Generaldirektor Armin Walpen (72): «Ja, wir sind ein Paar»
Aus Freundschaft wurde Liebe. Dies haben FDP-Nationalrätin Doris Fiala und Ex-SRG-Generaldirektor Armin Walpen so erlebt. Zum ersten Mal sprechen sie über ihre Beziehung, für die sie einige Hindernisse überwinden mussten.
Es sind ungewohnt leise Töne, die Doris Fiala (63) von sich gibt. Denn es geht nicht um eine Initiative oder ein Referendum, wofür sie sich seit 2007 als FDP-Nationalrätin lautstark und mit viel Leidenschaft einsetzt. Es geht um ihr Herz und die Liebe zwischen ihr und dem einstigen SRG-Generaldirektor Armin Walpen (72). «Ja, wir sind ein Paar», bestätigen die beiden auf Anfrage von BLICK.
Das Glück und die neue Leichtigkeit sind Doris Fiala anzusehen. Dies nachdem sie ihren Mann Jan (†70) am 15. Dezember 2019 an den Folgen seines langjährigen Krebsleidens verlor. 38 Jahre lang war sie mit dem Chemieingenieur verheiratet, gemeinsam haben sie drei erwachsene Kinder. Doris Fiala kämpfte bis zuletzt für die Patientenverfügung, seine wollte man am Schluss nicht umfassend anerkennen. «Dafür werde ich mich immer einsetzen», sagt sie bestimmt.
Ihre erste Begegnung fand vor 14 Jahren statt
Wieder leiser spricht sie von ihrer Begegnung mit Armin Walpen. «Wir trafen uns vor 14 Jahren erstmals. Er lud mich an einen SRG-Anlass ein.» Zwei Jahre später sei es eine zufällige Begegnung in der Wandelhalle im Bundeshaus gewesen. «Später dann war es sein Zuhören und Dasein, als mein Mann schwer erkrankte und schliesslich starb.» So wurde aus Freundschaft Liebe.
«Eine Liebe, die wir mit Respekt, Vorsicht und Dankbarkeit leben», sagt sie. Es sei für beide eine grosse Bereicherung, sich auf Augenhöhe begegnen zu können. «Armin war immer ein sehr politischer Mensch. Wenn ich ihm etwas von meinen Anliegen und Bestrebungen erzähle, weiss er, wovon ich spreche. Dies ist auch umgekehrt der Fall. Wir sind zwei gelebte Leben, die den weiteren Weg nun gemeinsam gehen dürfen.»
Die Beziehung sei anfangs weder für ihre noch für seine Kinder einfach gewesen
Sie hat drei erwachsene Kinder und zwei Enkel, er hat zwei Kinder und vier Enkel. «Weder für meine noch für seine Kinder war unsere Beziehung anfangs einfach. Da gab es sicher auch grosse Leidensmomente. Für seine Kinder, weil er sich von ihrer Mutter getrennt hat, für meine Kinder, weil für sie die Beziehung nach dem Tod des geliebten Vaters doch recht früh kam», sagt sie offen und ehrlich. «Doch wir fanden es wichtig, Klarheit zu schaffen. Und es ist doch auch schön, wenn man vermitteln kann, dass es nach dem Tod eines geliebten Menschen einen Weg gibt, der gut weiterführt.» Nun seien sie alles in allem gemeinsam auf gutem Weg, wie sie sagt, den sie möglichst mit Sensibilität ihrem Umfeld gegenüber gehen wollen. «Wir sind uns bewusst, dass unser Weg auch Verletzungen bei unserem Umfeld hinterlassen hat», sagt Armin Walpen.
Ihre gemeinsame Zukunft mit Armin Walpen sieht sie Hand in Hand. Er ist seit zehn Jahren im Ruhestand. Doris Fiala wird am 29. Januar 64, für eine Wiederwahl stellt sie sich nicht zu Verfügung, will aber beruflich noch lange begeistert aktiv bleiben, wie sie sagt. Auf die Zeit nach ihrer politischen Karriere freut sie sich sehr. «Weder Armin noch ich müssen noch irgendjemandem etwas beweisen. Das macht uns frei, einfach dankbar zu sein und zu geniessen, was möglich ist. Dabei bleiben unsere Familien und Freunde sehr wichtig.»
Als Nächstes steht eine gemeinsame Wohnung in Zürich auf dem Plan
Pläne hat das Paar auch. «Wir sind auf der Warteliste für eine gemeinsame Wohnung in Zürich», so Fiala, die mit Walpen momentan zwischen ihrem Hauptwohnsitz in Samedan GR und in Zürich pendelt. «Wenn einem die Liebe in dem Alter, in dem wir sind, nochmals erreicht, ist das einfach wunderschön. Dafür sind wir beide sehr dankbar», ergänzt sie wieder mit leisen Tönen. Schreibt Blick.
ZumAbschluss dieser turbulenten Woche eine versöhnliche Nachricht aus dem Umfeld der FDP, die eine alte Lebensweisheit bestätigt: Auch alte Zitronen haben noch Saft.
Wir wünschen dem glücklichen Paar einen tollen Honeymoon und viel Glück.
Mögen einige Mit- und ohne Glieder aus der FDP diese tolle Herzblatt-Geschichte zum Anlass nehmen, in Zukunft zwischendurch mal ebenfalls mit positiven und glückselig machenden News aufzuwarten statt mit den ewig gleichen Floskeln des vulgären Neoliberalismus frei von jeglichem Sinn.
So könnte uns doch der solariumgebräunte Luzerner FDP-Ständerat und PöstchenjägerDamian Müller mit der Meldung überraschen, endlich eine Liebste oder einen Liebsten gefunden zu haben. Genug und ungefragt geredet über seine Sexualität («ich bin nicht schwul») in unzähligen Interviews vor den Nationalrats- und Ständeratswahlen 2019 hat er ja schon. Nun muss er seinen Worten nur noch Taten folgen lassen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang

-
8.1.2021 - Tag der Sozialhilfequoten
Auswirkung der Corona-Krise: In keiner anderen Stadt steigt die Sozialhilfequote so stark wie in Luzern
Die Corona-Krise ist die grösste wirtschaftliche Herausforderung für die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Zahl der Sozialhilfe-Bezüger wird markant ansteigen. Das zeigt sich fast nirgends so deutlich, wie in der Stadt Luzern. Grund ist insbesondere die hiesige Wirtschaftsstruktur.
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) zeichnet ein düsteres Szenario für die Zukunft. Seit Mai behält sie im Auge, wie sich die Fallzahlen in der Sozialhilfe im Zuge der Coronakrise entwickeln. Noch ist gesamtschweizerisch kein Anstieg feststellbar – einzelne Regionen verzeichnen aber signifikant mehr Fälle. Vorne mit dabei: Die Stadt Luzern.
Hier lag die Sozialhilfequote im Monat November 2020 8 Prozent höher als in einem Durchschnittmonat 2019. Stärker ist der Anstieg nur im Kanton Genf (plus 8,5 Prozent). Wobei dort im Zuge infolge von Corona spezielle Regeln für den Bezug der Sozialhilfe beschlossen wurden, was einen Vergleich schwierig macht. Klar ist jedenfalls: Der Index der Fallzahlen liegt in der Zentralschweiz deutlich über dem gesamtschweizerischen.
Warum ist gerade Luzern von einem Anstieg der Sozialhilfefälle betroffen? «Mögliche Gründe dafür sind der hohe Anteil von Beschäftigten in einem auf ausländische Gäste ausgerichteten Tourismus sowie ein generell steigender Trend aus dem Vorjahr», schreibt die Skos in ihrem Bericht.
Felix Föhn, Leiter der sozialen Dienste der Stadt Luzern, bestätigt dies. «Ende November verzeichnete die Stadt Luzern 2’436 Stellensuchende und 1’440 Personen, die Sozialhilfe beziehen», sagte er an einer virtuellen Medienkonferenz am Donnerstagmorgen. Die Arbeitslosenquote sei im Verlauf des Jahres auf drei Prozent angestiegen – und liegt damit deutlich höher als im gesamten Kanton (2,3 Prozent).
Besonders betroffen vom Stellenverlust ist die Hotellerie und der Gastronomiebereich – und alles was damit verbunden ist. Sprich: Die Event- und Kulturbranche, die Schmuck- und Uhrenindustrie, die Schifffahrtsgesellschaft und der Detailhandel. Daneben stieg die Zahl der Arbeitslosen im Baugewerbe und im Gesundheitswesen.
«Im März hatten wir einen massiven Anstieg, nämlich eine Verdoppelung der Anmeldungen bei der Arbeitslosenversicherung», erklärte Föhn. Im Sommer habe sich die Situation leicht entspannt. Die Ruhe war aber trügerisch. «Sehr viele Personen haben nur eine befristete Stelle gefunden – sie befinden sich also weiterhin in prekären Arbeitsverhältnissen», so Föhn weiter.
Für eine Entwarnung ist es also noch zu früh – zumal die Zahlen seit Oktober wieder deutlich ansteigen. «Ab Juni gab es eine etwas ruhigere Phase, im Oktober hat uns dann die zweite Welle voll erwischt», führte Föhn aus. Er betont, dass es für die Sozialhilfe 2020 einen Nachtragskredit brauchen wird – und eine Aufstockung der Budgets der Gemeinden für 2021. Denn verantwortlich für die Ausrichtung der Sozialhilfe sind die Kommunen.
Mehrkosten von 821 Millionen Franken
Die Skos geht davon aus, dass sich die Zahl der Sozialhilfe-Bezüger schweizweit im nächsten Jahr um 21 Prozent erhöhen wird. Dies wird zur Folge haben, dass die Kosten im Bereich der Sozialhilfe schweizweit um 821 Millionen Franken steigen.
Als Hauptproblem bezeichnet die Skos die steigende Arbeitslosigkeit und die wachsende Zahl von Selbstständigen, die sich aufgrund der Corona-Krise finanziell nicht mehr über Wasser halten können. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation sei zudem die berufliche und soziale Integration erschwert.
Als «dringend» bezeichnet die Skos, dass es innerhalb der Kantone einen Lastenausgleich zwischen den Gemeinden gibt – weil die Zentren besonders von der steigenden Sozialhilfequote betroffen sind, wie die Fälle Luzern und der städtische Kanton Genf zeigen. Der Wunsch der Stadt Luzern, die Kosten gleichmässiger zu verteilen, dürfte im Kanton in den nächsten Monaten noch zu reden geben. Schreibt ZentralPlus.
Alles hängt mit allem zusammen
Dass die Stadt Luzern nun auch im Schweizer Ranking der Sozialhilfequote den ersten Platz einnimmt, ist nicht nur dem Coronavirus zu verdanken. Das ist viel zu kurz gesprungen und pure Augenwischerei der verantwortlichen Politiker*innen, um vom eigenen Versagen abzulenken. Da gibt es weitere Gründe, die seit längerer Zeit schleichend und unaufhaltsam daherkommen.
Wenn Luzern mit knapp 82'000 Einwohnern*innen innert kurzer Zeit hinter Zürich (knapp 403'000 Einwohner*innen) zum Drogen-Hotspot Nummer 2 in der Schweiz aufsteigt, lässt das den Schluss zu, dass die Stadt Luzern auch bei den Drogenkonsumenten und notabene damit auch bei den Drogendealern gewaltig zugelegt hat. Es gibt ja auch naheliegende Gründe, weshalb Eltern aus Luzern ihre Kinder nicht mehr an der Luzerner Kanti ausbilden lassen(siehe Link unten).
Wenn zehn Moscheen in der Stadt Luzern und Umgebung (Eyüb Moschee, Hauptstrasse 58, Islamischer Kulturverein Barmherzigkeit, Baselstrasse 61A plus diverse illegale «Kellermoscheen» in Mehrfamilienhaus-Liegenschaften) wie Pilze aus dem Boden schiessen, hat das auch Auswirkungen auf das Sozialamt. Denn die muslimischen Gross-Spender aus dem arabischen Raum zahlen ihre Millionen nicht auf das Konto des Luzerner Sozialamts ein, sondern auf die Konten der Imame und islamischen Vereine.
Wie sagte Peter Scholl-Latour – geografisch leicht abgewandelt – treffend? «Wer den halben Balkan, halb Arabien und halb Afghanistan aufnimmt, hilft nicht etwa dem Balkan, Arabien oder Afghanistan, sondern wird selbst zum Balkan, zu Arabien und zu Afghanistan!»
Allein die täglich nach Mitternacht zugemüllte Stadt Luzern und das Luzerner Sozialamt bestätigen Scholl-Latours Worte. Ebenso die Tatsache, dass in der Stadt Luzern kaum mehr ein «Coiffeur-Salon» zu finden ist, dafür an jeder Ecke ein «Barber Shop».
Luzern: 50 Schüler wegen Drogenhandels verhaftet.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
7.1.2021 - Tag danach
Heute, am Tag danach, auch nur eine einzigen Artikel aus den Medien als «Schlagzeile des Tages» zu präsentieren, hiesse Eulen nach Athen zu tragen. Es scheint, als hätten alle Journalisten nach der Hitze des Gefechts rund um das Kapitol einander die genau gleichen Schlagzeilen abgeschrieben. Von «der Wiege der Demokratie» und den hehren «westlichen Werten» des Hegemons ist unisono die Rede. Als ob die USA in den vergangenen 50 Jahren je ein Leuchtturm der Demokratie und moralischer Werte gewesen wäre.
Trump, der nach Angaben seiner Ex-Frau Ivana «Mein Kampf» auf dem Nachttisch liegen hatte, ist nicht zufällig vom Himmel gefallen. Er wurde auch nicht zufällig von beinahe 75 Millionen Bürgern*innen gewählt. Er ist das Produkt einer verkommenen Nation mit einem ebenso verkommenen Neoliberalismus, der die amerikanische Gesellschaft zerreisst und den Niedergang der Weltmacht USA beschleunigt.
Ich empfehle an dieser Stelle einmal mehr das Buch «Weltmacht USA: Ein Nachruf» von Emmanuel Todd, der drei wesentliche Gründe für seine Thesen benennt: Räumliche Überdehnung (Weltpolizist, Kapital), Zerfall der Demokratie und Zunahme der Dekadenz.
Besser kann man den derzeitigen Zustand des (noch) Welt-Hegemons nicht auf den Punkt bringen.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
6.1.2021 - Tag der Oldenburger Butter
Männer in den Wechseljahren: Vollkommen fix und fünfzig
Sind Männer in der Lebensmitte erschöpft, übergewichtig und haben wenig Lust auf Sex, liegt das an der Andropause. Helfen Testosteronpräparate wirklich?
"Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!", sang der Schlagerstar Udo Jürgens. "Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss." Aber nicht alle Senioren können die Botschaft dieses Liedes unterschreiben. Gerade Männer, die in die Jahre kommen, sind häufig deprimiert – und Ärzte nehmen sich ihrer an. "Sie stehen in der zweiten Lebenshälfte und fühlen sich schlecht?", heißt es auf der Website einer Arztpraxis. "Merken, wie Ihre Kraft stark nachgelassen hat, leiden unter Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit und Erektionsproblemen? Sie sind gereizt, Ihr Bart wächst nicht mehr richtig? Sie legen an Gewicht zu, aber die Muskeln schwinden? Dann leiden Sie möglicherweise unter starkem Testosteronmangel."
Die "Wechseljahre des Mannes" – in Anlehnung an diejenigen der Frau – sind ein Modethema: Ärzte, Pharmafirmen und Journalisten haben es populär gemacht. Genau wie die Hormonbehandlungen, die dagegen helfen sollen: Testosteron steigere die Lebensfreude, wird suggeriert, sorge für mehr Lust und stärke die Potenz. In Deutschland verschreiben Ärzte bereits mehr als dreimal so viel synthetisch hergestelltes Testosteron wie noch 2004, und auch in Österreich und der Schweiz steigen die Umsätze mit solchen Präparaten.
Im Griff von Hormonen
Marco Caimi, der 2014 in Basel die "erste Praxis für Männermedizin" der Schweiz gegründet hat, hält Testosteron-Ersatztherapien (TRT) in vielen Fällen für sinnvoll. "Früher dachte man beim Stichwort 'Wechseljahre' ausschließlich an Frauen", sagt der Arzt und Psychiater: Stellen die Eierstöcke die Produktion der Östrogene ein, spüren viele Frauen in der Lebensmitte den Rückgang dieser Sexualhormone bekanntlich als Wechseljahrsbeschwerden und lassen sich dagegen Östrogene verschreiben. Oft bringen die Hormone Linderung, sagt Caimi. Warum also sollten Männer, deren Hormonspiegel im Lauf des Lebens ja auch sinkt, in ihren Wechseljahren nicht ebenfalls von einer Hormontherapie profitieren?
Geschlechtshormone wie Östrogene oder Testosteron haben nachweislich viele wichtige Funktionen: Sie beeinflussen nicht nur die Sexualität und Fruchtbarkeit. Testosteron ist auch am Muskelwachstum beteiligt, stärkt die inneren Organe und die Knochen, wirkt positiv auf die Psyche und steigert die Vitalität.
Ein Testosteronmangel dagegen habe sehr oft negative Auswirkungen auf die Cholesterinwerte und den Zuckerstoffwechsel (Diabetes), was zu einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen führe. "Sinkt der Testosteronspiegel, kann das auch die Beziehung erheblich belasten", sagt Caimi. "Und heute machen sich viele Männer zum Glück mehr Gedanken über ihre Gesundheit als noch ihre Väter oder Großväter."
In der Lebensmitte
Die Wechseljahre des Mannes werden auch Andropause genannt, abgeleitet von den griechischen Wörtern"andro" (Mann) und "pausis" (Ende). Sie setzen meist Anfang oder Mitte 50 ein, sagt Caimi. "Also etwas später als die Wechseljahre der Frau." Häufige Begleiterscheinungen dieser Lebensphase seien bei Frauen und Männern aber ähnlich: emotionale Verstimmungen etwa, Antriebsschwäche, Schweißausbrüche, weniger Lust auf Sex (Libidoverlust) und allgemeiner Leistungsabfall. Gerade Letzteres werde in der heutigen Arbeitswelt kaum toleriert. "Viele Betroffene 'kompensieren' die nachlassende Leistung daher durch noch mehr zeitlichen Aufwand, was Müdigkeit und Lustlosigkeit weiter verstärkt", sagt Caimi. "Ein Teufelskreis." Doch soll man diesen wirklich mit synthetisch hergestelltem Testosteron zu durchbrechen versuchen?
Shahrokh Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie am AKH Wien, rät zu einer differenzierten Betrachtung. Die Bezeichnung "Andropause" hält er für unpassend. "Dieser Begriff suggeriert, dass es ein männliches Gegenstück zu den weiblichen Wechseljahren gäbe", sagt Shariat. "Und das stimmt so nicht." Denn erstens komme es bei Männern nicht wie bei Frauen zu einem schlagartigen, sondern zu einem kontinuierlichen Abfall der Hormonproduktion. "Und zweitens beeinflussen die hormonellen Veränderungen nicht die Fruchtbarkeit, wie das bei Frauen in der Menopause bekanntlich der Fall ist."
Testosteron zuführen
Früher nutzen vor allem Sportler und Bodybuilder synthetisch hergestelltes Testosteron, und zwar als eine Art Doping, um ihren Körper in Form zu bringen. Hinzu kamen Patienten mit einer seltenen Unterfunktion der Hoden. Inzwischen aber scheinen manche Mediziner Patienten zu suggerieren, dass jeder Mann irgendwann zum Kandidaten für eine solche Behandlung werde. Shariat dagegen hält eine Testosteron-Ersatztherapie nur in ausgewählten Fällen für sinnvoll. "Männer mit geringem Sexualtrieb, niedriger Energie, Stimmungsschwankungen und erektiler Dysfunktion haben zwar in der Tat oft einen niedrigen Testosteronspiegel", sagt Shariat. "Diese Symptome können aber auch auf andere Ursachen zurückzuführen sein." Man müsse sehr genau abklären, ob solche Medikamente wirklich angezeigt seien.
Produziert ein Mann nicht ausreichend Testosteron, spricht Shariat von Hypogonadismus oder "Low T" (niedriger Testosteronspiegel). Oft liege das aber gar nicht am Alter, betont er. Männer mit Gesundheitsproblemen wie Diabetes, depressiver Verstimmung, Nieren- oder Herz-Kreislauf-Erkrankung oder starkem Übergewicht tendieren ebenfalls zu niedrigen Testosteronwerten. "Bei einem Verdacht auf Low T ist es daher wichtig, möglich rasch einen Arzt aufzusuchen, um abzuklären, ob eine andere Erkrankung dahintersteckt", sagt Shariat. Wichtig seien die Analyse der medizinischen Vorgeschichte, eine ärztliche Untersuchung und ein Blutbild, um die Testosteronwerte genau zu bestimmen.
Therapie gegen "Low T"
Eine Testosteron-Ersatztherapie kann auf viele verschiedene Arten erfolgen, erklärt Shariat: durch Hautgels etwa, Spritzen, Pellets, die unter der Haut eingesetzt werden, oder auch durch Spezialpflaster. Und: Bei einer TRT handelt es sich um eine lebenslange Behandlung. Setzt man die Präparate ab, sinken auch die Testosteronwerte wieder. "Manche von Low T betroffene Männer entscheiden sich denn auch gegen eine solche Therapie", sagt Shariat. "Sie finden entweder andere Mittel und Wege, ihr Energielevel zu steigern, oder finden sich mit den körperlichen Veränderungen und ihrem geringeren sexuellen Verlangen ab."
Lasse man sich auf eine TRT ein, seien regelmäßige Bluttests wichtig, sagt der Experte. "Und unterziehen Sie sich keiner TRT aus nichtmedizinischen Gründen wie etwa im Rahmen von Bodybuilding-Programmen, Versuchen, den Alterungsprozess aufzuhalten, oder zur Erhöhung der Leistungssteigerung." Patienten mit unbehandelten Herzproblemen, Prostatakrebs oder Schlafapnoe rät er generell von einer TRT ab, da Testosteron diese Erkrankungen verschlimmern kann. Und noch etwas ist ihm ein Anliegen: "Männern mit einem Testosteronwert im normalen Bereich wird durch eine TRT nicht geholfen."
Speck weg
Gibt es Alternativen, wenn männliche Senioren über Symptome klagen, die auf eine Andropause hinzudeuten scheinen? Der erfahrene Arzt und Psychotherapeut Thomas Walser aus Zürich empfiehlt in solche Fällen, erst einmal zwei, drei Monate lang den Alltagsstress zu reduzieren. Die Männer sollen sich Zeit für Dinge nehmen, die ihnen Freude machen, und im Zweifelsfall ein paar Kilo abspecken. "Oft bringt das bereits eine deutliche Verbesserung des Wohlbefindens", sagt Walser. Und auch der Hormonspiegel normalisiere sich häufig. Im Übrigen sei auch in höherem Alter ein wirklich gravierender Testosteronmangel eine Seltenheit: "Nur bei etwa drei bis fünf Prozent der 60- bis 79-Jährigen ist der Pegel so niedrig, dass er ein stark vermindertes sexuelle Verlangen und andere Symptome erklären könnte", so Walser.
Auch andere Experten halten die "zunehmende Fokussierung auf das Testosteron" in der Männermedizin für keine gute Entwicklung. Und sie haben gute Argumente: In einer großen Studie, die 2016 in der Fachzeitschrift "Endocrine Review" publiziert wurde, war das sexuelle Begehren (Libido) bei den Probanden, die Testosteron nahmen, durchschnittlich zwar etwas stärker als bei der Gruppe ohne Testosteronbehandlung. Weder in Bezug auf die Körperkraft noch auf die Gesundheit oder die Zufriedenheit zeigte sich jedoch ein positiver Effekt durch die Hormonpräparate.
Gefährliche Nebenwirkungen
Auch Shahrokh Shariat verweist auf eine durchwachsene Bilanz: "Auch wenn viele Männer eine positive Wirkung durch eine TRT erfahren, wie Veränderungen bei Energie und Libido, liegt doch noch einiges im Ungewissen", sagt er. "Auch daher ist es sehr wichtig, eine solche Therapie ausschließlich unter der Kontrolle eines erfahrenen, auf Testosteronbehandlungen spezialisierten Arztes durchführen zu lassen." Manche Männer kaufen testosteronsteigernde Nahrungsergänzungsmittel hingegen im Fitnesscenter oder im Internet. "Das kann sehr gefährlich sein", warnt Shariat. "Man kann sich nie sicher sein, welche Inhaltsstoffe in solchen Produkten verwendet werden, da sie keinerlei offiziellen Kontrollen unterliegen."
Karl-Heinz Steinmetz, Gesundheitswissenschafter und Leiter des Instituts für Traditionelle Europäische Medizin (TEM) in Wien, rät generell zu Alternativen. "Eine Substitution des Testosterons ist in Sachen Andropause nur äußerst selten der Schlüssel zum Erfolg", sagt er. Die Andropause sei ein "ganz normaler Abschnitt" des natürlichen Alterungsprozesses. Aus der Sicht der TEM sei sie daher ein wichtiges "Lehrstück der Lebensschule", so Steinmetz: Sie lade Männer dazu ein, über Leistung, Sex und den Sinn des Lebens neu nachzudenken.
Gutes Leben
Unter anderem plädiert Steinmetz für Bewegung und eine "gesunde Genussküche". Viele Männer haben während der Andropause Probleme mit der Verdauung und dem Magen-Darm-Trakt, sagt er. Und was man esse, sei so wichtig, weil es einen unmittelbaren Einfluss auf die Hormonwerte habe. "Die Andropause kann eine wunderbare Gelegenheit sein, sich mit Bitterkräutern, Heilerde und generell mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen." Zudem gebe es "eine Palette von spannenden Heilpflanzen", die Wirkung auf den Androgen-Gesamthaushalt gezeigt hätten, sagt Steinmetz. "Auch bei bedenklichen Hormonständen würde die TEM zum Beispiel eher an eine Behandlung mit Brennnesselwurzelpulver und Kieferpollen denken, bevor sie die Testosteronspritze zückt."
Es soll allerdings auch männliche Senioren geben, die mit "spannenden Heilpflanzen" eher wenig am Hut haben. Denen kann vielleicht die Orientierung an Udo Jürgens helfen, der ja auch im höheren Alter noch sehr beschwingt wirkte. In seinen Lieder empfahl auch der Schlagerstar bekanntlich nicht etwa Testosteronpräparate als Wundermittel für mehr Lebenslust, sondern Fernreisen ("Ich war noch niemals in New York"), griechischen Wein und Süßspeisen. "Aber bitte mit Sahne!" Schreibt DER STANDARD.
Liebe Senioren, solange man(n) noch nicht bei den Wechselhaaren angekommen ist, spielen die Wechseljahre überhaupt keine Rolle. Und sollten alle Stricke reissen, nehmen Sie sich eine alte Bauernweisheit aus Deutschland zu Herzen: «Oldenburger Butter hilft dem Bauer auf die Mutter.»
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
5.1.2021 -- Tag der Dekadenz
Rolls-Royce Ghost – Das Auto, in dem sich der Brexit ertragen lässt
Der neue Ghost soll weniger dick auftragen, beteuert Hersteller Rolls-Royce. Eine gewagte Form britischen Understatements: Der Wagen kommt verschwenderischer daher denn je.
Der erste Eindruck: Dekadent! Irre groß ist der neue Rolls-Royce Ghost. Sehr prall auch der von einer Tempelfassade inspirierte Kühlergrill – er wird indirekt von 20 LED beleuchtet.
Das sagt der Hersteller: Auch wenn es zunächst nicht jedem auffällt – Rolls-Royce will beim neuen Ghost Zurückhaltung zeigen. So sollen weniger Konturen im Blech das Design schemenhaft wirken lassen. »Der brüllt nicht, er flüstert«, sagt Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös über den Ghost. Marktforschungsexperten hätten bei den Superreichen den Trend zur »Post-Opulenz« ausgemacht. Wer es in einen Rolls-Royce geschafft hat, so die Botschaft, muss seinen Status niemandem mehr beweisen und will deshalb nicht noch extradick auftragen. Daher hätten die Designer eine Linie um die andere weggerubbelt, sagt Henry Cloke aus dem Stylingteam des Herstellers. Von der bisherigen, ersten Generation des Ghost, wurden in elf Jahren knapp 20.000 Exemplare gebaut – so viele wie von keinem anderen Fahrzeug in der bisherigen Firmengeschichte. Dass die zweite Generation nun dezenter daherkommen soll, ist auch an den eher schlichten Scheinwerfern und Rückleuchten zu erkennen. Dennoch bleibt ein dekadenter Gesamteindruck: Obwohl ohnehin schon übergroß, ist der neue Ghost in Länge und Breite gewachsen. Und schwerer geworden ist das Auto auch.
Das ist uns aufgefallen: Kleine Bildschirme im Cockpit und über der Mittelkonsole, daneben die analoge Uhr ohne Ziffern auf dem tiefschwarzen Blatt – auch innen müht sich der Ghost um Zurückhaltung. Allerdings nur, um dann – genau wie beim Kühlergrill – mit einzelnen, besonders opulenten Details umso mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Das beginnt bei den gegenläufig angeschlagenen Fondtüren. Sie schließen elektrisch und lassen sich per Servomotoren öffnen. Weiter geht's mit dem LED-Firmament in der Deckenverkleidung, durch das nun auch Sternschnuppen schwirren. Der Luxus gipfelt im Armaturenbrett, für dessen Vertäfelung angeblich 10.000 Entwicklungsstunden verbraten wurden: Nach dem Zünden erstrahlt ein Ghost-Schriftzug, umgeben von 850 Sternen. Sie werden, gemeinsam mit den Buchstaben, von 152 LED über einen Lichtleiter zum Leuchten gebracht. Das Blendwerk strahlt dank mehr als 90.000 lasergeätzten Punkten ziemlich perfekt. Von Details besessen, schwadronieren die Briten gern auch über die 20 sogenannten Halbhäute, mit denen sie die 338 Paneele im Innenraum beziehen, oder über die Länge der Nähte.
Daneben ist der Ghost aber immer auch noch ein Fahrzeug und bereit, große Distanzen zu überwinden. Nur bekommt man innen davon eben wenig mit – dank mehr als 100 Kilo Dämmmaterial in Dach, Türen und Radhäusern, ausgeschäumten Reifen und doppelt verglasten Fenstern.
Der Ghost gilt als Auto für Selbstfahrer. Das Lenkrad steht deshalb nicht ganz so steil wie beim Phantom (der eher ein Chauffeursauto ist) und ist etwas griffiger. Dahinter sitzt der Fahrer weniger steif. Vor allem haben die Briten viel getan, damit weniger versierte Fahrer den Ghost würdevoll bewegen können. Der erste Allradantrieb in einer Rolls-Royce-Limousine erhöht die Sicherheit bei schlechtem Wetter. Dank der erstmals eingesetzten Hinterachslenkung geht der Ghost trotz 5,55 Meter Länge und 3,30 Meter Radstand gut ums Eck.
Das muss man wissen: Genau wie der Phantom nutzt der Ghost eine spezielle Rolls-Royce-Architektur und übernimmt von der Konzernmutter BMW nur einzelne Komponenten – wie das Infotainmentsystem oder einige Assistenten. Kaum etwas haben die Briten unverändert vom Vorgängermodell übernommen: lediglich die Kühlerfigur »Spirit of Ecstasy« und die Regenschirme in den Türen.
Unter der Haube der komplett aus Aluminium gefertigten Karosserie steckt ein V12-Motor mit 6,75 Liter Hubraum. Der hat dank 571 PS und vor allem 850 Nm Drehmoment bei lediglich 1600 Touren mit drei Tonnen Auto leichtes Spiel. Der Ghost beschleunigt binnen 4,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und schafft mühelos Tempo 250. Allerdings schluckt er 15,7 Liter Sprit auf 100 Kilometern – laut Norm. In der Praxis wird es deutlich mehr. Von wegen Post-Opulenz.
Zwar ist der Antrieb altmodisch und von Hybrid und Elektro ist bei Rolls-Royce keine Rede. Dennoch bietet der Ghost technisch Wegweisendes. Dabei geht es um »Waftability«, jene mühelose, einem fliegenden Teppich ähnelnde Form der Fortbewegung, die Rolls-Royce proklamiert. So nutzt die Steuerelektronik der Automatik die Daten des Navigationssystems für unmerkliche Gangwechsel. Auch das Fahrwerk lässt vorausblicken (mit Kameras) und stellt die Dämpfer auf Unebenheiten ein, noch ehe sie erreicht sind. Um diesen Effekt zu verfeinern, haben die Briten das Planar-System entwickelt. Bei dem sind die Dämpfer – vereinfacht formuliert – nochmals über spezielle Dämpfer mit der Karosserie verbunden. Das Ergebnis ist ein Gefühl, das näher am Fliegen ist als am Fahren. So ertragen wohl auch EU-Fans den Brexit.
Abgehoben sind auch die Preise. Für den Standard-Ghost stehen mindestens 290.000 Euro auf der Rechnung. Für die Langversion mit 17 Zentimetern mehr Radstand kommen 36.000 Euro obendrauf. Und bei der Interieurauswahl ist es leicht, diese Summe zu verzehnfachen.
Das werden wir nicht vergessen: Die Optionen bei der Ambientebeleuchtung. Wo andere Hersteller Millionen Farben anbieten, gibt’s im Ghost nur zwei Alternativen: Warmweiß und Kaltweiß. Da ist er dann doch wieder, dieser seltsame Minimalismus mitten im Überfluss. Schreibt DER SPIEGEL.
In Zeiten wie diesen, die in den Medien von einer unerträglich schreienden Aufgeregtheit beherrscht wird, tut einem ein Artikel über automobile Dekadenz richtig gut. Die Dekadenz hält sich in vertretbaren Grenzen, wurden doch 2019 gerade mal 5'455 Fahrzeuge der Marke Rolls Royce gebaut (Quelle: Statista).
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang
-
4.1.2021 - Tag der offenen Tür zur Psychiatrie
Ehemalige US-Verteidigungsminister warnen Trump vor Missbrauch des Militärs
In einem Meinungsartikel haben alle zehn noch lebenden ehemaligen US-Verteidigungsminister Donald Trump dazu aufgerufen, das Wahlergebnis zu respektieren. Ein Einschalten des Militärs würde die USA in »verfassungswidriges Gebiet bringen«.
Zehn ehemalige US-Verteidigungsminister haben Donald Trump davor gewarnt, an den Betrugsvorwürfen zur Präsidentschaftswahl festzuhalten. In einem Meinungsartikel, den sie in der »Washington Post« veröffentlichten, schrieben die früheren Minister, dass es vorbei sei, die Ergebnisse der Wahl infrage zu stellen.
An dem Artikel beteiligten sich alle noch lebenden Ex-Verteidigungsminister: Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Leon Panetta, William Perry, Donald Rumsfeld – sowie James Mattis und Mark Esper, die jeweils unter Trump das Pentagon leiteten. Neben der Aufforderung an die Republikaner, das Wahlergebnis zu akzeptieren, schrieben sie auch, dass das US-Militär keine Rolle beim Ausgang der Wahl spielen dürfe.
Grund für den Artikel ist offenbar, dass einige Republikaner planen, die Zertifizierung der Wahlleute-Abstimmung am Mittwoch anzufechten. Noch immer erkennt Trump das Ergebnis der Wahl nicht an, obwohl mehrere Versuche scheiterten, Ergebnisse aus einzelnen Bundesstaaten anzufechten. Zuletzt veröffentlichte die »Washington Post« am Sonntag einen Audio-Mitschnitt, in dem Trump in einem Telefonat den Wahlleiter von Georgia, Brad Raffensperger, unter Druck setzte.
Sorgen um Rolle des Militärs
Aufgrund Trumps Verhaltens mehrten sich zuletzt die Bedenken, dass der US-Präsident das Militär nutzen könnte, um ihn auch nach dem 20. Januar im Amt zu halten. Dann zieht der designierte Präsident Joe Biden ins Weiße Haus ein.
»Die US-Streitkräfte in die Lösung von Wahlstreitigkeiten einzubeziehen, würde uns in gefährliches, ungesetzliches und verfassungswidriges Gebiet führen«, heißt es in dem Meinungsartikel der ehemaligen Verteidigungsminister. Sie warnten zugleich potenzielle Komplizen eines solchen Putschversuchs. »Amtsträger, die solche Maßnahmen anordnen oder durchführen, würden für die schwerwiegenden Folgen ihres Handelns zur Rechenschaft gezogen.«
Bereits im August hatte US-Generalstabschef Mark Milley die neutrale Position der Streitkräfte betont. »Ich glaube zutiefst an das Prinzip eines unpolitischen US-Militärs«, schrieb Milley in einer schriftlichen Antwort auf Fragen zweier demokratischer Mitglieder des Armeeausschusses des Repräsentantenhauses. »Im Falle eines Streits über einen Aspekt der Wahlen sind laut Gesetz US-Gerichte und der US-Kongress verpflichtet, alle Streitigkeiten zu lösen, nicht das US-Militär. Ich sehe keine Rolle für die US-Streitkräfte in diesem Prozess.«
Offenbar bereiteten den ehemaligen Verteidigungsministern auch Äußerungen von Joe Biden Sorge, nach denen die Trump-Administration den Übergangsprozess zur neuen Regierung behindere. Biden sprach unter anderem davon, dass die US-Sicherheitsbehörden »ausgehöhlt« seien und mögliche Feinde jegliche Unklarheiten beim Übergangsprozess ausnutzen könnten. Der amtierende Verteidigungsminister Christopher C. Miller und seine Mitarbeiter müssten sich jeglicher politischer Handlung enthalten, die das Ergebnis der Wahl untergraben oder den Erfolg des neuen Teams gefährden, heißt es in dem Meinungsartikel. Schreibt DER SPIEGEL.
Das grosse Problem mit The Donald ist ja nicht, dass man ihm nichts zutraut, sondern dass ihm ALLES zuzutrauen ist.
Falls Sie einen Kommentar zum Kommentar abgeben wollen: Hier geht's lang