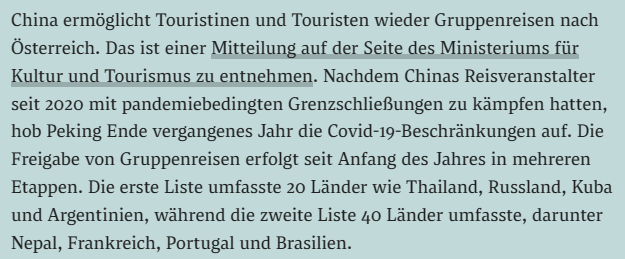René Benko und Signa: Eine Rekonstruktion des Scheiterns
Die Nachricht birgt Zündstoff: Österreichs Justiz ermittelt gegen den Immobilieninvestor René Benko. Es ist Oktober 2022. In Wien wird der Fall zum Stadtgespräch. Benko steht im Verdacht, einen hochrangigen Beamten des Finanzministeriums bestochen zu haben, um ein Steuerverfahren zu beeinflussen.
Das Justizverfahren markiert einen Wendepunkt in Benkos Karriere. Erstmals wirkt der erfolgreiche Immobilienunternehmer angeschlagen.
Zuvor war der 46-jährige Benko in der Öffentlichkeit der «Wunderwuzzi» gewesen – das Wunderkind, dem alles zu gelingen schien. Noch im Jahr 2020 kauft Benko zusammen mit der thailändischen Central Group in der Schweiz die Warenhauskette Globus, mitsamt prestigeträchtigen Immobilien wie dem Stammhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse. Ende 2021 erwerben die Partner zudem das britische Warenhaus-Konglomerat Selfridges für 4 Milliarden Franken.
Zusammen formen Signa und Central Europas führende Luxuswarenhauskette. Es ist der Höhepunkt von Benkos Karriere.
Erste Zweifel an der Signa-Gruppe
Doch im Herbst 2022 findet sich Benko plötzlich in den Niederungen juristischer Verfahren wieder. Der Geschäftsmann wird Gegenstand öffentlicher Mutmassungen. Hat er geschummelt und womöglich die Grenzen des Zulässigen überschritten?
In Benkos Signa-Gruppe herrscht Nervosität. Die schlechte Presse kommt ihr höchst ungelegen. Denn zur gleichen Zeit mehren sich die Fragen, wie es Benko geschäftlich geht. In Deutschland beantragt die Warenhaustochter Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal in zweieinhalb Jahren ein Sanierungsverfahren.
Zudem gerät die Immobilienbranche in einen Sturm. Im Sommer 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins erstmals wieder erhöht und damit eine fast zehnjährige Nullzinsphase beendet. Die Kredite zur Finanzierung von Immobilien werden teurer. Gleichzeitig treibt die hohe Inflation die Baukosten nach oben. In Deutschland, dem Hauptmarkt der Signa-Gruppe, gehen verschiedene Immobilienfirmen in Konkurs.
Die Firmenverantwortlichen der Signa beteuern jedoch, man habe alles im Griff. Ein Beispiel dafür ist Signa Prime, das wichtigste Immobilienunternehmen der Gruppe. Es ist nicht nur Mitbesitzer der Globus-Liegenschaften oder der KaDeWe-Gebäude, sondern treibt vor allem in Deutschland prestigeträchtige Bauprojekte wie den Hamburger Elbtower voran.
Christoph Stadlhuber, der Geschäftsführer der Signa Holding, erklärt im Sommer 2022 im österreichischen Fernsehen, die Top-Immobilien von Signa Prime seien auf 20 bis 25 Jahre fix finanziert. «Dort treffen uns die Zinssteigerungen überhaupt nicht.» Erst später stellt sich heraus, dass Signa Prime schon im Jahr 2022 den Wert des Immobilienportefeuilles wegen der gestiegenen Zinsen um 1,2 Milliarden Euro abschreiben und einen Verlust ausweisen muss.
Der äussere Druck führt zunächst dazu, dass sich wichtige Investoren der Signa-Gruppe hinter den Firmengründer Benko stellen. Dem Tiroler war es ab 2013 gelungen, bedeutende Geldgeber für seine Geschäfte zu gewinnen. Zu ihnen gehören der Hamburger Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne, der österreichische Bauunternehmer und Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner, der Schweizer Lindt-&-Sprüngli-Präsident Ernst Tanner oder die französische Peugeot-Familie.
In der Firmenzeitschrift «Signa Times» loben die Mitinvestoren Benko noch im Oktober 2022 als «erfolgreichen Geschäftsmann» und zeigen sich «hochzufrieden» mit ihren Investments. Und sie lassen ihren Worten Taten folgen: Insgesamt rund 1 Milliarde Euro schiessen die Investoren an frischem Kapital in die Signa-Immobilienfirmen ein.
Ein verfängliches Zitat von Investor Kühne
Ende Februar 2023 kippt jedoch die Stimmung. Eine Aussage von Klaus-Michael Kühne im «Manager-Magazin» lässt aufhorchen. Angesprochen auf seine Signa-Beteiligung, sagt er: «Das ist derzeit etwas volatil; das Thema haben wir unter Beobachtung.» Es ist ein isoliertes Zitat ohne Kontext, aber es sorgt sofort für Aufregung. Signalisiert Kühne mit hanseatischer Zurückhaltung, dass er auf Distanz zu Benko geht? Jedenfalls lässt erstmals ein bestehender Investor durchblicken, dass der Signa-Gruppe die steigenden Zinsen zu schaffen machen.
Von nun an mehren sich die Anzeichen, dass Benko Geld braucht. Die Signa-Unternehmen sind offensichtlich doch kurzfristiger finanziert, als dies zuvor dargestellt wurde. Im Frühling 2023 verkauft Signa Prime die Hälfte des KaDeWe-Gebäudes in Berlin an die Geschäftspartner der thailändischen Central Group. Für Benko ist es ein schmerzhafter Schritt. Das berühmte «Kaufhaus des Westens» war für ihn eine Trophäe gewesen. Sein Erwerb zehn Jahre zuvor hatte Benkos Aufstieg symbolisiert.
Anfang Juni 2023 schreitet Benko zum bisher grössten Verkauf. Er stösst für rund 400 Millionen Euro die österreichische Möbelkette Kika-Leiner samt Immobilien ab. Die Transaktion sorgt in Österreich für Unmut, denn Kika-Leiner muss kurz darauf Insolvenz anmelden. Die Öffentlichkeit fragt sich: Ist da alles mit rechten Dingen zugegangen? Steuert Benko auf den Abgrund zu, oder gelingt es ihm, die Finanzen von Signa neu zu ordnen?
Suche nach frischem Geld
Im Sommer 2023 ist Benko auf der Suche nach neuen Geldgebern. Er hofft, von einem institutionellen asiatischen Grossinvestor eine Kapitalspritze von 500 Millionen Euro zu erhalten. Doch das Geschäft kommt nicht zustande. Es ist der Anfang vom Ende.
Benko versucht, die verschachtelte und weitverzweigte Signa-Gruppe zusammenzuhalten. Aber das wird immer schwieriger. Wie schlecht es um die Gruppe bestellt ist, wird am 19. Oktober 2023 offenkundig. Benko zieht eine Geldzusage von 150 Millionen Euro an die angeschlagene Online-Sporthandelstochter Signa Sports United zurück. Der Firma bleibt nichts anderes übrig, als Konkurs anzumelden. Benko benötigt das Kapital offenbar, um andere Löcher zu stopfen.
Benkos Mitinvestoren sind entsetzt. Es ist die erste Insolvenz einer Firma der Signa-Gruppe. Bei Signa Sports United haben sich 3 Milliarden Börsenkapitalisierung in Luft aufgelöst. Manche Geschäftspartner werfen Benko vor, er habe eigenmächtig gehandelt. Das Vertrauen erodiert.
Stillstand auf den Baustellen in Deutschland
Die zweite Zäsur folgt Ende Oktober 2023. Auf der Baustelle des Elbtowers in Hamburg, der noch nicht einmal halb fertiggestellt ist, steht die Arbeit still. Die Baufirmen erhalten von Signa keine Zahlungen mehr.
Damit wird für die breite Öffentlichkeit schlagartig klar, dass Benkos Signa-Gruppe in akuten Geldnöten steckt und ums Überleben kämpft. Ausgerechnet der Elbtower wird zum Symbol für Benkos Niedergang. Ein Jahr zuvor war das Bauvorhaben in der Firmenzeitschrift «Signa Times» noch als «Wahrzeichen für Stabilität und Statement gegen Verunsicherung und Pessimismus» gefeiert worden.
Von da an nimmt das Drama seinen Lauf. Einzelne Investoren wie der Unternehmensberater Roland Berger und der Fressnapf-Gründer Torsten Toeller wollen ihr Geld zurück. Auf immer mehr Baustellen ruhen die Arbeiten. Benkos Mitinvestoren bei der Signa-Holding, unter ihnen Hans Peter Haselsteiner und Ernst Tanner, fordern den Firmengründer zum vorübergehenden Rückzug auf und verlangen, dass ein Sanierungsexperte die Geschäfte übernehme. Nur so lasse sich die Signa-Gruppe noch retten, schreiben sie in einem Brief an den Firmengründer.
Benko willigt vordergründig ein. Aber er denkt nicht im Traum ans Aufgeben. Den Investor zeichnet ein starker Drang aus, wirtschaftlich aufzusteigen. Scheitern kommt für ihn nicht infrage. Der Business-Fanatiker arbeitet weiter rund um die Uhr – so, wie er es schon bisher tat, obwohl er längst keine offizielle Funktion im Firmengeflecht mehr innehatte.
Benko setzt sich in den Privatjet, um das frische Geld aufzutreiben, das die Signa-Gruppe so dringend benötigt. Er spricht mit dem saudiarabischen Staatsfonds und verschiedenen Hedge-Funds. Aber keiner der potenziellen Geldgeber lässt sich überzeugen. Die Lage im verschachtelten Firmenkonstrukt ist wohl auch für sie zu wenig durchschaubar.
Signa-Holding meldet Insolvenz an
Am 29. November 2023 lässt sich das Schicksal nicht mehr abwenden. Die Signa-Holding, die als Dachgesellschaft über der Signa-Gruppe thront und die mehrheitlich René Benko gehört, meldet beim Wiener Handelsgericht Zahlungsunfähigkeit an. Es ist der vorläufige Höhepunkt im Signa-Drama. Gleichzeitig handelt es sich um die grösste Insolvenz der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.
Die Dimensionen bringen die Öffentlichkeit zum Staunen. Die Signa-Holding schuldet ihren Gläubigern 5,3 Milliarden Euro. Allein im Jahr 2023 hat sich die Verschuldung offenbar mehr als verdoppelt. Im Gegenzug sind die Vermögenswerte – die Beteiligungen an den verschiedenen Immobilien- und Handelsfirmen der Signa-Gruppe – dramatisch geschrumpft. Sie haben einen Buchwert von nur noch 2,8 Milliarden Euro. Angesichts der starken Überschuldung erscheint es fraglich, ob der Plan der Signa-Holding, sich in Eigenverwaltung zu sanieren, aufgehen kann.
Der Insolvenzantrag gibt auch Einblicke, wie bei der Signa-Holding geschäftet wurde. Im Jahr 2022 gab sie 4,9 Millionen Euro für Reisekosten aus. Rund 2 Millionen Euro entfielen auf Privatjet-Flüge. Benko und seine Vertrauten luden Geschäftspartner auch gerne auf die Jagd ein, dafür wurden 0,4 Millionen ausgegeben. Bewachung liess man sich 0,7 Millionen kosten, Helikopterflüge 0,4 Millionen.
Benko frönte dem Luxus. Er war grosszügig – zu sich selbst, aber auch zu den Angestellten. Geld war für den Investor stets auch ein Mittel, um sich die Loyalität von Geschäftspartnern und Mitarbeitern zu erkaufen.
Offene Zukunft
Was von Benkos Signa-Gruppe übrig bleiben wird, ist offen. Es wird erwartet, dass weitere Firmen Insolvenz anmelden werden, etwa die Immobiliengesellschaft Signa Prime oder die Muttergesellschaft von Globus in der Schweiz. Die Firmen von Signa sind über Finanzverbindlichkeiten eng miteinander verbunden. Deshalb besteht das Risiko, dass ein bankrottes Unternehmen weitere Firmen der Gruppe in den Abgrund reisst.
In den nächsten Monaten wird es ans Abrechnen und Aufräumen gehen. Nur etwas mehr als ein Jahr hat es gedauert, bis aus dem «Wunderwuzzi» ein gescheiterter Immobilienunternehmer geworden ist. Benko hat sich zu den finanziellen Schwierigkeiten der Signa-Gruppe nie geäussert. Seit Monaten ist er abgetaucht. Es gibt lediglich Bilder einer Einkaufstour mit Familie Ende November in Barcelona. Schreibt die NZZ am 9.12.2023.
10.12.2023 – Tag des talentierten Mr. Benko
Vorweg sei festgehalten, dass die Muttergesellschaft von Globus Schweiz längst Insolvenz angemeldet hat. Wie auch etliche Unternehmen der Signa-Gruppe aus Deutschland. Das sollten eigentlich auch die drei (sic!) Verfasser des NZZ-Artikels vom 9.12.2023 wissen. So viel zum Qualitätsjournalismus.
Was in Österreich ein Riesenthema ist, geht den meisten Schweizern und Schweizerinnen allerdings am Allerwertesten vorbei, sind wir Kinder von Wilhelm Tell seit jeher an einiges in Sachen «Schneeballsystemen» gewöhnt. Nur, dass diese in good old Switzerland etwas andere Dimensionen haben. Denn, Hand aufs Schweizer Herz: Etwas anderes als ein gigantisches Schneeballspiel produzierte auch die von der UBS übernommene «Credit Suisse» nicht. Gegen die Banksters beim CS-Crash wie Urs Rohner & Co. ist der «talentierte Mr. Ripley, pardon, Mr. Benko» ein Waisenknabe.
Und die Signa-Investoren, etliche davon aus der obersten Kiste der Schweizer Wirtschaftselite, bestätigen einmal mehr, dass die Gier nichts anderes als eine Hure ist. Denn wie im Puff werden auch im Casino der niemals versiegenden, wunderbaren Geldvermehrung aus fetten Titten nicht selten verbrannte Fozelschnitten.
Randnotiz: Auch die Credit Suisse soll Dutzende Millionen gesprochen haben – nun könnte das neue Mutterhaus UBS auf den Krediten sitzen bleiben. Mit der Notübernahme der Bank im vergangenen März landet nun auch dieses Darlehen in den Büchern der UBS, die offenbar mit Benko im Gegensatz zur CS nie Geschäfte machen wollte. Die Kredite sind insofern gefährdet, heisst es weiter, da sie zu wesentlichen Teilen mit Wertschriften besichert seien, die aufgrund der Implosion der Signa-Gruppe wohl markant an Wert verlieren.
Peter Studer – ein Verfechter des Qualitätsjournalismus
Der Publizist und ehemalige Chefredaktor ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Eine wohltemperierte Stimme verstummt.
Peter Studer war 1978 bis 1987 Chefredaktor des Zürcher «Tages-Anzeigers», 1988/89 Verwaltungsrat bei der damaligen Nachrichtenagentur SDA, in den 1990er-Jahren fast zehn Jahre lang Chefredaktor des Schweizer Fernsehens, später Präsident des Presserates.
Prägend war er auch in seiner Rolle als Experte, Gutachter und Referent medienrechtlicher und -ethischer Fragen. Branchenkennerinnen und -kenner würdigen vor allem sein Engagement für Medienqualität und Medienfreiheit.
Peter Studer sei in den teilweise aufgeladenen, schrillen Mediendebatten aufgefallen als wohltemperierte Stimme, als Instanz, als ein Verfechter des Qualitätsjournalismus.
Zürcher Journalistenpreis und Ehrendoktorwürde
Als Chef habe er sich immer wieder standhaft vor seine Redaktion gestellt, heisst es in der Laudatio des Zürcher Journalistenpreises, den er mit 83 Jahren erhielt. Er wurde geehrt als jemand, der «aus tiefster liberaler Überzeugung den Journalismus gegen alle seine Anfeindungen» verteidigt hat.
Studer lehrte unter anderem an der Universität St. Gallen, die ihm die Ehrendoktorwürde verlieh, und an der Hochschule Luzern. Von seinen Studierenden forderte er nicht nur medienethische Reflexion, sondern auch Praxiswissen. Die «Neue Zürcher Zeitung» wurde zur Pflichtlektüre erklärt und deren Inhalte regelmässig abgefragt. Dr. Studer war früher Oberst und drillte künftige Berufsleute mit Herz und trockenem Humor durch die Semester.
«Neugierig, wahrhaftig, fair und transparent»
Seine Familie nennt in der Todesanzeige, die sie dem Branchenportal persoenlich.com zukommen liess, die Werte Neugierde, Wahrhaftigkeit, Fairness und Transparenz als «seine Leitwährung».
Sein wacher Geist und sein breites Wissen werde in bester Erinnerung behalten. Diese Erinnerungen wird weit über seine Familie hinausreichen. Schreibt SRF.
4.12.2023 – Tag des aussterbenden Qualitätsjournalismus
Peter Studer war mehr als nur eine «wohltemperierte» Stimme. Viel mehr. Er verkörperte als einer der Letzten die alte Schule des Journalismus. Seine qualitativ hochstehende Berichterstattung – und damit der Qualitätsjournalismus an sich – machte den Unterschied zum schreienden Boulevard und dem Clickbaiting, das es damals als Wortschöpfung zwar noch gar nicht gab, aber dennoch bereits von Boulevardmedien wie Blick und später 20Minuten angewendet wurde.
Ausserdem verfügte er über ein breites Wissen, speziell im Bereich der Historie, von dem heutige Journalisten nur noch träumen können. Er war liberal, aber niemals Neo- oder gar Illiberal. Lobgesänge auf Nazi-Grössen vom verbrecherischen Kaliber Goebbels oder Göring und servile Huldigungen an den Diktator Putin, wie sie beispielsweise ein Roger Köppel absondert*, wären bei Peter Studer trotz Wirtschaftsnähe undenkbar gewesen.
R.I.P.
* Anmerkung: Die Suchmaschine Google hilft weiter, falls Sie es nicht für möglich halten
Rettungsversuch gescheitert – Signa von René Benko insolvent
Die Signa Holding GmbH wird einen Antrag auf Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien einbringen. Zudem beantragt sie die Annahme eines Sanierungsplans. Ziel ist "die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens", heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns von Mittwochvormittag. Anlass der Insolvenzanmeldung ist Zahlungsunfähigkeit der Signa Holding. Die Investoren rund um Hans Peter Haselsteiner sollen den Schritt Richtung Insolvenzgericht mittragen und unterstützen, wie DER STANDARD erfahren hat.
Als Hintergrund dafür wird der Druck genannt, der auf dem Retail-Bereich, und da vor allem dem stationären Einzelhandel, laste. Die Investitionen der Signa hätten nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Im Immobilienbereich hätten sich zuletzt die externen Faktoren "negativ auf die Geschäftsentwicklung" ausgewirkt. Man habe trotz erheblicher Bemühungen die nötige Liquidität nicht sicherstellen können, die man für eine außergerichtliche Restrukturierung gebraucht hätte.
Auf Antragsprüfung folgt Sanierungsplan
Das Ziel, das sich die von René Benko gegründete Signa Holding gesetzt hat, ist, mit einem Sanierungsverwalter "die weiteren Maßnahmen zur Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs umzusetzen". Zudem soll ein Sanierungsplan ausgearbeitet werden, dafür sind 90 Tage Zeit. Sollte alles so kommen, wie von der Signa beantragt und erhofft, würde das eine 30-prozentige Quote für die Gläubiger bedeuten. Das Insolvenzgericht wird den Antrag nun prüfen und gegebenenfalls einen Sanierungsverwalter einsetzen.
"Herkulesaufgabe" fürs Insolvenzgericht
Der Insolvenzantrag gilt ausschließlich für die Signa Holding GmbH, nicht für andere Gesellschaften, die zum Signa-Reich ressortieren. Laut dem Kreditschutzverband KSV 1870 ist die Signa Holding an 36 österreichischen Kapitalgesellschaften beteiligt, in unterschiedlichem Ausmaß, wie der KSV in einer Aussendung am Mittwoch schrieb. Eine der wesentlichen Aufgaben des vom Handelsgericht Wien zu bestellenden Insolvenzverwalters sei nun die Prüfung der Werthaltigkeit der direkten Beteiligungen der Signa Holding GmbH. Aufgrund der Tatsache, dass die direkten Beteiligungen der Signa Holding wieder eine Vielzahl an Beteiligungen halten, sei das "eine Herkulesaufgabe". Informationen zur Höhe der Verbindlichkeiten und Zahl der Gläubiger hatte der KSV am Mittwoch noch nicht.
Die Frage, wer aufseiten der Signa den angestrebten Sanierungsprozess begleiten wird, wird von der Signa Holding in ihrer Aussendung nicht beantwortet. Zu hören ist, dass dies die Geschäftsführer der Signa Holding sein werden, also Christoph Stadlhuber und Marcus Mühlberger, sie sollen im Amt bleiben.
Benko soll keine Rolle spielen
Die künftige Rolle des bereits von Benko als Sanierer geholten deutschen Experten Arndt Geiwitz dürfte intern noch nicht ganz geklärt sein – er soll aber ausschließlich beratend tätig sein. Und Signa-Gründer René Benko selbst werde in dem angestrebten Sanierungsverfahren keine Rolle spielen, ist zu hören.
In der jüngsten Vergangenheit war es ja intern zu schweren Turbulenzen gekommen. Benko habe sich nicht aus dem Beirat zurückgezogen, obwohl das die Signa-Investoren rund um Hans Peter Haselsteiner (Strabag) verlangt haben. Auch wurde der von Geiwitz angekündigte Restrukturierungsvorstand Ralf Schmitz bisher nicht in seine Funktion gesetzt – jedenfalls ist davon nichts im Firmenregister zu sehen. Weder Benko, noch sein Sprecher, noch Geiwitz, noch die Investoren waren in den vergangenen Tagen zu erreichen, Kommunikation nach außen gab es keine.
Auch im Beirat der Signa Holding herrschte Funkstille. So war auch von Beiratsmitglied Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) oder Ex-RBI-Chef Karl Sevelda oder Wüstenrot-Chefin und Ex-Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn (FPÖ) nichts zu hören. Was allerdings zu hören ist: Haselsteiner soll vor allem auf Gusenbauer schlecht zu sprechen sein – von Letzterem wurden zuletzt hohe Honorarnoten an die Signa bekannt. Gusenbauer sitzt auch im Aufsichtsrat der Signa Prime und Signa Development, der beiden wichtigsten Signa-Gesellschaften im Immobilienbereich. Darüber hinaus ist Gusenbauer Aufsichtsratsvorsitzender des Baukonzerns Strabag und im Vorstand von Haselsteiners Privatstiftung.
Konflikte mit den Investoren
Derartige internen Querelen könnten nun noch befeuert werden. Offensichtlich wurden auch zwischen den diversen Signa-Gesellschaften Honorare bezahlt – diesbezüglich dürfte es auch unter den Investoren noch Aufklärungsbedarf geben. Dass Benko seine "Privatimmobilien" wie jene am Gardasee und die Familienvilla in Igls bei Innsbruck an die Signa Holding vermietet hat, wie DER STANDARD berichtete, könnte weitere Fragen aufwerfen. Laut "Spiegel" erwägen erste Investoren gar eine Strafanzeige gegen Benko. Es sei "nicht verständlich, was passiert ist", sagte demnach ein Investor. Man sehe "Zeichen für eine Insolvenzverschleppung", denn die Probleme hätten sich bereits im Sommer abgezeichnet. Von Benko gab es gegenüber dem "Spiegel" keinen Kommentar.
Ein prominenter Gläubiger ist laut "Kurier" auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser hat nach seinem Ausstieg aus der Politik Benko beraten, etwa bei der Anbahnung möglicher Deals im arabischen Raum. Nun sind laut "Kurier" noch 1,5 Millionen Euro Honorar an Kurz offen.
Jahrelang galt die Signa mit einem Immobilienvermögen von zuletzt rund 15 Milliarden Euro als einer der schnellstwachsenden Immobilien- und Handelskonzerne Europas. Gegründet wurde die Signa als Nachfolgegesellschaft der Immofina im Jahr 2006, im Jahr 2013 zog sich der heute 46-jährige Innsbrucker Benko in den Beirat zurück, wo er den Vorsitz übernahm. Neben Immobilien investierte man in den Handelssektor, unter anderem durch den Erwerb der deutschen Warenhauskette Galeria Kaufhof, Kika/Leiner und Globus in der Schweiz. Dazu kommen Online-Handelsplattformen, etwa im Sportbereich.
Einstieg in Handel und Medien
Im Jahr 2018 kaufte sich Benko indirekt mit jeweils rund 24 Prozent in die österreichischen Tageszeitungen "Krone" und "Kurier" ein. Zu den bekanntesten Signa-Immobilien zählen etwa das Goldene Quartier, die Postsparkasse oder das Hotel Hyatt in der Wiener Innenstadt. An der Wiener Mariahilfer Straße errichtet Signa mit einem Partner gerade das Kaufhaus- und Hotelprojekt Lamarr. In Hamburg sollte der Elbtower entstehen, der derzeit von einem Baustopp betroffen ist. In New York besitzt der Tiroler mit Partnern das Chrysler Building. Dazu kommen weitere Luxuskaufhäuser in München, Berlin und Hamburg. Schreibt DER STANDARD.
29.11.2023 – Tag des Neofeudalismus
Ein Leserbeitrag im Forum (Nick-Name «Minimaximus») bringt einiges auf den Punkt über die gesellschaftlichen Zustände in Österreich: «Wir erleben hier einen weiteren, besonders plakativen Auswuchs des herrschenden Neofeudalismus. Mit Neoliberalismus – selbst in seiner ärgsten Prägung – hat das schon lange nichts mehr zu tun. Unser (österreichisches, Anm.) System ähnelt wieder absolut und verblüffend dem System der Feudalzeit im 18. und 19. Jahrhundert. Demokratie gibt es – wenn überhaupt – als Feigenblatt; eine wirkliche Rolle spielt sie längst nicht mehr. Welche Partei immer auch gewählt wird, sie hat kaum Einfluss darauf, was tatsächlich passiert.
Der Neofeudalismus dient dazu, der kleinen herrschenden Schicht des «Geldadels» die Verwaltung und Erhaltung der exzessiven Vermögen zu ermöglichen. Im Gegenzug partizipieren die auf dem Papier formal «gewählten» Volksvertreter ebenfalls.
Carlo Sommaruga, Präsident der Gruppe Schweiz-Palästina, will kein Hamas-Verbot
Ein Verbot der Hamas in der Schweiz wäre laut dem Präsidenten der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Palästina ein Fehler. Es würde den langfristigen Interessen des Landes schaden, so Carlo Sommaruga.
Würde die Schweiz nun andere als von der UNO verbotene Organisationen verbieten, «öffnet man die Büchse der Pandora», sagte Sommaruga in einem Interview mit «Le Matin Dimanche». «Man liefert sich dem Druck von Ländern aus, die denselben Antrag stellen werden, zum Beispiel die Türkei für die PKK.»
Diese Woche war bekannt geworden, dass Aussenminister Ignazio Cassis anstrebt, die Hamas per Sondergesetz zu verbieten. «Leider verbeugt sich Herr Cassis vor Israel, anstatt die langfristigen Interessen unseres Landes zu sehen», sagte der Genfer SP-Ständerat Sommaruga nun im Interview. Schreibt SRF im Nahost-Liveticker.
20.11.2023 – Tag der politischen Bankrotterklärung
Auch ein SP-Ständerat wie Carlo Sommaruga sollte zwischen dem Palästinensischen Volk und der von den saudischen Salafisten gegründeten Terrorgruppe Hamas unterscheiden können.
Die Behauptung, dass die Schweiz mit einem Verbot der Hamas damit Anträgen anderer Länder wie der Türkei künftig nicht mehr widerstehen könne, ist eigentlich nichts anderes als eine Bankrotterklärung der Schweizer Politik durch Sommaruga.
Bleibt zu hoffen, dass dem nicht so ist. Trotz mehr oder weniger fragwürdigem politischen Personal querbeet durch alle Parteien im Schweizer Parlament.
Wie ein 21 Jahre alter Bin-Laden-Brief viral ging
Die britische Zeitung "The Guardian" hat eine Verlinkung zu einer 21 Jahre alten Botschaft des ehemaligen Al-Kaida-Anführers Osama bin Laden von ihrer Website entfernt, nachdem diese im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg in Nahost mehrere Millionen Mal in Onlinediensten geteilt wurde. Der Link zu bin Ladens "Brief an Amerika" wurde am Mittwoch gelöscht und durch eine Erklärung ersetzt.
Darin schreibt die Zeitung: "Die auf unserer Website veröffentlichte Abschrift wurde ohne den vollständigen Kontext in den sozialen Medien weit verbreitet. Daher haben wir uns entschlossen, sie zu entfernen und die Leser stattdessen auf den Artikel zu verweisen, in dessen Kontext sie ursprünglich stand."
Ausschnitte des Briefes mit Krieg in Nahost verbunden
Bin Laden verurteilt darin die Unterstützung der USA für Israel und nennt diese als Grund für die Angriffe am 11. September 2001. "Sie haben Hunderttausende Soldaten auf uns gehetzt und sich mit den Israelis verbündet, um uns zu unterdrücken und unser Land zu besetzen – das war der Grund für unsere Antwort am elften Tag", erklärte bin Laden mit Blick auf die Anschläge. Bei TikTok wurden Zitate daraus und Verweise auf den Text beim "Guardian" mit Bezug auf den Gaza-Krieg verbreitet.
Das Weiße Haus verurteilte das Teilen des Beitrags und erklärte auf X, ehemals Twitter, niemand solle die "2.977 amerikanischen Familien, die immer noch um ihre Angehörigen trauern, beleidigen, indem er sich mit den abscheulichen Worten von Osama bin Laden in Verbindung bringt".
Tiktok löscht Videos
Die Videoplattform Tiktok reagierte nun mit dem Löschen solcher Videos. Die Videos würden "proaktiv und aggressiv" entfernt, teilte Tiktok am Donnerstag mit. Tiktok sperrte auch den Hashtag "#lettertoamerica" in der Suchfunktion der Plattform. Die Verbreitung der Videos und die Berichte darüber lösten sofort neue Kritik an dem Dienst aus, dem in den USA Nähe zu chinesischen Behörden vorgeworfen wird – was Tiktok zurückweist. So schrieb die republikanische Präsidentschaftsanwärterin Nikki Haley auf X, dies sei ein Beispiel dafür, "wie unsere ausländischen Feinde soziale Medien vergiften".
Tiktok konterte, es habe nur "eine geringe Anzahl" der Videos gegeben – und sie verstießen ganz klar gegen die Regeln der Plattform. Laut einer Analyse wurden die seit Anfang der Woche veröffentlichten Videos zunächst rund zwei Millionen Mal angesehen, was nicht sehr viel für eine Plattform mit rund 150 Millionen Nutzern allein in den USA ist. Dann habe ein Zusammenschnitt auf X neue Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Bis Donnerstagnachmittag seien Videos mit dem entsprechenden Hashtag mehr als 15 Millionen Mal angesehen worden.
"Guardian"-Entscheidung bringt auch Kritik
Bin Laden war im Mai 2011 in Pakistan von US-Spezialkräften getötet worden. Eine Expertin für Propaganda und Falschinformationen an der Stanford-Universität kritisierte die Entscheidung des "Guardian" als einen Fehler. Man sollte längst öffentlich bekannte Fantasien eines Terroristen nicht zum verbotenen Wissen machen, nur weil es einige bei Tiktok verbreiteten, argumentierte Renee DiResta beim Onlinedienst Threads. So könne es für manche aufregender werden, sie wiederzuentdecken. Stattdessen solle man Leute "die Forderungen des Mörders" lesen lassen und mehr Kontext hinzufügen. Schreibt DER STANDARD.
17.11.2023 – Tag der TikTok-Vollposten
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die TikTok-Vollpfosten Adolf Hitlers «Mein Kampf» entdecken, aus dem sich so ziemlich die übelsten Aussagen über die Juden zitieren lassen. Oder die tausenden (Anm. das ist keine Übertreibung) von Original-Videos auf YouTube mit dem sprachlichen Originalgetöse des GRÖFAZ (Grösster Führer aller Zeien).
Es sei aber auch erwähnt, dass wir diese aufgebauschte Medienmeldung nicht allzu hoch hängen sollten. Selbst wenn Bin Ladens Brief von zig tausend TikTok-Fans gelesen wurde: Die überwiegende Mehrheit der Erdbewohner*innen haben ihn nicht gelesen. Circa 0,004 Milliarden von 8,06 Milliarden der derzeitigen Weltbevölkerung sind eigentlich vernachlässigbar.
Alles halb so wild, aber ein guter Aufmacher fürs Clickbaiting.
Grüne verlieren an einem Tag zwei Sitze im Ständerat
Der Ständerat war noch nicht komplett. Am Sonntag fanden deshalb in diesen vier Kantonen zweite Wahlgänge statt: Genf, Wallis, Waadt und Freiburg.
Spannend war es besonders in Genf. Hier konnte die SP mit Carlo Sommaruga ihren Sitz verteidigen. Mauro Poggia vom Mouvement Citoyens Genevois (MCG) hingegen konnte den Sitz der Grünen erobern. Auch im Kanton Waadt verlieren die Grünen ihren Sitz. Hier geht er an Pascal Broulis von der FDP.
Im Kanton Freiburg schafften die Mitte-Ständerätin Isabelle Chassot und FDP-Ständerätin Johanna Gapany ihre Wiederwahl. Die Herausforderin Alizée Rey von der SP musste sich mit 900 Stimmen weniger geschlagen geben.
Im Wallis sitzen die bisherigen Ständeräte hingegen fest im Sattel. Die beiden Mitte-Ständeräte Beat Rieder und Marianne Maret sind wiedergewählt, Herausforderer Philippe Nantermod von der FDP belegte abgeschlagen den dritten Platz. Schreibt WATSON.
13.11.2023 – Tag der Entzauberung der Grünen
Je höher man steigt, umso tiefer fällt man.
Christoph Blochers «Auslegeordnung»
Die eidgenössischen Wahlen waren ein Fingerzeig: Die Träumereien der letzten dreissig Jahre sind hoffentlich vorbei. Allzu viele glaubten allen Ernstes, es gebe keine Kriege mehr, man könne die Armee abschaffen oder doch massiv verkleinern. Die Chefin des Verteidigungsdepartements reagierte nach dem längt sichtbaren Angriff der Russen auf die Ukraine völlig überrascht, wie wenn es keinen Nachrichtendienst gäbe. Dazu kam die verantwortungslose Aufweichung der Neutralität. Die USA übten Druck auf die Banken aus, worauf die Landesregierung sich der Sanktionspolitik der EU unterordnete.
Die Grünen und die Grünliberalen haben verloren, weil ihre Luftschlösser durch die massive Verteuerung der Energie entzaubert wurden. Auch zeigen sich die Folgen des verfehlten, einzig von der SVP bekämpften Krankenversicherungsgesetzes in Form von dauernden Prämiensteigerungen. Jeder Zuwanderer und jeder Asylbewerber erhält sofort die vollen Gesundheitsleistungen.
Hinzu kommt eine Bevölkerungsexplosion. Es wird behauptet, die EU-Personenfreizügigkeit sei nötig wegen dem Fachkräftemangel. Dabei kommen alle, die wollen, nicht jene, die wir benötigen. 47 Prozent all jener, die auf dem ordentlichen Weg einwandern, arbeiten gar nicht, belasten aber unsere Infrastrukturen und brauchen wieder neue Zuwanderer. Die 180'000 Netto-Zuwanderer benötigen 40 Prozent der Leistung des stillgelegten Kernkraftwerks Mühleberg. Auch das verfehlte Asylsystem bricht jetzt auf: Es kommen und bleiben nicht nur jene, die an Leib und Leben bedroht sind, sondern vor allem viele, die ein besseres Leben suchen.
All das haben die Bürgerinnen und Bürger am 22. Oktober erkannt – und hoffentlich ein Stück weit korrigiert.
E gueti Wuche. Schreibt Alt-Bundesrat Christoph Blocher in der «Verlegerkolumne» seiner Gratisblätter
12.11.2023 – Tag der Schweizer Migranten und deren Startups
Den ersten und zweiten Absatz kann man durchgehen lassen. Es ist ja nicht per se alles falsch, nur weil es Blocher schreibt. Die «Aufweichung der Neutralität» ist reine Ansichtssache. Viele ältere Schweizerinnen und Schweizer tun sich mit Veränderungen schwer. Aber ohne permanente Veränderungen würde die Menschheit noch immer auf den Bäumen leben. Das Problem mit den Veränderungen sind meines Erachtens gar nicht die Veränderungen an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der sie über uns hereinbrechen. Ansonsten verweise ich auf König Artus (sofern es ihn überhaupt gegeben hat): «Nichts bleibt wie es ist. Doch der Starke wird immer den Schwachen besiegen».
Beim dritten Absatz muss man Herrn Blocher aber schon die rote Karte zeigen. War es nicht Bundesrat Christoph Blocher als damaliger Departements-Vorsteher des EJPD, der vor der eidgenössischen Abstimmung über die Personenfreizügigkeit die Parole verbreite, an deren Wortlaut ich mich noch ganz genau erinnere? «Ich denke, wir sollten das probieren». Auf Grund dieser Empfehlung von Bundesrat Blocher habe sogar ich damals mit Ja gestimmt. Aus heutiger Sicht würde ich das als einen Fehler von mir bezeichnen. Wobei festzuhalten ist, dass ein Nein von mir am Wahlergebnis nichts geändert hätte.
Doch das gebetsmühlenartige Gebabbel über die Migranten an sich nervt je länger je mehr. Vor allem vom Wahlkämpfer Blocher. Die Wahlen sind vorbei. Die Migranten sind nun mal da und sind gekommen um zu bleiben. Herr Blocher vergisst, dass auch sein Ururgrossvater Johann Georg Blocher (1811–1899) als Armenlehrer aus dem grenznahen Ort Beuggen in die Schweiz einwanderte und 1861 im Kanton Bern eingebürgert wurde. Und? Hat die Migration des Armenpfarrers Georg Blocher der Schweiz geschadet?
Hat Herr Blocher schon einmal darüber nachgedacht, dass viele der grössten Schweizer Firmen wie etwa Nestlé oder Swatch, um nur zwei der Weltfirmen zu nennen, von Einwandern gegründet wurden? Weiss Herr Blocher, dass 40 Prozent aller 2023 in der Schweiz gegründeten Startups von Menschen ohne Schweizerpass ins Leben gerufen wurden? Die Schweiz ist nicht umsonst «Innovationsweltmeister», auch wenn das eine oder andere Startup in die Hosen geht.
Hört man Blocher bei seinen populistischen Tiraden über Flüchtlinge und Einwanderer zu, wird man das Gefühl nicht los, dass es sich bei den Migranten und Einwandern ausschliesslich um Parasiten handelt. Der selbsternannte Primus inter Pares in der Schweizer Parteienlandschaft sollte sich einmal die Frage stellen, wer all die Jobs in der Schweiz verrichtet, die von Schweizern längst nicht mehr ausgeübt werden.
In der von der Aussenwelt abgeschotteten Oligarchen-Villa auf dem Herrliberg sieht man halt nicht, wer draussen den Kehricht beiseite räumt, bei Aldi, Lidl, Coop und Migros die Läden zum Mindestlohntarif am Laufen hält, bei der EMS-Chemie zum Unternehmensgewinn beiträgt, im Luzerner Stadtverkehr den VBL-Bus steuert, die öffentlichen Toiletten reinigt oder als Pfleger und Pflegerin in Spitälern und Altersheimen wertvollste Arbeit verrichtet. Ganz zu schweigen von den unzähligen Arbeitern auf den Baustellen, ohne die in der Schweiz nicht ein einziger Neubau mehr fertiggestellt werden könnte. So viel Wahrheit sollte schon sein!
Dass die Migration in die Schweiz einen Punkt erreicht hat, der langfristig nicht mehr zu bewältigen ist, dürfte allen bekannt sein. Wird ja nicht einmal von den Migranten hierzulande bestritten. Doch statt populistischen Unsinn vor und nach den Wahlen zu verbreiten, sollte Herr Blocher so ehrlich sein wie er es kürzlich war. In einem seiner Artikel erwähnte er so ganz nebenbei, 'dass es eben nicht so einfach sei, aus den internationalen Verträgen der Migration auszusteigen, wie beispielsweise bindenden UNO-Verträgen'. 'Dass möglicherweise sogar Verfassungsänderungen notwendig wären'. Das muss man den Leuten auch erzählen und nicht im Kleingedruckten wie bei einer Versicherungspolice verstecken.
Es ist an der Zeit, dass Bund und Parteien endlich handeln und die illegale Massen-Einwanderung bekämpfen. Dazu gehört aber auch, dass man dem umworbenen Wahlvolk nach den Wahlen offen und ehrlich begegnet und die Wahrheit auf den Tisch legt. Und nicht wie bisher stets darüber grübelt, welcher Partei man den Schwarzen Peter für ein paar Wählerstimmen zuschieben könnte.
Wir müssen endlich lernen die Debatten um die Migration ehrlich zu führen und auch die gesetzlichen Hürden benennen, die bis in unsere Verfassung hinein reichen, und den Menschen erklären, bevor wir ihnen Lösungen vorgaukeln, die so niemals ausgeführt werden können. Denn noch ist die Schweiz ein Rechtsstaat.
Die fünf Bücher Moses (Tora), den Koran und die Bibel können wir nicht ändern. Die Schweizer Gesetze hingegen schon. Man muss es nur tun. Auch wenn dazu eine Volksabstimmung notwendig ist.
Doch Idiotenvorschläge und Lachnummern, die vor keinem Gericht dieser Welt und schon gar nicht in Brüssel standhalten würden, wie derjenige des Luzerner Wendehals-Staatsmannes und Pöstchenjäger – wie Blick ihn nennt – mit seinen binären oder non binären Problemen, DarmJan Müller, Migranten nach Burundi abzuschieben, sind der Sache nicht dienlich. Das läuft so auch gar nicht in einer Konkordanz. Es sei denn, man gäbe diese auf. Was das Migrationsproblem aber auch nicht löst.
Alain Berset schenkt Papst Franziskus ein Wetterbulletin von 1921
Bundespräsident Alain Berset ist von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen worden. Als Geschenk hat Berset ein über 100-jähriges Wetterbulletin mitgebracht. Im Zentrum des Treffens sind Gespräche über Friedensförderung gestanden. Bei der Privataudienz, die rund 20 Minuten dauerte, überreichte Berset dem Papst als Geschenk die Kopie des Wetterbulletins vom 29. Juli 1921 – einem in Genf für damalige Verhältnisse ungewöhnlich heissen Tag.
Dieser soll den Waadtländer Schriftsteller Charles-Ferdinand Ramuz zu seinem 1922 erschienenen Werk «Présence de la mort» inspiriert haben. «Was einst ungewöhnlich war, ist heute normal», stand auf der Karte zu dem Geschenk, wie die italienischen Nachrichtenagentur Ansa berichtet.
Der Papst überreichte Berset eine Bronzeskulptur mit dem Titel «Amore sociale». Die Skulptur stellt ein Kind dar, das einem anderen hilft, sich aufzurichten. Im Zentrum des Treffens standen nach Angaben des Departements des Innern Gespräche über Friedensförderung. Dabei ging es um internationale Krisen wie den Ukraine-Krieg, den Nahost-Konflikt und die Situation in einigen Ländern in Afrika. Schreibt SRF.
11.11. 2023 – Tag des grossen Geschenks eines Bonvivants aus dem Bundeshaus
Das grösste Geschenk hat der «Bonvivant»Alain Berserker, der vor allem in seinen letzten drei Amtsjahren zur unerträglichen «Skandalnudel» mutierte, nicht dem Mann auf dem «Heiligen Stuhl» gemacht, sondern einer gewaltigen Mehrheit von Schweizerinnen und Schweizern. Und da ist beileibe nicht die Rede von den zahlenmässig vernachlässigbaren Spinnern und Spinnerinnen der Trichler und Esoteriker*innen aus dem SVP-Umfeld. Und auch nicht von Göbbels-Fan Köppel.
Die Befürchtung, den lächerlichen Selbstdarsteller noch länger ertragen zu müssen und darauf zu warten, bis man ihn auf der Bahre aus dem Bundeshaus trägt, ist endlich vorbei.
Wir sollten den Tag von Bersets Rücktrittserklärung zum nationalen Feiertag erheben. Das müsste eigentlich dem non-binären DarmJan von der Luzerner FDP eine Motion wert sein. Schliesslich hat er schon weit dümmere bisher im Parlament eingebracht. Ich sage nur: Abgelehnte Migranten nach Burundi entsorgen...
Kennen Sie den Unterschied zwischen Saudiarabien und der Schweiz? Schweiz spricht 90 Millionen Franken zur Unterstützung der Region Nahost
Der Bundesrat verurteilt die Terrorakte, welche die Hamas seit dem 7. Oktober 2023 verübt, erneut auf das Schärfste und fordert die sofortige Freilassung aller Geiseln. Er anerkennt das Recht Israels auf Selbstverteidigung und Sicherheit und erinnert daran, dass sich alle Parteien an das humanitäre Völkerrecht halten müssen. Angesichts der äusserst besorgniserregenden humanitären Lage beantragt der Bundesrat dem Parlament weitere 90 Millionen Franken zur Unterstützung der Region.
Der bewaffnete Konflikt im Nahen Osten hat verheerende humanitäre Folgen für Israel, das Besetzte Palästinensische Gebiet und die betroffenen Nachbarländer. Der Bundesrat beantragt dem Parlament daher zusätzliche Mittel in der Höhe von 90 Millionen Franken für die humanitäre Nothilfe in der gesamten Region.
Die Mittel sind vor allem für die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, die UNO sowie internationale Nichtregierungsorganisationen bestimmt, die im humanitären Bereich tätig sind. Diese Organisationen bieten konfliktbetroffenen Personen Schutz und Unterkunft und versorgen sie mit Grundnahrungsmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln.
Seit dem 7. Oktober 2023 sind Tausende von Zivilpersonen ums Leben gekommen. Der Bundesrat hat die terroristischen Angriffe der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung auf das Schärfste verurteilt. Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Gemäss Schätzungen der UNO von Mitte Oktober beläuft sich die Zahl der Binnenvertriebenen im Gazastreifen auf 1,4 Millionen. Auch im Westjordanland ist die Lage sehr instabil.
Der Bundesrat anerkennt das Recht Israels auf Selbstverteidigung und Sicherheit und erinnert daran, dass beide Parteien verpflichtet sind, die Zivilbevölkerung zu schützen und das humanitäre Völkerrecht zu beachten. Es braucht humanitäre Feuerpausen oder Waffenruhen, um den Zugang von Hilfsgütern zu ermöglichen und die Bevölkerung zu versorgen.
Gefahr einer Destabilisierung der Region
Der Konflikt im Nahen Osten droht die ganze Region zu destabilisieren, vor allem bei grossen zusätzlichen Fluchtbewegungen aus dem Gazastreifen. Die Zahl der Menschen in der Region, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, wird wahrscheinlich weiter ansteigen. Schreibt das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
Tag der grossen Unterschiede zwischen der Schweiz und Saudi Arabien
Saudi-Arabien will die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen umgerechnet mit zwölf Millionen Euro unterstützen. Das kündigte das nach König Salman benannte Zentrum für humanitäre Hilfe an. König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman würden diese Summe selbst spenden. Das 2015 gegründete saudische Zentrum arbeitet mit UNO-Organisationen zusammen und hat nach eigenen Angaben Empfänger in fast 100 Ländern der Welt. Schreibt SRF im Nahost-Liveticker.
4.11.2023 - Tag der grossen Unterschiede zwischen der Schweiz und Saudi Arabien
Der Unterschied zwischen den saudischen Billionären und den Schweizer Spendenonkeln und Spendentanten in ihren üppigen Spendierhosen beträgt exakt 78 Millionen 402 Tausend und 600 Franken (Stand Euro/Schweizer Franken Kurs von heute).
Das muss man sich zuerst einmal auf der Zunge zergehen lassen: Während Saudi Arabien – eines der reichsten Länder der Welt und notabene die Erfinderin der salafistisch-sunnitischen Terrororganisation Hamas, das keine Hemmungen hat, schnell mal beinahe eine Milliarde Pfund, Dollar oder Schweizer Franken für einen englischen Fussballverein plus einen abgehalfterten Fussballspieler aus Portugal locker zu machen, spendet der hardcore-islamische Staat Saudi Arabien seinen muslimischen Brüden und Schwestern gerade mal lächerliche 12 Millionen Euro.
Die Schweiz als globale Nachfahrin von Mutter Theresa hingegen lässt es krachen: 90 Millionen Schweizer Franken. Gehen Sie mal über die Website vom EDA in deren Eingeweide. Dann werden Sie feststellen, dass diese 90 Millionen Franken für den Nahost eigentlich Peanuts sind. Da sind – nur als nachzuprüfendes Beispiel, falls Sie es nicht glauben können – fast acht Milliarden Schweizer Franken von 2024 bis 2028 für den «Globalen Süden», sprich vorwiegend Afrika, budgetiert.
Tja, die Einen führen Krieg und die Schweiz rettet nebst ihren Banken die Welt mit Milliardensummen. Als Gegenleistung erhalten wir tausende von bestens ausgebildeten Migranten und Migrantinnen, die unseren «Fachkräftemangel» beseitigen.
Fehlt aber zum Beispiel wie gehabt eine läppische Milliarde Franken in der AHV, wird schlicht und einfach die Schweizer Mehrwertsteuer angehoben. Das lassen sich unsere wandelnden Spendierhosen von und zu Bern auch noch vom Volk via Volksabstimmung (25. September 2022) bestätigen. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selbst.
Noch irgendwelche Fragen? Wie zum Beispiel «können reiche Länder wie die Schweiz verarmen»? Ja liebe Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Mit den falschen Lotsen an Bord und globalen Verwerfungen kann dies sogar relativ schnell passieren. Die Credit Suisse, fast schon sowas wie ein Staat im Staate (Deep State), wurde durch ein einziges Telefonat vom Hegemon USA (Federal Reserve System) an die unfähigste Geröllhaldentussie vom Schweizer Finanzministerium (FDP) einen Tag später erledigt. Für immer. Lesen Sie ein bisschen Geschichte. Fangen Sie mit den atemberaubenden Verwerfungen Argentiniens vor langer Zeit bis hin zum failed state an und ackern Sie sich anschliessend weiter durch die Geschichtsbücher. Sie werden staunen, was alles möglich ist.
Happy Weekend.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Ex-Assistentin will 12 Millionen Dollar von Robert de Niro wegen verbaler sexueller Belästigung
«Das ist alles Unsinn!»: Mit finsterer Miene machte Robert De Niro (80) im Zeugenstand seinem Unmut Luft. Was eine Szene aus einem Hollywood-Streifen hätte sein können, spielte sich in echt vor dem obersten Gerichtshof von Manhattan ab. Der Star wird dort von seiner ehemaligen Assistentin auf zwölf Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Graham Chase Robinson (41) bezichtigt ihn, ein höllischer Boss gewesen zu sein, der sie auch sexuell belästigt habe. Der 80-Jährige nennt die Vorwürfe einen Racheakt, weil er die 41-Jährige zuerst auf sechs Millionen Dollar verklagt hatte.
Der Hintergrund: Robinson war zwölf Jahre lang Vizepräsidentin für Produktion und Finanzierung für De Niros Produktionsgesellschaft «Canal Productions» gewesen, bis sie im April 2019 gefeuert wurde. Der Star warf ihr zudem in einer Schadensersatzklage vor, mit der American Express Firmen-Kreditkarte über Jahre nicht autorisierte Ausgaben in Millionenhöhe getätigt zu haben. Darunter für private Restaurantbesuche, Louis-Vuitton-Handtaschen, Hundesitter und auch 32'000 Dollar für Taxis. Des Weiteren soll Robinson mit Millionen von De Niros «Frequent Flyer»-Freimeilen umsonst geflogen sein und sich selbst 70'000 Dollar für «ungenutzte Urlaubstage» auszahlen lassen. Hinzu kam, dass Robinson laut der Klage dafür bekannt gewesen sein soll, während der Arbeitszeit im Büro «eine astronomische Anzahl Stunden» Netflix-Shows geschaut zu haben.
«Für dich ist es verdammt noch mal vorbei!»
Chase Robinson konterte 2021 mit ihrer Gegenklage, in der sie zwölf Millionen Dollar wegen sexueller Anzüglichkeiten am Arbeitsplatz fordert. Laut ihrer Klage soll De Niro sie nur im Pyjama oder im Bademantel empfangen und «während unserer Telefonate uriniert» haben. Und: «Er hat auch nicht eingegriffen, als ein Freund von ihm Ms Robinson auf den Hintern geschlagen hat.» Ausserdem habe De Niro vor ihr anzügliche Witze über seinen Viagra-Konsum gemacht und sie angewiesen, «mir vorzustellen, wie er auf der Toilette sitzt».
Mit einer in der Klage beigefügten Sprachnachricht will Chase Robinson auch belegen, dass De Niro sie verbal misshandelt habe. Auf den Aufnahmen schimpft der Star unter anderem: «Du ignorierst meine verdammten Anrufe? Wie kannst du es wagen? Ich werde dich feuern. Für dich ist es verdammt noch mal vorbei!» Auf einer weiteren Nachricht brüllt er sie an: «Du verwöhnte Göre. Wage es nicht, keinen verdammten Respekt vor mir zu haben!»
Seine Freundin sei eifersüchtig gewesen
Im Zeugenstand gab De Niro zu, dass seine Freundin Tiffany Chen eifersüchtig gewesen sei, weil sie glaubte, Chase Robinson sei ihn verliebt: «Anfangs habe ich das nicht geglaubt. Doch wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, dass sie vielleicht recht hatte.» Chase Robinsons Anwalt Brent Hannafan konterte: «Und Sie haben alles getan, um ihre Freundin Chen glücklich zu machen, richtig.» Zum ersten Mal kam De Niros schiefes Grinsen zum Vorschein: «Würden Sie das nicht auch tun?» – was selbst die Geschworenen zum Lachen brachte. Der Prozess soll noch zwei Wochen dauern. Schreibt Blick.
31.10.2023 - Tag der trivialen Prozesse
Dass sich selbst die Geschworenen während diesem trivialen Prozess ihr Lachen nicht verkneifen können, dürfte eigentlich niemanden verwundern. Auch nicht die US-amerikanische Tatsache, dass ein beiderseitig derart hanebüchener Schwachsinn überhaupt vor einem Richter landet.
Ist halt nun mal so in Amerika. Leider schwappt der US-amerikanische Blödsinn in Sachen Justiz je länger je mehr auch auf Europa über. Wie so vieles andere mehr aus dem Land von «God's Own Children And The Home Of The Brave».
Wäre Zofingen ein Bestandteil der Grossmacht USA, hätte jetzt ein Mitglied vom Artillerie-Verein Zofingen eine gesalzene Klage von mir am Hals. Eröffnete mir doch der ehrenwerte Herr anlässlich eines Telefonats zwischen ihm und mir vor geraumer Zeit, dass er gerade auf dem Klo sitze.
Dass mir da die Kaffeetasse aus der Hand fiel und das künstliche Gebiss zu wackeln begann, dürfte wohl klar sein. In den USA könnte ihn eine solch unappetitliche Äusserung bis zu 12 Millionen Dollar kosten. Auch wenn da keine sexuelle Belästigung im Raum stand: So viel müssten meine Meissener Porzellan-Kaffeetasse und die Zahnprothese schon wert sein.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Chinas ehemaliger Ministerpräsident Li Keqiang gestorben
Der frühere chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist tot. Er habe am Donnerstag einen plötzlichen Herzinfarkt erlitten und sei nach vergeblichen Rettungsversuchen am Freitag um 0:10 Uhr (Ortszeit) in Shanghai gestorben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Li Keqiang war im März nach zehn Jahren im Amt als Ministerpräsident abgetreten. Er wurde 68 Jahre alt.
Als Funktionärssohn wurde Li Keqiang am 1. Juli 1955 in Dingyuan in der Provinz Anhui geboren. Wie andere Intellektuelle musste er 1974 am Ende der Kulturrevolution noch aufs Land. Als einer von nur drei Prozent aller Bewerber, die die Aufnahme schafften, studierte er Jura an der Peking-Universität, promovierte in Wirtschaftswissenschaften. In der kommunistischen Jugendliga arbeitete Li Keqiang 1983 unter seinem späteren Förderer, Staats- und Parteichef Hu Jintao.
Konkurrenz mit Xi Jinping
Sein Aufstieg an die Spitze in Peking begann aber mit einem Fehlstart. Der scheidende Präsident Hu Jintao hatte seinen Schützling eigentlich zum "starken Mann" machen wollen. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der "Shanghai-Fraktion" um seinen mächtigen Vorgänger Jiang Zemin, der vielmehr Xi Jinping zum neuen Führer aufbaute. Li Keqiang hatte das Nachsehen, wurde aber zumindest Premier.
Sein Glück verließ ihn weiter, als die Protektion durch seinen Förderer Hu Jintao nachließ. Xi Jinping entmachtete praktisch die Regierung, indem Arbeitsgruppen und Kommissionen der Partei unter seiner Führung die Regierungsarbeit übernahmen. So wurde Li Keqiang zur "lahmen Ente". Über seinen Gesundheitszustand gab es zudem bereits seit Jahren Gerüchte. Bei seinen Auslandsbesuchen hätten immer lange Ruhepausen ins Programm eingebaut werden müssen, berichteten Diplomaten im vertraulichen Gespräch.
Mit Mühe stemmte sich Li Keqiang 2020 gegen den Abschwung infolge der Corona-Krise, indem er die Staatsausgaben erhöhte. "Außergewöhnliche Maßnahmen für ungewöhnliche Zeiten", nannte er das. Zusätzlich machte der Handelskrieg mit den USA der zweitgrößten Volkswirtschaft zu schaffen. Damals warnte Li Keqiang den Volkskongress mit den Worten: "Gegenwärtig und in der näheren Zukunft wird China vor Herausforderungen stehen wie nie zuvor." Schreibt DER STANDARD.
27.10.2023 - Tag der dubiosen Todesfälle
In Russland sterben missliebige Personen, egal ob Oligarchen, Politiker oder Journalisten*innen durch einen Sturz aus dem Fenster, Nowitschok, Polonium-210 oder ihr Privatjet fällt aus unerklärlichen Gründen vom russischen Himmel.
Wer in China die Gunst von Präsident Xi Jinping verliert, wird zuerst gedemütigt und verschwindet dann von einer Minute auf die andere aus Öffentlichkeit und Medien, um nach einer gewissen Zeit an einem Herzschlag zu sterben. Frei nach Hollywood, leicht abgewandelt: «You Don't Mess with the Vladimir or the Xi». (Deutsch: «Leg dich nicht mit Vladimir oder Zi an»).
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Die internationale Kommunikation des Bundesrats wird mit einem neuen englischen Account auf X (Twitter) gestärkt
Geschäfte und Entscheide des Bundesrats mit einer internationalen Dimension sollen auch im Ausland besser vertreten werden. Darum wird die internationale Kommunikation der Regierung gestärkt, unter anderem mit einem neuen englischen Account auf X (Twitter).
Der Bundesratssprecher betreibt seit 2011 auf Twitter (heute X) den Account @BR_Sprecher, der sich vorwiegend in den Landessprachen an ein inländisches Publikum richtet. Im Rahmen seiner «Strategie soziale Medien» hat der Bundesrat 2021 entschieden, diesen Account durch einen zweiten zu ergänzen, der vorwiegend in englischer Sprache informieren soll. Der Account heisst @SwissGov und nimmt den Betrieb heute auf.
Der Bundesrat will, dass die Interessen der Schweiz bei Geschäften und Entscheiden mit einer internationalen Dimension auch im Ausland besser vertreten werden. Der neue Account trägt diesem Bedürfnis Rechnung. Er greift Regierungsthemen von internationaler Bedeutung auf und bereitet sie den Bedürfnissen eines ausländischen Publikums entsprechend auf. Er richtet sich insbesondere an Medienschaffende im Ausland und an Mitarbeitende von Regierungen, internationalen und supranationalen Organisationen.
Der neue Social-Media-Account dient dabei hauptsächlich als Kanal, um das Zielpublikum zu erreichen. Überdies werden die Webseiten des Bundesrates vermehrt mit Inhalten für Englischsprachige aufbereitet; im Fokus stehen dabei wichtige aktuelle Themen und Ereignisse. Schreibt die Bundeskanzlei
23.10.2023 - Tag des Fegefeuers der Eitelkeiten
Besoffen von ihrer eigenen Wichtigkeit lancierten die höchsten Vertreter*innen der Schweizer Regierung einen Chanel (Kanal) in Englisch auf X (ehemals Twitter). Darauf haben die Weltenlenker in Washington, Peking, Moskau, Belarus, Nordkorea, Aserbeidschan, Abu Dhabi, Katar und Saudi Arabien sehnlichst gewartet.
Der nächste Schritt des Bundesrates wird eine direkte Verbindung mit einem exterritorialen Satellit in der Nähe der Andromeda-Galaxie sein. Frei nach James Bond: «The world is not enough». Denn auch die Ausserirdischen müssen unbedingt von der einmaligen Herrlichkeit der Schweizer Regierungselite und ihrem eloquenten Denglisch überzeugt werden. Dass sie letztendlich nur Befehlsempfänger einer noch herr/licheren Oligarchen-Elite sind, wird logischerweise nicht erwähnt. Ist wohl auch besser so.
Denn trotz aller Eitelkeiten im Hohen Haus von und zu Bern sind sich unsere höchsten Magistraten*innen sehr wohl bewusst, wer in unserem Neun-Millionen-Ländchen Koch und wer Kellner ist. Die NZZ schrieb vor vielen Jahren, die Schweiz werde von zehn Familien regiert. Und dies seit ihrer Gründung. Wenn die NZZ sowas schreibt, muss es ja stimmen.
Inzwischen sind es allerdings mindestens elf Familien. Denn hinzugekommen ist die Oligarchen-Familie Blocher mit eigener Partei, eigenen Zeitungen, eigenem Sprachrohr in der Person von Roger Köppel, Fabriken in Russland und einem Läckerli-Huus an der Hertensteinstrasse in Luzern.
Letzteres verdient grosses Lob und Anerkennung.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Die grosse Weltunordnung
Wer dieser Tage auf sein Handy blickt, muss jeden Augenblick damit rechnen, mit dem nächsten Ausbruch brutaler Gewalt in irgendeiner Ecke der Welt konfrontiert zu werden. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine begann eine Welle von Aggressionen, Umstürzen und Konflikten. Allein in den letzten Monaten brach ein blutiger Bürgerkrieg im Sudan aus, eroberte Aserbaidschan das armenisch besiedelte Bergkarabach, versuchten serbische Milizen den Norden des Kosovo zu destabilisieren, häuften sich die militärischen Coups in Afrika, während die Sahelzone von Woche zu Woche mehr in Anarchie versinkt. Der letzte Höhepunkt dieser Kaskade von Gewalt, der terroristische Überfall der Hamas auf den Süden Israels, könnte sich zu einem verheerenden Flächenbrand im Nahen Osten ausweiten.
Jedes einzelne dieser Ereignisse hat seine eigenen Ursachen und historischen Hintergründe. Dennoch gibt es eine Reihe von Faktoren, die die Häufung der Gewalt in letzter Zeit erklären.
An erster Stelle steht die Rückkehr der Geopolitik. Die Anfang des Jahrhunderts noch verbreitete Hoffnung auf eine auf Demokratie und Recht basierende Weltordnung erwies sich als Illusion. Innen gespalten und außen überfordert verringerten die USA ihre weltpolitische Führungsrolle. Russland schwenkte auf einen auf territoriale Expansion abzielenden Kurs. In China brachte der wirtschaftliche Aufstieg keine ideologische Konvergenz mit dem Westen, sondern im Gegenteil den Anspruch, die Vormacht des Westens zu brechen und zur stärksten Macht Asiens aufzusteigen. Der machtpolitische Virus erfasste auch mittlere Mächte wie Türkei, Iran oder Saudi-Arabien und resultierte in einer Reihe regionaler Hegemonialkämpfe.
Die über Jahrzehnte von der internationalen Gemeinschaft entwickelten Gegenmittel gegen den Einsatz von Gewalt verloren an Wirkung. UN-Sicherheitsrat, Internationaler Strafgerichtshof und das gesamte Regelwerk der friedlichen Streitbeilegung haben der unerbittlichen Dynamik geopolitischer Machtentfaltung wenig entgegenzusetzen. Wirtschaftssanktionen – lange das Lieblingsinstrument des Westens – verlieren an Durchschlagskraft, wenn viele Länder bereit sind, sie zu umgehen.
Abstieg des Westens
Dazu kommt der relative Abstieg des Westens. Die G7 – seine wichtigste Koordinationsplattform – hatte 1989 etwa 70 Prozent des Weltbruttonationaleinkommens (BNP), aber 2023 nur mehr 40 Prozent. Während in den 2000er-Jahren oft ein Anruf des US-Außenministers ausreichte, um eine Krise zu entschärfen, bleiben solche Anrufe heute oft folgenlos. Die Weigerung des Globalen Südens, die Sanktionen gegen Russland mitzutragen, zeigte die massiven Ressentiments, die die frühere Dominanz Europas und der USA hinterlassen hat. Diese Kluft droht sich durch den heutigen Konflikt im Nahen Osten noch zu vertiefen, da der westlichen Solidarität mit Israel verbreitete Unterstützung für die Palästinenser im globalen Süden entgegensteht.Abstieg des Westens
Dazu kommt der relative Abstieg des Westens. Die G7 – seine wichtigste Koordinationsplattform – hatte 1989 etwa 70 Prozent des Weltbruttonationaleinkommens (BNP), aber 2023 nur mehr 40 Prozent. Während in den 2000er-Jahren oft ein Anruf des US-Außenministers ausreichte, um eine Krise zu entschärfen, bleiben solche Anrufe heute oft folgenlos. Die Weigerung des Globalen Südens, die Sanktionen gegen Russland mitzutragen, zeigte die massiven Ressentiments, die die frühere Dominanz Europas und der USA hinterlassen hat. Diese Kluft droht sich durch den heutigen Konflikt im Nahen Osten noch zu vertiefen, da der westlichen Solidarität mit Israel verbreitete Unterstützung für die Palästinenser im globalen Süden entgegensteht.
Ein weiterer Faktor liegt auch in der Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Krisen. Unsere individuelle, aber auch kollektive Fähigkeit, mit mehreren parallelen Herausforderungen gleichzeitig zurande zu kommen, ist begrenzt. Immer neue Konflikte verdrängen die bestehenden aus dem Bewusstsein und überfordern die Kapazitäten für brauchbare Antworten. Aufmerksamkeit und Ressourcen werden jeweils von der jüngsten Krise absorbiert und von anderen abgezogen. Dies kommt den Aggressoren zugute und geht zulasten der Opfer.
Gewalt lohnt sich nicht
Die gegenwärtige Entwicklung ist umso tragischer, als eine Anzahl von Studien gezeigt hat, dass es sich bei den letzten 50 Jahren um die friedlichste Periode in der Menschheitsgeschichte handelte. Und in der Tat, die meisten Regierungen in allen Weltregionen wünschen auch heute noch eine Welt, in der Interessengegensätze mit friedlichen Mitteln gelöst werden. Denn nur so sind dauerhafter wirtschaftlicher Fortschritt und die Lösung der großen transnationalen Herausforderungen möglich. Sofern diese Länder konsequent zusammenarbeiten, müssten sie in der Lage sein, die destruktive Dynamik der letzten Monate zu brechen.
Die dringendste Priorität wäre dabei, die Ausweitung des Konflikts im Mittleren Osten zu verhindern und die Unterstützung der Ukraine zu stärken. Der Nachweis, dass sich Gewalt nicht lohnt, ist wohl das wirksamste Mittel, um die Gefahr neuer Übergriffe zu verringern. Längerfristig wird man auch die Instrumente des internationalen Krisenmanagements nachschärfen und ausbauen müssen, um auf weitere Aggressionen besser antworten zu können. Dies wiederum kann nur gelingen, wenn westliche Staaten zu einer neuen Form der gleichberechtigten Partnerschaft mit den Ländern des Globalen Südens finden. Letztlich wird es vom konsequenten Zusammenwirken aller konstruktiven Kräfte abhängen, ob die gegenwärtige Spirale der Gewalt nur einen temporären Rückschlag darstellt oder ob sie ein dauerhaftes Abgleiten in die schon überwunden geglaubte Logik von Aggression und Eroberung bedeutet. Schreibt Stefan Lehne in DER STANDARD.
22.10.2023 - Tag der FED-Telefonate
Ein Telefonanruf eines hochrangigen Mitglieds des westlichen Hegemons USA genügt auch heute noch, um amerikanische Interessen in Europa durchzusetzen. Es muss ja nicht immer der/die/das US-Aussenminister sein.
In der Schweiz reichte vor noch gar nicht so langer Zeit ein einziger Anruf der amerikanischen FED-Chefin Janet Yellen, um die Schweizer Bank «CS» innerhalb kürzester Zeit abzuwickeln. Was vor zehn Jahren schon beim Bankgeheimnis mit einem Call an die damalige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf innert kürzester Zeit funktionierte, erreichte Amerika nun auch bei der Credit Suisse.
So ist das nun mal. Schon König Artus war sich bewusst, «dass der Stärkere immer den Schwachen besiegen wird.» Dagegen schützen nicht mal Schimären wie beispielsweise die Neutralität. Von der Armbrust Wilhelm Tells ganz zu schweigen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Chinas Neue Seidenstrasse wird grüner und digitaler, aber auch kleiner
Zumindest der PR-Erfolg dürfte Xi Jinping gewiss sein: Bei einem Gala-Bankett am Dienstagabend hielt der chinesische Präsident eine Rede vor zahlreichen Regierungschefs, darunter der russische Präsident Wladimir Putin und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Anlass des Treffens ist das dritte Forum zur Neuen Seidenstraße, auch bekannt als Belt and Road Initiative (BRI). Dieses erste geopolitische Großprojekt Chinas feierte vor kurzem seinen zehnjährigen Geburtstag.
Auch die Anzahl der Teilnehmer spricht für sich: Beim ersten Treffen dieser Art im Jahr 2017 waren nur Repräsentanten von 29 Staaten nach Peking gekommen, 2019 waren schon 37 Staaten vertreten. Dieses Jahr sind 130 Vertreterinnen und Vertreter gekommen, darunter 23 Staatschefs. Peking ist es in den vergangenen Jahren gelungen, sich als Führer des Globalen Südens zu präsentieren. Die Neue Seidenstraße ist ein wichtiges Werkzeug dieser Strategie. Umgerechnet über eine Billion US-Dollar dürfte China in den vergangenen zehn Jahren in zahlreiche Staaten Asiens, Afrikas und auch Europas investiert haben. Die Kredite für Infrastrukturprojekte wurden gerne als Win-win-Situationen für alle Beteiligten präsentiert. Tatsächlich aber kam das Geld aus Peking meist mit geheimen Klauseln – wie zum Beispiel bei UN-Resolutionen im Sinne Chinas zu stimmen.
Eine Zeitlang funktionierte die Strategie selbst innerhalb der EU. Gerade osteuropäische Staaten nahmen das Geld aus China gerne an. Erst mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sich die Lager deutlich aufgespalten. Und auch darauf zielt das dritte Treffen zur BRI ab: dem Westen zu verdeutlichen, dass Peking sich zwar nicht an Russlands Krieg beteiligt, sich die Weltsicht der beiden autoritär regierten Staaten aber weitgehend deckt: "Neokolonialismus und Hegemoniestreben des Westens" würden in eine Sackgasse führen, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.
Geschäfte mit korrupten Eliten
Tatsächlich lässt sich genau das dem chinesischen Großprojekt vorwerfen: Zahlreiche Empfängerstaaten der Neuen Seidenstraße gelten mittlerweile als überschuldet. Chinesische Staatsunternehmen machten immer wieder Geschäfte mit korrupten Eliten, um einerseits Märkte für chinesische Waren zu öffnen und andererseits Rohstoffe nach China zu importieren.
Auch was die Zukunft betrifft, bleibt das Forum bisher vage und blumig. Von mehr Investitionen in Hightech, künstliche Intelligenz, Gesundheit und Biotechnologie ist die Rede, von konkreten Projekten aber bisher nicht. Seit 2020 gehen die Investitionen zurück: Vor der Pandemie flossen mehr als 100 Milliarden US-Dollar jährlich von Peking ins Ausland, im vergangenen Jahr waren es nur noch 40 Milliarden. Ein Grund dürfte sein, dass man in Peking vorsichtiger geworden ist, das Geld zu verteilen: Viele der Häfen, Straßen, Autobahnen und Zugstrecken haben sich als schlecht geplant erwiesen und blieben hinter den Renditeerwartungen zurück. Einen Teil der Kredite muss Peking sogar abschreiben oder mit Rettungskrediten den chinesischen Unternehmen helfen. Schreibt DER STANDARD.
19.10.2023 - Tag des Clickbaitings vs. Qualitätsjournalismus
Wenn zwei Polit-Ganoven wie der russische Präsident Wladimir Putin und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán von Philipp Mattheis (DER STANDRAD) als «hochkarätiges Publikum» bezeichnet werden, weist schon der Lead des Artikels darauf hin, dass damit alles gesagt ist. Der Rest ist Zeilenhonorar-Müll.
Sätze wie «Neokolonialismus und Hegemoniestreben des Westens würden in eine Sackgasse führen» von einer chinesischen Nachrichtenagentur zu rezitieren, erinnern lediglich an das alte Sprichwort «Ein Esel nennt den anderen Langohr». Tieferen Informationsgehalt haben sie keinen.
Fazit: Ein reiner Clickbaiting-Artikel; zusammengeschustert aus diversen Agentur-Nachrichten. Einer Zeitung, die sich selber mit dem Prädikat «Qualitätsjournalismus» rühmt, nicht unbedingt würdig.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Putin schlägt Russland als Friedensvermittler in Nahost vor
Der russische Kriegspräsident Putin hat Vermittlungshilfe im eskalierenden Nahost-Konflikt offeriert. Moskau pflege «sehr gute Beziehungen» sowohl mit Israel als auch den Palästinensern. Niemand könne Russland dabei «irgendwelche Spielchen» vorwerfen.
Auf Besuch in Kirgistan hat der russische Präsident Wladimir Putin (71) Vermittlungsdienste in Nahost offeriert. Im Rahmen seiner ersten Auslandsreise, auf die sich Putin in diesem Jahr gewagt hat, stellte sich der Kreml-Führer weder hinter Israel noch Palästina. Israel sei von einem noch nie dagewesenen Angriff konfrontiert, wird Putin von russischen Medien zitiert. Aber Israels Reaktion sei auch «ziemlich brutal».
Dabei bot Putin russische Vermittlung an, um den Konflikt zu schlichten. Moskau habe «sehr gute Beziehungen» zu Israel sowie traditionelle Beziehungen zu den Palästinensern. «Niemand kann vermuten, dass wir irgendwelche Spielchen spielen wollen», so Putin.
Will Zweistaatenlösung
Russland versteht sich seit langem als Anwalt der arabischen Welt. Berichten zufolge kann sich Moskau auch eine Wiederbelebung des Nahost-Quartetts vorstellen, zu dem neben Russland die USA, die EU und die Vereinten Nationen gehören.
Putin selbst pocht bei öffentlichen Auftritten und Telefonaten mit ausländischen Kollegen darauf, dass eine Zweistaatenlösung im Nahen Osten umgesetzt werden müsse – für eine Wahrung der Rechte der Palästinenser.
Russland legt Uno-Sicherheitsrat Resolutionsentwurf zu Nahost vor
Ebenfalls am Freitag hat Russland bei einer Sitzung des Uno-Sicherheitsrats zur jüngsten Gewalteskalation im Nahen Osten einen Resolutionsentwurf vorgelegt. Darin werden unter anderem eine «humanitäre Feuerpause» sowie die Freilassung der von der Islamistenorganisation Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln gefordert, wie die Deutsche-Presse Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr. Die Hamas wird in dem am Freitag hinter verschlossenen Türen präsentierten Papier allerdings nicht direkt genannt.
Ob und wann Russland die Resolution im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen zur Abstimmung stellen wollte, war zunächst nicht klar. Eine Verabschiedung gilt als äusserst unwahrscheinlich. Eine Resolution im Sicherheitsrat braucht mindestens neun Ja-Stimmen, zudem darf es kein Veto der neben Russland vier anderen ständigen Mitglieder Frankreich, Grossbritannien, China und USA geben, die Berichten zufolge vorab nicht wegen der Resolution konsultiert worden waren. Am vergangenen Wochenende war bereits eine Dringlichkeitssitzung des Rates ohne eine einmütige Verurteilung der Hamas zu Ende gegangen. Schreibt Blick.
14.10.2023 - Tag des Bocks, der zum Gärtner gemacht wird
Russland als Friedensvermittler im Nahost zu akzeptieren, hiesse nichts anderes als den Bock zum Gärtner zu machen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Armee hat «keine Bestätigung»: Blutbad in Kibbuz – wurden Babys enthauptet?
Zehn Prozent der Einwohner des Kibbuz Be’eri nahe der Grenze zum Gazastreifen sind gestorben. Getötet von Hamas-Terroristen, die mordend durchs Dorf zogen. In einem anderen Kibbuz sollen Babys getötet worden sein, berichtet eine Journalistin.
Im Kibbuz Be’eri lebten etwas mehr als 1000 Menschen. Er liegt nur etwa fünf Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt, ist für seine gepflegten Grünanlagen bekannt. Eine Druckerei gibt es hier und eine laut der «Süddeutschen Zeitung» aufstrebende Kulturszene.
Doch seit diesem Samstag ist alles anders: Videoaufnahmen zeigen, wie schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer brandschatzend durch den Kibbuz ziehen, sie durchsuchen Häuser, wer Israeli ist, wird erschossen oder entführt.
«Sie schossen wahllos um sich»
Aufnahmen zeigen, wie die Terroristen Menschen in ihren Autos erschiessen, danach ihre Habseligkeiten nach Wertsachen durchsuchen. «Sie liefen in Be'eri herum, als ob der Ort ihnen gehörte», sagt Haim Jelin, ein Überlebender des Kibbuz einem Radiosender.
«Sie schossen wahllos um sich, entführten, wen immer sie konnten, brannten die Häuser der Menschen nieder, sodass sie durch das Fenster fliehen mussten, wo die Terroristen warteten», sagt Jelin.
Wie viele Opfer das Massaker forderte, wisse er nicht. Jetzt haben Rettungskräfte eine erste Zahl bekannt gegeben. 108 Leichen seien bereits geborgen worden, zehn Prozent der Einwohner sind tot. Noch ist die Suche aber nicht beendet, noch mehr Todesopfer sind zu befürchten.
Bis zu 40 Kinder getötet
Auch im nahegelegenen Kibbuz Kfar Aza richteten die Terroristen ein Blutbad an: Die Hamas-Kämpfer hätten dort auch vor Babys und Kindern keinen Halt gemacht. So berichtet eine Journalistin des israelischen Fernsehsenders i24news von Gräueltaten, die kaum zu fassen sind: «Soldaten des israelischen Militärs haben mir berichtet, dass zahlreiche Babys geköpft wurden», so die Journalistin. Bis zu 40 Kinder sollen in Kfar Aza umgebracht worden sein. Viele hätten ihr gesagt, dass sie noch nie so etwas wie hier erlebt hätten.
Gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu sagt nun ein Sprecher der israelischen Armee, man habe die Berichte über enthauptete Babys gelesen und gehört. «Wir haben die Nachrichten gesehen, aber wir haben keine Details oder Bestätigung dazu.» Allerdings sagt der israelische Armee-Kommandant David Ben Zion selbst im Interview mit der Reporterin: «Sie haben Kindern die Köpfe abgeschnitten, sie haben Frauen die Köpfe abgeschnitten.»
Eine andere Journalistin schliesst sich den Berichten an. So seien zahlreiche Kinder gefunden worden, denen man die Hände hinter dem Rücken zugebunden und sie dann mit einem Schuss in den Kopf getötet hat.
«Sie haben ihnen in den Kopf geschossen»
Adi Efrat ist eine der Überlebenden des Horrors von Be’eri. Sie erzählt «Ynet», wie zwei Männer sie gefangen genommen hätten, sie sei nur mit einem Bademantel bekleidet gewesen, als diese in ihr Haus eindrangen. Sie hätten sie mitgenommen und in ein anderes Haus gebracht, wo ihr Handschellen angelegt wurden.
Efrat erzählt: «Sie haben eine Mutter mit ihrem Sohn gebracht, sie war voller Blut und zitterte am ganzen Körper.» Und: Neben ihrem Mann sei auch ihr Baby getötet worden. Efrat habe sie daraufhin beruhigen wollen und gesagt, dass sie vielleicht nicht tot seien. Worauf die Mutter antwortete: «Sie haben ihnen in den Kopf geschossen.»
Die Israelin erzählt, dass sie die trauernde Mutter nicht habe umarmen können wegen der Handschellen. Also habe sie ihren Kopf auf ihre Schulter gelegt und zusammen hätten sie geweint.
Schliesslich wird Efrat von den Hamas-Kämpfern weggebracht. Kurz danach treffen die israelischen Streitkräfte ein, und sie wird befreit. Sie wisse nicht, was aus der Mutter geworden sei, mit der sie geweint habe. Sie sagt: «Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe.» Schreibt Blick.
11.10.2023 - Tag der hässlichen Fratze des Boulevardjournalismus
Nicht genug der unsäglichen Tragödie tatsächlich ermordeter Kinder, nein, Blick suhlt sich in seiner Berichterstattung über den Krieg in Israel geradezu im Blut mit entsprechenden Titel-Schlagzeilen, die zwar dem Clickbaiting geschuldet sind, aber jeglichem Wahrheitsgehalt, dem Respekt und der tiefen Trauer gegenüber den ermordeten Kindern widersprechen. Von seriösem Journalismus ganz zu schweigen.
Da wird dem Blick-Publikum eine nur schwer zu verdauende Schlagzeile serviert, obschon diese von der israelischen Armee nicht bestätigt wird.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Kündigung wegen Eigenbedarfs: «Es war ein riesiger Schock»
Künftig wird die Kündigung einfacher bei Eigenbedarf. Betroffene Mieterinnen und Mieter erzählen von ihren Erlebnissen unter dem bisherigen Mietrecht.
«Ich erinnere mich, wie mich mein Sohn angerufen hat und erzählt hat, dass ihn die Hausbesitzerin gerade angerufen und ihm gekündet hat», erzählt Barbara Feuz. «Es war ein riesiger Schock.» Wir treffen sie und ihren Sohn Sebastian Nötzli in Basel vor dem Mehrfamilienhaus, in dem sie 20 Jahre lang wohnten. Zuletzt lebten die beiden in zwei verschiedenen Wohnungen, Barbara Feuz hatte zudem ein Büro im Parterre gemietet.
Vor zwei Wochen sind sie ausgezogen. Die beiden verbinden viele Erinnerungen mit dem Haus. «Wenn man so will, habe ich alle ersten Male hier erlebt; den ersten Job, die erste Freundin, das erste grosse Fest», erzählt Sebastian Nötzli. Und das alles sei jetzt weg, von heute auf morgen.
Einfachere Kündigung wegen Eigenbedarfs
Die Kündigung erfolgte, weil der Sohn der Vermieterin, der selbst Miteigentümer der Liegenschaft ist, mehr Platz im Haus braucht. Er möchte eine Familie gründen. Die Eigentümerin sagt gegenüber SRF, sie bedaure, dass das langjährige Mietverhältnis beendet werden musste. Sie sei aber froh, dass die ehemaligen Mieter jeweils eine neue Wohnung gefunden hätten.
Die Kündigung wegen Eigenbedarfs soll nun für Eigentümer einfacher werden. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat beschlossen, dass Eigentümer rascher zu ihrer Wohnung oder ihrem Haus kommen sollen, wenn sie dringenden Eigenbedarf anmelden. Der Mieterverband will sich gegen die Änderung des Mietrechts wehren und hat das Referendum angekündigt.
Andreas Zappalà vom Hauseigentümerverband Basel nimmt Stellung zum konkreten Fall und erklärt, eine Kündigung sei immer bedauerlich für die Mieter. «Aber wir haben einen Mietvertrag, den beide Seiten kündigen können und in diesem Fall hat der Eigentümer ein berechtigtes Interesse geltend gemacht.»
Er begründet die Änderung des Mietrechts damit, dass es heute oft zu lange dauere, bis Eigentümer von ihrer Wohnung oder ihrem Haus Gebrauch machen könnten. Zappalà erzählt von einem Fall, den er in der Vergangenheit betreut hatte: «Da haben die Eigentümer als Zwischenlösung bereits auf dem Campingplatz gewohnt und wussten, dass dieser in einem Monat schliessen würde.»
Für solche Fälle sei es schwierig, wenn man die Dringlichkeit auf langem Weg nachweisen müsse. In dem konkreten Fall hätten sich Eigentümer und Mieter schliesslich einigen können, bevor die Eigentümer auf der Strasse standen.
Gegenläufige Interessen
Eine Einigung gab es auch im Fall von Barbara Feuz. Seit zwei Wochen wohnt sie in einer neuen Wohnung, ihr Sohn ebenso. Feuz hatte sich gegen ihre Kündigung gewehrt, die Einsprache schliesslich aber nicht weiterverfolgt, da sie in der Zwischenzeit neue Räumlichkeiten gefunden hatte. Sie habe sich zwar gut eingelebt, erzählt sie in ihrem neuen Wohnzimmer. Die neue Wohnung sei aber nicht gleichwertig wie die alte. «Sie ist kleiner, sie ist dunkler und sie ist teurer», so Feuz. Sie bezahle jetzt 400 Franken mehr Miete pro Monat.
Das Beispiel zeigt deutlich die unterschiedlichen Interessen von Mietern und Eigentümern. Die Mieter wollen sich nun mit einem Referendum gegen die Änderung wehren, die Eigentümer dagegen sind der Meinung, dass ein rascherer Prozess bei den Kündigungen wegen Eigenbedarfs nötig sei. Schreibt SRF.
19.9.2023 - Tag der Phantomdiskussionen
Das ist für mich jetzt aber wirklich eine hochgejazzte Phantomdiskussion. Dass Vermieter jederzeit bei Eigenbedarf bestehende Mietverhältnisse kündigen können, war schon immer so und ist letztendlich nichts anderes als eine Selbstverständlichkeit.
Dass da bei Kündigungen von Mietverhältnissen immer wieder mit dem Begriff «Eigenbedarf» geschummelt wurde und auch in Zukunft gemogelt wird, gehört zur DNA einiger Vermieter*innen. Noch aber funktionieren unsere Schlichtungsämter bei Auseinandersetzungen zwischen Mietern und Vermietern. Das gilt auch bei Kündigungen wegen Eigenbedarf.
Es darf vermutet werden, dass dieser Parlamentsentscheid nichts anderes ist als eine zu vernachlässigende Gefälligkeit der Parlamentarier*innen, von denen unglaublich viele als willige Diener*innen der lukrativen Immobilienbranche ihren Herren und Meistern gegen Bares den Rücken stärken. Prüfen Sie einmal nach, wie viele dieser Damen und Herren aus National- und Ständerat mit Immobilienfirmen verbandelt sind. Sie werden staunen!
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
EZB erhöht Leitzins im Euroraum auf 4.5 Prozent
Der Leitzins im Euroraum steigt auf 4.5 Prozent. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss eine Anhebung um 0.25 Prozentpunkte, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Es ist die zehnte Zinserhöhung in Folge.
Mit den höheren Zinsen versucht die Notenbank, die hartnäckig hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Weil teurere Kredite zugleich eine Last für die Wirtschaft sind, waren zuletzt Forderungen nach einer Zinspause lauter geworden.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte nach der Sitzung des EZB-Rates Ende Juli für die September-Sitzung sowohl eine weitere Zinserhöhung als auch eine Unterbrechung der beispiellosen Serie von Anhebungen nicht ausgeschlossen. Lediglich einer Zinssenkung erteilte die Französin bereits damals eine Absage.
Mittelfristig strebt die EZB für den Euroraum eine Inflationsrate von 2.0 Prozent an. Bei diesem Niveau sehen die Währungshüter Preisstabilität gewahrt. Doch von dieser Zielmarke ist die Teuerung nach wie vor weit entfernt. Im August schwächte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Währungsraum der 20 Länder nicht weiter ab.
Inflationsrate bleibt hoch
Die jährliche Inflationsrate verharrte einer ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat zufolge bei 5.3 Prozent. Im vergangenen Jahr war die Inflation wegen des Ukraine-Kriegs, in dessen Folge die Preise für Energie und Nahrungsmittel in die Höhe schnellten, zeitweise zweistellig gewesen.
Höhere Inflationsraten zehren an der Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Menschen können sich für ihr Geld weniger leisten. Das bremst den privaten Konsum, der eine wichtige Stütze der Konjunktur ist.
Immerhin gab es in den jüngsten Inflationsdaten einen Hoffnungsschimmer: Die Kernteuerung im Euroraum – das ist die Rate ohne schwankungsanfällige Preise für Güter wie Energie und Lebensmittel – ging von 5.5 Prozent im Juli auf 5.3 Prozent im August zurück. Schreibt SRF.
14.9.2023 - Tag der Chicago Boys
Die Zinserhöhungen der EZB stammen aus dem längst veralteten VWL-Hamsterrad des «perversen angelsächsisch geprägten» Neoliberalismus der «Chicago Boys». Auch die zehnte Zinserhöhung wird die Inflation kurzfristig nicht beseitigen.
Dafür werden die Bankster einmal mehr ihre Hände reiben und einige Staaten in eine Rezession fallen. In Deutschland sind die Bewilligungen für Neubauten im Baugewerbe um über 35 Prozent in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 zurückgegangen. Das bedeutet über kurz oder lang in einer äusserst personalintensiven und wichtigen Jobmaschine ein Heer von neuen Arbeitslosen. Ob die Umschulung eines Dachdeckers zum Pfleger dem arbeitslosen Bauarbeiter tatsächlich hilft, wie ein paar vertrottelte Politiker*innen tatsächlich glauben, darf trotz dem täglich beschworenen Fachkräftemangel bezweifelt werden.
Da hilft eigentlich nur noch eine Empfehlung: Zähne zusammenbeissen, denn für neue wird das Arbeitslosengeld kaum mehr reichen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
«Porno-Modus» und zehn weitere neue Funktionen fürs iPhone
Das mobile Betriebssystem iOS 17 kommt in den nächsten Tagen. Das Update bringt etliche neue Funktionen auf das iPhone. Diese elf neuen solltest du kennen.
Alles neu macht der September. Dann veröffentlicht Apple jeweils das neue Betriebssystem für iPhones. Auch wer sich dieses Jahr kein neues Apple-Gadget kauft, erhält für sein Telefon also viele neuen Funktionen. Bereits seit Sommer kann das System getestet werden. Blick hat iOS 17 ausprobiert. Das sind die Highlights.
Hübsch, hübscher, Kontaktposter
Wenn du jemanden anrufst, bestimmst neu du, wie es beim Gegenüber aussieht. Definiert wird das durch das sogenannte Kontaktposter. Diese digitale Visitenkarte lässt sich über Kontakte > Meine Karte anpassen. Zur Auswahl stehen verschiedene Stile, Farben, Fotos, Memojis und Schriften. Später kann man etwa direkt in der iMessage-App wählen, mit wem man seine Karte teilen will.
Woooooooooosh!
Nummer eintippen war gestern: Mit Namedrop lassen sich die Kontaktposter auch direkt zwischen zwei iPhones verschieben. Hält man diese nahe zusammen, gibt es eine futuristische Animation und zwei Optionen werden präsentiert: nur empfangen oder teilen. Ersteres empfängt lediglich die Visitenkarte des Gegenübers, nur wenn man Teilen wählt, wird die eigene ausgetauscht. Sensible Informationen wie die Adresse werden nicht verschickt.
Ein iPhone für Opa
Das iPhone ist ein Supercomputer im Hosensack: Doch nicht alle wollen oder können mit den zahlreichen Funktionen umgehen. Darum gibt es neu den «unterstützenden Zugriff». Dieser kann über die Bedienhilfen eingestellt werden. Das Gerät lässt sich dabei auf das Wesentliche reduzieren. Dabei kann man wählen, welche Apps oder sogar welche Teile von Apps angezeigt werden. Aus einem komplizierten Smartphone wird dann ein Gerät, das lediglich die Fötelis der Enkelkinder zeigt, das Lieblingslied vom Ätti abspielt und die Telefonnummer der Tochter als Schnellwahlknopf hat.
Plappern? Das war gestern!
Mit iOS 17 kommt eine neue Art von Anrufbeantworter aufs iPhone. Geht das Gegenüber nicht ran, kann man eine Videobotschaft hinterlassen. Das geht nur, wenn man Facetime, also Apples eigenen Dienst für Videoanrufe nutzt.
Joghurt und Gemüse
Konkurrenz für Shopping-Apps: In der App Erinnerungen kann neu direkt eine Einkaufsliste angelegt werden. Praktisch ist, dass diese ähnliche Einträge automatisch in Kategorien gruppiert. So sind verschiedene Obst und Gemüse, Körperpflege- und Milchprodukte zusammen. So läuft das Einkaufen im Laden effizienter ab. Bei einem Test klappte das gut – sofern man nichts dagegen hat, anstatt Rüebli und Härdöpfel, Karotten und Kartoffeln zu schreiben. Mit schweizerdeutschen Begriffen kann iOS nämlich nichts anfangen.
Rotlicht im Schlafzimmer
Eleganz auf dem Nachttisch: Lädt das iPhone und liegt es dabei quer, wird der neue Stand-by-Modus angezeigt. Dieser ist standardmässig aktiviert. Erkennt das Gerät eine dunkle Umgebung, schaltet die Anzeige auf Rot, um nicht zu stören. Zudem ist die Uhr nur zu sehen, wenn Bewegung registriert wird. Damit es richtig chic wirkt, kann ein Magsafe-Ständer genutzt werden. Es klappt aber genauso, wenn man das Handy mit dem Kabel lädt und es quer aufstellt.
Gymnastik für die Arme
Im Bett, im Tram oder Zug: Nutzerinnen und Nutzer halten ihr iPhone oft nur wenige Zentimeter vom Gesicht weg. Für die Augen kann das belastend sein. Jetzt gibt es Hilfe: Mit iOS 17 kann die Funktion Bildschirmentfernung aktiviert werden. Sie ist unter Einstellungen > Bildschirmzeit > Bildschirmentfernung zu finden. Schaltet man die Funktion ein, misst das iPhone mit den Sensoren von Face ID, wie weit das Gerät von den Augen entfernt ist. Hält man es zu nahe, poppt eine Meldung auf, mit der Aufforderung, es weiter wegzuhalten.
Dein Gesicht schützt Safari
Sichereres Browsen mit Safari: Private Tabs können jetzt zusätzlich mit Face ID gesperrt werden. Wenn man das entsperrte iPhone an jemanden weitergibt und diese Person versucht, die privaten Safari-Tabs zu öffnen, muss dieser Schritt mit Face ID entsperrt werden. Die neue Funktion hat darum insgeheim bereits den Namen «Porno-Modus» bekommen.
Passwörter für alle
Xasdfh7391_asDDfafu37912$daz – wer ein solches Passwort hat, darf stolz sein. Mühsamer wird es dann, wenn man es eintippen oder weitergeben will. Etwa, um auf den gemeinsamen Streamingdienst zuzugreifen. Mit iOS 17 wird das einfacher, verspricht Apple. So kann man neu in den Einstellungen unter Passwörter einzelne Gruppen erstellen, um eben Passwörter zu teilen. Dazu muss man jedoch den iCloud-Schlüsselbund aktiviert haben und alle Geräte müssen mit der neusten Systemversion laufen.
Begleitung für Heimweg
Gut versteckt, aber praktisch, ist die neue Funktion namens Wegbegleitung. Ist diese aktiv, erledigt sich die Frage: «Bist du gut zu Hause angekommen?» Mit der Wegbegleitung erhalten zuvor ausgewählte Freunde oder Familienmitglieder eine Rückmeldung, ob man am Ziel angekommen ist. Ist das nicht der Fall, hat man 15 Minuten Zeit, um zu reagieren, bis ein Alarm samt dem letzten Standort an das Gegenüber verschickt wird. Zu finden ist die Funktion direkt in der Nachrichten-App. Verfasst man eine neue Nachricht, tippt man links auf das Pluszeichen und scrollt im Menü bis zum Punkt Wegbegleitung.
«Hurra, geschafft!»
Roboter mal anders. Mit dem neuen iOS lässt sich die eigene Stimme klonen. Was es dazu benötigt? Rund 20 Minuten Zeit und Ausdauer. Die Funktion Personal Voice ist etwas versteckt. In den Einstellungen tippt man auf Bedienungshilfen, dann auf «Eigene Stimme». Dann braucht es etwas Spucke: Der Reihe nach muss man 150 Sätze einsprechen. Diese sind teilweise länger, wie «Ist es ok, seine Schuhe auf die Treppe zu stellen?» oder ganz kurz, wie «Hurra, geschafft!». Die Aufnahmen dienen als Basis für die Berechnung der Robostimme. Generiert wird diese dann über Nacht, sofern das iPhone am Ladekabel hängt und nicht genutzt wird. Bisher ist die Funktion nur in englischer Sprache verfügbar.
Diese iPhones erhalten das Update
Nicht alle iPhones erhalten das neuste Systemupdate. So blicken Besitzerinnen und Besitzer mit einem iPhone 8, einem iPhone 8 Plus oder einem iPhone X – und älteren Modellen in die Röhre. Installiert werden kann iOS auf folgenden Geräten:
iPhone SE (2. Generation oder neuer)
iPhone XR
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
Sollte man nicht mehr wissen, welches Modell man hat, erfährt man dies in den Einstellungen. Der Name des Modells wird unter Einstellungen > Allgemein > Info angezeigt.
Installiert werden kann iOS 17 voraussichtlich ab nächster Woche. Die Installation kann unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate ausgelöst werden. Wie immer vor einem Update sollte man vorab seine Daten sichern. Schreibt Blick.
12.9.2023 - Tag des Porno-Modus
Clickbaiting at its best vom Zürcher Boulevardmagazin. Um die «Face ID» als Porno-Modus zu bezeichnen, braucht es schon arg viel kaputte oder kranke Phantasie. Aber was tut man nicht alles beim Blick für einen Klick.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Orthodoxe Juden und Davos – eine unerwiderte Liebe?
Sind orthodoxe Juden in Davos nicht mehr willkommen? Der Davoser Tourismus-CEO Reto Branschi (64) beklagt in zwei Interviews, dass sich jüdische Touristen schlecht benehmen. Ein Augenschein vor Ort.
Orthodoxe Juden lieben Davos GR. Jeden Sommer reisen rund 4000 aus aller Welt an, während eines knappen Monats prägen sie das Strassenbild. Es gibt dann koscheres Essen im Supermarkt und temporäre Lokale zum Beten. Die Wochenzeitung «Jüdische Allgemeine» erklärte die höchstgelegene Stadt Europas scherzhaft zum höchstgelegenen «Schtetl», das jiddische Wort beschreibt einen jüdisch geprägten Ort. Nur: Nicht überall in Davos wird die Liebe der Orthodoxen erwidert, im Gegenteil. Jetzt ist die Situation eskaliert.
Der Davoser Tourismus-CEO Reto Branschi (64) kritisierte seine jüdischen Gäste in zwei Interviews. «Ein Teil dieser Gästegruppe hat spürbar Mühe, die Regeln des Zusammenlebens hier in Davos zu respektieren», liess er sich in der «Davoser Zeitung» zitieren. Und beklagte Abfall in der Natur und respektlosen Umgang. Die Diagnose des Touristikers: «Es brodelt.»
Kurz darauf schlug den Juden in Davos auch Hass entgegen. Die «Gipfel Zytig», laut Eigenbeschrieb ein «Organ für den Tourismus» in der Region, brachte ein Bild von Fäkalien auf der Titelseite. Der Kot sei auf einer Terrasse gefunden worden und stamme «unzweifelhaft von einem menschlichen Wesen mit jüdischer Abstammung», so der widerliche Text. Was ist los zwischen Davosern und Orthodoxen?
Jüdische Touristen nicht mehr willkommen?
Jonathan Kreutner (44) trifft Blick vor der Station der Standseilbahn Schatzalp. Als Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) hat er die Eskalation miterlebt: «Offenbar sind der Tourismusorganisation jüdische Gäste in Davos nicht willkommen», sagt Kreutner.
In den letzten Jahren versuchten Freiwillige des Gemeindebundes zwischen den Davosern und den Orthodoxen zu vermitteln. Zum Beispiel mit einer Broschüre, die den Gästen die lokalen Gepflogenheiten näherbringen soll: Nicht vordrängeln, keinen Abfall in der Natur hinterlassen, und im Restaurant sollte jeder am Tisch auch etwas bestellen. Tourismus-CEO Branschi hat die Zusammenarbeit mit dem SIG aber aufgekündigt, «mit einem dürren Mail», wie Kreutner bemerkt. Der SIG-Generalsekretär ärgert sich, dass alle Juden in den gleichen Topf geworfen würden, weil sich einige wenige schlecht benehmen.
Er sieht zwei mögliche Gründe, die zur jüngsten Eskalation führten: Geld und antijüdische Ressentiments. Geld, weil die orthodoxen Touristen ein untypisches Konsumverhalten zeigen. Sie steigen öfter in Ferienwohnungen als in Hotels ab. Sie unterstützen, mangels Restaurants, die Essen nach koscheren Regeln zubereiten, auch die lokale Gastronomie nur wenig. Und eben: «Dazu gibt es Leute, die Ressentiments gegen Juden haben», sagt Kreutner. Gegen den Kot-Artikel in der «Gipfel Zytig» hat der SIG Anzeige eingereicht. «Das hat klar eine Linie überschritten.»
Lokales Gewerbe hat sich auf die Juden eingestellt
Das einheimische Gewerbe hat sich auf die orthodoxen Touristen eingestellt. Die Spar-Filialen bieten über den Sommer eine Auswahl koscheren Essens an. Metzgerin Susanne Pfister (48) vom Fleischzentrum bietet zwar kein koscheres Fleisch an, baut im Sommer dafür das Fisch-Angebot aus. «In dieser Zeit mache ich mit den Juden sicher 70 Prozent vom Fisch-Umsatz.» Den aktuellen Streit sieht sie differenziert. «Wenn zu viele zur gleichen Zeit kommen, führt das unabhängig von der Herkunft immer zu Problemen», sagt sie. Die Aussagen des Tourismus-CEOs findet sie im Hinblick auf mögliche Image-Schäden für Davos trotzdem «nicht so clever».
Seilbahn-Kassenchef Simon Lutz (38) sieht ebenfalls beide Seiten: «Es gab in der Vergangenheit schon Probleme mit Littering», sagt er. Und wenn das Gegenüber kein Englisch spricht, vereinfache das die Sache auch nicht gerade. Dass die Situation eine Belastung sei, würde er aber nicht sagen. Es sei eine Minderheit, die Probleme mache. Und: «Man muss einfach miteinander kommunizieren!»
«Wir Juden halten uns ans Gesetz»
Die jüdischen Touristen haben vom Streit nichts mitbekommen. Die Hochsaison ist vorbei, nur noch vereinzelt sind Orthodoxe auf der Strasse zu sehen. Joe (39) und Jacob (37) sind mit ihren Familien aus New York angereist. «Wir sind zum ersten Mal hier, das ist ja wie im Märchen!», schwärmt Joe. «Wir Juden halten uns ans Gesetz», sagt er zu den Problemen mit einigen Einheimischen. Und muss schnell weiter, um die Seilbahn zu erwischen.
Israel (47) aus Belgien wohnt im Haus «Etania», das seit 1911 als Heilstätte für orthodoxe Juden dient, die sich von der Höhenluft Linderung erhoffen. «Ich geniesse meinen Aufenthalt hier», sagt er. Dass manche jüdische Gäste lauter und lebendiger seien als der Durchschnitts-Schweizer, führt der zurückhaltende Belgier nicht auf die Religion zurück: «Das ist etwas typisch Israelisches.» Von negativen Erlebnissen erzählen die jüdischen Touristen aber auch: Eine jüdische US-Amerikanerin beklagt, sie sei von einem Picknick-Tisch vertrieben worden. Andere erzählen von schrägen Blicken und unfreundlichem Umgangston von manchen Einheimischen. Fest steht: Die Orthodoxen werden auch nächsten Sommer wieder kommen. Dass das nicht allen in Davos passt, ändert daran nichts. Schreibt Blick.
1.9.2023 - Tag des koscheren Litterings
Ein mutiger Artikel von Blick. Da wird es vermutlich nicht lange dauern, bis die Redaktion des Boulevardblatts an der Zürcher Dufourstrasse einige geharnischte Briefe von der jüdischen Diaspora erhält. Oder Post von einem Zürcher Staranwalt. Die Kommentarfunktion des digitalen Blick-Artikels wurde jedenfalls bis jetzt (Stand 11.30 Uhr) deaktiviert. Ist wohl auch besser so.
Wo immer orthodoxe Fundamentalisten, egal welcher Religion oder Kultur, die ihren Fundamentalismus aus alten Überlieferungen und Sagen aus der Steinzeit beziehen, auf die moderne Neuzeit des 21. Jahrhunderts treffen, sind gegenseitiger Ärger und Missverständnisse vorprogrammiert.
Die Stadt Luzern erlebte (vorwiegend kulturell bedingte) Unannehmlichkeiten seinerzeit mit der Touristenschwemme aus Indien und China. Diese wurden aber grösstenteils durch geschickte Kommunikation und entsprechende Massnahmen von Luzern Tourismus aus dem Wege geräumt.
Irgendwie kann man den Ärger vom Davoser Tourismus-CEO Reto Branschi nachvollziehen. Jede Touristen-Destination bevorzugt nun mal Gäste, die es krachen lassen und möglichst viel Geld ausgeben. Denn, zwischen den Zeilen gelesen, geht es doch eher um die zurückhaltende Konsumfreundlichkeit der orthodoxen Juden als um Littering und Fäkalien auf einem Balkon. Littering und Notdurft an jeder Ecke sind nicht die Markenzeichen von irgendwelchen fundamentalistischen Glaubensgemeinschaften. Diese beiden Untugenden praktiziert nun einmal die überwiegende Mehrheit unserer Gesellschaft.
Es steht uns frei, das religiöse Steinzeit-Gedankengut von Fundamentalisten zu kritisieren. Nur sollten wir nicht vergessen, dass viele ScheizerInnen immer noch tief und fest an die Wilhelm-Tell-Saga glauben, obschon längst feststeht, dass es sich dabei um eine volkstümliche Geschichte aus dem Fabelreich handelt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Nur 42 Prozent der Österreicher befürworten, dass die Ukraine weiterkämpft – 37 Prozent meinen, dass es Frieden um jeden Preis geben muss
"Seit eineinhalb Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Dazu gibt es zwei Meinungen: Die einen sagen, dass die Ukraine kämpfen soll, um ihr Staatsgebiet zurückzugewinnen. Die anderen sagen, dass es Frieden um jeden Preis geben muss – auch um den, dass Russlands Angriffskrieg letztlich erfolgreich ist.
"Was meinen Sie?" Diese Frage legte das Linzer Market-Institut 805 repräsentativ ausgewählten Wahlberechtigten vor. Und nicht einmal jeder Zweite sagte, dass die Ukraine weiterkämpfen soll. In Zahlen: 42 Prozent unterstützen den Wunsch der angegriffenen Ukraine, ihr von Russland besetztes Staatsgebiet zurückzugewinnen – aber 37 Prozent meinen, dass es Frieden um jeden Preis geben muss. Das übrige Fünftel der Befragten kann sich für keinen der Standpunkte erwärmen.
Jene, die der Ukraine einen Verteidigungserfolg wünschen, sind in allen Altersgruppen etwa gleich stark vertreten – unter älteren Befragten sind die Befürworter eines Friedens "um jeden Preis", also zulasten der Ukraine, allerdings deutlich stärker vertreten als bei den Jüngeren, die häufig keine der Positionen teilen wollen. Viele Unentschiedene gibt es auch unter jenen, die derzeit nicht wissen, welche Partei sie bei der nächsten Nationalratswahl wählen sollen. Schreibt DER STANDARD.
28.8.2023 - Tag des Friedens um jeden Preis
Um es gleich vorwegzunehmen: Vergleichen heisst nicht gleichsetzen und Pazifismus ist eine ehrbare menschliche Haltung, aber nicht immer zielführend. Historische Analogien hingegen sind bei gewissen Gedanken, Überlegungen und Szenarien schlicht und einfach nicht von der Hand zu weisen. Lernt man daraus? Ja und Nein. Kommt allein auf die Sichtweise an.
Die sogenannte «Appeasement-Politik» in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts gegenüber Hitler-Deutschland machte immer und immer wieder Zugeständnisse gegenüber dem Expansionsstreben von Hitler. Es scheint, dass die damaligen Weltenlenker, allen voran der britische Premierminister Neville Chamberlain, Hitlers Buch «Mein Kampf» wohl kaum gelesen haben. Obschon der deutsche (aus österreich stammende) Diktator und Führer darin seine aggressiven aussenpolitischen Vorstellungen inklusive den damit verbundenen Vernichtungsplänen ganzer Ethnien während seiner Festungshaft in Landsburg (Bayern) schon sehr deutlich niedergeschrieben hatte.
Hitler war ja auch sehr geschickt mit seinen Forderungen an die von ihm als «schwach» verachteten Demokratien. So forderte er anfänglich «nur» die Beseitigung einiger Beschränkungen aus dem «Versailler Vertrag», die Deutschland von den Siegermächten auferlegt worden waren. Mit diesen Forderungen konnten die meisten Politiker leben. Man nahm sogar den Anschluss «Österreichs» im März 1938 an das «Deutsche Reich» tatenlos hin, obschon damit fast die gesamte Tschechoslowakei an Hitler-Deutschland grenzte, was wiederum für zusätzlichen Sprengstoff sorgte.
Die ständigen Nationalitätenkonflikte in der Tschechoslowakei mit den rund drei Millionen Sudetendeutschen nahm Hitler zum Anlass, durch die sudetendeutsche Partei SdP stetig neue Forderungen wie die (beinahe) vollständige Autonomie des Sudetengebiets an den tschechoslowakischen Staat zu stellen, die dieser unmöglich akzeptieren konnte. Denn dies hätte faktisch das Ende der Tschechoslowakei bedeutet.
Nachdem sich die Spannungen zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei je länger je mehr zuspitzten, setzten beide Staaten ihre Armeen in Bereitschaft: Die Tschechoslowakei am 20. Mai 1938, Deutschland am 30. Mai 1938. Anfang September 1938 drohte Hitler öffentlich mit dem Einmarsch in die Tschechoslowakei, worauf sich der englische Premierminister Arthur Neville Chamberlain als «Vermittler» zu persönlichen Gesprächen nach Deutschland aufmachte und von Hitler am 15. September 1938 auf dem Obersalzberg zu persönlichen Gesprächen empfangen wurde.
Es folgte die «Godesberger Konferenz» am 22. September 1938, an der Chamberlain Hitlers Forderung nach Abtretung des Sudetengebiets an das Deutsche Reich akzeptierte. Doch Hitler stellte sogleich weitere Forderungen wie den Einmarsch der Wehrmacht im Sudetengebiet sowie eine Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit der Sudetendeutschen. Forderungen, die er ultimativ mit dem 29. September 1938 verknüpfte.
Um den drohenden Krieg doch noch in letzter Minute abzuwenden, bat Chamberlain den italienischen Diktator Mussolini um Vermittlung. Hitler, Mussolini, Chamberlain und der französische Premierminister Edouard Daladier trafen sich am 29. September in München. Die Tschechoslowakei war nicht eingeladen. Auch nicht deren Bündnispartner, die damalige Sowjetunion.
Im Münchner Abkommen wurde die Abtretung des Sudetengebiets an das Deutsche Reich festgelegt. Die Besetzung durch Deutschland war vom 1. bis zum 10. Oktober geplant; die Grenzen waren noch nicht definitiv festgelegt. England und Frankreich garantierten der Tschechoslowakei, die sich dem Abkommen fügen musste, den Fortbestand des Reststaates.
Ende gut alles gut? Mitnichten. Hitlers Behauptung, das Sudetenland wäre die letzte territoriale Forderung Deutschlands, war eine Lüge. Am 15. März 1939 fuhren Panzer der Wehrmacht auf dem Wenzelsplatz in Prag auf. Hitler bekam somit Österreich, das Sudetengebiet und dann auch noch den Rest der Tschechoslowakei kampflos geschenkt. Doch trotz dieser «Geschenke» für einen «Frieden um jeden Preis» konnte der Zweite Weltkrieg nicht verhindert werden.
So wie der Krieg Putins mit der Ukraine auch nicht verhindert werden konnte, obschon – oder vielleicht weil ihm die Krim nach seinem Testlauf im Jahr 2014 von der «hehren westlichen Wertegemeinschaft» quasi gratis auf dem Teller serviert wurde. Die danach vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen waren eher Lachnummern nach dem Motto «wasch mir den Pelz aber mach' mich nicht nass».
Einen gerechten «Frieden um jeden Preis» gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie ohne Gewinner und Verlierer. Es wird ihn auch nie geben, ohne dass jemand einen entsprechenden Preis dafür bezahlt. Nicht einmal bei kriegerischen Patt-Situationen, egal wie lange sie dauern. Offen ist nur wer diesen Preis letztendlich bezahlt. Auf lange Sicht betrachtet ist es manchmal sogar der vermeintliche Sieger. Oder umgekehrt. Siehe den 30-Jährigen Krieg von 1618 bis 1648, der als Religionskrieg begann und als Territorialkrieg endete.
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass viele Friedensabkommen den nächsten Krieg bereits wieder in sich bergen. Warum eigentlich? Weil die Evolution diesen Entwicklungssprung (bis jetzt) für die Menschheit noch nicht vorgesehen hat. Erstaunlich nach Hitlers Holocaust und den US-Amerikanischen Atombomben-Abwürfen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
25.8.2023 - Tag der Freudschen Versprecher
Das Polizeibild von The Donald sieht irgendwie schon etwas grauslich und abartig aus. Das Bild ist das Ergebnis von KI (Künstlicher Intelligenz). Der Polizist am PC wollte der KI den naheliegendsten Begriff für Donald Trump, «straw blonde» (strohblond) eingeben, schrieb in der Hitze des Gefechtes allerdings «straw dumb» (stroh dumm). Das Resultat sehen Sie nun oben. Da kann man nur noch den Hut ziehen: Perfektes Bild aus Frankensteins Gruselkabinett.
Die KI erkennt scheinbar zwischen «strohblond» und «strohdumm» keinen Unterschied. Bei The Donald liegt sie da ja tatsächlich richtig!
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Chinas Wirtschaft ist ins Wanken geraten: Woher die Probleme kommen
Als "tickende Zeitbombe" bezeichnete US-Präsident Joe Biden jüngst den wirtschafts- und geopolitischen Rivalen China. Diese drastische Wortwahl hängt wohl auch mit einem amerikanischen Hang zur Dramatik zusammen, doch in der chinesischen Wirtschaft kriselt es tatsächlich ordentlich. Zwei Aushängeschilder für die problematische Lage sind die Immobilienriesen Evergrande und Country Garden. Evergrande etwa hat Ende vergangener Woche Gläubigerschutz in New York beantragt, Country Garden berichtet von Zahlungsschwierigkeiten.
Doch die Probleme reichen weit über den aufgeblasenen Immobiliensektor hinaus: das Wachstum schwach, die Jugendarbeitslosigkeit hoch wie nie, die Schulden steigend, der Konsum rückläufig. Sogar der Sprech der politischen Führung in Peking ändert sich mittlerweile. Präsident Xi Jinping spricht von langfristigen Zielen bei Bildung, Gesundheit und Lebensmittelversorgung, die er über kurzfristigen materiellen Wohlstand stellt. Er mahnt die Bevölkerung zur Geduld. DER STANDARD hat sich angesehen, wo es überall hakt.
Kriselnder Immobiliensektor
Die Bau- und Immobilienbranche hat in den vergangenen Jahren rund ein Viertel der chinesischen Wirtschaftsleistung ausgemacht, dementsprechend gehört dieser Sektor zu den größten Sorgenkindern im Reich der Mitte. Im September 2021 fingen beim zweitgrößten Immobilienentwickler des Landes die Zahlungsprobleme an akut zu werden, die Insolvenz wurde damals mehr oder weniger mit staatlicher Hilfe verschleppt, DER STANDARD hat berichtet.
Bereits seit Jahren galt der chinesische Immobilienmarkt als überhitzt, nun brechen die Preise ein. Es wurde immer mehr und immer mehr Geld in den Sektor gepumpt, und es wurde zum Trend, Wohnungen zu kaufen, die noch nicht gebaut waren. Bald wurde der Bau von bereits verkauften Wohnungen durch den Verkauf neuer Wohnungen finanziert – die Dynamik erinnert an ein Pyramidenspiel.
30 Jahre stiegen die Preise im Immo-Sektor. Eigentumswohnungen waren für die Chinesen so beliebt wie in Österreich und Deutschland jahrzehntelang das Sparbuch. Gekauft wurde überwiegend auf Pump. 2021 griff die Regierung dann ein, um das schuldenbasierte Wachstum zu bremsen. Die neuen Vorgaben (Verhältnis der Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten unter 70 Prozent, Nettoverschuldungsgrad nicht höher als 100 Prozent, Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten größer als Faktor eins) haben gezeigt, wie tief das Problem sitzt.
Konsum hat Long Covid
Ende des vergangenen Jahres hat die Staatsführung die langen und sehr strikten Corona-Regeln aufgehoben, in der Hoffnung, die Leute würden ihre Ersparnisse großzügig ausgeben. Doch dem ist nicht so. Sie horten ihr Geld. Es wurde eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen ergriffen – von der Ankurbelung der Nachfrage nach Autos und Haushaltsgeräten über die Lockerung einiger Immobilienbeschränkungen bis hin zur Unterstützung des Privatsektors.
Doch bisher lässt eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung auf sich warten. Viele Menschen geben zwar wieder Geld für Reisen und Restaurants aus, doch bei größeren Anschaffungen halten sie sich zurück. Die zahlreichen Lockdowns und Ausgangssperren führten aber ebenfalls dazu, dass zahlreiche Lokale und kleinere Geschäfte aufgeben mussten. Der Service-Sektor brach ein.
Weniger Exporte und Importe
China leidet derzeit unter einer eingebrochenen Auslandsnachfrage – der Exportmotor stottert, was die Sorgen hinsichtlich der Konjunkturentwicklung verstärkt. Aber nicht nur die Exporte, auch die Importe Chinas sind im Juli schneller als erwartet zurückgegangen. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken laut der Zollbehörde in Peking die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent.
Die Importe verzeichneten einen ähnlich deutlichen Rückgang um 12,4 Prozent. Beide Werte fielen noch schlechter aus als von Analysten erwartet. Mit der gesamten EU und den USA ging der chinesische Handel zurück. Ganz anders stellt sich die Lage zwischen Russland und China dar. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben die chinesischen Exporte in das Nachbarland deutlich angezogen. Im Juli stiegen sie im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent.
Folgenschwere Maßnahmen von USA und EU
Das von den USA angestoßene "De-Coupling" und das von der EU in abgeschwächter Form aufgenommene "De-Risking" waren ein weiterer schwerer Schlag, denn die Direktinvestitionen in China sind danach massiv zurückgegangen. Darüber hinaus verschrecken immer neue Regeln innerhalb Chinas, die angeblich der nationalen Sicherheit dienen sollen, Investoren aus dem Ausland. Verbindlichkeiten für direkte Investitionen, eine wichtige Messgröße, fielen im zweiten Quartal verglichen zum Vergleichszeitraum um fast 90 Prozent auf ein 25-Jahrestief von 4,9 Milliarden Dollar.
In die Deflation gerutscht
Im Gegensatz zu den meisten westlichen Staaten, die gegen hohe Inflationsraten kämpfen, sinken in China die Preise. Das Land ist in einer Deflation angekommen, was für Verbraucher den angenehmen Effekt mit sich bringt, dass alles billiger wird. Viele Ökonominnen und Ökonomen fürchten diese Entwicklung allerdings sehr, denn üblicherweise führen fallende Preise dazu, dass Verbraucher ihre Konsumentscheidungen aufschieben. In der Folge wird weniger gekauft, weswegen die Unternehmen weniger produzieren, eventuell Leute entlassen und so eine gesamte Volkswirtschaft in die Rezession rutscht.
Hohe Jugendarbeitslosigkeit
Die prekäre Wirtschaftslage spiegelt sich auch in der historisch hohen Jugendarbeitslosigkeit in den Städten wider, die mittlerweile auf 21,3 Prozent angestiegen ist. Auch hier spielt die rigide Corona-Politik eine Rolle. Viele Studenten zogen vor, ihr Studium zu verlängern, anstatt sich um Jobs zu bewerben. Das bringt heruntergebrochen ein weiteres Problem mit sich: Die Ausbildung junger Chinesinnen und Chinesen geht am Bedarf vorbei. Es gibt eine "Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten, die Hochschulabsolventen erworben haben, und dem, was von Arbeitgebern in der Industrie mit einem stark wachsenden Personalbedarf gesucht wird", heißt es bei Asien-Spezialisten der US-Investmentbank Goldman Sachs.
Auswirkung auf Finanzbranche
Die Immobilienkrise droht überdies auf die Finanzbranche überzugreifen. Zhongrong International Trust, einer der führenden Anbieter der in China weitverbreiteten Treuhandfonds, hat gegenüber Investoren "kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten" eingeräumt und seit Ende Juli die Rückzahlungen auf Dutzende seiner Produkte ausgesetzt, wie ein Teilnehmer eines Treffens mit Anlegern berichtete. Zhongrong ist traditionell beträchtlich im Immobilienmarkt investiert. Auf das Geld aus diesen Treuhandfonds (Trusts), die zu den unregulierten Schattenbanken gezählt werden, hatten viele Immobilienentwickler bei ihrer fast ungezügelten Expansion in den vergangenen Jahren gebaut. Nun werden Ansteckungseffekte befürchtet, und der Ruf nach dem Staat wird laut.
Noch mehr Intransparenz
Es herrscht generell große wirtschaftliche Unsicherheit im Land, die durch zunehmende Intransparenz noch weiter verstärkt wird. Behörden halten zunehmend Daten zurück und verraten beispielsweise keine Zahlen mehr zur Jugendarbeitslosigkeit. Wirtschaftsforschende wurden zuletzt angehalten, sich nicht negativ über die aktuelle Wirtschaftslage zu äußern. Zudem lassen sich Unternehmen praktisch nie in die Bücher schauen, und man weiß nicht genau, wie groß die Risikolage gerade ist, das ist allerdings nicht wirklich neu.
Angekündigte Gegenmaßnahmen
Nach der überraschenden zweiten Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank vergangene Woche reduzieren nun auch die großen chinesischen Banken ihre Kreditzinsen. Das bezieht sich aber nur auf einjährige Kredite und nicht auf fünfjährige Darlehen. Dieser fünfjährige Zins ist allerdings besonders wichtig für das Niveau der Immobilienkredite. Überdies versucht die Notenbank nervöse Investorinnen und Investoren zu beruhigen. Das Land werde seine Finanzhilfen koordinieren, um die Schuldenprobleme lokaler Regierungen zu lösen, teilte die Zentralbank am Sonntag mit. Die Analyse von Risiken müsse zudem verbessert werden. Große Banken sollten ihr Kreditvolumen erhöhen. Schreibt Andreas Danzer in DER STANDARD.
22.8.2023 - Tag der Wiederkäuer
Ein dem Sommerloch und Clickbaiting geschuldeter Artikel wird auch durch stetige Wiederholung nicht besser. Siehe unten «Wort zum Tag» vom 9.8.2023.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Übergewinnsteuer für Banken ist ein Brandbeschleuniger
In ihrem Gastkommentar schreibt die Wirtschaftswissenschaftlerin Heike Lehner über die Übergewinnsteuer der italienischen Regierung und warum diese langfristig vor allem in Krisenzeiten eher Probleme schafft, als löst.
Es war eine überraschende Ankündigung vergangene Woche: Italien möchte eine Übergewinnsteuer auf Banken einheben. Nachdem die Aktienkurse der Banken daraufhin auf Talfahrt gegangen waren, ruderte die Regierung nicht einmal 24 Stunden später zurück und begrenzte die maximal mögliche Steuer. Doch Italien ist nicht das einzige Land, das Übergewinnsteuern für Banken befürwortet. Auch Spanien, Ungarn, Litauen und Tschechien haben in den vergangenen Monaten Ähnliches eingeführt. Zu stark ist der Unmut über die hohen Gewinne der Banken, die mit den steigenden Zinsen einhergehen. Aber die Lösung der Übergewinnsteuer für Banken wurde nicht zu Ende gedacht. Sie ist alles andere als ein Geniestreich. Im Gegenteil: Sie macht die Wirtschaft in Zeiten der Unsicherheit noch fragiler und verhindert gleichzeitig eine effektive Inflationsbekämpfung.
Es scheint so einfach: Die steigenden Zinsen belasten die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, während die Sparzinsen von den Banken bisher nicht in gleichem Ausmaß erhöht wurden. Unter anderem das beschert den Banken riesige Gewinne, bekommen sie doch hohe Kreditzinsen, müssen aber den Sparerinnen und Sparern bei weitem nicht diese Zinsen zahlen. Die daraus resultierenden Gewinne teilweise abzuschöpfen sei die einzig logische Konsequenz. Gerade in Krisenzeiten soll doch jeder seinen Teil beitragen, oder? Bei dieser Frage hört der beschriebene Gedankengang bei den Befürworterinnen und Befürwortern der Übergewinnsteuer leider auf. Denn gerade in Zeiten von wirtschaftlichem Abschwung wäre es genau die falsche Entscheidung, Banken zusätzlich zu belasten.
Notwendiger Geldpuffer
Banken benötigen Geldpuffer, um etwa die in Krisen oft steigende Anzahl von ausfallenden Krediten abzufedern. Durch die zusätzliche Abschöpfung der Gewinne ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie eben diese Stressfälle abfedern könnten. Ohne ausreichend finanziellen Spielraum werden insbesondere Banken noch fragiler. Das kann wiederum das Vertrauen in den Bankensektor infrage stellen. Und wir alle wissen, dass Vertrauen in das Bankensystem maßgeblich ist, um die Finanzmarktstabilität aufrechtzuerhalten. Das vermeidet Bankenrettungen, die dann erst recht Milliarden an Steuergeldern verschwenden werden. Diese Kosten wären übrigens weitaus höher, als durch eine Übergewinnsteuer jemals eingenommen werden könnte.
Hohe Nettozinserträge, also die Differenz zwischen gezahlten und erhaltenen Zinsen, helfen den Banken in der EU in aktuell möglichen Stressszenarien und würden in diesem Fall ihre Eigenkapitalpositionen stabilisieren. Das wurde übrigens auch von der europäischen Bankenaufsicht beim Stresstest vom Juli bestätigt. Diese Zinserträge würden etwa steigende Kreditausfälle gut abfedern. Dass bei der Debatte die Resultate der Aufsicht derart unter den Tisch gekehrt werden, spricht Bände.
Doch die Bankenaufsicht ist nicht die einzige unabhängige Institution, die komplett außer Acht gelassen wird. Offenbar ist es noch nicht zu allen durchgedrungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) gerade versucht, die Inflation in den Griff zu bekommen. Das macht sie vor allem durch steigende Leitzinsen, die dann unter anderem via erhöhten Kreditzinsen an die Haushalte und Unternehmen weitergegeben werden. Diese sollen weniger investieren und konsumieren, um die Nachfrage zu senken und somit den Inflationsdruck. Jedoch plant Italien, die Einnahmen durch die Übergewinnsteuer zum Beispiel an Personen mit Hypothekarkrediten zurückzugeben, um deren Zinsbelastung zu reduzieren. Genau das würde die Bemühungen der EZB allerdings wieder zunichtemachen. Auf der einen Seite erhöht die Zentralbank die Zinsen, deren Auswirkungen werden auf der anderen Seite durch die italienische Regierung wieder abgefedert.
Nicht Kredite zahlen
Die Regierungen sind dafür verantwortlich, für die Schwächsten die Auswirkungen der Inflation abzufangen. Aber nicht, die Kredite für die Bevölkerung zu bezahlen. Denn die Wahrheit ist: Inflationsbekämpfung ist nicht gratis. Sie birgt ökonomische Kosten und beeinträchtigt die Wirtschaftsleistung. Die Teuerungskrise wird durch diese Herangehensweise sogar unnötig verlängert und die Inflationsbekämpfung noch schmerzhafter.
Nach den Instabilitäten im Bankensystem im Frühling nun im Sommer nach einer Übergewinnsteuer für diese zu rufen ist unverständlich. Es scheint, als hätten die Regierungen die wochenlange Unsicherheit und Angst vor einem Crash nur wenige Monate später vollkommen vergessen. Viel zu attraktiv scheint eine populistische Maßnahme, die Steuereinnahmen bringen soll. Dabei sollte der Fokus jetzt darauf liegen, die schwächelnde Wirtschaft nicht noch weiter zu belasten und die Inflation so rasch wie möglich zu reduzieren.
Wenn man die Idee der Übergewinnsteuer zu Ende denkt, wird klar, dass die langfristigen Risiken den kurzfristigen Nutzen in Form von zusätzlichen Steuereinnahmen klar überwiegen. Und gerade in Krisenzeiten sollte man sich dreimal überlegen, ob man hier dem Populismus nachgibt und einen möglichen Brandbeschleuniger wie eine Übergewinnsteuer einführen möchte. Schreibt Heike Lehner in DER STANDARD.
16.8.2023 - Tag des Brotes das ich ess'
Machen wir uns nichts vor: Die inzwischen in beinahe alle Situationen unseres täglichen Lebens verdeckt eingreifenden Tätigkeiten der Banken sind für Normalbürger nicht mehr nachvollziehbar. Nicht einmal mehr für die höchsten RepräsentantenInnen der Regierung. Das wurde beispielsweise bei der Pressekonferenz unserer Bundesrätin Keller-Sutter zum Credit Suisse-Debakel einmal mehr aufgedeckt: Einige ihrer Äusserungen wurden denn auch umgehend von der Presse ebenso genüsslich wie nachweisbar als «Falschaussagen» bewertet. Stichwort «FINMA».
Die Finanzwirtschaft ist derart komplex und machtvoll, dass sie inzwischen selbst von anerkannten ExpertenInnen in vielen Fällen gar nicht mehr erklärt werden kann. Oder, noch schlimmer, nicht erklärt werden will. Bei Frau Keller-Sutter war es definitiv Unwissen, was irgendwie zu ihrer DNA gehört.
Wie bei jeder Studie sollten wir uns auch bei «Gastkommentaren» stets eine einzige Frage stellen: Wer hat die Studie bezahlt bzw. wer bezahlt die UrheberInnen der «Gastkommentare», die notabene den kränkelnden Medien auf den ersten Blick gratis zwecks Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden, meistens aber auf irgend eine Art und Weise dennoch alimentiert sind. Mehrheitlich durch zeitversetzte Inserate, so dass ja nicht nicht der Eindruck von «Gefälligkeitsjournalismus» entsteht.
Bevor Sie jetzt obigen Artikel bewerten, falls Sie das Banken-Kauderwelsch überhaupt verstanden haben, sei festgehalten, dass die Wirtschaftswissenschaftlerin Heike Lehner Mitglied des österreichischen Think Thanks «Agenda Austria» ist, der sich damit brüstet, nicht vom Staat, sondern ausschliesslich aus privaten Quellen finanziert zu werden, die da wären: Wirtschaftsnahe Stiftungen, Banken, Industrieunternehmen.
Nun erst können Sie Ihre eigene Analyse unter Berücksichtigung der Frage «wem nützt dieser Artikel am meisten» vornehmen. Bedenken Sie dabei die alte Volksweisheit: «Wessen Brot ich ess', dessen Lied ich sing'». Dieser uralte Spruch macht denn auch die auf den ersten Blick unverständlichen oder unstimmigen Passagen in obigem Artikel ganz klar verständlich. Oder anders ausgedrückt: Der zweite Blick relativiert die Weisheiten von Frau Lehner als das was sie sind: Ein schlecht verpacktes Credo für die Interessen der Banken.
Sie sehen: Der zweite Blick ist wichtig. In medialen Zeiten wie diesen sogar unerlässlich.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Mega-Bank UBS: Kein Blanko-Scheck für Ermotti
Die UBS verzichtet auf Garantien des Bundes. Doch für die Steuerzahlenden bleiben viele Risiken. Das CS-Debakel muss Wahlkampfthema bleiben.
Im Jahr 2008 musste die Schweiz die UBS retten und im Jahr 2023 die Credit Suisse. So erfreulich es klingt, dass die UBS nun die Verlustgarantie des Bundes nicht mehr benötigt: Die Risiken für die Steuerzahlenden sind nicht vom Tisch.
Unklar ist, wie ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen ausgeht. Der Streitwert, für den im ungünstigsten Fall die Steuerzahlenden aufkommen müssen, beträgt 17 Milliarden Franken.
Schwerer wiegt das Klumpenrisiko. Schon die CS war «too big to fail», die neue Megabank UBS ist es erst recht. Die Bilanz beider Banken ist mehr als doppelt so gross wie das Bruttoinlandprodukt. Bei einer neuen Finanzkrise hätte die Schweiz ein massives Problem.
Aus Sicht der UBS ist es verständlich, vor dem beginnenden Wahlkampf auf Beruhigung zu setzen. Auch andere Banken wollen verhindern, dass Eigenkapitalquote, Regulierung oder Boni zum Wahlkampfthema werden. Doch die Lehren aus dem CS-Debakel dürfen nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden.
Die Krisen von 2008 und 2023 zeigen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Finanzmarktaufsicht darf kein zahnloser Tiger bleiben. Die Schweiz braucht Regeln für die Abwicklung systemrelevanter Banken. Und für UBS-CEO Sergio Ermotti gibts keinen Blankoscheck. Das CS-Debakel muss Wahlkampfthema bleiben. Schreibt Raphael Rauch im Blick.
14.8.2023 - Tag des Kochs und seiner Kellnerin
Dass die UBS den Verzicht auf die Staatsgarantien des Bundes rechtzeitig vor den National- und Ständeratswahlen im Herbst 2023 verkünden würde, war so sicher wie das Amen in der Kirche. Entsprechend äusserte sich denn auch sofort Switzerland's next Topmodel Karin Keller-Sutter, nicht ohne genüsslich darauf hinzuweisen, dass der Bund mit den Staatsgarantien für die UBS rund 200 Millionen Franken Gewinn gemacht habe.
Besoffen von ihrer eigenen Grossartigkeit vergass sie allerdings zu erwähnen, dass da noch etliche Baustellen offen sind. Wie beispielsweise die Klagen bezüglich den wertlos gewordenen AT1-Bonds der Credit Suisse vor dem Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, mit denen beispielsweise die MIGROS-Pensionskasse auf einen Schlag fast 100 Millionen Franken verloren hat. Denken Sie einen kurzen Moment darüber nach, wessen Geld hier gestohlen wurde! Ja genau, Sie liegen richtig: Das Geld der ArbeitnehmerInnen der MIGROS.
FDP-Präsident Thierry Burkart verkündete gleichentags ebenfalls seine grosse Zufriedenheit über das geniale Krisenmanagement der grossartigen FDP-Bundesrätin aus dem Finanzdepartement. Gleichzeitig gab er bekannt, dass die FDP nun im Wahlkampf vom kommenden Herbst in gewohnter Wendehalsmanier auf das SVP-Thema «Flüchtinge / Migration» setzen werde. Ein Thema, das längst von der fleischgewordenen Lächerlichkeit, dem Luzerner Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller, mit einer bei Boris Johnson abgekupferten Motion im Parlament bespielt wurde.
Dass ausgerechnet FDP-Bundesrätin Keller-Sutter vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2022 als Justizministerin der Schweiz mit ihrem Departement für die Flüchtlingsproblematik / Migration zuständig war, hat Thierry Burkart logischerweise nicht erwähnt. Auch der Luzerner Ständerat mit den grotesken Binär-Problemen verlor über diese Tatsache kein Wort.
Scheinbar hat die FDP aus dem Wahldebakel 2019 unter der unsäglichen FDP-Präsidentin Gössi nichts gelernt. Der Sprung auf den fahrenden Zug der Grünen mit dem Thema «Klimaschutz» erwies sich im Nachhinein als Rohrkrepierer. Kein Wunder. War es doch die FDP, die in den vergangen Jahren bis zum Ende der Parlamentssession 2019 so ziemlich jede Vorlage zum Klimaschutz im Parlament abgelehnt hatte. So dumm waren die Wählerinnen und Wähler denn doch nicht, dies zu vergessen.
Kommt hinzu, dass das Original immer besser abschneidet als die Kopie. Das wird auch bei den kommenden Wahlen der Fall sein. Denn Hand aufs Herz: Das Copyright beim Thema Flüchtlinge ist nun mal seit vielen Jahren im Besitz der SVP. Da helfen vermutlich nicht einmal die unseligen Listenverbindungen der FDP mit der SVP.
CS-Crash: Ende gut alles gut? Nein! Denn mit der gigantischen UBS werden die Risiken der «to big to fail»-Strategie des Bundes noch grösser. Sergio Ermotti von der UBS hat ja unserer glorreichen Finanzministerin von allem Anfang an gezeigt, wer Koch und wer Kellnerin ist. Und das wird auch immer so bleiben.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Barbies Attacke auf Allahs Ordnung
In den meisten arabischen Staaten haben die Behörden ihr Okay für den Start von Greta Gerwigs Barbie-Film gegeben. Der Film irritiert aber.
Auch in der arabischen und islamischen Welt mag es kritische Eltern geben, die die Puppe Barbie deshalb ablehnen, weil sie ihren Töchtern ein jenseitiges Körperbild und ein überholtes Selbstverständnis vermitteln könnte. Die Betroffenen können im Fall des Films Barbie aber auf einen über jeden Zweifel erhabenen Fan verweisen: Malala Yousafzai, die mittlerweile 26 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin aus Pakistan, auf die wegen ihres Engagements für die Ausbildung von Mädchen ein Attentat verübt wurde, ließ sich nach dem Kinobesuch sogar in Barbie-Pink-Aufmachung fotografieren.
Der als Komödie angelegte Kassenschlager Barbie (Buch und Regie von Greta Gerwig) stößt jedoch in islamisch geprägten Gesellschaften – und bei Reaktionären weltweit – aus anderen Gründen auf Widerstand. Am deutlichsten meldete sich diese Woche der libanesische Kulturminister Mohammed al-Mortada zu Wort, der von den zuständigen Sicherheitsbehörden ein Verbot des Films verlangte. Barbie "widerspricht der Moral und den Werten des Glaubens und den etablierten Prinzipien im Libanon", sagte der Jurist, der in hohen Positionen gedient hat und auf einem Ticket der schiitischen Partei Amal Minister wurde.
Vater infrage gestellt
Nicht nur im Libanon werden westliche Produktionen auf LGTBIQ-Inhalte gescreent und gegebenenfalls verboten oder purifiziert. Barbie, sagt Mortada, bewerbe "Homosexualität und sexuelle Transformation". Aber nicht nur das, der Film "stellt die Führung des Vaters infrage, mache die Rolle der Mutter klein und lächerlich und hinterfragt die Notwendigkeit, zu heiraten und eine Familie zu haben".
Was arabische Staaten betrifft, ging der Filmstart nur in Tunesien und in Marokko am 20. Juli vonstatten, in den meisten anderen wurde er erst einmal auf den 31. August verschoben. Inzwischen haben jedoch etliche Behörden ihr Okay gegeben, mit einer Altersgrenze von 18 Jahren, wie in Ägypten. In Saudi-Arabien kam Barbie am Donnerstag ins Kino, auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar haben ihn inzwischen abgenickt. Diskussionen gab es zudem in Kuwait, Jordanien, Oman und Bahrain.
Man sollte auch nicht erwarten, dass diese Debatten – und die Versuche, den Film zu verbieten – damit vom Tisch sind. Islamistische Aktivisten und Aktivistinnen sind immer wieder sehr findig dabei, die Justiz zum "Schutz der Gesellschaft" einzuschalten. Oft setzt die Aufregung erst verspätet ein.
Ende des offenen Libanon
Während ausgerechnet konservative Golfstaaten, die verstärkt westliche Unterhaltungsindustrie zulassen, nolens volens mitziehen, ist die reaktionäre Wende im einstmals offenen Libanon auffällig. Dort gibt es eigentlich mehr westlich gestylte Frauen als irgendwo anders in der arabischen Welt. Auch Homosexualität war jahrzehntelang kein Thema. Dass die islamischen Schrauben angezogen werden, zeigte sich 2019 beim Auftrittsverbot beim Byblos-Festival für den queeren Sänger Hamed Sinno und seine (2022 aufgelöste) Band Mashrou’ Leila, die ursprünglich aus dem Libanon stammt. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sei der Meinung, vermeldet Naharnet, dass eine Person bereits für einen einzigen homosexuellen Akt getötet werden müsse.
Disneys Computeranimationsfilm Lightyear wurde aber unter anderem auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Saudi-Arabien und Ägypten wegen einer gleichgeschlechtlichen Kussszene verboten. Ein weiteres Opfer ist Spider-Man: Across the Spider-Verse, etwa in den VAE und Saudi-Arabien. In dem Film ist die Regenbogenfahne zu sehen.
Im Libanon sind die Reaktionen bitter-sarkastisch, angesichts der Situation des wirtschaftlich und finanziell am Abgrund stehenden Landes. The New Arab zitiert Karim Bitar, einen Politikwissenschafter an der Université Saint Joseph in Beirut: "Bigotte Kleriker aller Konfessionen" würden sich zusammenfinden, wenn es darum gehe, den Menschen zu diktieren, was sie kulturell konsumieren dürften.
Trojanisches Pferd
Am Film Barbie stört die Reaktionäre weltweit nicht die Puppe an sich, sondern der Umstand, dass sie selbst die ihr als Spielzeug zugedachte Rolle als lächerlich erkennt. Die Barbie-Puppe galt antiwestlichen Regimen, etwa ganz stark jenem im Iran, aber immer schon als eine Art trojanisches Pferd, in dessen Inneren sich der westliche Kulturimperialismus verberge. Im Mehrjahresabstand gibt es im Iran Verbotskampagnen, bei denen Spielzeuggeschäfte ins Visier der Behörden geraten. An der Frauenkleidung trägt das iranische Regime heute mehr denn je seinen Kulturkampf aus. Das bezahlen Frauen, die sich wehren, sogar mit dem Leben, wie der Fall Mahsa Amini vor fast einem Jahr gezeigt hat.
Auf Plastikpuppen wird aber auch in islamisch geprägten Mädchenzimmern nicht verzichtet, schon vor Jahren kamen die ersten kulturell angepassten Modelle heraus, "Fulla" etwa, die – kommerziell nicht sehr erfolgreiche – "Sara" im Iran oder die "Hijarbies" (von Hijab, Kopftuch) einer nigerianischen Künstlerin. 2017 stieg auch der Barbie-Produzent Mattel darauf ein und modellierte eine Puppe nach der US-Fechterin Ibtihaj Muhammad, die einen Hijab trägt. Schreibt Gudrun Harrer in DER STANDARD.
11.8.2023 - Tag der religiösen Entrüstung
Ausgerechnet den libanesische Kulturminister Mohammed al-Mortada zu zitieren, dient Frau Gudrun Harrer vom STANDARD wohl als Rechtfertigung für diesen vernachlässigbaren Sommerloch-Artikel. Denn Mohammed al-Mortada aus dem «Staat» Libanon, den man inzwischen ohne Gewissensbisse als «failed State» bezeichnen kann, dürfte derzeit wohl schwerwiegendere Probleme haben als eine lächerliche Plastikpuppe.
Dass es unter Musliminnen und Muslimen stets genügend Hardcore-Gläubige gibt, die sich unter Berufung auf das «Heilige Buch», genannt der Koran, wegen jeder Banalität in einen Entrüstungsmodus steigern, ist eine bekannte Tatsache, die eigentlich nicht mehr erwähnt werden müsste. Sommerloch hin oder her.
Erwähnenswert wäre allerdings, dass Rechtskonservative* und SektiererInnen aus den USA, der Sektennation Nummer Eins auf unserem Erdball, zum Boykott des Barbie-Films aufrufen. Angeblich wegen dem «woken» Inhalt des Films, was letztendlich auch nichts anderes als sektiererischer, religiöser Unsinn ist, der dem islamischen Unsinn in nichts nachsteht.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
China erlaubt wieder Gruppenreisen nach Österreich
Ein Artikel von heute im STANDARD, den man nicht gelesen haben muss, der aber mitten im Sommerloch immerhin zum Schmunzeln anregt.
10.8.2023 - Tag der Freudschen Versprecher
So kommt es halt, wenn man das Lektorat aus Kostengründen nach Slowenien oder in den Kosovo auslagert: Da wird aus einem Reiseveranstalter schnell mal ein Reisveranstalter und aus dem angeblichen «Qualitätsjournalismus» ein Leckerbissen für alle Fans von Sigmund Freud.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Warum China in die Deflation gerutscht ist
Erstmals sind in China die Verbraucherpreise gefallen. Jetzt hat Peking die Wahl zwischen Pest und Cholera. Geht es gegen die Deflation vor, bekommt es etwas anderes, das es nicht will: neue Schulden.
Die Chinesen werden reicher. Das wurden sie nicht nur statistisch in den vergangenen drei Jahrzehnten, nein, ihre Kaufkraft hat sich in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent erhöht. Wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte, sind die Verbraucherpreise gefallen.
Anders als die allermeisten westlichen Volkswirtschaften kämpft China aktuell nicht mit einer Inflation, sondern mit dem Gegenteil: der Deflation. Diese hat zwar für die Verbraucher und Sparer den angenehmen Effekt, dass alles billiger wird. Für Ökonomen aber ist die Deflation ein Schreckgespenst. Gemäß der reinen Lehre führen fallende Preise dazu, dass Verbraucher Konsumentscheidungen aufschieben – in der Hoffnung, dass die Preise noch weiter sinken. In der Folge wird weniger gekauft, weswegen die Unternehmen weniger produzieren, eventuell Leute entlassen und so eine gesamte Volkswirtschaft in die Rezession rutscht.
Ein strukturelles Problem
Und tatsächlich hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt aktuell ein strukturelles Problem. Der Immobilienkonzern Country Garden wollte eigentlich am vergangenen Montag neues Geld an der Börse in Hongkong besorgen. 300 Millionen US-Dollar sollten durch die Ausgabe neuer Aktien herangeschafft werden. Blöd nur, dass am selben Tag die 100 größten Immobilienunternehmen des Landes neue Zahlen veröffentlichten: Die Verkäufe neuer Wohnungen waren um ein Drittel gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Country Garden verzichtete zunächst auf die Ausgabe neuer Aktien – die Kurse nämlich rasselten wegen der schlechten Nachrichten in den Keller.
Die aktuelle wirtschaftliche Misere Chinas ist untrennbar mit der Situation auf dem Immobilienmarkt verwoben. Mindestens 30 Prozent der Wirtschaftsleistung macht der Sektor aus. Nirgendwo sonst auf der Welt entwickelte sich die Urbanisierung in solch einer Rasanz. Rund eine halbe Milliarde Chinesen zog in den vergangenen 30 Jahren vom Land in die Stadt.
Hinzu kommt: Chinesen bleibt kaum eine andere Anlagemöglichkeit als eine Immobilie. Der Aktienmarkt gilt als riskante Zockerbude, die staatlichen Renten sind niedrig, und Kapitalverkehrskontrollen verhindern, dass das Geld im Ausland angelegt wird. Also setzte jeder, der zu etwas Geld gekommen war, auf eine eigene Wohnung, vielleicht auch zwei oder drei. Rund 30 Jahre lang stiegen die Preise ja auch jedes Jahr kräftig.
Durch die scheinbare Garantie auf Wertsteigerung aber begann sich die Branche immer schneller zu drehen: Immobilienunternehmen wie Evergrande nahmen immer mehr Schulden auf, um fachfremde Investitionen wie in Fußballclubs zu tätigen. Die Verschuldung nahm immense Formen an: Während der chinesische Staat, anders als viele westliche Regierungen, nur mit knapp 50 Prozent der Wirtschaftsleistung verschuldet ist, liegt das Verhältnis bei den Unternehmensschulden bei 160 Prozent.
"Unmöglich, Schulden zu ignorieren"
Dies hatte zwar jahrelang für gute Wachstumszahlen gesorgt, "aber irgendwann wurde es unmöglich, die Schulden zu ignorieren", so der Ökonom Michael Pettis am Mittwoch auf Twitter. Die Regierung entschloss sich vor knapp zwei Jahren, diesen Berg abzubauen. Das bedeutet: eine sich verlangsamende Wirtschaft, mehr Arbeitslose, fallende Preise – ein klassisches Deflationsszenario, das viele Ökonomen so fürchten.
Hinzu kommen geopolitische Spannungen und die Covid-Politik der vergangenen Jahre. Die Lockdowns und Ausgangssperren führten dazu, dass zahlreiche Restaurants und kleinere Geschäfte aufgeben mussten. Der Servicesektor brach ein.
De-Coupling und De-Risking
Das von den USA angestoßene "De-Coupling" und das von der EU in abgeschwächter Form aufgenommene "De-Risking" haben außerdem dazu geführt, dass die Direktinvestitionen in China regelrecht eingebrochen sind. Wurden trotz Zero-Covid-Politik von 2019 bis 2022 zwischen 60 und 100 Milliarden US-Dollar pro Quartal in China investiert, waren es im zweiten Quartal dieses Jahres gerade einmal fünf Milliarden.
Möglich, dass der Tiefpunkt schon erreicht ist. "Ich vermute, dass Peking für den Rest des Jahres alles tun wird, um die Wirtschaftsaktivität anzukurbeln", so Ökonom Pettis. Das Problem ist nur: Jedes Konjunkturpaket würde wiederum die Schuldenquote erhöhen – also genau das, was Peking eigentlich vermeiden möchte. Schreibt Philipp Mattheis aus Peking im DER STANDARD.
9.8.2023 - Tag der reinen Leere
So richtig stimmig ist dieser Artikel nun wirklich nicht. Schon die dem Clickbaiting geschuldete Headline lässt aufhorchen. Ist China denn tatsächlich in die Deflation «gerutscht»? Vermutlich würden sich Millionen von Menschen in den von der derzeit – teilweise zweistelligen – Inflation geplagten Ländern der westlichen Wertegemeinschaft über die chinesischen Zustände die Hände reiben.
Ob man bei einer Minus-Inflation von 0,3 Prozent überhaupt schon von einer Deflation sprechen kann sei dahingestellt. Dauernd fallende Preise in einer Volkswirtschaft lösen irgendwann eine Deflation aus. Nach einem einzigen Quartal aber bereits den Teufel an die Wand oder meinetwegen an die chinesische Mauer zu malen, ist denn doch etwas zu verfrüht. Zumal China in der Vergangenheit auch die Inflation stets erfolgreich gemanagt hat. Das autoritäre Staatsmodell Chinas ist möglicherweise daran nicht ganz unschuldig.
Ausserdem sei die Frage an den Autor des Artikels erlaubt, ob die «reine Lehre» aus dem letzten Jahrhundert wirklich noch aussagekräftig ist. Um welche «reine Lehre» handelt es sich überhaupt? Diejenige der Wall Street, der united Bankster oder der brachial neoliberalen Wirtschaftsprofessoren der HSG & Co.?
Auf die «reine Lehre» wird normalerweise nur in den heiligen Büchern der monotheistischen Religionen hingewiesen. Deswegen sollten wir diesem Begriff skeptisch gegenübertreten. Vor allem wenn er im Zusammenhang mit einer Volkswirtschaft wie derjenigen der asiatischen Supermacht verwendet wird.
Dass China mit riesigen Problemen in der Bauwirtschaft / Immobilienbranche konfrontiert ist, wissen wir nun seit mehr als einem Jahr. Entsprechend wurde der Untergang der chinesischen Immobilien-Giganten über Monate hinweg atemlos von den alleswissenden «Experten der reinen Leere» querbeet durch alle Medien hindurch prophezeit. Eingetroffen ist er bis heute nicht. Und sollte er doch noch eintreffen, geht davon weder China noch die Welt unter. Die Erde dreht sich ja schliesslich auch nach dem Credit Suisse-Crash weiter.
PS: Hier ein Artikel aus der TAZ, der eine etwas andere Sicht der Dinge beschreibt: Wirtschaftskrise in China: Das Ende des Wunderlands der Wirtschaft
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Das pralle Leben im Mittelalter verständlich und launig erzählt
Der Schriftsteller Gunter Haug grub, eingeladen von Das Bricklebrit und der Ortsbücherei, den begeisterten Zuhörern einen „Tunnel ins Mittelalter“.
Von Rittern, Bauern und Gespenstern“ erzählte Gunter Haug, ehemaliger Fernsehjournalist, studierter Historiker und Landeskundler und heute erfolgreicher Schriftsteller, am Freitagabend auf Einladung von Das Bricklebrit – Mundart-, Lieder- und Geschichtenhaus Bricklebrit und der Ortsbücherei im Erligheimer Bürgerhaus. Dem Verein Das Bricklebrit ist Haug durchaus verbunden, hat er doch vor sechs Jahren das Kulturprojekt, damals noch in Walheim, mit aus der Taufe gehoben: Er hielt den noch in lebhafter Erinnerung gebliebenen Eröffnungsvortrag.
Für heutige Leser verständlich
Basis seiner „Geschichten aus dem prallen Leben im Mittelalter“ ist die Zimmersche Chronik, verfasst um 1516 und mit 1600 Seiten eines der bedeutendsten Geschichtswerke des ausgehenden Mittelalters. In zwei Büchern - „Von Rittern, Bauern und Gespenstern“ und „Die Welt ist die Welt“ – hat er die besten und drolligsten Geschichten sprachlich etwas geglättet und für die heutigen Leser verstehbar neu herausgegeben. Allerdings schon vor 25 Jahren. Wer die Geschichten selbst lesen will, tut sich etwas schwer, denn beide Bände sind inzwischen vergriffen und nur mit Glück oder antiquarisch erhältlich.
An Derbheit kaum zu übertreffen
An Derbheit lassen die Geschichten nichts zu wünschen übrig. Man fühlt sich an Boccaccios Decamerone erinnert, nur eben auf schwäbisch, denn die Zimmersche Chronik beschäftigt sich hauptsächlich mit Oberschwaben und dem Bodenseeraum.
Wie in der Geschichte vom „Furzer von Buchhorn“. So hieß Friedrichshafen, bevor es vor rund 200 Jahren an Württemberg und dessen erstem König Friedrich – bekannt als der Dicke Friedrich – geriet. In der Geschichte vom Furzer spielt aber ein anderer Friedrich eine Rolle, nämlich Kaiser Friedrich III., der von 1440 bis 1493 regierte. Auf einer Inspektionsreise kam er auch in die damalige Freie Reichsstadt Buchhorn. Die Nervosität des Bürgermeisters der Stadt ob des hohen Besuches entlud sich in einem für den Kaiser vernehmbaren Darmwind, vulgo Furz, der den Kaiser amüsierte.
Monate später, als die Reichsstädte in Köln wieder einmal beim Kaiser um die Verlängerung ihrer Privilegien anstanden, erinnerte sich der Kaiser an die Episode und fragte nach dem „Furzer von Buchhorn“ und ließ den überraschten Schultes zu sich führen. Indes, der „tapf‘re Schwabe forcht sich nit“ und der hohe Herr erneuerte der völlig unbedeutenden Stadt Buchhorn vor allen anderen ihre Rechte und Privilegien. Wie sagte doch schon Martin Luther: Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz.
Geistlicher am Glockenseil
Deutlich deftiger geht es in der Geschichte von der Wetterglocke zu. Ein hoher Geistlicher übernachtet in einem Kloster voller junger Nonnen. Als mitten in der Nacht ein schweres Gewitter aufzieht, läutet er im Nachthemd die Wetterglocke, weil die eigentlich dafür zuständige ältere Nonne zu schwach ist. Ungeübt im Umgang mit dem Glockenseil, rutscht ihm beim Läuten sein Nachthemd nach oben, so dass die inzwischen herbeigelaufenen jungen Nonnen im Kerzenlicht „sein Geschirr und Geschell wohl sehen“ können, wie die Chronik vermeldet.
Noch einen? Ein Apotheker hatte für einen Kunden ein Aphrodisiakum und für einen anderen ein Abführmittel zu mischen. Bei der Auslieferung verwechselt der Gehilfe jedoch die beiden Fläschchen. Wie der Mann mit der Verstopfung auf die unerwartete Liebeshilfe reagierte, erwähnt die Chronik nur am Rand.
Dass der liebeshungrige andere Kunde seine sorgfältig vorbereitete Liebesnacht weitestgehend auf dem „geheimen Ort“ verbringt und zu guter Letzt die Braut und ihren Schmuck auch noch versaut, wird hingegen genüsslich ausgewalzt.
Den geistlichen Herren begegnet man in der Chronik auch noch bei fröhlichen Festgelagen und Schäferstündchen mit jungen Witwen, sehr zum Vergnügen der heutigen Leser und Zuhörer. Fazit von Gunter Haug: Die Zeiten ändern sich, die Menschen nicht. Schreibt die Bietigheimer Zeitung.
28.7.2023 - Tag des Furzers von Buchhorn
Wenn eine Vereins-Website wie diejenige vom Artillerie-Verein Zofingen Monat für Monat um die 30'000 echte (wohlverstanden!) Besucher*innen generiert, gibt es dafür etliche Gründe. Einer davon ist die «Macht der Bilder» im Internet.
So präsentiert die politisch völlig unabhängige und Pay-Wall-freie Website vom Artillerie-Verein Zofingen seit vielen Jahren täglich ein «Bild zum Tag», die in tausenden von Bildern auf dem Internet zu finden sind und aus guten Gründen auch nicht gelöscht werden. Obschon selbsternannte «IT-Experten» dies immer wieder fordern.
Im oberwähnten Artikel der Bietigheimer Zeitung befasst sich der ehemalige Fernsehjournalist, studierte Historiker / Landeskundler und heute erfolgreiche Schriftsteller Gunter Haug mit dem «Furzer von Buchhorn», der auch im heutigen «Sommerbild zum Tag» mit einem Bild von unserem Hof-Fotograf Res Kaderli thematisiert wird.
Res führt uns auf seinen Ausflügen immer und immer wieder in spannende Gegenden, die viele von uns entweder kaum oder gar nicht kennen. Dabei legt er stets grossen Wert auf die Historie der besuchten Orte. Man nennt den Pensionist, der noch immer Stadtführungen für die Stadt Zofingen durchführt, nicht umsonst ein «wandelndes Lexikon».
Die Schmonzetten um den «Furzer von Buchhorn» oder den «Apotheker von Buchhorn», der versehentlich einem von Verstopfung Geplagten statt dem Abführmittel ein Aphrodisiakum aushändigte, sind zwar nicht weltbewegend, aber immerhin historisch gesicherte Überlieferungen, über die sich auch heute noch schmunzeln lässt. Die uns auch und vor allem in Zeiten wie diesen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Lieber Res, ich mache es kurz: Du bist nicht nur ein hervorragender Fotograf und Historiker, sondern auch in menschlicher Beziehung – frei nach den «Doors» – simply the best in the west. Das sage ich als Hysteriker vom Dienst, der schon wieder gierig auf Deine nächste Bilder-Serie wartet.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Wegbegleiter und Stars erinnern sich an Sinéad O'Connor
Die mit «Nothing Compares 2 U» weltbekannt gewordene irische Sängerin Sinéad O'Connor ist am Mittwoch überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben. Kurz nach ihrem Tod äusserten sich bekannte Wegbegleiterinnen- und Begleiter aus Musik und Politik.
Die irische Sängerin Sinéad O'Connor ist tot. «Nothing Compares 2 U», das traurige Liebeslied, das sie vor 33 Jahren berühmt machte, hatte einst der US-Musiker Prince (1958–2016) geschrieben. Die Ballade war auch in der Schweiz ein Nummer-eins-Hit, stand 1990 mehrere Wochen an der Spitze der Charts. O'Connor starb etwa 18 Monate nach ihrem damals 17 Jahre alten Sohn Shane. Sie hinterlässt drei Kinder.
Der irische Premierminister Leo Varadkar (44) würdigte O'Connor und sagte, ihre Musik «wurde auf der ganzen Welt geliebt und ihr Talent war unübertroffen und unvergleichlich». Der irische Präsident Michael D. Higgins (82) lobte O'Connors «Authentizität» sowie ihre «einzigartige Stimme». «Was Irland in einem so relativ jungen Alter verloren hat, ist einer unserer grössten und begabtesten Komponisten, Songwriter und Interpreten der letzten Jahrzehnte», erklärte der Politiker.
Auch Musikgrössen äussern sich
«Das ist so eine Tragödie. Was für ein Verlust. Ihr ganzes Leben lang wurde sie verfolgt. Was für ein Talent», twitterte die US-amerikanische Singer-Songwriterin Melissa Etheridge (62). Auch die britische Popsängerin Alison Moyet (62) zeigte sich auf Twitter betroffen: «Ich wollte oft mit ihr Kontakt aufnehmen, tat es aber nicht. Ich erinnere mich an ihren Start. Erstaunliche Präsenz. Eine Stimme, die Steine mit Gewalt und nach und nach knacken liess.»
Der kanadische Rockmusiker Bryan Adams (63) twitterte: «RIP Sinéad O'Connor, ich habe es geliebt, mit dir zusammenzuarbeiten, Fotos zu machen, gemeinsam Auftritte in Irland - und zu plaudern ...»
Ein bewegtes Leben
O'Connor war am 8. Dezember 1966 geboren worden. Ihre Mutter verunglückte bei einem Autounfall 1985 tödlich. Ihr warf sie vor, sie als Kind misshandelt zu haben. Mit kontroversen Auftritten und Aussagen erregte O'Connor immer wieder Aufmerksamkeit, sie zerriss etwa 1992 in der US-Show «Saturday Night Live» vor laufender Kamera ein Bild von Papst Johannes Paul II.(1920–2005) – als Protest gegen die Kindesmissbrauchsskandale der katholischen Kirche. Später sagte sie dazu laut «Irish Times»: «Es tut mir nicht leid, dass ich es getan habe. Es war grossartig. Aber es war sehr traumatisch. Es öffnete Tür und Tor, um mich wie eine verrückte Schlampe zu behandeln.» 2018 konvertierte sie zum Islam, trug auch Kopftuch. In den 1990ern hatte sie sich noch von einer katholischen Splittergruppe zu einer Priesterin weihen lassen.
Immer wieder gab es Berichte über Vertragsstreitigkeiten aus der Branche, mehrfach kündigte sie an, ihre Karriere beenden zu wollen. O'Connor sprach öfter über psychische Probleme. 2017 sagte sie in einem Video: «Psychische Krankheiten sind ein bisschen wie Drogen – sie kümmern sich nicht darum, wer du bist.» Schreibt Blick (bzw. SDA/las).
27.7.2023 - Tag der sterblichen Unsterblichkeit
Jetzt mal Hand aufs Herz: Würde derzeit nicht das mediale Sommerloch herrschen, wäre Sinéad O'Connors Tod nicht mehr als ein «Shortie» wert, wie man in der digitalen Neuzeit Kurznachrichten nennt.
Sinéad O'Connor hatte einen einzigen Welthit mit dem von Prince geschriebenen Song «Nothing Compares 2 U». Und dies vor 33 Jahren. Das wars denn aber auch schon. Sie blieb zwar stets im Gespräch, aber eher mit ihren teilweise – je nach Blickwinkel – etwas kruden Aktionen als mit ihrer Musik.
Den Vogel schoss heute Morgen früh auf SRF3 ein Musikexperte ab, der wortwörtlich folgende Weisheit über die gestern Verstorbene ins Mikrophon plapperte: «Mit dem Song «Nothing Compares 2 U» machte sich Sinéad O'Connor unsterblich.» Scheint irgendwie mit der Unsterblichkeit nicht wirklich geklappt zu haben.
Irgendwer bei SRF3 war mit diesem Satz, der für die Gilde der Comedians eine Steilvorlage darstellt, vermutlich nicht wirklich happy und so fehlte er denn auch eine halbe Stunde später beim zweiten Durchgang.
Da kann man der Verstorbenen wirklich nur noch wünschen: R.I.P Sinéad O'Connor.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Warum sich Wetter-Apps schon wieder geirrt haben
Die Verlässlichkeit von Wetter-Apps scheint weiterhin unzureichend zu sein. Die Frage, warum das so ist, darf und muss gestellt werden.
Um 15 Uhr sollten orkanartige Stürme über Wien fegen, hieß es in diversen Wetter-Apps Montagfrüh. Sagen wir so, es war nicht einmal ein Lüfterl zu spüren. Weder in Liesing, Penzing noch in Kagran. Nicht zum ersten Mal lagen die zahlreichen, digitalen Helferlein völlig daneben. Ärgerlich, wenn man einen Ausflug deshalb abgesagt hat oder solche Falschmeldungen das Leben auf andere Art schwieriger gemacht haben.
Aber woran liegt es, dass manche Apps meist falsch und andere Apps meist völlig falsch das Wetter prognostizieren? Hat es mit der Unberechenbarkeit des Klimawandels zu tun? Verstecken manche die richtigen Wetterdaten hinter einer Bezahlwand? Der STANDARD hat nachgefragt.
Südwestliche Höhenströmung
"Grundsätzlich war es gestern so, dass sehr viele Modelle sehr starken Wind bis hin zur Orkanstärke simuliert haben", erklärt die Meteorologin Kathrin Götzfried von Geosphere Austria dem STANDARD. Apps würden diese Prognosen aus den Modellen abgreifen und sie oft eins zu eins ausgeben. Ganz unberechtigt waren die gestrigen Warnungen jedoch nicht: "Man muss sagen, dass sehr viel Energie in der Atmosphäre feststellbar war", sagt Götzfried. Der Ostalpenraum befand sich im Vorfeld einer Kaltfront im Bereich einer südwestlichen Höhenströmung, mit der sehr viel feuchte und labil geschichtete Luft aus dem Mittelmeerraum gelenkt worden sei. "Die damit einhergehende Abkühlung macht sich heute schon bemerkbar", stellt die Meteorologin fest. Zusätzlich sei eine sehr hohe Windscherung – das heißt eine starke Änderung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung mit der Höhe – vorhanden gewesen.
Die vorhandene, hohe Energie in der Atmosphäre hätte sich an der Alpennordseite in Form einer Druckwelle äußern sollen, die mit starken Böen einhergeht. Zumindest haben das die Modelle nahegelegt. Warum es dann aber nicht so gekommen ist? Das liege daran, dass die energetische Entladung in Etappen ging, erläutert Götzfried. "Vielmehr kam es zu immer wieder auflebendem Wind und nur zu vereinzelt schweren Sturmböen in Gewitternähe. Außerdem hat sich der erwartete Druckgradient zwischen dem heißen Österreich im Osten und der deutlich kühleren Luft im Westen nicht so stark aufgebaut."
Natürlich ist die Irritation groß, wenn vor starken Unwettern gewarnt wird und diese dann ausbleiben. Allerdings ist es auch die Aufgabe von Wetterdiensten, in solchen Fällen – und bei Modellrechnungen wie jenen vom 24. Juli – das Signal zu geben, dass etwas passieren könnte. Hier neigt man eher zum Überwarnen. "Wenn die Situation dann allerdings glimpflicher verläuft, sollten wir froh sein, dass wir gut davongekommen sind", gibt Götzfried zu bedenken.
Die ausgegebenen Warnungen zeigen dabei auch ein Manko diverser Applikationen: "Man sieht hierbei einmal mehr die Schwächen von automatisierten Wetter-Apps", sagt sie. Erfahrene Meteorologinnen und Meteorologen können solche Situationen in der Regel sehr gut einschätzen, Nutzerinnen und Nutzer profitieren hier meist von einer deutlich besseren Prognose.
Fehlerhaft
Was aber sind die Gründe dafür, dass Wetter-Apps noch immer so ungenau sein können?
Zwar liefert die Wettervorhersage immer Stoff zum Schimpfen, aber im Großteil der Fälle gibt sie doch hilfreiche Orientierung. Da Wetterkonditionen extrem dynamisch und variabel sind, beschränkt sich der Vorhersagebereich auf einen Zeitraum von zehn bis 14 Tagen. Hier ist die Trefferquote durchgeführter Simulationen aber hoch: Handelt es sich um das Wetter der kommenden zwei bis drei Tage, liegt diese bei 90 Prozent, ab dem fünften Tag bei 80 Prozent. Für Modellrechnungen und Prognosen braucht die Meteorologie jedoch eine Unmenge an Daten.
Die Daten bilden die Grundlage für Vorhersagen; das ist bei allen Apps ähnlich. Wie aber die Vorhersage schließlich berechnet wird, hängt vom Rechenmodell ab. Dieses legt in der Regel ein 3D-Raster über die Erde. Jedes Quadrat des Gitternetzes entspricht einem Vorhersagegebiet. Ist das Raster eher grobmaschig, ist die Vorhersage ungenau. Je feiner das Gitter, desto genauer wird die Vorhersage.
Geht es um die Wettervorhersage, wird zuerst der Ist-Zustand betrachtet. Das geschieht über Punktdaten, also Werte von Messstationen, die lokale Gegebenheiten aufzeichnen. Diese werden um Satellitendaten, Radiosonden- und Radardaten ergänzt. Physikalische Modelle, die meist mehrmals täglich upgedatet werden, bilden sämtliche in der Atmosphäre ablaufenden Prozesse ab. Dieses Paket wird schließlich in mathematische Modelle eingespeist, die mögliche Entwicklungsszenarien errechnen.
Blick zum Himmel
Gewitter und regionale Schüttregen gehören laut Meteorologen zu den kleinräumigen Ereignissen, die ohnehin noch schwerer vorauszusehen sind. Sogar regionale Modelle, die ein engmaschigeres Netz zeichnen als ihre großen Brüder, sind zu grob, um Gewitterzellen treffsicher vorhersagen zu können. Im europäischen Vorhersagezentrum wird deshalb fieberhaft daran gearbeitet, dass man die Auflösung dieser Modelle noch weiter verfeinert, um auch lokalen Starkregen, wie erst am Montag prognostiziert, besser vorhersagen und lokal einschränken zu können.
Trotz wiederkehrender Ausreißer gelten meteorologische Modelle als die am weitesten entwickelten und mit der höchsten Trefferquote. Modellen aus der Medizin oder Wirtschaft sind sie teils weit überlegen. Komplette Fehlprognosen sind natürlich ärgerlich, sie passieren allerdings eher selten. Angesicht der fortschreitenden globalen Erwärmung stellt sich die Frage, ob diese auch Einfluss auf die Exaktheit des Wetterberichts hat. Fachleute winken hier jedoch ab.
Beim allgemeinen Wettergeschehen nimmt der Klimawandel wenig Einfluss auf die Genauigkeit der Vorhersagen, heißt es. "Wettermodelle liefern hier immer noch die gleichen guten Ergebnisse", erklärt Alexander Orlik, Klimatologe der Geosphere Austria, im STANDARD-Gespräch. Die punktuelle Vorhersage von Unwettern war jedoch immer schon schwierig und ist es nach wie vor. Tatsächlich gehört diese Art der Prognose zu den wohl komplexesten Aufgaben für die Meteorologie. Das Problem liegt darin, dass Unwetter teils sehr kleinräumig auftreten. "Wir können zwar sagen, dass ein hohes Gewitterpotenzial herrscht und mit starken Windböen und hohen Regenmengen zu rechnen ist", sagt Orlik. Wo diese genau auftreten werden, sei aber seit jeher schwer vorherzusagen gewesen. Bis heute hat sich daran nichts geändert.
Somit bleibt nur die Hoffnung, dass hier weiter geforscht wird. Die Expertinnen sind sich aber sicher, dass Wetterprognose immer auch eine Wahrscheinlichkeitsaussage bleiben wird. Der Blick zum Himmel scheint da also auch in den nächsten Jahren eine valide Alternative zu Wetter-Apps und anderen Prognosen zu sein. Schreibt DER STANDARD.
25.7.2023 - Tag der Kachelmänner
Der STANDARD-Artikel hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Habe ich mich noch während der Pandemie-Zeit und den damit verbundenen Lock-Downs über die präzisen Wettervorhersagen gewundert, irritiert mich jetzt das pure Gegenteil: Im Sommer 2023 sind die Wetter-Prognosen unzuverlässig wie kaum je zuvor. Und das nicht nur bei den Apps.
Auch meine (chinesische) Handy-Wetter-App dreht in letzter Zeit öfters völlig durch, wenn sie mir zum Beispiel mit simulierten Regentropfen-Tönen – ein bisschen Bling-Bling muss bei einem Chinesen-Handy schon sein – um 15.00 Uhr mitteilt, dass derzeit auf dem Gütsch starker Regen herrsche, während ich exakt um 15.00 Uhr bei herrlichem Sonnenschein auf der Terrasse vom Chateau Gütsch einen «Kafi Gräm» schlürfe, ohne dass auch nur ein einziger Regentropfen vom Himmel fällt. Der angesagte Regen fand an diesem Tag überhaupt nie statt.
Aber es ist ja nicht nur mein chinesischer Wetter-Konfuzius, der in letzter Zeit andauernd Wetterprognosen voraussagt, die man im Nachhinein ohne Wimpernzucken als Fake-News bezeichnen darf. Nein, auch die Wetter-Vorhersagen von seriösen Anbietern wie SRF oder Google-Wetter & Co. liegen oft so krass daneben, dass man sich langsam fragt, was mit den Wetterpropheten und Kachelmännern denn eigentlich los ist. Warten die alle auf die KI?
Machen wir es kurz: Ich habe auch keine Antwort auf all die Fragen rund um die Wettervorhersagen. Und vielleicht ist das auch gut so. Denn es kommt sowieso wie's kommt.
Oder wie Ray Charles, Frank Sinatra, Billie Holliday u.v.a. sangen: «Come rain or come shine, happy together, unhappy together».
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Yves Rossier: «Russland war nie ein einfaches Land, aber trotzdem attraktiv»
Westliche Unternehmen in Russland werden enteignet, viele Firmen haben sich aus dem russischen Markt zurückgezogen, einige sind geblieben. Yves Rossier, bis 2020 Schweizer Botschafter in Moskau, erklärt im Interview, was den russischen Markt so attraktiv machte für westliche Unternehmen, welche Risiken Geschäfte in Russland bergen, und weshalb die Zukunft für Russland düster aussieht.
SRF News: Weshalb war Russland attraktiv für westliche Unternehmen?
Yves Rossier: Russland hat immerhin 145 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Sehr gut ausgebildete Leute und keine Gewerkschaften, die diesen Namen verdienen. Die Löhne waren nicht sehr hoch. Deshalb war es natürlich sehr profitabel, in Russland zu investieren und zu arbeiten. Russland war nie ein einfaches Land, aber es hat sich gelohnt. Es gab darum auch seit dem Ende der Sowjetunion sehr viele gegenseitige Investitionen. Die russische Wirtschaft wurde stark in die Globalisierung integriert, in der Wertschöpfungskette.
Und seit dem Krieg?
Seit dem Krieg ist man natürlich dran, alle diese Bindungen abzuschneiden. Die russische Wirtschaft schneidet sich ab von all diesen gegenseitigen Investitionen. Ich glaube, das Problem war, dass wir eine ökonomische Konvergenz und eine politische Divergenz hatten. Russland hat sich ökonomisch Europa genähert, aber politisch hat es sich immer etwas weiter wegbewegt. Und an einem gewissen Punkt ging es nicht mehr, und dort befinden wir uns jetzt.
Was sind zurzeit die grössten Risiken für westliche Unternehmen in Russland?
Ein grosses Risiko für westliche Unternehmen ist vor allem das Image. Deshalb versuchen sie, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen. Das ist nicht einfach, weil sie dort viel investiert haben. Sie haben dort viele Leute, die für sie arbeiten. Was viele machen, ist, sie verkaufen das Russlandgeschäft für einen kleinen Preis, aber mit einem Rückkaufsrecht von fünf, sechs oder sieben Jahren.
Wie diese Unternehmen in der Zwischenzeit funktionieren werden, das ist die grosse Frage. Die Stadt Moskau hat zum Beispiel das Nissan-Renault-Werk gekauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Moskau in der Lage ist, Autos zu fabrizieren. Nein, diese Unternehmen ziehen sich zurück für eine gewisse Zeit und hoffen, dass sie in zehn Jahren zurückkommen können und man sich irgendwie wieder in einer normalen Situation befindet.
Kam die Invasion für Sie aus dem Nichts?
Im Nachhinein findet man sehr gute Erklärungen. Aber ich war erstaunt, weil ich der Ansicht war, es ist nicht machbar, ein Land wie die Ukraine zu besetzen und zu kontrollieren. Vor allem ein Land, das nicht Teil Russlands werden will. Und man sieht es ja, der Krieg dauert jetzt länger als ein Jahr, es sind sehr, sehr viele Leute gestorben auf beiden Seiten. Also dieser Krieg ist ein Albtraum für alle Beteiligten und für die Leute, die tagtäglich sterben. Und ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern
Sie kennen das Land sehr gut, was löst der Krieg bei Ihnen aus?
Es macht mich traurig. Für die Ukraine und für Russland. Und eigentlich mehr für Russland, denn ich glaube, nach diesem Krieg wird die Ukraine wieder auferstehen, mit der Unterstützung des Westens. Meine Sorge ist, dass ich sehe, wie Russland einfach wegrutscht, dass man alle Brücken abgebrochen hat. Und wohin kann Russland wegrutschen? Es gibt nichts. Deshalb sehe ich Russland in der Finsternis, das Russland, das ich mag und das ich liebe, und die Leute, die ich doch kenne und die ich besonders schätze. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Schreibt SRF.
Das Gespräch führte Camilla Herrmann
24.7.2023 - Tag des Gegenteils vom Konjunktiv
Ein nicht nur spannendes sondern auch aussagekräftiges Interview, das SRF mit Yves Rossier führte, dem ehemaligen Schweizer Botschafter in Russland. Hebt sich wohltuend ab vom alltäglichen Konjunktiv-Müll der selbsternannten Russland-Experten in den medialen Live-Ticker-Formaten.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Suche nach Löwin in Berlin geht mit Drohnen und Wärmebildkameras weiter
Die ausgebüxte Löwin macht nach offiziellen Angaben weiter ein Gebiet in Kleinmachnow bei Berlin unsicher. Bislang konnte das Tier nicht betäubt oder eingefangen werden. Zur Herkunft der Löwin ist laut Polizei weiter nichts bekannt. Schreibt DER STANDARD.
21.7.2023 - Tag der Sommerloch-Krokodile
Ich lehne mich jetzt vielleicht etwas arg aus dem Fenster, aber ich werde die Vermutung nicht los, dass es sich bei der Berliner Löwin um eine gezielte Fake-Meldung handelt. Sommerloch-News at its best.
Erinnern wir uns an die Sommerloch-Krokodile der vergangenen Jahre, die allein die Schweiz (Hallwilersee zum Beispiel) in Hysterie versetzten und sich im Nachhinein stets als Scherze entpuppten. Ein entsprechendes Fake-Video wie das der Berliner Löwin ist heutzutage ohne grosse Mühe im Netz zu finden. Oder selbst zu produzieren.
Sollte ich mich geirrt haben, wünsche ich der Löwin noch ein paar feine und fette Wildschwein-Mahlzeiten.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Schweizer Luftwaffe im Löscheinsatz im Wallis – doch Air Zermatt findet das gar nicht gut
Die Schweizer Luftwaffe unterstützt die Walliser Behörden beim Löscheinsatz in Bitsch (VS).
Seit dem späten Montagnachmittag brennt ein Waldstück oberhalb der Walliser Gemeinde Bitsch und Riederalp. Aufgrund einer Anfrage des Kantons Wallis unterstützt die Armee die Brandbekämpfung seit dem 17.07.2023 mit einem Super Puma Helikopter der Luftwaffe. Zwei weitere Helikopter halten sich am 18.07.2023 für den Einsatz bereit. Die Koordination der Löschflüge erfolgt durch die zivilen Behörden. Schreibt das VBS.
Air Zermatt droht mit Abzug ihrer Helis
Der riesige Waldbrand in Bitsch VS ist verheerend: Mit Helis versuchen die Rettungskräfte, das Feuer so schnell wie möglich zu löschen. Dazu hat der Kanton auch die Schweizer Armee um Hilfe gebeten. Die schickte zwei Super Pumas.
Die Air Zermatt ist mit fünf Helis im Einsatz, sieben Helikopter kreisen fast unablässig über Bitsch und dem Aletschwald. Jetzt berichtet der «Walliser Bote»: Die Air Zermatt ist gegen den Einsatz der Armee!
Armee-Einsatz erst, wenn zivile Mittel erschöpft sind
Deren Verwaltungsratspräsident, Philipp Perren, hat laut der Zeitung eine brisante E-Mail verfasst und am Dienstagmittag an diverse Verantwortliche von privaten Helifirmen, aber auch an Kader von Luftwaffe und Armee verschickt. Darin pocht er auf die Tatsache, dass der Kanton die Armee nur dann aufbieten dürfe, wenn die zivilen Mittel nicht ausreichen.
Perren schreibt laut dem «Walliser Boten», dass dies überhaupt nicht der Fall sei. «Nun wird die Armee angefordert, weil diese gratis ist.» Dies entspreche «natürlich nicht dem Subsidiaritätsprinzip, wonach die Armee nur dann zum Einsatz kommen darf, wenn die zivilen Mittel nicht ausreichen». Perren fragt gegenüber der Zeitung: «Wie weit soll und darf sich die Armee einbringen?» Neben der Air Zermatt beteiligen sich die Lions Air Group und die Firma Rotex an den Löscharbeiten.
Air Zermatt droht mit Heli-Abzug
Perren droht nun sogar mit Abzug der Helis, wenn die Armee noch weitere schicke! Der Air Zermatt und den anderen privaten Helifirmen gehe es ums Geld, schreibt der «Walliser Bote»: Denn der Einsatz für die privaten Löschflüge könne später in Rechnung gestellt werden.
Als im Jahr 2011 bei Visp der Wald in ähnlich grossen Dimensionen brannte, beliefen sich die Kosten für die Löschflüge auf rund 400'000 Franken. Die Pressestellen von VBS und Armee wollten sich gegenüber der Zeitung zum Zwist nicht äussern. Ein Sprecher sagt: «Grundsätzlich ist die Armee immer da, wenn sie gebraucht wird.» Schreibt Blick.
(Quellen: VBS / Blick)
19.7.2023 - Tag der geldgierigen Air Zermatt
Nein, Sie sind kein Schelm sondern ein Realist, wenn Sie das Naheliegendste denken: 400'000 Franken sind viel Geld. Sehr viel Geld sogar für eine mittelprächtige Helikopter-Gesellschaft. Da knallen die Champagner-Korken und es siegt logischerweise die verlockende Aussicht auf den kommenden Jahresabschluss der Air Zermatt von VRP Dr. Dr. Perren gegen Vernunft, Ethik und Moral (ja, er hat zwei Doktortitel, einen davon honoris causa). Wir Lateiner sind uns bewusst, dass honoris causa selbst bei den römischen Eliten nichts anderes als eine Floskel war.
Irgendwie im Lande des abartigen Neoliberalismus, der die Schweiz seit ein paar Jahrzehnten immer mehr und mehr spaltet und wann immer es ihm passt in Geiselhaft nimmt, fast schon verständlich. Da wird auch bei einer Tragödie, die ein Waldbrand für Natur und Gesellschaft nun einmal darstellt, der Staat bis zum geht nicht mehr abgezockt. Egal, ob es sich nun bei den Zockern um eine Airline, eine Helikopter-Gesellschaft oder eine global tätige Schweizer Grossbank handelt.
Alles, was Air Zermatt in ihrer heutigen Medienmitteilung daherschwurbelt, ist ein billiger Versuch, den wahren Grund, nämlich die Geldgier, irgendwie mit hanebüchenen Argumenten doch noch unter den Tisch zu wischen. Schwamm drüber. Sowas vergiss man speziell im Kanton Wallis sowieso recht schnell.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube

Illegale Entsorgung an der Dammstrasse in Luzern
Illegale Entsorgung an der Dammstrasse in Luzern. Foto AVZ
Statt Überwachungskamera gegen kriminelle Müllentsorgung setzt die Stadt Luzern einmal mehr auf eine «Sensibilisierungskampagne»
An der Entsorgungsstelle vis-à-vis vom Dammgärtli wird seit Jahren viel und illegal Abfall entsorgt. Jetzt lanciert die Stadt zusammen mit Menschen aus dem Quartier ein Aufwertungsprojekt: Auf einer rekordverdächtigen Länge von rund 50 Metern entsteht ein kreatives, buntes Riesenwandbild. Dieses soll nicht nur die illegale Entsorgung eindämmen, sondern den ganzen Platz schöner erscheinen lassen und das Quartier erfreuen.
Gegenüber dem Dammgärtli-Spielplatz, direkt unterhalb der hohen grauen Stützmauer der SBB-Gleise, gibt es eine Separatsammelstelle von Real. Glas, Büchsen, Batterien und Textilien können dort beim Parkplatz entsorgt werden. Leider wird der Ort seit Jahren auch für die illegale Entsorgung von Abfall jeglicher Art missbraucht – auch von Leuten, die nicht im Quartier wohnen. Wöchentlich muss das Strasseninspektorat grössere Mengen von illegal entsorgtem Sperrgut und Kehricht einsammeln und von Hand separieren.
Auch fürs betroffene Quartier Basel-, Bernstrasse ist das ein Ärgernis. Denn die Abfallberge unterlaufen die seit Jahren unternommenen Bemühungen des Quartiers und der Stadt, vom einstigen Schmuddelimage wegzukommen. Verschiedene Versuche der Stadt Luzern, die illegale Entsorgung zu reduzieren, verliefen unbefriedigend. Deshalb wird der Platz nun zusammen mit dem Quartier künstlerisch aufgewertet.
Auf einer Länge von rund 50 Metern wird die 3,5 Meter hohe Betonmauer von Künstlern und Quartierbewohnenden bemalt. Die SBB als Eigentümerin der Stützmauer hat die Genehmigung erteilt. Das neue propere Erscheinungsbild soll signalisieren, dass dies kein Areal mehr ist, das man einfach mit Abfall entstellen kann. Zudem wertet das Wandbild den von Zug- und Autolärm stark geprägten Ort künstlerisch auf. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Quartier wird sichergestellt, dass das Projekt von den Menschen, die dort leben, mitgetragen wird.
Mitte Juli 2023 beginnen die Vorbereitungsarbeiten. Gemalt wird das wohl längste Wandbild der Schweiz bis Mitte August 2023. Der Abschluss soll am 18. August 2023 mit einer kleinen Feier im Quartier gewürdigt werden.
Die Idee zu diesem Projekt entstand im Strasseninspektorat der Stadt, zusammen mit der Quartierarbeit und dem Verein BaBeL (Basel-, Bernstrasse Luzern). Für die Gestaltung und Realisierung konnte der vor Ort beheimatete Verein «Seed of Change» gewonnen werden. Dieser Verein engagiert sich mit viel Herzblut für eine Aufwertung des Quartiers. 2021 hat er deshalb den Anerkennungspreis Quartierleben der Stadt erhalten (siehe Mitteilung vom 27. Oktober 2021). Für die anspruchsvolle Umsetzung – ein Wandbild dieser Grösse erfordert ein hohes Mass an Erfahrung – wurde der Verein «Cup of Color» engagiert. «Cup of Color» hat weltweit Erfahrungen mit solchen grossflächigen Community-Art-Projekten.
Gemeinsam ist ein sehr farbiger, sehr positiv wirkender Entwurf entstanden, der als Gemeinschaftsprojekt umgesetzt wird. Auf der Mauer wird eine fröhliche Landschaft mit Pflanzen, Bäumen und Sträuchern entstehen und im Bild wird es Platz geben für die Botschaften der Leute aus dem Quartier. Die Botschaften orientieren sich an der Frage: Was würdest du niemals wegwerfen? Damit wird die Verbindung zum Abfall- und Entsorgungsthema geschaffen. Die Frage hilft zudem, mit den Menschen in Kontakt zu treten, Probleme zu erkennen und über mögliche Lösungsansätze zu sprechen. Quelle: Stadt Luzern
17.7.2023 - Tag der unsäglichen Sensibilisierungskampagnen der Stadt Luzern
Geht es in der Stadt Luzern um gesellschaftlich relevante Themen wie Müllhalden und illegale Müllentsorgung oder öffentlicher Drogenkonsum, antwortet die Luzerner Stadtregierung mit grosser Verspätung meistens mit einer sündhaft teuren «Sensibilisierungskampagne». Nice zwar, aber lächerlicher Aktionismus ohne jede Wirkung, der noch nie ein akutes Problem in der Stadt Luzern positiv beeinflusst, geschweige denn gelöst hat. Der Werbeclaim der Stadt Luzern «Luzern glänzt» ist an komödianter Aussagekraft kaum zu überbieten.
Die von einigen Bewohnern*innen der Dammstrasse vorgeschlagene Überwachungskamera wurde von allem Anfang an verworfen. Angeblich nicht vereinbar mit dem Datenschutzgesetz. Da fragt man sich natürlich, weshalb über der «Junkie-Insel» bei der Bushaltestelle am Luzerner Bahnhof und im Bahnhof selbst Kameras erlaubt sind. Immerhin frequentieren pro Tag mehr als 40'000 Menschen den Luzerner Bahnhof. Ausserdem haben die Stimmbürger*innen der Stadt Luzern vor etlichen Jahren bei einer entsprechenden Wahl die Stadt Luzern ermächtigt, den öffentlichen Raum mit Kameras zu überwachen und zu schützen. Schon vergessen?
Der Stadtrat Luzern wird sich wieder mit der Floskel des «grössten Wandgemäldes im Universum» schmücken und wie immer selbstlobend auf die Schenkel klopfen. Selbst dann, wenn die «rekordverdächtige» Wand bei der Dammstrasse innert kürzester Zeit von Luzerns Sprayer-Elite bis zur Unkenntlichkeit übersprüht worden ist, was so sicher ist wie das Amen in der Kirche.
Dass die Probleme der Müllentsorgung damit nicht gelöst werden, geht in der Besoffenheit über die eigene Genialität beim Luzerner Stadtrat «as usual» unter. Denn längst ist klar, dass meistens nach Mitternacht, wenn alle Katzen grau sind und Metallicas «Sandman» unterwegs ist, die noblen Damen und Herren aus dem städtischen Umland mit den BMW- und Mercedes-Limousinnen/SUVs an der Entsorgungsstelle an der Dammstrasse vorfahren und ihren Hausrat ebenso schamlos wie gebührenfrei entsorgen. Das werden sie auch in Zukunft tun, dem «grössten Wandgemälde» zum Trotz.
Wieder einmal viel Lärm und vor allem viel Geld für nichts. Die Stadtluzerner Bevölkerung sollte sich vor den nächsten Stadtratswahlen fragen, ob sie wirklich die richtigen und fähigsten Leute in den Stadtrat gewählt hat. Einen Fehler sollte man nämlich nach Möglichkeit nie zweimal machen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Luzern glänzt
Moskau feuert Armeegeneral – weil er Führung kritisiert
Iwan Popow (48) benannte Probleme – und wurde dafür bestraft. Der russische General ging damit nun an die Öffentlichkeit.
Es ist ein Tondokument mit Sprengkraft: Iwan Popow (48), Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten 58. Armee, richtet sich mittels einer auf Telegram verbreiteten Audioaufnahme an seine Truppe.
Popow wendet sich immer wieder von Seufzern unterbrochen an seine «Gladiatoren», wie er seine Untergebenen nennt. «Ich werde ehrlich zu euch sein: Die Situation ist kompliziert.» Er habe gegenüber der Armeeführung nicht länger still bleiben können. «Ich habe an höchster Stelle offen und ehrlich darüber gesprochen.»
«Grösste Tragödie des modernen Kriegs»
Er habe auf Probleme und Schwierigkeiten bei der Logistik und beim Kampf selbst – seine Armee ist bei Saporischja stationiert – hingewiesen. «Ich habe die Aufmerksamkeit auf die grösste Tragödie des modernen Kriegs gelenkt – auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie.»
Auf Telegram berichten russische Kriegsblogger, dass Popow Generalstabschef Waleri Gerassimow angeboten habe, Putin höchstpersönlich mit Belegen über die Situation zu informieren. Dieser habe ihn als «Panikmacher» bezeichnet. Popow sagt in seiner Botschaft, das Verteidigungsministerium habe sich seiner sofort entledigt.
«Armee im schwersten Moment enthauptet»
Popow hält nun mit Kritik nicht zurück: «Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte konnten unsere Front nicht durchbrechen, aber von hinten hat uns der Oberbefehlshaber einen verräterischen Schlag versetzt, indem er die Armee im schwersten Moment der höchsten Anspannung enthauptet hat.»
Der Konflikt eskaliert am 10. Juli. Einen Tag später schlägt eine «Storm Shadow»-Rakete der Ukraine in einem Hotel in Berdiansk ein – und tötet General Oleg Tsokow (†51). Popow befand sich zum Zeitpunkt des Einschlags nicht mehr dort.
Unzufriedenheit bei den russischen Streitkräften
Die Entlassung und Kritik Popows fügt sich in das Bild, das Militärexperten von der russischen Armee gut 16 Monate nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine zeichnen. Demnach herrscht in grossen Teilen der russischen Streitkräfte Unzufriedenheit mit der eigenen Militärführung und deren geschönten Lageberichten.
Auch der am Ende missglückte Aufstand der lange für Moskau kämpfenden Privatarmee Wagner richtete sich explizit gegen Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dem Söldnerchef Jewgeni Prigoschin Korruption und Unfähigkeit vorwarf. Schreibt BLICK.
13.7.2023 - Tag von Napoleon Bonaparte
Wie schon Napoleon Bonaparte treffend sagte: «Gott steht auf der Seite der besseren Artillerie».
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Das umstrittene Ende der Friedensmission in Somalia
Im Süden nichts Neues. Die extremistische Al-Shabab-Miliz überfällt in der somalischen Region Lower Shabelle Ende Mai ein Lager der afrikanischen Friedensmission Atmis und tötet 54 ugandische Soldaten. Wenige Tage später greifen die islamistischen Kämpfer einen Stützpunkt der somalischen Armee in der Region Galguduud an und bringen nach eigenen Angaben 149 Soldaten um.
Wieder ein paar Tage später stürmen die Al-Kaida-Verbündeten ein Lager äthiopischer Truppen in der Grenzstadt Doolow: Dort sollen mehr als 200 Soldaten aus dem Nachbarland getötet oder verwundet worden sein. Zwischendurch schlagen Al-Schabab-Kommandos auch mehrmals in der Hauptstadt Mogadischu zu. Einmal stürmen sie das Pearl Beach Hotel am Lido und nehmen mehrere Gäste als Geiseln. Ein andermal jagen sie das Fahrzeug eines hochrangigen Polizeibeamten in die Luft.
EU kürzt Gelder
Die Kette an Gewalttaten der "Jungs" (al Schabab auf Arabisch) ereignete sich innerhalb eines Monats, zwischen Ende Mai und Ende Juni. Zur selben Zeit muss die afrikanische Friedensmission Atmis um 2.000 Soldaten verkleinert werden, weil die Finanziers, allen voran die Europäische Union, ihre Zuwendungen kürzen. Bislang trug die EU fast 90 Prozent der Kosten für die jährlich 300 Millionen US-Dollar teure Mission. Ende des kommenden Jahres sollen die Zahlungen ganz eingestellt werden.
Die Aussicht, dass die bald 17-jährige Mission bald vollständig abgewickelt wird, treibt manchem Somalier den Angstschweiß auf die Stirn: "Der Plan ist unbedacht und überstürzt", schimpft der Vizepräsident der Jubaland-Region, Mohamud Sayid Aden, gegenüber dem Radiosender Voice of America. "Das wird genauso schiefgehen wie in Afghanistan", ist der ehemalige Vizechef des Geheimdienstes, Abdisalam Yusuf Guled, überzeugt.
Ginge es nach den Plänen der Atmis-Kommandeure, sähe die Lage in Somalia heute anders aus. Vergangenen August setzten die Friedenssoldaten mit dem ungewöhnlich kriegerischen Mandat gemeinsam mit somalischen Truppen zu einer Offensive an: Innerhalb weniger Monate befreiten sie große Teile des somalischen Hinterlandes aus der Hand der Extremisten.
Extremisten konnten sich neu formieren
Mehr als 3.000 Extremisten sollen getötet worden sein, darunter auch einer der Gründer der Miliz, Abdullahi Yare. In einer zweiten Phase der Offensive wollten die Alliierten "die Jungs" in diesem Jahr vollends ausschalten. Doch ihr Feldzug geriet ins Stocken – unter anderem, weil die Besetzung eines neuen Atmis-Kommandeurs lange umstritten war. Die Miliz hatte Zeit, sich neu zu organisieren und selbst wieder zum Angriff überzugehen.
Werde die Mission mit einer Verkleinerung geschwächt, drohten "Jahrzehnte menschlicher und materieller Opfer" zunichte gemacht zu werden, warnt der einstige Geheimdienstoffizier Abdullahi Ali Ma'ow. Mit Verlusten von mehr als 3.500 Soldaten in ihrer bald 17-jährigen Geschichte ist die Friedensmission die tödlichste der Weltgeschichte.
Bei der Entsendung der ersten ugandischen Truppen im Jänner 2007 kontrollierten die Islamisten noch fast das gesamte Land. Das Einflussgebiet der Übergangsregierung war auf wenige Straßenzüge in Mogadischu beschränkt. In jahrelangem Häuserkampf gelang es den zunächst knapp 8.000 ugandischen und burundischen Soldaten der damals noch Amisom genannten Mission unter Aufsicht der Afrikanischen Union (AU), die Extremisten aus der Hauptstadt zu vertreiben: Im Juli 2011 mussten sich "die Jungs" aus der einstigen "Perle am Indischen Ozean" verziehen.
Auch Nachbarn schickten Soldaten
Zug um Zug nahmen die Amisom-Soldaten auch die anderen Städte des Landes ein. Allerdings blieben große Teile der ländlichen Regionen unter der Kontrolle der Islamisten, die immer wieder zu blutigen Anschlägen in den Städten auftauchten. Nach und nach schlossen sich dem Kampf gegen die Extremisten auch die Nachbarstaaten Kenia, Äthiopien und Dschibuti an, bis Amisoms Truppenstärke auf mehr als 20.000 Soldaten und 1.000 Polizisten angewachsen war.
Den Löwenanteil des Einsatzes bezahlte die EU, bislang insgesamt 2,4 Milliarden Euro. Schon seit Jahren drängen die Europäer auf eine schrittweise Abwicklung der Friedensmission, die im vergangenen Dezember mit dem Abzug von 2.000 Atmin-Soldaten beginnen sollte. Daraus wurde allerdings nichts – auch weil die beteiligten afrikanischen Regierungen für die Entsendung ihrer Soldaten bezahlt werden.
Die EU kürzte ihre Zuschüsse im Jahr 2022 bereits auf 140 Millionen Euro, bezahlt in diesem Jahr 85 Millionen und will im kommenden Jahr nur noch 33 Millionen zur Verfügung stellen. Angesichts ihres auf mehr als 50 Millionen Euro angewachsenen Schuldenbergs sah sich Atmis jetzt gezwungen, mit der Abwicklung zu beginnen: Im Juni wurden 2.000 Soldaten nach Hause geschickt, im September werden 3.000 weitere folgen.
Regierung für Ende der Mission
Somalias Regierung hat gegen ein Ende der Mission nichts einzuwenden – ihr war die Einschränkung ihrer Souveränität durch die ausländischen Hilfstruppen schon lange ein Dorn im Auge. Die von Atmis, europäischen und US-Ausbildern trainierte neue Armee des Landes werde mit den "Jungs" schon selber fertig, meint Ex-Geheimdienstchef Yasin Abdullahi Mohamud: "Es ist die richtige Zeit für die Abwicklung der Mission."
Sein Abschiedsgruß ist allerdings mit einem Vorbehalt verbunden: dass das von der Uno über Somalia verhängte Waffenembargo aufgehoben und die somalische Armee mit Finanzen aus dem Ausland augestattet wird. Also auch in dieser Hinsicht: Im Süden nichts Neues. Schreibt DER STANDARD.
12.7.2023 - Tag der Völkerwanderung
Wenn ich hurtigen Schenkels die Baselstrasse in Luzern frequentiere und auf Schritt und Tritt bei praller Hitze den vermummten Damen mit den Kinderwagen und den im Schlepptau folgenden Kinderpyramiden begegne, lässt mich das Gefühl nicht los, durch eine somalische Stadt zu wandern.
Man darf jetzt schon gespannt sein, wie sich diese Völkerwanderung erst in Zeiten der dritten Generation in der Schweiz auswirken wird. Frankreich mit seinen berüchtigten «Banlieue»-Ghettos und deren Bewohnern der dritten Generation – vorwiegend aus Afrika stammend – lässt grüssen.
Frei nah dem Song einer österreichischen Band: «Jemand muss dafür bezahlen!»
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
KI in der Politwerbung: Ein FDP-Plakat entzweit die Gemüter
Die FDP präsentiert ein Wahlplakat, das mithilfe von KI erschaffen wurde – und erntet dafür Kritik. Eine Einordnung.
Darum geht es: Die FDP hat ihre Kampagne für das Wahljahr lanciert. Darunter auch dieses Bild: Zu sehen sind Klimaaktivistinnen und -aktivisten, die sich auf einer Strasse festgeklebt haben. Im Hintergrund Autos – darunter eine Ambulanz – denen der Weg versperrt wird. Über dem Bild ist der Slogan zu lesen «Anpacken statt ankleben». Das Pikante: Das Sujet wurde mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Die Situation hat so also nie stattgefunden.
Das sind die Reaktionen: Vor allem das Blaulicht im Bild irritiert viele. Im Netz ist von «Fake News» die Rede. Adrian Michel, Wahlkampfleiter der FDP, zeigt sich überrascht über die negativen Reaktionen. «Bildmontagen sind bei Wahl- und Abstimmungsplakaten gang und gäbe. Wir adressieren mit dem Motiv stattfindende Blockade-Aktionen einer radikalen Gruppierung.»
Politanalyst Mark Balsiger kritisiert dieses Vorgehen jedoch: «Es ist Basiswissen, dass man sich nicht auf das politische Terrain des Gegners festkrallen sollte. Die meisten werden beim Bild als Erstes an Renovate Switzerland denken.» Die Reaktion des Bündnisses, das sich für thermische Sanierungen einsetzt, fällt denn auch süffisant aus: «Renovate Switzerland freut sich, dass die FDP die Klimakrise ernst nimmt.» Balthasar Glättli, Parteipräsident der Grünen, stört vor allem der politische Stil. «Statt Lösungen zu präsentieren, schlägt die FDP auf den politischen Gegner ein», sagt er gegenüber SRF.
Darum ist das Thema brisant: Peter G. Kirchschläger, Ethikprofessor an der Universität Luzern, kritisiert die «frei erfundene» Blockade einer Ambulanz und fügt hinzu: «Die Forschung zeigt, dass Fake News als Texte und insbesondere als Bilder viel länger bei Menschen wirken und hängenbleiben als echte News.» Ein weiterer Faktor: die Kostenfrage. Der Aufwand für einen nationalen Wahlkampf kann rasch mehrere Hunderttausend Franken betragen. Der Einsatz von KI könnte hier ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Balsiger schlägt in die gleiche Kerbe: «In kurzer Zeit lassen sich mit KI ausgezeichnete Bilder in guter Qualität generieren, die knifflige Arbeit mit Bildbearbeitungsprogrammen entfällt. Kaum jemand wird in der Lage sein, die Fakes zu enttarnen. Das ist enorm gefährlich.» Die US-Forscher Robert Chesney und Danielle Citron sprachen 2019 gar von einem «Lügenbonus», der entstehen könne. Politikerinnen und Politiker könnten sich aus der Verantwortung ziehen, indem sie die Schuld für problematische Aussagen auf die KI schieben.
So geht es weiter: Die Regulierung der politischen Werbung wird in der Schweiz den Kantonen überlassen. Es bestehen keine Institutionen, die nationale Kampagnen überprüfen würden. Auf dem Plakat der FDP ist ein kleiner Zusatztext angebracht, der den Einsatz von KI erkennbar macht. Doch den hat die Partei freiwillig platziert. Balthasar Glättli will darum einen Ethikkodex einführen für den Einsatz von KI in der politischen Kommunikation. Man stehe im Austausch mit den anderen Parteien, erklärt er gegenüber SRF.
Der Blick über die Schweiz hinaus: Das Thema gibt auch international zu reden. Im April haben die US-Republikaner einen TV-Spot lanciert, der mit KI-generierten Bildern gefüllt war. Darin zu sehen: dystopische Szenen, die das Land unter US-Präsident Joe Biden zeigen sollen. Die Demokraten haben daraufhin einen Gesetzesentwurf im Parlament präsentiert, der den Einsatz von KI im Politmarketing regulieren will. Schreibt SRF.
3.7.2023 - Tag pinkfarbigen FDP-Slogans
Dass die Wendehalspartei FDP selbst für ein Primitiv-Plakat künstliche Intelligenz (KI) beanspruchen muss, erstaunt nun nicht wirklich. Denn wem die natürliche Intelligenz fehlt, bleibt halt logischerweise nur noch die KI.
Sprang die Copy&Paste-Partei FDP 2019 vor den National- und Ständeratswahlen unter der unsäglichen Frau Gössi und ihrem ebenso unsäglichen wie unfähigen ex-Kioskverkäufer und Ständerat Damian «ich bin nicht schwul» Müller auf den Klimarettungszug der Grünen, obschon sämtliche Parlamentsmitglieder der FDP 2019 (nachweisbar) jedes Klimaschutzgesetz abgelehnt haben, versucht sie nun, für die Parlamentswahlen im kommenden Herbst die Parolen der SVP zu kopieren.
Das wird definitiv in die blauen Hosen gehen. Denn niemand braucht in der Schweiz eine als SVP light verkappte FDP. Eine abgehalfterte Partei der abartig neoliberalen Zunft, die nicht einmal die dämlichsten Brutalo-Plakate der SVP ohne KI toppen kann, macht sich nur noch lächerlich. Das Original wird der Kopie immer überlegen sein. Da helfen nicht einmal pinkfarbene Slogans weiter.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Immer mehr Kleinbrauereien müssen schliessen
Jahrelang gab es in der Schweiz einen Brauereien-Boom. Damit ist nun Schluss: 2022 mussten 100 Brauereien schliessen. Ein ehemaliger Bierbrauer über die Gründe.
Die Zahl der Brauereien in der Schweiz ist in den letzten Jahren explodiert. Während es 1990 noch 32 Brauereien gab, erreichte die Zahl 2021 mit 1278 Brauereien den Höhepunkt. Das zeigt die Brauereistatistik des Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG).
Doch mit diesem Boom ist jetzt Schluss: Erstmals nimmt die Zahl an Brauereien ab. 2022 sank die Zahl von 1278 auf 1179. Somit sind rund 100 Brauereien innerhalb eines Jahres verschwunden. Die meisten sind Kleinbrauereien. Dazu gehören beispielsweise die Soorser Bier AG im luzernischen Sursee, «Dark Wolf» in Dietikon im Kantons Zürich, «Blackwell Brewery» in Burgdorf im Kanton Bern oder die Brauerei Maihof aus der Stadt Luzern.
Produktionskosten schiessen in die Höhe
Bei vielen Brauereien sieht man das Problem bei den gestiegenen Energiekosten. So auch Christopher Lüke, ehemaliger Bierbrauer der Brauerei Maihof: «Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist alles teurer geworden.» Wasser-, Strom- und Gaspreise seien absurd in die Höhe geschossen. Auch die Rohstoffpreise und Transportkosten sind angestiegen.
Die Brauerei Maihof war eine kleine Brauerei. Das selbst gebraute Craft-Beer von Lüke gab es vier Lokalen in Luzern zu trinken. «Der Gewinn hat sich daher schon immer in Grenzen gehalten», sagt er. Die höheren Produktionskosten hätten ihn nun auf null gesetzt: «Ich konnte mir nicht mal selbst mehr einen Lohn auszahlen.»
Also entschied sich Lüke letzten Winter dazu, dicht zu machen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie er selbst sagt. Zum einen sei es schön gewesen, plötzlich so viel Zeit zu haben. Lüke ist eigentlich Architekt, das Bierbrauen war für ihn ein Nebenberuf: «Zu anderen ist es das schönste Gefühl, wenn die Leute in der Bar dein Bier trinken. Das hat mich immer besonders stolz gemacht.» Aufzuhören habe weh getan.
Hauptsächlich kleine Brauereien betroffen
Dass die Krise hauptsächlich kleine Brauereien betrifft, bestätigt Martin Uster. Er ist Präsident der freien Schweizer Brauereien, einem Verein, der Brauereien in der Schweiz unterstützt: «In unseren Reihen ist kein Mitglied von einem Konkurs betroffen.»
Uster betont, dass die hohe Brauereidichte im Kontrast zum vergleichsweise niedrigen Bierkonsum in der Schweiz steht. In Österreich und Deutschland trinkt man fast doppelt so viel Bier im Jahr wie in der Schweiz. «Es kann schwierig sein, in diesem Wettbewerbsumfeld in der Schweiz erfolgreich zu sein, insbesondere für kleinere Brauereien», sagt Uster.
Uster vermutet auch, dass der Fachkräftemangel eine Rolle spielen könnte – ähnlich wie in der Gastronomie: «Zudem werden jährlich in der ganzen Schweiz gerade einmal neun bis zwölf Lebensmitteltechnologen EFZ in Fachrichtung Bier ausgebildet. Dies ist leider sehr wenig.»
Aus seiner Sicht sollte man die Schliessungen jedoch nicht überbewerten. Es seien eher die ganz kleinen Betriebe, die Mühe bekunden würden, am Markt zu bestehen.
Pause statt Ende
Obwohl der eigene Ausstieg nicht einfach gewesen ist, sieht Lüke den Rückgang der Brauereien in der Schweiz positiv: «Es ist ein gesundes Schrumpfen.» Brauen sei wie Velo fahren oder schwimmen. Man verlerne es nicht. Lüke ist überzeugt: «Irgendwann kommen die Leute wieder. Vielleicht wird die Produktion ja auch wieder günstiger, das weiss man nicht.» Für Lüke ist es kein definitiver Abschied vom Brauen. Er sieht es mehr als Pause. Schreibt SRF.
3.7.2023 - Tag von Hopfen und Malz
Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Teuerung mögen mit ein Grund sein für die desolate Lage vieler Kleinbrauereien, die in den letzten Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der Teufel liegt im schweizerischen Marktumfeld.
Während der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol in der Schweiz insgesamt seit Jahren rückläufig ist, bleibt er bei Bier stabil: der Pro-Kopf-Konsum von Bier lag hierzulande, ersten Berechnungen des Schweizer Brauerei-Verbandes (SBV) zufolge, im Braujahr 2019/20 bei 52 Litern. In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Konsum von Bier bei 90 Litern, in Österreich bei 101,9 Litern.
Kleinbrauereien können mit den Dumping-Preisen der nationalen und globalen Grossbrauereien nicht mithalten. Meistens fehlt ihnen auch die finanzielle Potenz für Marketing und Werbung.
Während sich etliche bereits angeschlagene Klein-Bierbrauereien mit ihren Nischenprodukten während der Pandemie dank staatlichen Zuschüssen noch über Wasser halten konnten, ist jetzt die Zeit der Bereinigung angebrochen. Es wird nicht bei den 100 Brauereien bleiben, die 2022 schliessen mussten. Da werden noch einige erkennen, dass in ihrem Betrieb Hopfen und Malz verloren sind.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Das sagt Beatrice Egli zum Kuschel-Auftritt mit Silbereisen
Am Samstagabend schaute ein Millionenpublikum zu, wie Beatrice Egli und Florian Silbereisen in der Sendung «Schlagerbooom» die Liebe besangen. Dabei kamen sich die beiden ungewöhnlich nahe. Nun äussert sich Egli zum Kuschel-Auftritt.
Es war das grosse Highlight des «Schlagerbooom» am Samstagabend: Beatrice Egli (35) und Florian Silbereisen (41) stellten in der ARD-Sendung «Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich» zum ersten Mal vor einem Millionenpublikum ihr erstes Duett «Das wissen nur wir» vor.
Die beiden besingen darin die Liebesgerüchte, die immer wieder über die beiden kursieren. Passend dazu zeigten sich die zwei nah wie selten beieinander, zeitweise fehlten nur noch Zentimeter für einen Kuss. Auch geflirtet wurde, was das Zeug hält. «Hat man dir schon gesagt, dass ich ab und zu deinetwegen die Balance verliere?», neckte die Schwyzerin den TV-Mann. Blick hat bei Beatrice Egli nachgefragt, was wirklich zwischen dem TV-Mann und ihr läuft. Schreibt Blick.
3.7.2023 - Tag der infantilen Gesellschaft
Und das soll's dann schon gewesen sein mit dem infantilen Tratsch und Klatsch über das angebliche Turtelpaar? Nein! Denn nach der letzten Artikelzeile folgt ein Aufmacher von Blick: «Lies weiter mit Blick+ für CHF 9.90 pro Monat – jederzeit kündbar».
Die Boulevardkönigin von der Zürcher Dufourstrasse hat sich entschlossen, nun ebenfalls eine Pay Wall für «hochkarätige» Medienbeiträge einzuführen. Daran ist nichts auszusetzen. Immer noch besser als jährlich Millionen von Staats-Subventionen für den Unterhaltungsmüll «systemrelevanter» Medien zu verschleudern.
Allerdings frage ich mich, ob damit nicht langfristig das Ende von «Blick» eingeläutet wird. Denn wer dieses Blick+-Abo löst, muss wohl wirklich mit dem berühmten Klammerbeutel gepudert sein.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Ex-Kanzler Schröder nennt Prigoschin «lupenreinen Demokraten» – Aber wo ist Prigoschin?
Nach den Unruhen in Russland hat sich jetzt auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu Wort gemeldet. Er bezeichnete Jewgeni Prigoschin vorsorglich als «lupenreinen Demokraten».
«Prigoschin ist ein lupenreiner Demokrat», erklärte der SPD-Altkanzler am Rande einer Gala. «Ich bin mir sicher, dass Prigoschin Russland zu einer ordentlichen Demokratie machen will.»
Insofern mache Schröder sich angesichts des aktuellen Konflikts keine Sorgen. «Putin, der ja ebenfalls ein lupenreiner Demokrat ist, und Prigoschin werden das alles ganz sauber und demokratisch unter sich ausmachen.»
Ihm sei daher prinzipiell auch egal, wer von den beiden gewinne und ihm anschliessend einen hochdotierten Posten im Aufsichtsrat eines russischen Staatskonzerns anbiete. Satirebeitrag von DER POSTILLON (Hannover). (Anmerkung: Alt-Bundeskanzler Schröder wohnt seit Jahrzehnten in Hannover; deswegen dürfte DER POSTILLON eine spezielle Beziehung zu ihm haben.)
1.7.2023 - Tag des vermissten Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin
Satire kann auch der Artillerie-Verein Zofingen. Sogar in Wort und Bild. Mit dem Hinweis, dass Satire ab und zu schwer verdauliche Koste sein kann. Je nach Blickwinkel. Auf den es ja angeblich ankommen soll, denn «Wer heute noch nicht verrückt ist, ist einfach nicht informiert» wie der grossartige, österreichische Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur Gabriel Barylli zu sagen pflegt.
Aber nun zur Frage, die alle bewegt: Wo ist Prigoschin? Wo hält er sich auf? Natürlich unter lupenreinen, absolut neutralen Demokraten. Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin wurde gestern im Raum Freiburg gesichtet, wie nachstehende Aufnahme eindeutig zweideutig beweist. Dass sich Prigoschin bei den Herrschaften um eine Stelle als Koch beworben habe, ist allerdings ein Gerücht, das nicht verifiziert werden kann.
Happy Weekend.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube

Wo ist Prigoschin? Des Rätsels Lösung
Fotomontage Webmaster Artillerie-Verein Zofingen
Ekel-Zustände in Winterthur – Mitarbeiterin Ella S.* (21) packt aus: «In unserem Burger King sollte keiner essen»
Ranziges Frittieröl, abgelaufene Produkte und unhygienische Zustände: Burger-King-Mitarbeiterin Ella S.* (21) packt über die Ekel-Zustände in der Filiale Winterthur Untertor aus.
Ella S.* (21) macht sich Sorgen. Sorgen um ihre Kunden. Seit rund sechs Monaten sollen Ekel-Zustände im Burger King in der Winterthurer Altstadt herrschen. Zu Blick sagt die junge Frau: «Ich wünschte den Kunden einen guten Tag. Dabei befürchtete ich immer, dass, wenn die Kunden unsere Produkte essen, sie bald aufs WC rennen müssten.»
Sie arbeitete rund ein Jahr dort. Ihren Job mochte sie. Seit einem Wechsel in der Geschäftsführung soll es allerdings drunter und drüber gegangen sein in der Filiale Untertor. «Inzwischen schäme ich mich, den Leuten das Essen herausgegeben zu haben. Denn ich ging davon aus, dass es eigentlich nicht mehr gut war», sagt S. «Deshalb betete ich immer, dass die Kunden nicht zurückkommen, um sich zu beschweren.»
Falsch gelagerte Lebensmittel
Bilder - die teilweise während einer Woche im Februar und an einem Wochenende im Juni geschossen wurden - zeigen eine bedenkliche Situation in der Küche: Das Frittieröl ist ranzig und dunkel. Grosse Mengen an tiefgekühlten Fleisch-Patties liegen vor einem Feuergrill. Oben fehlen Mini-Pfännchen für die Burger, also liegen sie direkt auf den Grillschienen. Gebratenes Fleisch wird in Behältern bei Zimmertemperatur in der Küche auf einer Theke zwischengelagert. S. sagt: «Eigentlich war das Fleisch bereits übergart und stand herum. Wir mussten es den Kunden trotzdem weitergeben.»
Auf einem der Fotos, die Blick zugestellt wurden, ist zu sehen, wie sich gleich neben dem Fleisch mehrere Salat-Tüten stapeln, wobei der Salat eigentlich in Behälter abgefüllt und im Kühlschrank gelagert werden müsste. Auch abgelaufene Produkte sind in der Küche zu finden, so etwa der Schnittsalat und der Crumble-Mix für das Nutella-Glace.
Unhygienische Zustände im Store
In der Küche sieht es unhygienisch aus: Verschmutzte Maschinen, dreckige Oberflächen und verschmutzte Böden stechen ins Auge. Auch die Lobby lädt nicht gerade zum Essen ein: Überall liegt Abfall und ungebrauchte Ausstattung. Die Wände sind schmutzig. Auch das WC sollte dringend gereinigt werden.
Schuld an allem soll die neue Filialleitung sein. «Sie weiss nicht, wie man einen solchen Laden führt und hält die Abläufe nicht ein», sagt S. So sei es die Pflicht der Filialleiterin, die Anweisung zur Reinigung des Stores an den Schichtleiter weiterzugeben. Diese müsste die Aufgaben anschliessend an die Mitarbeiter verteilen. «Doch das passiert nicht. Deshalb der ganze Dreck, das ganze Chaos.»
So habe sie den Eindruck bekommen, dass möglichst hohe Umsätze bei möglichst geringen Abschreibern erzielt hätten werden sollen. «Dafür übte man maximalen Druck auf uns Mitarbeiter aus», sagt S. «Man behandelte uns nicht fair und sprach sehr herablassend mit uns.» Jeder, der die Zustände im Store kritisierte, wurde entlassen, so S: «Mit mir sind es noch mindestens fünf andere, denen in den letzten sechs Monaten gekündigt worden ist.»
Zahlreiche Google-Rezensionen unterstreichen die getätigten Aussagen. So heisst es etwa: «Es roch nach Hölle dort drin. Die Burger waren trocken und ungeniessbar» und «Essen war nicht wirklich gut – im Vergleich zu anderen Burger Kings» oder «Im Restaurant herrscht Unordnung. Bezeichnenderweise ist dies erst seit circa vier Monaten so. Also seit Herbst 2022.»
«Fotos aus dem Zusammenhang gerissen»
Blick hat Burger King mit den Fotos aus der Küche der Filiale in Winterthur konfrontiert. In einer Stellungnahme streiten die Medienverantwortlichen allerdings ab, dass es in der Winterthurer Altstadt Probleme gäbe. «Burger King ist der Meinung, dass die Bilder und Videos aus dem Zusammenhang gerissen wurden und nicht die Realität und das Tagesgeschäft in den Restaurants widerspiegeln», heisst es. Und man ist sich sicher: Einige der Bilder seien zu Zeitpunkten aufgenommen worden, als das Restaurant bereits für die Gäste geschlossen war, sowie während Reinigungsarbeiten.
Vielmehr würden die Mitarbeitenden von Burger King die Restaurants in regelmässigen Abständen reinigen und desinfizieren. «Zusätzlich finden in den Restaurants regelmässige Inspektionen durch externe Prüfstellen statt, die die Hygienestandards von Burger King von unabhängiger Seite überprüfen. Das Restaurant in Winterthur hat erst kürzlich bei einer solchen Untersuchung gut abgeschnitten», heisst es seitens Burger King weiter.
Natürlich könne es, wo viele Menschen zusammenarbeiten, in Einzelfällen zu Fehlern kommen. «Deshalb schult Burger King seine Mitarbeitenden regelmässig und stellt sicher, dass die richtigen Abläufe von allen Seiten eingehalten werden».
Ex-Mitarbeiterin S. hat dies anders erlebt. Sie sagt klar: «In diesem Burger King sollte keiner essen – zumindest vorerst, bis sich hygienetechnisch etwas geändert hat.». Schreibt Blick.
30.6.2023 - Tag der Fastfood-Buden
Um Zustände zu verhindern, wie sie in diesem Artikel beschrieben werden, gibt es beispielsweise im Kanton Luzern die Lebensmittelkontrolle und den Verbraucherschutz. Staatliche Institutionen, die sicher auch im Kanton Zürich und Winterthur zu finden sind. Da scheint irgendwer in Winterthur seinen Job nicht gemacht zu haben. Inklusive Ella S., deren Geständnis im Blick irgendwie nach persönlicher «Rache» riecht.
Statt sechs Monate sehenden Auges zuzuschauen, was sich in der Winterthurer Fastfood-Bude abspielt und damit gesundheitliche Schäden der Konsumenten*innen billigend in Kauf zu nehmen, hätte sie auch die dafür zuständige Behörde informieren können. Sogar anonym. Damit hätte sie vermutlich mehr erreicht als mit Blick. Denn die Lebensmittelkontrolle kann ein Lokal durchaus auch (temporär) schliessen. Ist in der Stadt Luzern schon öfters passiert.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Massive Vorwürfe gegen SVP-Politiker und Kantonsrat Bernhard Diethelm aus Schwyz
Die SVP-Kantonalpartei Schwyz hat die Ortspartei Wägital aufgefordert, die Parteimitgliedschaft von SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm per sofort zu sistieren. Grund dafür: Diethelm ist der Gefährdung des Lebens, der versuchten sexuellen Nötigung und verbotener Pornografie angeklagt. Der Beschuldigte muss sich am nächsten Montag vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten – die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von vier Jahren.
Die Vorwürfe sind happig: Im Jahr 2021 soll Bernhard Diethelm eine Frau zu sadomasochistischen Rollenspielen getroffen haben. Nach dem Betreten der Wohnung habe Diethelm die Sexarbeiterin von hinten gepackt, in einen Unterarmgriff genommen und sie massiv gewürgt. Damit habe er sie wissentlich und willentlich in verwerflicher Weise in Lebensgefahr gebracht, heisst es in der Anklageschrift, die der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt.
Danach habe der Beschuldigte probiert, die Frau mit einer unbekannten Substanz zu betäuben, wobei diese fast in Ohnmacht gefallen sei. Die Frau versuchte sich zu wehren und konnte zwischenzeitlich auf den Balkon flüchten und um Hilfe rufen. Diethelm habe sie aber eingeholt.
Aufgrund erneuter Hilferufe wurden Leute in der Nachbarschaft auf die Situation aufmerksam. Diethelm soll das Haus darauf verlassen haben. Die Frau habe durch die verschiedenen Gewaltanwendungen Kratzer und Prellungen an den Armen, Oberschenkeln, Knie und Fuss sowie Verletzungen am Unterkiefer erlitten.
Staatsanwaltschaft wirft Diethelm Pornografie vor
Die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl wirft Diethelm ausserdem vor, er habe der Frau im Vorfeld über Whatsapp einen Link zu 43 verbotenen pornografischen Bildern mit sexuellen Handlungen mit Tieren geschickt. Bei der Auswertung des Handys und Notebooks des Beschuldigten seien insgesamt 56 verbotene Bilder «der Kategorie Zoophilie» gefunden worden. Diethelm habe diese aber nur für seinen eigenen Konsum gebraucht und nicht geteilt.
Für all diese Vergehen – von versuchter sexueller Nötigung über versuchte Vergewaltigung, Gefährdung des Lebens und mehrfacher Körperverletzung bis hin zu harter Pornografie – fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von vier Jahren.
Beschuldigter bestreitet alle Vorwürfe
Der angeklagte SVP-Politiker Bernhard Diethelm betonte gemäss Medienberichten in einer Stellungnahme 2021 seine Unschuld. Er verwies darauf, dass es sich um eine rein private Angelegenheit handle, die seine politische Tätigkeit nicht tangiere und deshalb auch nicht von öffentlichem Interesse sei. Er bestreitet sämtliche Vorwürfe.
Obwohl die Unschuldsvermutung gelte, zeigte sich die SVP Kanton Schwyz am Sonntag in einer Medienmitteilung «erschüttert» über die Schwere der Vorwürfe. «Wir sind ganz klar der Meinung: Wir müssen handeln», sagt Kantonalpräsident Roman Bürgi. «Die Parteileitung hat entschieden, die SVP-Ortspartei Wägital aufzufordern, die Parteimitgliedschaft von Bernhard Diethelm per sofort bis zu einem allfälligen Freispruch zu sistieren.»
Die SVP-Wägital wolle nun in den nächsten Tagen eine Vorstandssitzung abhalten. Sollte diese der Aufforderungen nicht nachkommen, werde die Kantonalpartei über einen vorläufigen Ausschluss der Ortspartei befinden müssen. Schreibt SRF.
26.6.2023 - Tag der Schwarzen Polit-Schafe
Ich bin ja nicht unbedingt als Fan-Boy der SVP bekannt. Aber in diesem SRF-Artikel kommen mir die drei Buchstaben «SVP» zu oft vor. Als ob das Parteibuch für einen perversen Triebtäter verantwortlich wäre. Treffen die im Artikel aufgeführten Vorwürfe zu, ist Kantonsrat Bernhard Diethelm in der Tat nichts anderes als ein Perversling. Und dafür steht ER als kranker Mensch vor Gericht und nicht die SVP.
Auch die Grünen hatten im Sommerloch 2014 ihr «Geri Gate» um den Grünen Nationalrat und Stadtammann von Baden wegen Nacktselfies inklusive Geris Schrumpfpimmel, die Geri Müller aus seinem Stadtammann-Büro an eine Frau in Bern via Handy gesandt haben soll. War 2014 ein riesiger medialer Aufreger. Ein Sprühling sprayte denn auch sofort in einer Unterführung an der Reuss in Luzern «Hol doch mal den Geri raus» an die Wand. Ich mit meinem grossen Sprayerherz fand den Claim lustig, ohne ihn zu befolgen. No big deal. Andere rümpften eher die Nase. Aber soweit ich mich erinnere, wurde damals bei der über Wochen atemlos anhaltenden Sommerloch-Geri Gate-Berichterstattung der Namen der Grünen-Partei kaum erwähnt.
Natürlich bin ich mir bewusst, dass «Geri-Gate» eine völlig andere Hausnummer ist als diejenige von Diethelm, der angeblich die Prostituierte auch verletzt haben soll. Ich schreibe hier bewusst im Konjunktiv um einer allfälligen Klage gegen den Artillerie-Verein Zofingen vorzubeugen. Denn für einen Angeklagten gilt – selbst wenn er SVP-Mitglied ist – in unserem Rechtsstaat noch immer die Unschuldsvermutung.
Die regionale SVP-Partei schmeisst den gewählten Kantonsrat aus der Partei – oder er geht selber – und das ist gut so. Sie handelt konsequent ohne irgend etwas zu beschönigen. Diethelm wird wohl auch sein Mandat verlieren. Damit sollten wir es bewenden lassen. Denn abartige Perversion steht den Menschen nun mal nicht ins Gesicht geschrieben. So wusste die Partei wohl kaum, mit welch komischen sexuellen Gelüsten dieser Mann behaftet ist. Was für Sportclubs mit pädophilen Trainern gilt, muss auch für Parteien gelten. Es ist anzunehmen, dass sämtliche Parteien in ihren Reihen Menschen haben, die aussergewöhnliche Sexpraktiken ausüben oder davon träumen, ohne dass die Partei auch nur die geringste Ahnung hat. Schwarze Schafe gibt es überall. Nicht nur auf den SVP-Plakaten.
Wir sollten uns wieder darauf besinnen, den Parteien ihre wirklichen Versäumnisse an Staat und Gesellschaft unter die Nase zu reiben, statt uns auf billigen Clickbaiting-Nachrichten im Blick-Boulevardstil auszuruhen. Dies ganz besonders im Hinblick auf die kommenden Parlamentswahlen im Herbst.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Luxuriöse Ladenhüter – Diese Reichen bringen ihre Schweizer Villen nicht los
Das Anwesen des Personalvermittlers Egon Zehnder steht für über 20 Millionen Franken zum Verkauf. Andere prominente Beispiele zeigen: Der Luxusimmobilien-Markt ist ein hartes Pflaster. Käufer zu finden, kann Jahre dauern.
Es ist fast ein Jahr her, seit der verurteilte Ex-Chef von Raiffeisen Pierin Vincenz (67) seine Luxusvilla hoch über Teufen AR zum Verkauf ausschreiben musste. Passiert ist seither nichts. Der Beton-Palast am exklusiven Sonnenhang in der steuergünstigsten Gemeinde Appenzells ist noch immer auf dem Markt. Dabei könnte Vincenz das Geld gut gebrauchen.
Der Luxusimmobilienmakler Ginesta preist das Anwesen auf seiner Website noch immer für 10 bis 15 Millionen Franken an. Ist der Preis zu hoch oder liegt es an der Beton-Optik? CEO Claude Ginesta (50) will sich auf Anfrage nicht dazu äussern.
Vincenz ist nicht der einzige Banker, der es mit seiner Immobilie in die Schlagzeilen geschafft hat – und trotzdem keinen Käufer dafür findet. Der russischen Financier Igor Akhmerov (58) versucht seit über vier Jahren, für seinen Prunk-Palast mit Privatanstoss am Zürichsee einen neuen Besitzer zu finden. Bisher ohne Erfolg. Einst bei Sotheby’s International Realty ausgeschrieben, ist die Villa inzwischen ebenfalls bei Ginesta im Portfolio. Schafft der Zürcher Nobelmakler, was der internationalen Konkurrenz bisher missglückte? Oder ist die Villa an der Goldküste für 20 bis 25 Millionen Franken unverkäuflich?
Nicht nur die Kundschaft ist anspruchsvoll
Die Vermarktung von hochpreisigen Immobilien dauert oft länger als die eines durchschnittlichen Objekts. «Je spezieller das Objekt, umso weniger mögliche Käufer gibt es», sagt Katharina Hofer (36), eine auf den Luxusimmobilienmarkt spezialisierte Ökonomin der UBS.
Gibt es also zu wenige Multimillionäre, die eine noble Bleibe suchen? Nicht ganz. Die Zahl der Personen mit Vermögen über 10 Millionen Franken stieg in der Schweiz zwischen 2011 und 2021 um rund 8 Prozent jährlich und damit auch die Anzahl potenzieller Käufer von Luxusimmobilien. Das Problem: Die reiche Kundschaft öffnet ihr Portemonnaie nicht mehr so grosszügig wie früher.
«Der Markt für Luxusimmobilien ist im Vergleich zu den boomenden Vorjahren anspruchsvoller geworden», sagt Hofer. «Ein turbulentes Börsenjahr 2022 belastete die Vermögen der Reichen, wodurch die Nachfrage entsprechend nachliess», so die Ökonomin.
Käufer dringend gesucht
Gleich noch ein prominentes Beispiel zeigt, wie schwierig es in der Schweiz ist, eine Luxusimmobilie zu verkaufen: Die Erb-Villa in Winterthur ZH steht zwei Jahre nach der umfassenden Sanierung noch immer leer. Die einst marode Villa Wolfensberg wurde seit der Zwangsversteigerung im Jahr 2020 zu einem Luxusanwesen umgebaut – inklusive Wellness-Bereich im Untergeschoss. Genützt hat das grosse Makeover bisher nichts. Der neue Besitzer, die Immobilienfirma Leemann + Bretscher, sitzt noch immer auf dem Nobelanwesen. Der Grund: In dieser Preisklasse einen Käufer zu finden, den es in die beschauliche Vorstadt von Zürich lockt, ist schwierig bis unmöglich.
Wird es der Familie des legendären Personalvermittlers Egon Zehnder (†91) anders ergehen? Seit kurzem steht sein Anwesen der Superlative in Küsnacht ZH zum Verkauf. Das Grundstück hoch über dem Zürichsee ist über 3600 Quadratmeter gross. Die Zahl auf dem Preisschild: mehr als 20 Millionen Franken. Zu viel?
Die Ruhe nach dem Boom
Das Luxussegment verteuerte sich in den zwei Pandemiejahren um durchschnittlich 8,5 Prozent jährlich – dreimal so viel wie im zehnjährigen Mittel. «Damit einhergehende Überbewertungen werden zunehmend kritisch hinterfragt», sagt die Ökonomin Hofer. Soll heissen: Potenzielle Käufer zögern vermehrt, die verlangten Preise ohne Verhandlung zu zahlen.
Das schlägt sich inzwischen auch auf die Preise nieder. So stiegen die Preise für Luxusobjekte im vergangenen Jahr im Schweizer Durchschnitt mit knapp 4 Prozent schwächer als der Gesamtmarkt. Für 2023 erwartet die UBS sogar einen Rückgang im tiefen einstelligen Bereich. Ob das noble Anwesen der Zehnders für über 20 Millionen Franken einen Käufer findet, wird sich in den nächsten Monaten – oder Jahren – zeigen. Schreibt Blick.
21.6.2023 - Tag der Sommerloch-News
Das mediale Sommerloch treibt wie jedes Jahr seine Blüten. Dass exorbitant teure Immobilien seit jeher schwierig zu verkaufen sind, liegt auf der Hand. Das Interesse der Kundschaft reduziert sich auf wenige Personen, die erst noch extrem hohe Ansprüche stellen.
Alles halb so schlimm. Unser Mitleid darf sich im Zusammenhang mit dieser Sommerloch-Schmonzette für einmal wirklich in Grenzen halten.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
SVP-Nationalrat Glarner hatte den Massnahmenkritiker eingeladen – Parlament geht nach Rimoldi-Vorfall über die Bücher
Für Journalistinnen und Besucher war die Wandelhalle im Bundeshaus während des Auftritts Selenskis Sperrzone. Doch Mass-Voll-Präsident Rimoldi konnte sich dort unbehelligt bewegen. Nicht nur die Parlamentsdienste stehen deswegen in der Verantwortung.
Die Sitze auf der rechten Seite des Nationalratssaals blieben leer, als sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (45) gestern ans Parlament wandte. Bis auf zwei Parlamentarier boykottierte die SVP die virtuelle Ansprache.
Während die SVP demonstrativ mit Abwesenheit glänzte, nutzte ein anderer die Gelegenheit, um sich selbst in Szene zu setzen: Corona-Massnahmenkritiker Nicolas Rimoldi (28). Das ehemalige FDP-Mitglied und Präsident der zu Beginn der Corona-Pandemie gegründeten Bewegung Mass-Voll spazierte am Donnerstagnachmittag während der Selenski-Rede unbehelligt durch die Wandelhalle im Bundeshaus – während Medienschaffenden, Lobbyisten und Mitarbeitenden der Parteien der Zugang zu ihr «aus Sicherheitsgründen» verwehrt war.
Glarner dementiert nicht
Rimoldi wollte auf Blick-Nachfrage gestern nicht sagen, welcher Parlamentarier ihn ins Bundeshaus geladen hatte. Im Bundeshaus hat sich aber schnell herumgesprochen, wer es war: SVP-Nationalrat Andreas Glarner (60).
Der Aargauer dementiert gegenüber Blick nicht, dass Rimoldi als sein Gast im Bundeshaus war. Er wolle das Ganze nicht kommentieren, sagt er nur.
Glarner wird sich deshalb davor hüten, frei von der Leber weg über seinen Besuch zu plaudern, weil er genau weiss: Parlamentarierinnen und Parlamentarier dürfen ihren Besuch im Bundeshaus eigentlich nicht unbeaufsichtigt lassen. Das hat seinen Angaben zufolge auch das Sicherheitspersonal Rimoldi gesagt, als er am Donnerstagnachmittag alleine aus der Wandelhalle spazierte.
Parlamentsdienste prüfen Massnahmen
Die Parlamentsdienste teilen auf Anfrage mit, der «Fall» sei ihnen bekannt. «Er wird intern analysiert, und falls nötig, werden Massnahmen getroffen», heisst es. Die Frage, ob Glarner deswegen Konsequenzen drohten, beantworten die Behörden nicht.
Sie halten lediglich fest, dass die Ratsmitglieder die Verantwortung für ihre Gäste übernehmen. «Diese Verantwortung ist nicht detailliert definiert, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass insbesondere der Ratsbetrieb in keiner Art und Weise gestört werden darf, die Gäste die Sicherheit nicht gefährden, die Einrichtungen und das Gebäude nicht beschädigen und sich jederzeit an Anweisungen des Personals halten.»
Sperrzone für Journalisten
Warum vor und während der Rede Selenskis die sonst für akkreditierte Personen frei zugängliche Wandelhalle für alle ausser die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gesperrt war, wollten die Parlamentsdienste gestern nicht sagen. Die Vereinigung der Bundeshausjournalistinnen und -journalisten sandte deswegen eine Protestnote an die Leitung von National- und Ständerat sowie die Verwaltung. Schreibt Blick.
17.6.2023 - Tag der SVP-Dummschwätzer und Primitiv-Schwurbler
Gleich und gleich gesellt sich gern sagt der Volksmund. Das trifft besonders dann zu, wenn sich zwei von jedem Intellekt befreite Primitiv-Schwurbler aus der untersten Schublade der Verschwörungs- und SVP-Szene (was ja eigentlich mehr oder weniger dasselbe ist) treffen.
Dass man den einen (Glarner) sogar laut einem Gerichtsentscheid offiziell einen «infantilen Dummschwätzer» nennen darf, spricht für sich. Da kommt mit Glarner und Rimoldi wirklich zusammen, was zusammen gehört.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Schweiz: noch kein Entscheid über Ukraine-Hilfspaket in Milliardenhöhe
Ob die Schweiz in der Ukraine mit einem milliardenschweren Hilfspaket helfen soll, ist noch nicht entschieden. Der Ständerat hat soeben den Entscheid über eine Motion von Mathias Zopfi (Grüne/GL) vertagt.
Der Vorstoss verlangt eine gesetzliche Grundlage für die Unterstützung der Ukraine, mit einem Hilfsprogramm. Die Mittel sollen insbesondere für humanitäre Hilfe, den Schutz der Zivilbevölkerung und den Wiederaufbau eingesetzt werden. Schreibt SRF heute im Ukraine-Live-Tiker.
12.6.2023 - Tag der Schweizer Hilfsgelder in Milliardenhöhe
Sind solche Wahnsinns-Summen an Hilfsgeldern dem Schweizer Volk eigentlich noch vermittelbar? Nachdem für die angeblich fehlende Milliarde bei der AHV die Mehrwertsteuer erhöht werden muss und Kita-Unterstützung von knapp 800 Millionen Franken durch den Bund an die Kantone von der Frau Finanzministerin (FDP) infolge Sparmassnahmen abgelehnt wurden?
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Das Wunder im kolumbianischen Regenwald: vier vermisste Kinder lebend gefunden!
Über einen Monat nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im kolumbianischen Regenwald sind alle vier vermissten Kinder lebend gefunden worden. Die Geschwister – 13, 9, 4 und 1 Jahr alt – waren am 1. Mai verunglückt. Auf eigene Faust schlugen sie sich durch die Wildnis.
Entkräftet und abgemagert, doch am Leben! Eineinhalb Monate nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im kolumbianischen Regenwald sind vier überlebende Kinder aus dem Dschungel gerettet worden. Nach einer wochenlangen Suchaktion im Amazonasgebiet fanden Einsatzkräfte die Geschwister im Alter von 13, 9 und 4 Jahren sowie ein einjähriges Kleinkind im Süden des Landes, wie der kolumbianische Präsident Gustavo Petro (63) am Freitag mitteilte.
«Eine Freude für das ganze Land. Die vier Kinder, die seit 40 Tagen im kolumbianischen Regenwald vermisst wurden, sind lebend gefunden worden», schrieb der Staatschef auf Twitter. Dazu veröffentlichte er ein Foto von Soldaten und Indigenen im Dschungel, die die Kinder mit Wasser versorgten und fütterten.
Kinder «setzten ein Beispiel des Überlebens»
«Sie waren allein, aber sie haben ein Beispiel des Überlebens gesetzt, das in die Geschichte eingehen wird», sagte Petro nach seiner Rückkehr aus Kuba, wo er einen Waffenstillstand mit der linken Guerillaorganisation ELN bekanntgegeben hatte. «So sind diese Kinder heute, die Kinder des Friedens, die Kinder Kolumbiens.»
Die kolumbianischen Streitkräfte posteten eine Serie von Fotos der geglückten Rettung auf Twitter – mit den Worten: «Die Bündelung der Kräfte hat diese Freude für Kolumbien möglich gemacht. Ruhm den Soldaten der Streitkräfte Kolumbiens und den indigenen Gemeinden und Gruppen, die an der ‹Operation Hoffnung› teilgenommen haben.»
Die Geschwister waren am 1. Mai mit einer Propellermaschine vom Typ Cessna 206 im Department Caquetá im Süden des Landes abgestürzt. Private Kleinflugzeuge sind in der unwegsamen Region oft die einzige Möglichkeit, grössere Strecken zurückzulegen. Bei dem Unglück kamen die Mutter der Kinder, der Pilot und ein indigener Anführer ums Leben. Auf der Suche nach den Kindern fanden die Soldaten Schuhe, Windeln, Haargummis, eine lila Schere, eine Babyflasche, eine aus Blättern und Ästen gebaute Notunterkunft sowie halbverzehrte Früchte.
Pilot versuchte Notwasserung
Der Pilot hatte noch per Funk von Problemen mit dem Motor berichtet, bevor die Maschine abstürzte, hiess es zuletzt im vorläufigen Bericht der Luftfahrtbehörde. Zuvor hatte der Pilot noch angekündigt, auf einem Fluss notwassern zu wollen. Das Kleinflugzeug sei dann aber mit den Baumspitzen kollidiert, Motor und Propeller seien von der Maschine abgerissen worden und das Flugzeug sei senkrecht zu Boden gestürzt.
Offenbar war das Flugzeug beim Zusammenstoss mit den Baumkronen schon stark abgebremst worden, so dass der Aufprall auf der Erde weniger stark war. Im hinteren Teil der Kabine waren kaum Schäden festgestellt worden. Die Kinder könnten das Flugzeugwrack über die vordere Tür zur Linken des Piloten verlassen haben.
Hoffnung nie aufgegeben
Anhand der gefundenen Gegenstände und Spuren konnten die Soldaten den bisher zurückgelegten Weg der Kinder rekonstruieren. Demnach entfernten sie sich zunächst von der Absturzstelle vier Kilometer Richtung Westen. Dann stiessen sie offenbar auf ein Hindernis und wendeten sich gen Norden. Der Regenwald in der Region ist sehr dicht, was die Suche nach den Vermissten erheblich erschwerte. Zudem regnet es praktisch ununterbrochen.
Die Kinder – drei Mädchen und ein Junge – gehören selbst zu einer indigenen Gemeinschaft, ihre Kenntnis der Region könnte ihnen geholfen haben, nach dem Absturz im Dschungel zu überleben. Ihre Grossmutter Fátima Valencia vertraute vor allem auf die älteste Schwester. «Sie war immer wie die Mutter, sie hat die anderen mit in den Wald genommen», sagte sie zuletzt im Radiosender La FM. «Sie kennt die Pflanzen und Früchte. Wir Indigene lernen von klein auf, welche man essen kann und welche nicht.»
Parallelen zu junger Frau 1971
Der Fall erinnert an die Deutsch-Peruanerin Juliane Koepcke, die 1971 einen Flugzeugabsturz im peruanischen Regenwald überlebte und nach zehn Tagen gerettet wurde. Da ihre Eltern als Biologen im Amazonasgebiet forschten, war der damals 17-Jährigen die Umgebung vertraut und sie konnte sich bis zu einem Fluss durchschlagen, wo sie schliesslich von Waldarbeitern gefunden wurde.
Die Kinder in Kolumbien waren Medienberichten zufolge mit ihrer Mutter auf dem Weg zu ihrem Vater, der nach ständigen Drohungen durch eine Splittergruppe der Guerillaorganisation Farc aus der Region geflohen war. Zwar hat sich die Sicherheitslage nach dem Friedensabkommen 2016 zwischen der Regierung und der Farc verbessert, allerdings werden noch immer Teile des südamerikanischen Landes von illegalen Gruppen kontrolliert. Vor allem Indigene, soziale Aktivisten und Umweltschützer geraten immer wieder in das Visier der kriminellen Banden. Schreibt Blick.
10.6.2023 - Tag der Geschichten aus denen Netflix-Dokus entstehen
In Zeiten wie diesen, die für uns am Morgen beim Mediencheck täglich Horror-News im Live-Ticker-Format über gesprengte Dämme, getötete Kinder und die sonstigen Kriegsgreuel in der Ukraine en masse anbieten, wirkt ein Artikel über das «Wunder im kolumbianischen Regenwald» wie Balsam auf unsere von bad news gequälten Seelen.
Ohne Sarkasmus: Diese Geschichte aus dem kolumbianischen Regenwald bietet den Stoff, aus dem gute Netflix-Dokus entstehen. Wetten, dass die schon bald Wirklichkeit sein wird?
In diesem Sinne medial für einmal ein gefreutes und sonniges Sommer-Weekend.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Klimakrise: Philosoph Sloterdijk sieht grün
Konkrete Ideen statt Schaumtheorie: Der Philosoph Peter Sloterdijk wirbt in einem neuen Buch für einen klugen Kampf gegen den Klimawandel – und blickt dafür in die Schweiz.
Bereut er nun, oder bereut er nicht? Der griechische Titan Prometheus hatte den Menschen einst das Feuer geschenkt, gegen den Willen von Göttervater Zeus. Doch in den letzten 250 Jahren hat der Mensch damit Unheilvolles angerichtet – die Verbrennung fossiler Rohstoffe führte zur anrollenden Kilmakatastrophe.
Ein gewohnt sprachgewaltiger Sloterdijk
Diese beiden Phänomene, Mythos und fossile Realität, verknüpft der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk. In seinem 80-seitigen Essay «Die Reue des Prometheus» erläutert der 75-Jährige die Frage: Welche (Lösch-)Alternativen können wir als Prometheus' Erben entwickeln?
Sloterdijk schlägt dabei in gewohnt sprachgewaltiger, teils allzu verklausulierter Manier, den ganz grossen Bogen. Feuer, schreibt er, sei «eine der frühesten Grössen, die von Menschen als Manifestationen des transzendenten Prinzips ‹Kraft› und ‹Macht› aufgefasst werden konnten. Es war eine anfängliche Gottesmetapher neben Wind, Blitz und Sonne».
Menschheit als «Kollektiv von Brandstiftern»
Im Laufe der Geschichte aber hätten die Menschen ihre ehrfürchtige Dankbarkeit vergessen, seien zu einem «Kollektiv von Brandstiftern» mutiert. Mit der Erfindung der Dampfmaschine, von Zeitgenossen als «Feuermaschine» bezeichnet, habe ein zerstörerischer Verbrauch der Rohstoffe Erdöl, Erdgas und Kohle eingesetzt – Relikte der «unterirdischen Wälder» der Erde, wie er schreibt.
Eine Zukunft indes sei nur mit «post-prometheischer Energiegewinnung» möglich: Solartechnik, Biogas, Wind- und Wasserenergie, Erdwärme oder auch «mikroenergetische feuerfreie Systeme» wie etwa die Umwandlung jeglicher menschlicher Bewegung.
So weit, so bekannt. Aufschlussreich und innovativ werden Sloterdijks Gedanken, wenn er die mythische «Reue» in mögliches politisches Handeln übersetzt. Die entscheidenden Lösungsinstanzen sind für ihn dabei nicht die Gross-Akteure der Welt – Nationen, Megastädte, multinationale Konzerne. Die Rechte der Nationalstaaten an den «unterirdischen Wäldern», den fossilen Rohstoffen also, müssten vielmehr an die UN übergehen und als «Weltbodenschatzerbe» bewahrt werden.
Die «Helvetisierung» der Welt
Und ausserdem? Die lokalen Strukturen stärken. Wenn die Menschen lokal Einfluss hätten, würden sie sich noch mehr um ihren unmittelbaren Lebensraum kümmern wollen.
«Die Helvetisierung des Planeten allein würde die Weltkultur von ihren grossstaatlichen und hypermetropolitanen Gewaltmärschen in die Natur- und Selbstzerstörung abbringen.» Dieser lokale Einfluss-Zugewinn für kleinere Einheiten hätte zur Folge, dass die «Zweideutigkeit der Repräsentativsysteme realdemokratischen Verhältnissen» weichen würde.
Pointiert und zuweilen utopisch
Die kurze Lektüre birgt nachhaltigen Mehrwert, auch wenn der Sprachstil nicht jedermanns Sache ist. Dennoch: es ist ein verdichteter, pointierter, mitunter utopisch wirkender Pinselstrich. Zwischen den Zeilen drückt sich grosse Sorge des Autors aus.
Sein Gegenmittel: wieder zu staunen ob des Wunders der schieren blossen Existenz der Erde – um dann zu handeln, «nach-prometheisch» und verantwortungsvoll. Schreibt SRF.
9.6.2023 - Tag der philosophischen Klimarettung
Die Philosophenzunft ist inzwischen bei den Medien zum Allzweckmittel im Clickbaiting-Wettbewerb erkoren worden: Fehlt die lupenreine Expertise, weil es – wie etwa beim Klimawandel – der Wahrheiten viele gibt, wird inzwischen immer mehr Information bei den Philosophen gesucht. Das ist manchmal unterhaltsam streitlustig (Richard David Precht), jugendlich frisch (Yves Bossart von SRF) oder einfach nur schwindelerregende Wort-Akrobatik (Peter Sloterdijk). Philosophische Phrasendrescherei, die uns zwar zum Nachdenken bringen kann, aber keine Lösungen offenbart. Das ist auch nicht die Aufgabe der Philosophie, die seit Jahrtausenden versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen. Das ist ihr bis zum heutigen Tag nicht gelungen. Trotz Prometheus. Oder vielleicht sogar wegen Prometheus, der inzwischen doch etwas aus der Zeit gefallen ist.
Das neue Buch (Essay) «Die Reue des Prometheus» von Peter Sloterdijk wird daran auch nichts ändern. Möglicherweise nice to have für das Bücherregal, aber ohne Latein- und Altgriechisch-Unterricht werden auch Sie die kreativen und vieldeutigen Wortschöpfungen Sloterdijks nicht verstehen. Ganz zu schweigen davon, dass man zwar Lösungsansätze oder längst bekannte Allgemeinplätze zur Rettung des Klimas daraus formulieren kann, weiterbringen tun diese Kalendersprüche die Klimarettung nicht wirklich. Zumal die «Helvetisierung» des Planeten Erde ein uralter Zopf ist. Selbst der aus Ostdeutschland stammende Sänger Wolf Biermann formulierte vor etwa 15 bis 20 Jahren eine ähnliche These mit Blick auf Klima und Umweltverschmutzung und dem ungefähren Wortlaut: «Weg vom globalisierten Gigantismus und zurück zu den lokalen Strukturen.» Das erinnerte mich damals als ich die Zeilen las, irgendwie an Kambodscha 1975 bis 1979 und die «Roten Khmer».
Zu guter Letzt sei festgehalten, dass Peter Sloterdijk definitiv zu den wichtigsten und einflussreichsten Philosophen der letzten Jahrzehnte im deutschsprachigen Raum zählt. Doch auch für ihn gilt die alte Volksweisheit: Schuster bleib bei deinen Leisten.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Franzobel über die Sozialdemokratie: Im Excelbad der Gefühle
Mit ihrem Auszählungsdebakel hat die SPÖ bewiesen, dass sie Wahlen sogar dann verliert, wenn sie nur gegen sich selbst antritt. Oder ist das als Angebot an alle Mathematikhasser zu verstehen?
In meinen schlimmsten, sporadisch wiederkehrenden Angstträumen muss ich zurück in die Schule und die Matura wiederholen. Die Aufgaben sind unterschiedlich, aber das Befüllen einer Excel-Datei gehört normalerweise nicht dazu. Trotzdem wache ich jedes Mal schreiend und schweißgebadet auf.
Für Hans Peter Doskozil ist so ein Angsttraum Wirklichkeit geworden, doch nicht Parteivorsitzender, und welch Albdrücke Andreas Babler in nächster Zeit plagen werden, kann man sich ausmalen. Der einst so mächtigen SPÖ sitzt eine gräuliche Drud auf der Brust, sie verliert Wahlen sogar dann, wenn sie nur gegen sich selbst antritt.
Das Absurde daran: Der Fehler wurde überhaupt erst durch Zufall oder die Nachfrage eines Journalisten entdeckt. Man mag sich gar nicht vorstellen, was da sonst noch alles danebengeht, wie viele Leute in diesem Land durch einen falschen Eintrag keine Wohnung bekommen, unnötig operiert oder gleich fälschlicherweise für tot erklärt werden.
Auftritt Böhmermann?
Eine Großpartei schafft es nicht, sechshundert Stimmen auszuzählen? Das ist fast so grotesk wie damals 1999, als Hape Kerkeling den neuen litauischen GAK-Trainer Albertas Klimawiszys mimte. Auch diesmal rechnet man damit, dass sich (Ex-)Wahlleiterin Michaela Grubesa die Maske vom Gesicht reißt und ihrem Urnengangkontrollkokon ein Jan Böhmermann entsteigt. Das ist nicht der Fall. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich zerwuzeln. Eine verloren gegangene Stimme kostet Doskozil den Parteivorsitz. Äquatorialguinea bietet an, Wahlbeobachter zu entsenden. Babler im Excelbad der Gefühle.
So holt man aber keine Wählerinnen und Wähler zurück. Oder kalkuliert man mit der Solidarität aller Mathematikhasser? Damit, dass der Durchschnittsösterreicher Rechendilettantismus als Volksnähe begreift? Selten wurde bei einer Wahl so deutlich, wie sehr jede einzelne Stimme zählt. Ich vermute ja, dass die verloren gegangene Stimme dem ominösen dritten Kandidaten zuzurechnen ist, der auf den Ergebnislisten mit null Prozent ausgewiesen ist – Berthold Felber, den man zwar antreten, aber nicht eintreten ließ. Felber wählt sich nicht einmal selber?
Jedenfalls ist auch nach der x-ten Auszählung klar: Die SPÖ ist angezählt. Es stellt sich die Frage, ob mit der linken Volkspartei noch zu rechnen ist. Herbert Kickl wird zur Feier des Tages ein paar Tonsuren fechten, antisozialistische Lieder singen und eine Pferdeleberkäsesemmel verspeisen, während man in den Schaltzentralen der ÖVP ein paar Stoßgebete für Dollfuss zum Himmel schickt.
Wer auf die SPÖ als Verhinderer von Blau-Schwarz gehofft hat, hat sich möglicherweise grob verrechnet. Es ist alles sehr kompliziert, hat bereits Bundeskanzler Fred Sinowatz festgestellt, aber dabei nicht an das Befüllen einer Exceldatei gedacht. Und unter Excellenz Bruno Kreisky wäre so etwas sowieso niemals passiert.
Man kann der Sozialdemokratie vieles vorwerfen – Bonzentum, Postenschacher, Korruption –, aber sie hat in diesem Land auch vieles durchgesetzt, was den Wohlstand aller begründet hat: Mutterschutz, Abschaffung des Schulgeldes, Legalisierung der Homosexualität, Kinderbeihilfe, Arbeitszeitverkürzung, Gleichstellung der Frau, Sozialversicherung, Lehrlingsentschädigung, sozialer Wohnbau, Mietbeihilfen, Gesundenuntersuchung und vieles mehr.
Nur von historischen Leistungen zu zehren reicht aber auch nicht, und gegenwärtig macht die Partei den Eindruck, als würde sie Fettnäpfe aufstellen, um dann mit Anlauf hineinzuspringen. Peinlich? Ja, aber Fehler passieren, und die Albträume jenes Menschen, der die Zahlen falsch eingetragen hat, möchte ich nicht haben – da trete ich lieber noch ein paar Mal zur Matura an. Aber wegen eines blöden Missgeschicks eine ganze Partei verdammen?
Die Brezen der anderen
Ich beschäftige mich kaum mit Tagespolitik, weil ich überzeugt bin, dass dieses Geschäft korrumpiert und charakterlich verdirbt. Der österreichische Politiker, die österreichische Politikerin – egal welcher Couleur – ist in seiner oder ihrer patscherten Provinzialität bestenfalls liebenswert, aber fast ausnahmslos lächerlich. Trotzdem halte ich den österreichischen Weg mit der Sozialpartnerschaft für vorbildlich.
Mit den Tränen jedes echten Sozialisten ob des gegenwärtigen Dilettantismus ließe sich der Neusiedler See befüllen – ist die Glaubwürdigkeit der Partei doch an einem historischen Tiefststand angelangt. Trotzdem hoffe ich, dass mit der SPÖ wieder zu rechnen ist, auch wenn sie das nicht kann. Denn welche Brezen haben die anderen gerissen: Hypo Alpe Adria, Ibiza, Chatprotokolle, Schwiegermuttermillionen, Inserate, Pferdeentwurmungsmittel …
So verkommen wie Österreich möchte man nicht sein. Eigentlich muss man sich jeden Morgen wundern, dass noch alles halbwegs funktioniert. Oder ist das Land ein großangelegtes Satireprojekt, bei dem zwar uns das Lachen längst vergangen ist, sich andere aber gar köstlich amüsieren? Manchmal erwache ich aus meinen schlimmsten Träumen, aber dann stelle ich rasch fest: Die Realität ist schlimmer. Schreibt Schriftsteller, Essayist und Dramatiker Franz Stefan Griebl alias Franzobel im STANDARD.
7.6.2023 - Tag der von Bill Gates manipulierten Excel-Tabelle
Wer den Schaden hat, braucht für Spott nicht zu sorgen. Das erledigen heutzutage die Comedians und Satiriker/Satirikerinnen. Und weil die Satire absolute Narrenfreiheit geniesst, kann es schon mal vorkommen, dass gewisse Redewendungen wie «Tonsuren fechten» von der «geneigten» Leserschaft nicht als Satire erkannt werden, weil sich die beiden Begriffe «Tonsur» und «fechten» auf den ersten Blick eigentlich widersprechen. Das ist mit dieser Glosse passiert und führte zu einem mittleren Shitstorm der Mühseligen und Beladenen im Forum. Was einmal mehr beweist, dass Satire und (gelungene) Wortspiele nichts für «hochgebildete» Hardcore-Korintenkacker mit abgebrochenem Germanistik-Studium sind.
Ich finde persönlich sowieso, dass dieser Excel-faux pas anlässlich der Wahl des neuen Parteivorsitzenden der österreichischen SPÖ zu sehr dramatisiert wird. Ist nun mal passiert. Schwamm drüber und weiterarbeiten. 2016 musste – ebenfalls in Österreich – die Stichwahl um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten mit einem Kostenaufwand von zehn Millionen Euro wiederholt werden. In Berlin war es die Wahl zum Abgeordnetenhaus aus dem Jahr 2021, die wegen «massiver Unregelmässigkeiten» und dem daraus resultierenden Gerichtsentscheid des Berliner Verwaltungsgerichtshofs im Jahr 2023 widerholt werden musste. Na und? Who cares? Ist nun mal passiert. In den USA läuft noch heute ein Ex-Präsident herum, der nicht müde wird täglich zu verkünden, dass ihm, dem grössten blonden Genie aller Zeiten, die Wiederwahl zur zweiten Amtszeit als US-Präsident 2020 von Joe Biden gestohlen worden sei. Es gibt nicht wenige WELTWOCHE-Leser*innen, die das auch noch glauben.
Ich bin sowieso der Meinung, dass die «Excel»-Software von Microsoft bei sensiblen Aufgaben generell verboten werden müsste. Die kann ja jederzeit von Bill Gates, dem Gründer von Microsoft, manipuliert werden. Wer wie Bill Gates in der Lage ist, uns Corona-Geimpften mit einem einzigen Stich in den Oberarm gleichzeitig mit dem Impfstoff einen Mikro-Chip in unseren Körper zu injizieren wie mir eine SVP-Schullehrerin, WELTWOCHE-Leserin und Esoterikerin aus Kriens glaubhaft versicherte, wird ja wohl auch das Ergebnis einer lächerlichen Excel-Tabelle in Österreich mit einem einzigen Knopfdruck aus seinem kalifornischen Refugium verfälschen können.
Ist das nun Satire oder schon gelebte SVP-Wahrheit?
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Krankenkassenprämien für die Grundversicherung dürften 2024 wieder um 6 Prozent steigen – bei einigen Versicherungen sogar um 10 Prozent
Das Vergleichsportal Comparis erwartet einen erneuten Anstieg der Krankenkassen-Grundversicherung. Durchschnittlich dürften die Krankenkassenprämien im nächsten Jahr demnach um sechs Prozent ansteigen. Politische Entscheidungen zum Abbau von Reserven liessen die Prämien stärker ansteigen.
Bei einigen Krankenkassen sollen die Prämien um zehn Prozent steigen. Durchschnittlich erwartet das Vergleichsportal Comparis aber einen Anstieg von sechs Prozent. Dies, nachdem die Prämien bereits auf das laufende Jahr um 6,6 Prozent aufgeschlagen haben.
Auf lange Frist sieht Felix Schneuwly, Krankenkassenexperte, der in der Comparis-Mitteilung zitiert wird, aber eine Beruhigung. In den kommenden Jahren soll sich das Kostenwachstum für die Schweizerinnen und Schweizer leicht unter drei Prozent einpendeln.
Abbau der Reserven führte zu starkem Prämienanstieg
«Ohne den politisch erzwungenen Reserveabbau wären die Prämien in den letzten Jahren lediglich um rund 2,5 Prozent pro Jahr und Person gestiegen und würden aktuell weiter in diesem Bereich steigen», wird Felix Schneuwly zitiert. Damit künftig nicht jede Kostenschwankung zu einer Prämienschwankung führt, spricht sich der Krankenkassenexperte wieder für ein Reservepolster über dem gesetzlichen Minimum aus.
Die Prognose von Comparis basiert auf einer Abschätzung des Vergleichsportals im Zusammenspiel mit der ETH-Konjunkturforschungsstelle. Die Gesundheitskosten würden demnach im laufenden Jahr um 3.6 Prozent und im nächsten Jahr um 3.1 Prozent ansteigen, was sich auf die Krankenkassenprämie entsprechend auswirke.
In den Jahren 2021 bis 2023 können die steigenden Kosten teilweise mit der Corona-Pandemie erklärt werden. Ein höherer Bürokratieaufwand sowie mehr Psychotherapien oder die Umsetzung der Pflegeinitiative kosteten Geld.
BAG spricht auch von höheren Prämien
Bereits vor einer Woche veröffentlichte das Bundesamt für Gesundheit BAG Zahlen zu steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Im ersten Quartal seien die Preise um 3.4 Prozent angestiegen.
«Steigende Kosten werden auch zu steigenden Prämien führen», liess sich der BAG-Vizedirektor, Thomas Christen, zitieren. Wie hoch die Krankenkassenprämien ansteigen werden, konnte Christen noch nicht abschätzen. Die erste Prognose von Comparis lässt für die Schweizerinnen und Schweizer aber nichts Gutes erahnen. Schreibt SRF.
6.6.2023 - Tag der sündhaft teuren politischen Vernetzung
«Moloch» ist eine biblische Bezeichnung für phönizisch-kanaanäische Opferriten und bezeichnet eine «grausame Macht, die immer wieder neue Opfer fordert und alles zu verschlingen droht». Moloch ist genau der Begriff, der mir zur Schweizer Gesundheitsindustrie und den damit verbundenen Krankenkassen einfällt.
Die obligatorische Grundversicherung ist mit einer Ur-Sünde behaftet. Statt die obligatorische Krankenkasse als Schweizer Staatsunternehmen zu führen, wurde sie ebenso wie die (lukrativen) Zusatzversicherungen an die Schweizer Versicherungswirtschaft verscherbelt. Hier liegt der Kardinalfehler begraben.
Es gibt für jeden (demokratischen) Staat Kernaufgaben, die vom Staat sowohl kontrolliert wie auch mit eigener Administration geführt werden müssen. Die obligatorische Grundversicherung ist eine dieser Kernaufgaben.
Doch in den 90er Jahren, als die obligatorische Grundversicherung im Parlament entwickelt und 1996 eingeführt wurde, waren die politischen Apologeten der «freien (und ungezügelten) Marktwirtschaft» und des brachialen Neoliberalismus längst zu mächtig. Landauf landab wurde damit argumentiert, dass der Staat nicht in der Lage sei, ein Unternehmen zu führen. Dass dem nicht so ist, beweisen inzwischen staatliche Unternehmen wie Kantonalbanken, Post, Postfinance, Swisscom und sogar die SBB. Oder die gute alte AHV, die bisher seit Jahrzehnten bestens funktioniert hat.
Ganz im Gegensatz zu den marktwirtschaftlich, teilweise von Banken, geführten Pensionskassen. So verlor allein die Migros Pensionskasse durch den Credit Suisse-Crash 100 Millionen (in Worten: einhundert Millionen Schweizer Franken) mit den auf Null heruntergestuften und damit wertlos gewordenen AT1-Bonds. Das ist das Geld der MIGROS-Arbeitnehmer*innen, das nicht etwa verbrannt wurde, sondern schlicht und einfach den Besitzer gewechselt hat. Von irgendwoher müssen die 50 Millionen Boni für Ex-CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner ja stammen.
Hat sich auch nur ein einziger / eine einzige Politiker*in bei den MIGROS-Angestellten dafür entschuldigt? Wäre ja diesmal vor allem an der FDP, die mit den CS-Zuwendungen wie eine Made im Speck der Schweizer Grossbank gelebt hat und so Damian Müllers Wahlkampf 2019 mit kolportierten 80'000 Franken finanzieren konnte (hinter vorgehaltener Hand wird von Insidern ein weit höherer Betrag genannt). Bei der UBS war noch die SVP der grosse Profiteur. Riechen Sie auch was ich rieche? Der geistige und moralisch-ethische Zerfall einer ganzen Kaste, die unser Land zu allem auch noch regiert, hinterlässt einen üblen Geruch. Ihre Kinder, liebe Freundinnen und Freunde, werden dafür dereinst einen sehr hohen Preis bezahlen.
Leider ist in Bezug auf die Prämien der obligatorischen Grundversicherung keine Besserung in Sicht. Im Genteil! Es gibt wohl keine Branche im Schweizer Parlament, die querbeet durch alle, aber auch wirklich alle Parteien dermassen vernetzt ist wie die Gesundheitsindustrie. Kaum ein Politiker*in, der/die/das nicht mit Zuwendungen überschüttet wird, um brav im Sinne der Krankenkassen zu entscheiden. Unter dieser Voraussetzung sind definitiv keine Erleichterungen für die Prämienzahler*innen zu erwarten. Ein SBB-Zug kann vom Lokführer gestoppt werden. Der rasende Prämienzug der privaten Krankenkassen hingegen nicht.
Früher nannte man Schmiermittel solcher Art noch Korruption. Heutzutage fallen sie unter die mehr oder weniger legale Kategorie der «politischen Vernetzung».
Da wundert sich auch niemand, dass der Luzerner FDP-Ständerat und «Pöstchenjäger» Damian Müller in einem Interview vor den Eidgenössischen Wahlen 2019 mit der LZ einen einen ebenso lächerlichen wie eigenartigen Kommentar absonderte: Auf den Vorwurf bzw. die Frage, drei Jahre hätte man von ihm seit seiner Wahl zum Ständerat nichts gehört und was er denn in diesen drei Jahren überhaupt gemacht habe, antworte Müller: «Ich musste mich zuerst im Ständerat vernetzen.» Das Resultat von Müllers «drei Jahre lang dauernden Vernetzungen» finden wir auf Blick. Passt irgendwie perfekt zu den überbordenden Kosten für die obligatorische Grundversicherung.
Tja, so ist das halt, liebe Kälber, wenn ihr euren Schlachter auch noch selber wählt. Damian «ich bin nicht schwul» Müller ist nur einer von Vielen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
So nutzen die Parteien Künstliche Intelligenz im Wahlkampf
Mithilfe von künstlicher Intelligenz kann man schnell und einfach Bilder oder Texte generieren. Was zu Spielereien einlädt, kann im Wahlkampf auch zur politischen Manipulation verwendet werden.
Auftrag eingeben, die Künstliche Intelligenz (KI) arbeiten lassen und schon wird ein Text verfasst oder ein Bild generiert: Mit KI-basierten Programmen wie Midjourney, Stable Diffusion oder ChatGPT ist das einfach möglich.
Risiken wie auch Chancen
Peter Kirchschläger, auf künstliche Intelligenz spezialisierter Ethik-Professor, sieht die Gefahr der zunehmenden Manipulation. Durch die Verwendung von KI im Wahl- und Abstimmungskampf wird es für Wählerinnen und Wähler zunehmend schwieriger zu erkennen, dass man beeinflusst wird. Was heute noch mit einem Wahlplakat am Bahnhof gemacht wird, könnte in Zukunft mit KI auf eine personalisierte und subtilere Weise geschehen.
Zugleich sieht der Ethik-Professor auch Chancen. So könnten durch die Hilfe von künstlicher Intelligenz Informationen leichter zugänglich gemacht werden. Zudem besteht die Chance, einfachere Austauschmöglichkeiten zu schaffen. «Dies bedingt aber alles, dass man entsprechend organisiert und reguliert», so Kirchschläger.
Wie reagieren die Parteien auf die neuen Möglichkeiten?
Eine Umfrage von SRF bei den Parteien ergibt: Der aktive Gebrauch von KI-basierten Programmen ist bei den Parteien noch nicht weit verbreitet. Die Grünen und die GLP benutzen ChatGPT, den auf künstliche Intelligenz basierten Chatbot, als Recherchetool. Die SP und die FDP haben damit erste Tests gemacht. Die Mitte und die SVP benutzen noch keine KI-basierten Programme. Zudem hat noch keine Partei einen Leitfaden zum Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Balthasar Glättli, der Präsident der Grünen, schlägt nun einen Ehrenkodex der Parteien vor. Eine freiwillige Verzichtserklärung aller Parteien, dass KI nicht für Negativ-Kampagnen verwendet wird. Die ersten Reaktionen der anderen Parteien, abgesehen von der SVP, sind gemäss Glättli positiv. «Wir müssen uns grundsätzlich darüber unterhalten, wie wir als Gesellschaft, als Staat und als Politik auf diese massive und schnelle technologische Entwicklung reagieren.»
Grüter: Ehrenkodex nicht zielführend
Auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums ist klar, dass KI ein zunehmend wichtiges Thema wird. Doch Franz Grüter, Luzerner SVP-Nationalrat, hält den Ehrenkodex nicht für zielführend.
Ein Kodex zwischen Parteien würde Private oder andere politische Akteure nicht davon abhalten, Negativ-Kampagnen zu betreiben. «Ich möchte zuerst schauen, dass wir hier innovativ mit dabeibleiben, und dann ist die Frage nach neuen Gesetzen und Regulationen für mich erst eine nachgelagerte Frage», so Grüter.
Im Herbst wird sich zeigen, ob und wie künstliche Intelligenz im Wahlkampf eingesetzt wird. Wie das gemacht werden kann, zeigt zurzeit das Ja-Komitee zum Klimaschutzgesetz. Mit einem auf künstliche Intelligenz basierten Abstimmungs-Butler wird versucht, das Stimmvolk an die Abstimmung zu erinnern. Schreibt SRF.
5.6.2023 - Tag der künstlichen Intelligenz bei der Polit-Elite
Dass der kommende Wahlkampf so oder so schmutzig wird wie selten zuvor, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und bezüglich «politischer Manipulation» waren die Schweizer Parteien durchs Band weg noch nie zimperlich.
Daran ändert auch die «Künstliche Intelligenz» nichts, solange die ganz normale menschliche Intelligenz, zu der auch die Empathie zu zählen wäre, bei den Polit-Granden mit der Lupe gesucht werden muss.
Aber weil bekannterweise die Hoffnung zuletzt stirbt, könnte es ja durchaus sein, dass die Polit-Elite dank KI doch noch etwas Intelligenz im kommenden Wahlkampf verbreitet statt der üblichen Parteidogmen und vorgestanzten Worthülsen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Genfer Staatsrat Maudet zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt
Pierre Maudet, der wiedergewählte Genfer Regierungsrat, ist wegen Vorteilsannahme zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Zudem muss er dem Kanton Genf eine Kompensationszahlung in Höhe von 50'000 Franken leisten. Bei der Zahlung handelt es sich um den geschätzten Gegenwert der umstrittenen Luxusreise nach Abu Dhabi im Jahr 2015. Maudet trat später von seinem Amt zurück. Die Strafe legte das Appellationsgericht des Kantons Genf fest. Sie beläuft sich auf 300 Tagessätze zu je 400 Franken, wie das Gericht mitteilte. Die Strafe wurde bedingt auf zwei Jahre ausgesprochen.
Eine Reise nach Abu Dhabi
Maudet war mit seiner Familie, seinem damaligen Stabschef sowie zwei Genfer Geschäftsleuten begleitet worden. Unter anderem stand auch der Besuch eines Formel-1-Rennens auf dem Reiseprogramm in Abu Dhabi. Die Kosten waren damals vollständig von der Königsfamilie des Emirats übernommen worden.
Die Reise brachte Maudet den Vorwurf der Vorteilsannahme ein. Das erstinstanzliche Genfer Polizeigericht verurteilte den ehemaligen FDP-Regierungsrat im Februar 2021 bereits zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je 400 Franken.
Maudet focht dieses Urteil zunächst erfolgreich an. Das Kantonsgericht sprach ihn Anfang 2022 frei. Es sah den Tatbestand der Vorteilsannahme als nicht erfüllt an. In der Folge legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein.
Das Bundesgericht befand schliesslich Maudet wiederum der Vorteilsannahme für schuldig und hob den Freispruch des Kantonsgerichts wieder auf. Es überliess es dem Appellationsgericht, die Höhe der Strafe festzulegen, die nun dem erstinstanzlichen Urteil entspricht.
Rücktritt und Neuwahl
Die Reise hatte auch politische Folgen für Maudet. Nachdem ihm die Genfer Kantonsregierung praktisch sämtliche Dossiers entzogen hatte, trat er zurück, um aber gleichzeitig auch wieder für seine Nachfolge zu kandidieren. Mit dieser Kandidatur bei den Staatsratswahlen scheiterte er jedoch zunächst.
Bei den Gesamterneuerungswahlen für die Genfer Kantonsregierung trat Maudet im April als Spitzenkandidat einer von ihm gegründeten neuen Partei an. Mit seiner Wahl in den Genfer Staatsrat schaffte er damit ein überraschendes Comeback. Die FDP hatte ihn zuvor im Zuge der Affäre aus der Partei ausgeschlossen. Schreibt SRF.
31.5.2023 - Tag der bürgerlichen Einheits-Sauce und ihren wohlstandsverwahrlosten Kindern
Würde die Luzerner FDP mit Kleptokraten so konsequent umgehen wie die Genfer, wären etliche Inhaber*innen von öffentlichen Ämtern bis hinunter zu Gemeinderäten*innen ihre finanziell einträchtigen Jobs los. Ich könnte jetzt mühelos eine Geschichte erzählen, die sich um den Gemeinderat einer Luzerner Gemeinde mit einem der höchsten Steuersätze des Kantons dreht.
Schaffte es doch der Magistrat, der bei Veranstaltungen und auch im persönlichen Gespräch wie ein Priester von der Kanzel herunter mit gesalbten Worten über Moral und Ethik zu seinen Schäfchen spricht, knapp 200'000 Franken zusätzlich zu seinem ohnehin schon üppigen Magistraten-Gehalt unter den Nagel zu reissen. Selbstverständlich zu Lasten der Steuerzahler*innen. Frei nach dem Motto «Wo kein Kläger, da kein Richter».
Ein Luzerner FDP-Parteimitglied, selber im Vorstand einer kantonalen FDP-Filiale, schrieb mir kürzlich: «Diese Einheits-Sauce der "Bürgerlichen" ist völlig fernab der Realität. Wohlstandsverwahrloste Kinder. Und Mitte sowie FDP an vorderster Front.»
Das sagt eigentlich mehr als meine gestammelten tausend Worte. Er vergass allerdings zu erwähnen, dass auch die Vertreter*innen der anderen Parteien nichts anderes sind als «wohlstandsverwahrloste Kinder».
Dass die westlichen Demokratien mit Zerfallserscheinungen zu kämpfen haben, hat viele Gründe. Die Parteien sind einer davon. Die Wiederwahl eines verurteilten FDP-Kleptokraten wie Maudet ein weiterer.
Der «FDP-Prediger von der Kanzel» aus dem Kanton Luzern liess noch etwas mehr an sinisterer Kreativität als Maudet walten: Er trat nach seinem 200'000-Franken-Coup vom Gemeinderatsamt zurück und liess sich ein Jahr später in «stiller Wahl» erneut in den Gemeinderat wählen. Sie wissen hoffentlich, was «stille Wahl» in Wirklichkeit bedeutet: Söihäfeli, Söideckeli. Der «Tages-Anzeiger» nennt das jedenfalls so im Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall aus dem Jahr 2014.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Ron DeSantis wagt sich in den USA aus der Deckung
Ron DeSantis ist die Zukunft der republikanischen Partei. Zu diesem Schluss konnte man jedenfalls vor einem halben Jahr kommen: Mit einem überragenden Sieg wurde der 44-Jährige in Florida als Gouverneur wiedergewählt. Ein Triumph in einem Bundesstaat, der viele Jahre als besonders zwischen Demokraten und Republikanern umkämpft galt – und ein Lichtblick an einem Wahltag, der für die Republikaner insgesamt zur Enttäuschung wurde.
Besonders Kandidatinnen und Kandidaten, die von Donald Trump unterstützt wurden, schifften ab. Mit Trump, so schien es, können die Republikaner nicht mehr gewinnen. Der ehemalige Präsident wirkte geschwächt.
DeSantis schien die offensichtliche und viel jüngere Alternative: ein «Trump ohne Drama», also ohne Skandale und Gerichtsverfahren, ein Gouverneur, der sich darauf versteht, nationales Aufsehen zu erregen. Es galt nur noch als eine Frage der Zeit, bis sich DeSantis, der 2018 notabene mit Trumps Unterstützung Gouverneur geworden war, aus der Deckung wagen und seine Präsidentschaftskandidatur verkünden würde.
Unglücklicher Start in den Wahlkampf
Doch ein halbes Jahr ist in der US-Politik eine lange Zeit. Heute wissen wir: Die republikanische Basis scheint Donald Trump die Treue zu halten. In Umfragen führt er das Feld der republikanischen Präsidentschaftsanwärterinnen und -anwärter deutlich an.
DeSantis bleibt sein gefährlichster Gegner – doch manche erklären, seine Kandidatur sei gescheitert, bevor sie begonnen hat. Dass sich die gehypte Ankündigung wegen technischer Probleme verzögerte, ergab den Eindruck eines amateurhaften Wahlkampfauftakts.
Kritiker sagen auch, DeSantis verstehe sich nicht auf «retail politics», also auf den direkten Kontakt mit Wählern. Er könne nicht mithalten mit dem Charisma von Trump. DeSantis wird sich auf heftige Angriffe von Trump gefasst machen müssen. Es ist offen, wie sich DeSantis im republikanischen Vorwahlkampf gegen Trump schlagen wird, dem im politischen Nahkampf kaum jemand gewachsen ist.
DeSantis' Kreuzzug gegen den «Wokeism»
Wenigstens vermuten lässt sich, auf welche Themen DeSantis setzen wird: Während der Covid-Pandemie habe er sich gegen den «biomedizinischen Sicherheitsstaat» mit seinen Lockdowns und Impfausweisen widersetzt, schreibt DeSantis in einem neuen Buch. Florida sei in der Pandemie zur Bastion der Freiheit und Vernunft geworden und zur Blaupause für das ganze Land.
DeSantis verschrieb sich zudem ganz dem Kulturkampf, der in den USA ausgetragen wird: An den Schulen in Florida verbot er teilweise den Unterricht über sexuelle Orientierung, per Gesetz hat er eingeschränkt, welche Bücher in Schulbibliotheken stehen dürfen. DeSantis führt eine Art Kreuzzug gegen den «Wokeism», die linke Indoktrination, die er vielerorts zu erkennen meint. Als «Disney» eines von diesen Gesetzen kritisierte, brach DeSantis einen Streit mit einem der grössten Arbeitgeber in Florida vom Zaun.
Das mag die republikanische Basis begeistern. Es ist aber fraglich, ob sich damit eine Präsidentenwahl gewinnen lässt. Glaubt man den Umfragen, so liegt DeSantis weit hinter Donald Trump zurück. Doch sein Wahlkampf steht noch ganz am Anfang. Die ersten Vorwahlen stehen erst in deutlich mehr als einem halben Jahr an. Und das ist in der US-Politik eine lange Zeit. Schreibt SRF.
25.5.2023 - Tag der Kandidaten mit und ohne Gehirn
Die Vorwahlen für die amerikanische Präsidentschaft 2024 versprechen schon jetzt spannende Unterhaltung auf allertiefstem Niveau zwischen dem «Trump mit Gehirn», wie DeSantis in den USA gern genannt wird, und dem Original ohne Gehirn.
Auf jeden Fall wird's schmutzig. Drohte doch The Donald bereits im Vorfeld sybillinisch mit pikanten Enthüllungen über seinen Kontrahenten «mit Gehirn». «Ich weiss mehr über ihn als jeder andere - mit Ausnahme vielleicht seiner Frau» orakelte der Mann «ohne Gehirn» in einem Interview mit Fox News.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Bei diesen Lebensmitteln sinken jetzt die Preise
Die Inflation drückt aufs Haushaltsbudget. Der Wettkampf um die Supermarkt-Kundschaft zieht an. Coop inszeniert sich als grosszügiger Preissenker. Doch auch bei anderen befragten Händlern sinken punktuell die Preise. Entwarnung an der Preisfront gibt es aber keine.
Monatelang ist alles teurer geworden. In den Supermärkten, aber auch in den Discountläden. Allerdings: Im April blieben die Konsumentenpreise in der Schweiz gegenüber dem Vormonat konstant. Jetzt sorgt Coop mit grossflächigen Werbeanzeigen für Aufmerksamkeit: «Wir haben bei über 200 Markenartikeln die Preise gesenkt.» Auch Lidl wirbt mit «XXL Spar»-Tagen. Reine Preiskosmetik aus den PR-Abteilungen der Unternehmen?
Nachrichten wie diese machen jedenfalls preisbewussten Konsumentinnen und Konsumenten Hoffnung, dass die hohen Preise für Lebensmittel endlich wieder sinken. Die Inflationsrate für den Mai liegt noch nicht vor, offenbar tut sich aber was an der Preisfront. «Seit einigen Wochen kehrt der Wind und die Situation scheint sich etwas zu entspannen», bestätigt Migros-Sprecher Marcel Schlatter.
Die grosse Teuerungs-Entspannung bleibt bislang aber aus. Seit Jahresbeginn gibt es mehr Preiserhöhungen als Reduktionen beim orangen Riesen. So auch bei der Discount-Tochter Denner, wie Sprecher Thomas Kaderli auf Anfrage bestätigt. Er verspricht: «Wir verhandeln weiter hartnäckig mit unseren Lieferanten.»
Diese Lebensmittel gibts günstiger
Gut 2000 Produkte umfasst das Standard-Sortiment bei Denner. Seit Jahresbeginn haben die Verantwortlichen die Preise von 250 Produkten dauerhaft gesenkt. Das entspricht rund 13 Prozent des Sortiments. Beispiele: Toffifee kostet neu 2 Franken, 20 Rappen weniger als zuvor. Der Preis vom Emmi-Becherdrink Caffè Latte sinkt um 5 Rappen auf 2.10 Franken. Bei den Eigenmarken wurden Eierspätzli 50 Rappen billiger. Sie kosten neu 2 Franken.
Beim Discounter Lidl sind 150 Preissenkungen bei Artikeln zusammengekommen, «am deutlichsten in den Bereichen gekühlte Feinkost wie Salatdressings und Birchermüesli, Kosmetik und Käse», sagt Sprecher Mathias Kaufmann. Lidl – mit ebenfalls einem Sortiment von 2000 Produkten des täglichen Bedarfs – leiste sich keine «ineffizienten Distributionen und kein teures Marketing», kann der Sprecher sich eine Spitze auf die beiden Grossverteiler nicht verkneifen.
Die Kostentreiber bleiben bis auf Weiteres
Gleichzeitig sei man aktuell immer noch mit hohen Rohstoff- und Energiepreisen konfrontiert. «Einzelne Produkte können auch teurer werden», sagt Kaufmann von Lidl weiter.
Ins gleiche Horn stösst Aldi. Sagt aber: «Wo ein Kostenvorteil entsteht, geben wir ihn natürlich an unsere Kundschaft weiter.» Für Preis-Unsicherheit im Detailhandel sorgen zudem auch die Kostentreiber Transport und Verpackung.
Auf breiter Front werden Nahrungsmittel folglich in den kommenden Monaten nicht günstiger. Dafür sorgt der Wettbewerb unter den Grossen weiter für punktuelle Preissenkungen. Legt der eine vor, zieht der andere nach. Das geht hoffentlich schneller als es bei den Tankstellenbetreibern der Fall ist, wenn der Ölpreis fällt.
Eigenmarken stärker gefragt
Derweil spüren alle befragten Detailhändler, dass die Nachfrage nach günstigeren Artikeln wie M-Budget, Prix-Garantie und Eigenmarken der Discounter stetig steigt. «Unter dem Strich ist das Thema Preis allgemein stärker in den Fokus bei unseren Kundinnen und Kunden gerückt», sagt Lidl-Sprecher Kaufmann.
Neben den 200 Markenprodukten hat Coop auch bei 60, der rund 1500 Produkte der Prix-Garantie-Linie, die Preise gesenkt. Darunter etwa die Packung Frischbackbrötchen um 17 Prozent auf 1 Franken.
Fragen zum Ausmass der Preiserhöhungen beantwortet Coop nicht. Das Standard-Sortiment beim Basler Grossverteiler ist mit 5000 bis 40'000 Food- und Non-Food-Artikeln je nach Grösse der Verkaufsstelle deutlich grösser als jenes der Discounter oder auch Dorfläden.
Zu letzteren gehört Volg. «Die Situation im Preismarkt hat sich stabilisiert», macht Sprecherin Tamara Scheibli Hoffnung. Entwarnung gibt sie aber nicht. Immerhin: Bei Papierwaren und Brot würden sich auf Mitte Jahr Preissenkungen abzeichnen. Schreibt Blick.
24.5.2023 - Tag der Gamechanger und Lebensmittel, die gar keine sind
«Toffifee» und «Emmi-Becherdrink Caffè Latte» sind definitiv nicht DIE Gamechanger, um den teilweise exorbitant gestiegenen Lebensmittelpreisen den Garaus zu machen. Diese beiden Artikel überhaupt als «Lebensmittel» zu klassifizieren, verlangt einiges an Chuzpe.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Wasserquellen-Verkauf an China kein Problem für Bundesrat: «Lex China» versenkt
Immer mehr Schweizer Unternehmen gehören ausländischen Investoren. Im Wallis wollen Chinesen gar eine Wasserquelle kaufen. Während viele Parlamentarier solche Übernahmen einschränken wollen, sieht der Bundesrat keinen Handlungsbedarf.
Die chinesische Wirtschaft wächst und wächst – und mit ihr der Hunger nach lukrativen Investitionen im Ausland. Bereits im März wurde bekannt, dass chinesische Investoren am Kauf einer Wasserquelle in Turtmann VS interessiert sind.
Bei Parteien von Mitte bis Links regt sich Widerstand gegen solche Pläne. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (37, AG) hat einen Vorstoss mit dem Titel «Kein Verkauf von Trinkwasserquellen an ausländische Anleger» lanciert. Ein ähnliches Anliegen verfolgt die «Lex China» von Mitte-Ständerat Beat Rieder (60, VS).
China auf Shopping-Tour
Immer mehr Schweizer Unternehmen gehören chinesischen Investoren. Der Saatguthersteller Syngenta aus Basel oder die Flugzeugwartungsfirma SR Technics sind nur zwei Beispiele von vielen. Eigentlich eine logische Folge der freien Marktwirtschaft und der Globalisierung. Doch diese Entwicklung birgt auch Gefahren.
Die grösste Sorge ist diejenige einer übermässigen Abhängigkeit von einem einzigen Land. Bereits jetzt ist die Schweiz aufgrund globaler Lieferketten stark vom Reich der Mitte abhängig. Besonders brisant: Viele chinesische Unternehmen sind sehr staatsnah oder werden gar direkt von der kommunistischen Partei kontrolliert. Somit besteht die Gefahr politischer Einflussnahme durch das autoritäre Einparteienregime.
Dieser Einfluss – sollte er zu gross werden – kann zu einem Problem für die Schweiz werden. Noch grösser wird die Gefahr, wenn es sich beim verkauften Gut nicht «nur» um eine Firma handelt, sondern um etwas so Essenzielles wie zum Beispiel eine Wasserquelle.
National- und Ständerat wollen Einschränkungen
Wermuth möchte deshalb vom Bundesrat wissen, wie viele Schweizer Wasserquellen bereits in ausländischen Händen sind. Weiter soll geklärt werden, mit welchen Gesetzesänderungen die Verkäufe von Quellen ans Ausland verhindert – oder bereits erfolgte Verkäufe rückgängig gemacht – werden können.
Bei Rieders «Lex China» geht es um allgemeine Verkäufe von wichtigen Schweizer Firmen an ausländische Investoren. Rieder will, dass Verkäufe von für die Schweiz wichtigen oder staatsnahen Unternehmen in Zukunft vom Bund bewilligt werden müssen. Beide Räte haben der «Lex China» zugestimmt.
Bundesrat fürchtet wirtschaftlichen Nachteil
In beiden Fällen hält der Bundesrat nichts von den Plänen der Parlamentarier. Im Fall von Wermuths Vorstoss verweist er primär auf die Zuständigkeit der Kantone für die Wasserversorgung. Er sehe «zurzeit keinen Handlungsbedarf». Und dies, obwohl er nicht weiss, wie viele Quellen bereits verkauft wurden. «Das scheint mir eine Unterschätzung des Problems», sagt Wermuth. Er werde das Thema in der Wirtschaftskommission nochmals zur Sprache bringen.
Bei beiden Vorstössen befürchtet der Bundesrat einen Nachteil für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Er hat die «Lex China» bei der Umsetzung regelrecht zusammengestrichen. Lediglich im Rüstungs-, Strom-, Gesundheits- oder Telekombereich soll der Staat prüfen, ob beispielsweise Spionagegefahr besteht. Schreibt Blick.
18.5.2023 - Tag der versenkten Lex China
Es wird ja wohl irgendeinen Grund geben, weshalb Alt-Bundesrat Ueli Maurer kürzlich dem chinesischen Botschafter Wang Shihting* in der Schweiz ohne Absprache mit dem Bundesrat einen Besuch abgestattet hat. Laut Botschaft «tauschten sich beide Seiten ausführlich über die innovative strategische Partnerschaft zwischen China und der Schweiz sowie die Wirtschafts-, Finanz- und Industriekooperation zwischen den beiden Ländern aus».
Sprich «die Lex China» wurde versenkt. Ebenso die hehren Ankündigungen sämtlicher Politiker*innen aus der Corona-Zeit, «systemrelevante» Abhängigkeiten von China abzubauen und künftig zu vermeiden. Dass bei Ausbruch der Pandemie eine chinesische Virus-Schutzmaske – organisiert von jungen SVP-Boys – pro Stück bis zu 14 Franken kostete, ist längst vergessen. Interessant auch, wer da so alles aus der Schweizer Polit- und Wirtschaftselite die Finger in dieser schmutzigen Abzocke mit im Spiel hatte*.
Es ist und bleibt leider eine Tatsache, dass ausgerechnet die Apologeten der aufgepeppten Wilhelm Tell-Saga, die sie als Götzenfigur vom ehemaligen Rütli und heutigen Herrliberg wie eine Monstranz nicht nur an der Auffahrt vor sich hertragen, für Bares selbst ihre Grossmutter an «fremde Fötzel» verkaufen würden. Vorausgesetzt, der Preis stimmt.
Dass Ueli Maurer selbst als Bundesrat niemals etwas anderes war als «His Master's Voice» hat er hinlänglich bewiesen. Er ist stets das geblieben was er schon immer war: Der treue Parteisoldat und spätere Parteipräsident der SVP.
*Bleibt zu hoffen, dass der Name nicht Programm ist.
**Das Medium IP enthüllte in etlichen Berichten, dass von Schweizer Steuergeldern mehrere Personen (u. a. die sogenannten «Maskenkids» aus dem Umfeld der Familie Hildebrand-Dreyfus) zu vielfachen Multimillionären wurden.Diese gründeten in Osteuropa, z.B. in Polen, Firmen. Pikant dabei ist, dass die Ehefrau Philipp Hildebrands, Margarita Louis-Dreyfus aus Osteuropa stammt. Das wirft die Frage auf, wie junge Menschen um die 20 Jahre und ohne Kenntnisse osteuropäischer Sprachen auf die Idee kamen, in Ländern des ehemaligen Ostblocks Firmen zu gründen und schon kurz vor der sogenannten Corona-Krise sogar Masken in grossem Umfang bestellten.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Mitarbeiterin klagt gegen Ex-Trump-Anwalt Rudy Giuliani: «Musste nackt arbeiten – Oralsex war Pflicht»
Eine Ex-Mitarbeiterin verklagt Rudy Giuliani wegen sexueller Übergriffe. Die Vorwürfe sind übel. Für das Erlebte fordert die Frau 10 Millionen US-Dollar Schmerzensgeld.
Eine ehemalige Mitarbeiterin von Rudy Giuliani (78) hat den ehemaligen New Yorker Bürgermeister wegen «weitreichender sexueller Übergriffe und sexueller Belästigung» verklagt. Noelle Dunphy (43) fordert 10 Millionen Dollar (8,9 Millionen Franken) Schmerzensgeld von dem früheren Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump (76), wie aus der am Montag in New York eingereichten 70-seitigen Klageschrift hervorgeht. Demnach wirft Dunphy Giuliani auch Lohndiebstahl vor.
In der Anklageschrift ist die Rede von «alkoholgeschwängerten» Schimpftiraden mit sexistischen, rassistischen und antisemitischen Bemerkungen, die das Arbeitsumfeld «unerträglich» gemacht hätten. Der ehemalige Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump soll der Klage zufolge «oft Oralsex verlangt haben, während er Telefonate mit ranghohen Freunden und Klienten führte, darunter der damalige Präsident Trump».
Befriedigung sexueller Wünsche war Voraussetzung für Anstellung
Dunphy begann demnach im Januar 2019 als Leiterin für Geschäftsentwicklung für Giuliani zu arbeiten, für ein Gehalt von einer Million Dollar pro Jahr. Ihren Angaben zufolge begann Giuliani mit dem Missbrauch fast unmittelbar nach Beginn des Arbeitsverhältnisses. «Er machte klar, dass die Befriedigung seiner sexuellen Wünsche, die praktisch jederzeit, überall kamen, eine absolute Voraussetzung für ihre Anstellung war», heisst es in der Klageschrift weiter.
Demnach zwang Giuliani sie in seinem Apartment «gegen ihren Willen» zu Oralsex. Zudem habe Giuliani «oft verlangt, dass sie nackt arbeitet, im Bikini oder in kurzen Hosen, mit einer amerikanischen Flagge, die er für sie gekauft hatte». Zudem soll Giuliani die Klägerin oft «aus seinem Bett» angerufen haben, «wo er erkennbar unter einem weissen Laken sich selbst anfasste».
«Dies ist reine Schikane und ein Erpressungsversuch»
Dunphy wirft Giuliani zudem vor, ihr gegenüber erklärt zu haben, ihre Bezahlung werde «aufgeschoben und ihre Anstellung ‹geheim› gehalten», bis sein Scheidungsverfahren beendet sei. Der Klageschrift zufolge arbeitete sie bis Januar 2021 für Giuliani.
Ein Sprecher des 78-Jährigen erklärte in einer Mitteilung an US-Medien, Giuliani weise «die Vorwürfe in der Klage entschieden und vollumfänglich zurück» und wolle «vollständig gegen diese Behauptungen vorgehen». «Dies ist reine Schikane und ein Erpressungsversuch», sagte der Sprecher.
Giuliani war acht Jahre lang Bürgermeister von New York und genoss Anerkennung für seine Arbeit in der Finanzmetropole. In den vergangenen Jahren litt sein Ruf jedoch, vor allem wegen seiner Unterstützung für die von Ex-Präsident Trump vertretene, vielfach widerlegte Verschwörungstheorie eines gestohlenen Wahlsiegs im Jahr 2020. Schreibt Blick.
17.5.2023 - Tag der Schluckspechte aus New York
Es wird Sie wohl kaum überraschen, dass ausgerechnet dieser Blick-Artikel über den alten New Yorker Lustmolch im Tagesranking der meistgelesenen Publikationen des Boulevardblättlis Rang Eins bekleidet. Und das hat diese investigative Recherche auch verdient.
Dass die Putzfrau dem Schrumpfpimmel von Giuliani mittels Oralsex ein bisschen Leben einhauchen musste geht ja noch. Verlangt ohnehin jeder noch einigermassen potente Rentner von seinem fleischgewordenen Blasbalg. Daran gibt's nichts auszusetzen. Auch alte Zitronen haben noch Saft. In Italien nennt man diese Art von Housekeeping nicht umsonst «Bunga Bunga Spitex», was vom Latein in die deutsche Sprache übersetzt nichts anderes als «Schluckspecht» heisst.
Dass Noelle Dunphy allerdings nackt die Bude von The Donalds Kumpel staubsaugen musste ist inakzeptabel. Wie leicht hätte sich die entblösste Noelle erkälten können? Unvorstellbar, was sie durchgemacht haben muss. Dafür gehört Giuliani wirklich bis ans Ende seines Lebens hinter Gitter. Dauert ja ohnehin nicht mehr so lange wie's schon gedauert hat.
Erstaunlich ist, dass dieser meistgelesene Blickbaiting-Artikel trotz Clickbaiting nicht eine einzige Lesermeinung erzeugte. Aber das ist ja jetzt gründlich und kompetent nachgeholt. Wenn auch nicht im Blick.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Ylfete Fanaj erobert für SP Sitz in Luzern zurück: «So vielfältig wie jetzt war die kantonale Regierung noch nie»
Mit Ylfete Fanaj wird erstmals eine Person mit Wurzeln in Ex-Jugoslawien Regierungsrätin. Sie sehe sich in erster Linie als Luzernerin, sagt die SP-Frau, die einen wichtigen Sitz für ihre Partei gewann.
Fertig Männerklub! Seit Sonntag ist klar, dass in der Regierung des Kantons Luzern wieder zwei Frauen vertreten sind. Ylfete Fanaj (40) schaffte am Sonntag die Wahl für die SP. Bereits im ersten Wahlgang im April wurde Michaela Tschuor (Mitte) in die Regierung gehoben.
Bei der SP ist die Freude besonders gross. Sie hat mit Fanaj die Rückkehr in die Luzerner Regierung geschafft – nach achtjähriger Abwesenheit. Sie freue sich über diesen Fakt fast mehr, als den persönlichen Wahlerfolg, sagt Fanaj bescheiden zu Blick.
Der Kanton Luzern wurde in den vergangenen acht Jahren von einem rein bürgerlichen Männergremium regiert. «So vielfältig wie jetzt war die kantonale Regierung noch nie», jubelte Fanaj in der Whiskybar, in der bei Regenwetter gefeiert wurde.
«In erster Linie Luzernerin»
Mit ihr wird erstmals eine Person mit Wurzeln in Ex-Jugoslawien Regierungsrätin. Neun Jahre alt war sie, als sie aus einem Dorf in Kosovo nach Sursee im Kanton Luzern flüchtete. Heute lebt sie mit ihrem Kind und ihrem Mann in der Stadt Luzern.
Sie mag es nicht sonderlich, auf ihre Integration reduziert zu werden: «Ich sehe mich heute in erster Linie als Luzernerin, auch wenn meine Migrationsgeschichte zu mir gehört», sagt sie. Bei anderen Kandidaten sei zudem nicht erwähnt worden, dass sie Migrationshintergrund hätten.
Das zeige, dass das Thema noch nicht ganz normal sei in der Schweiz. Es sei jedoch richtig und wichtig, dass die vielfältige Bevölkerung Luzerns auch in der Regierung abgebildet werde, so Fanaj.
Secondas erobern Politik
Dass Secondas Exekutivämter in der Schweiz bekleiden, wird inzwischen immer normaler: 2020 etwa wurde Maria Pappa (52) als erste St. Galler Stadtpräsidentin gewählt. Die italienischen Wurzeln der SP-Kandidatin waren im Wahlkampf so gut wie kein Thema.
Auch SP-Co-Präsident Cedric Wermuth (37) gratulierte seiner «Freundin und Genossin» Fanaj am Sonntag auf Twitter zur Wahl. Die SP kehre «triumphal in die Luzerner Regierung zurück» freute er sich.
Fanaj ist Sozialarbeiterin und kann auf viel Erfahrung in der Politik zählen. 2007 wurde sie ins Luzerner Stadtparlament gewählt, seit 2011 sitzt sie im Kantonsrat, war dort Fraktionschefin und Kantonsratspräsidentin.
Regierung neu zusammengesetzt
Am Sonntag konnte die Luzerner SP-Frau auch auf die Hilfe der Mitte und der Grünen zählen, die sie zur Wahl empfohlen hatten. Die Kandidatin der Grünen, Christa Wenger, hatte sich nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen.
Mühelos gelang die Wahl auch Armin Hartmann, der den SVP-Sitz in der Regierung verteidige. Damit ist die fünfköpfige Luzerner Regierung nun wieder komplett. Bereits im ersten Wahlgang vom 2. April wurden Fabian Peter (FDP, bisher), Reto Wyss (Mitte, bisher) und eben Michaela Tschuor gewählt. Schreibt Blick.
16.5.2023 - Tag von Dick und Dünn im Luzerner Kantonsrat
Wie Napoleon, leicht abgeändert, treffend sagte: «Von der Vielfalt zur Einfalt ist nur ein kleiner Schritt.»
Dass der dicke Präsident vom frohlockenden Luzerner Hauseigentümerverband*, Armin Hartmann (SVP), «mühelos» gewählt worden ist, stimmt so nicht. Immerhin musste der Politiker mit der Körperfülle eines Samurais zu einem zweiten Wahlgang antreten. Die Mühsal für ihn beginnt sowieso erst jetzt, wenn er sich in einen der Stühle im Luzerner Kantonsrat quetschen will. Für seinen Bodyindex muss mindestens ein XXL-Sofa angeschafft werden, damit er überhaupt Platz nehmen kann.
* Wie sagte Bertolt Brecht, passend zur Wahl vom Präsidenten vom Luzerner Hauseigentümerverband und der katastrophalen Wohnungsmisere in der Stadt Luzern, ebenfalls leicht abgewandelt: «Nur die dümmsten Mieter wählen ihre Liegenschaftsverwalter selber.»
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Self-Check-out-Betrüger tricksen die Migros mit einer dreisten Masche aus
Filialen der Migros Aare werden vermehrt Opfer von Self-Check-out-Betrügern. Mit einer simplen Masche schlagen sie immer wieder zu. Nun ist ihnen der orange Riese auf die Schliche gekommen.
In Aargauer Migros-Filialen ist es zu einer ungewöhnlichen Häufung von Betrügereien an Self-Check-out-Kassen gekommen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, sind gleich mehrere Serientäter geschnappt worden. Gegen sie wurden Strafbefehle ausgesprochen.
Die Masche an den Selbstbedienungskassen des orangen Riesen war immer die gleiche. Die Täterinnen und Täter scannen ihren Einkauf an der Self-Check-out-Kasse. Bevor sie bezahlen, löschen sie einige Produkte wieder. Nehmen sie aber mit, ohne sie zu bezahlen.
14 Mal zugeschlagen
Ein klarer Fall von Diebstahl? Nein, die Ganoven begehen einen «geringfügigen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage», wie es im Bericht heisst. Weil die Serientäter die Artikel gescannt haben, handelt es sich nicht um einen Diebstahl.
14 Mal schlug ein 30-jähriger Mann zu. Er entwendete 130 Franken. Nun muss er eine Busse und Gebühren in der Höhe von 1040 Franken bezahlen. Eine 35-jährige Kundin ergaunerte Waren im Wert von 190 Franken. Ihr wurde eine Strafe von 1000 Franken aufgebrummt. Eine weitere Frau (32) entwendete gar Produkte im Wert von 460 Franken.
«Die Mehrheit ist ehrlich»
Und was sagt die Migros? Das Problem sei bekannt, die Lage aber nicht prekärer als in anderen Läden. «Die allergrösste Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden ist vertrauenswürdig und ehrlich und nutzt die neuen Technologien zur Vereinfachung ihres Einkaufs», sagt ein Sprecher zur «Aargauer Zeitung». Die Kontrollen würden ständig weiterentwickelt. Schreibt Blick.
14.5.2023 - Tag der vom Boulevard gelieferten Anleitung zum Klauen
Dass in den grossen Detailhandelsläden seit jeher geklaut wird was die Regale hergeben, ist nun wirklich keine neue Erkenntnis. Die Leidtragenden dieser skrupellosen Gaunerei sind in erster Linie wir Kunden und nicht Migros & Co. Denn die grossen Detailhandelsketten schlagen die Verluste in Millionenhöhe, die ihnen aus den Laden-Diebstählen entstehen, auf die Endpreise der Produkte. Das hat mir vor vielen Jahren der legendäre MIGROS-Pressesprecher Urs Peter Naef bestätigt.
Neu hingegen ist jedoch, dass das Boulevardblättli von der Zürcher Dufourstrasse im Artikel auch gleich noch die simple Anleitung für potenzielle Langfinger mitliefert, wie die MIGROS beim Self-Check-out für die bargeldlose Bezahlung auf einfachste Art und Weise betrogen werden kann.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
SVP-Glarner hetzt gegen Gender-Tag an Schule in Stäfa ZH
Die Schule in Stäfa ZH hat Sekundarschülerinnen und –schüler zu einem Gender-Tag am 15. Mai eingeladen. Die Einladung verbreitet sich im Netz und löst bei Gender-Gegnern Empörung aus. Jetzt wird die Schule von Unbekannten telefonisch terrorisiert.
Im Netz hat das Foto einer Einladung zu einem Gender-Tag für Sekundarschüler an der Schule in Stäfa im Kanton Zürich für Wirbel gesorgt. Wütende Gender-Gegner wähnen die grosse Umerziehung. Geteilt wurde die Einladung unter anderem auch von SVP-Nationalrat Andreas Glarner (60), der prompt die Entlassung der Schulleitung forderte.
«Wenn das echt ist, dann ist es eine Sauerei», regt sich ein Nutzer auf. «Gender-Tag, was für ein Scheiss», schreibt ein anderer.
Telefon-Terror durch Unbekannte
Die Empörungswelle im Netz hat für die Schule unangenehme Folgen. Schulverwaltung und Sozialarbeiter erreichen viele Anrufe von Unbekannten. Auch der Schulleitung ist der Wirbel um den Gender-Tag natürlich nicht verborgen geblieben.
Auf Blick-Anfrage antwortet Schulpräsidentin Daniela Bahnmüller: «Seit zehn Jahren führt die Schule Stäfa für Schülerinnen und Schüler der 2. Sek-Klassen einen Gender-Tag durch. Wir bedauern sehr, dass dieses bewährte Format nun in den sozialen Medien aus dem Zusammenhang gegriffen und falsch dargestellt wurde. Das zeigt, wie emotional diese Diskussion teilweise noch geführt wird.»
Gender-Tag gehört zum Lehrplan 21
«Gehört das zum Lehrplan 21?», wollten viele im Netz wissen und tatsächlich: Man müsse das Thema «wie alle anderen Schulen im Kanton Zürich» behandeln, gibt Bahnmüller an. Im Lehrplan 21, der in der Deutschschweiz die Lehrpläne für die Volksschule harmonisiert, sei das Thema «Geschlechter und Gleichstellung» als fachübergreifendes Thema und überfachliche Kompetenz verankert.
«Es ist der Anspruch der Schule Stäfa, relevante gesellschaftliche Themen offen und fundiert zu thematisieren», macht sie deutlich. Angesichts der teils hitzig geführten Debatte sei es wichtig, «dieses Thema sachlich und transparent zu behandeln und mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren».
Was genau ist Inhalt des Gender-Tags? «Die Jugendlichen setzen sich am Gender-Tag mit verschiedenen Rollenbildern, der Vielfalt von Lebensentwürfen sowie den Themen Liebe, Beziehungen und Sexualität auseinander. Der Tag soll Fachwissen vermitteln und die Jugendlichen ermutigen, eigene Normen und Werte zu reflektieren», erklärt Bahnmüller. Die Diskussionen erfolgen in nach Geschlechtern getrennten Gruppen.
Bereits vor den Frühlingsferien ist ein Brief an die Eltern mit umfassenden Erklärungen gegangen. Bei dem Schreiben, das derzeit in den sozialen Medien kursiere, handelt es sich um ein einfaches Erinnerungsschreiben für die Jugendlichen. Negative Reaktionen oder Abmeldungen hat es nicht gegeben. Von der im Netz gefürchteten Umerziehung also keine Spur. Schreibt Blick.
10.5.2023 - Tag des Aargauer SVP-Präsidenten, den man Dummschwätzer nennen darf
Es gibt Gründe, warum man den im Geiste armseligen Aargauer SVP-Präsident Andreas Glarner laut Gerichtsbeschluss einen «Dummschwätzer» und noch Vieles mehr nennen darf. Glarners Reaktion auf den «Gendertag» ist einer davon. Eigentlich ist es auch völlig egal, was dieser «dumme Mensch (Glarner), ein infantiler Dummschwätzer und Profiteur» an Bullshit täglich absondert: Er entschuldigt sich ja in der Regel am nächsten Tag sowieso dafür.
Unerklärlich ist allerdings, wieso solche Banalitäten beim Blickbaiting-, pardon beim Clickbaiting-Monster von der Zürcher Dufourstrasse überhaupt den Weg auf die Frontseite findet. Ist es das Kleinvieh, das auch Mist macht?
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
US- und EU- Geopolitik: Hybris des Westens
Das Rezept „Demokratie gegen Diktatur“ ist global gesehen zu schlicht. Die USA und Europa müssen sich mit ihrem Bedeutungsverlust auseinandersetzen.
Die neue globale Trennungslinie scheint „Demokratie gegen Autokratie“ zu sein. US-Präsident Joe Biden trommelt Demokratiegipfel zusammen, um eine vom Westen angeführte internationale Front gegen die autoritären Bedrohungen aus Russland und China zu bauen. Der Westen scheint seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wieder auferstanden zu sein, als moralische Wertegemeinschaft und schlagkräftiger politischer Player. Sogar das etwas ausgebleichte Freiheitsversprechen glänzt wieder.
In Europa wirkt diese Erzählung derzeit aus guten Gründen überzeugend. Putins neoimperiale Aggression zielt über die Ukraine hinaus. Die Sicherheit Europas wird, wie seit 1990 nicht mehr, von dem atomaren Drohungspotenzial der USA gewährleistet. Nur wenn der Westen vereint auftritt, wird er der russischen Aggression langfristig Einhalt gebieten.
Das Bild „Demokratie gegen Diktatur“ mag verführerisch klar sein, aber es ist als globales Rezept zu schlicht. Olaf Scholz, ansonsten Bidens treuer Verbündeter, reiht sich zu Recht nur halbherzig in den Feldzug gegen die Diktaturen ein und warnt in einem Beitrag für die Zeitschrift Foreign Affairs vor „einer neuen Zweiteilung der Welt in Demokratien und autoritäre Staaten“. Es gibt triftige Gründe, die gegen die gefeierte Renaissance des Westens sprechen – und noch mehr gegen die Aufspaltung der Welt in ein moralisch überlegenes, überwiegend weißes Zentrum und einen autoritären Rest.
Vielleicht ist die Beschwörung westlicher Werte nur die Begleitmusik, die den globalen Niedergang der USA und Europas übertönen soll. Die USA haben vor 20 Jahren noch achtmal so viele Waren und Dienstleistungen hergestellt wie China, heute ist dieser Vorsprung auf 25 Prozent geschrumpft. In den 38 OECD-Staaten, die sich Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen, also im erweiterten Westen, leben nur 16 Prozent der Weltbevölkerung. Global unangefochten führend ist der Westen nur in einem Metier: Waffen. Die USA geben doppelt so viel Geld für Rüstung aus wie Russland, China und Indien zusammen. In den Nato-Staaten lebt ein Achtel der Weltbevölkerung – aber sie zahlen 50 Prozent der globalen Rüstungsausgaben.
Selbstbestimmung nur für weiße Europäer gedacht
Um die Ambivalenz des mit Waffen und Weltanschauung ausgerüsteten Westens zu verstehen, nutzt ein Blick zurück auf den Moment, in dem der Westen als Verbindung der Machtzentren USA und Europa auf der Weltbühne erschien. Die Vereinigten Staaten traten 1917 auf der Seiten von Frankreich und Großbritannien, den europäischen Demokratien, in den Ersten Weltkrieg ein. Woodrow Wilson fuhr 1919, als erster US-Präsident überhaupt, ins Ausland.
Er reiste mit einer großformatigen Idee im Gepäck nach Europa – dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, das zwischen Paris und Belgrad eine gerechte Nachkriegsordnung stiften sollte. Mit Wilsons Reise begann das amerikanische Jahrhundert, in dem die USA in der Doppelrolle als Weltpolizist und Lehrmeister in Sachen Demokratie aufzutreten gedachten. Inder und Vietnamesen, Ägypter, Koreaner und Chinesen waren begeistert von Wilsons Idee, dass die Völker fortan selbst über ihr Schicksal bestimmen sollten. Und sie wurden bitter enttäuscht.
Denn Selbstbestimmung war nur für weiße Europäer gedacht, nicht aber für Bewohner der europäischen Kolonien. Ein 25-jähriger chinesischer Intellektueller notierte 1919 nach dem frustrierenden Ende der Versailler Verhandlungen in sein Tagebuch: „So viel zur nationalen Selbstbestimmung.“ Sein Name war Mao Zedong. Die Verwandlung prowestlicher asiatischer Idealisten in Kommunisten ist, wie der Publizist Pankaj Mishra gezeigt hat, ohne den Rassismus des Westens kaum zu verstehen.
Menschenrechte mit eigenen Interessen abgeglichen
Die Apologeten des Westens betonen heute, dass all das lange her ist. Zudem verfüge der Westen über die Fähigkeit zu Selbstkorrektur und selbstkritischer Vergangenheitsbearbeitung. In den früheren Kolonien schaut man auf die westlichen Werte, vor allem wenn sie von moralischen Fanfarenstößen begleitet werden, verständlicherweise mit einer gewissen Skepsis.
Zudem zeigen zwei Beispiele, dass der Westen Werte und Menschenrechte noch immer kühl mit eigenen Interessen abgleicht. Erstens: Saudi-Arabien führt im Windschatten des öffentlichen Interesses einen brutalen Krieg im Jemen. Es gibt in diesem Stellvertreterkrieg, in dem Iran die andere Seite unterstützt, laut der UNO 380.000 Opfer. Wirtschaftssanktionen gegen Riad? Im Gegenteil. Saudi-Arabien ist seit Jahrzehnten mit dem Westen verbündet und ein verlässlicher Öllieferant. Und EU- und Nato-Staaten beliefern Saudi-Arabien mit Waffen. Die Unterstellung, dass sich der Westen um die Ukraine kümmert, weil dort weiße Europäer sterben, wirkt angesichts des Grauens der russischen Kriegsführung kaltherzig. Völlig abwegig ist sie nicht.
Zweitens: Der Westen hat nach 1990 die Chance verspielt, als Sieger des Kalten Krieges eine stabile Ordnung zu schaffen. Die USA haben in Afghanistan und Irak im Namen von „Menschenrechten und Demokratie“ (George W. Bush) vielmehr genau das Muster wiederholt, das dafür sorgt, dass westliche Werte in vielen Regionen der Welt als Hohn empfunden werden. Beides waren neokolonial gefärbte Kriege.
Im Falle des Iraks schufen die USA durch ihren Angriffskrieg mit dem Islamischen Staat erst das Monster, das sie zu bekämpfen angetreten waren. Wenn die USA nach 2000 als Weltpolizist auftraten, dann meist als ein unfähiger Macho-Cop, der auf eigene Rechnung arbeitete und dem das Gemeinwohl schnurz war. „Nichts untergräbt die Idee des Westens mehr als die Verwestlichung mit vorgehaltenem Gewehr, wie sie vom 19. bis ins 21. Jahrhundert immer wieder praktiziert wurde“, so der US-Historiker Michael Kimmage.
Ideologen des Westens wie der Publizist Richard Herzinger bauen unverdrossen weiter auf dieses Konzept. „Wenn die demokratische Welt Einigkeit, politische Entschlossenheit und militärische Stärke mit konsequentem Eintreten für Freiheitsrechte überall auf dem Globus verbindet, wird sie auch künftig die bestimmende weltpolitische Kraft sein“, so Herzinger. Es gilt also weiterhin den Globus mit den Segnungen des Liberalismus zu beglücken – mit den Menschenrechten in der einen Hand, überlegener Feuerkraft in der anderen. So klingt eine lernunfähige, liberale Ideologie, die blind dafür ist, dass die Mischung aus zivilisatorischem Sendungsbewusstsein und rüder Interessenpolitik in vielen Regionen als Neuauflage des Imperialismus des 19. Jahrhunderts verstanden wird.
Politische Hartwährung im Ost-West-Konflikt
Es stimmt: Mächtige Autokraten instrumentalisieren die Kritik an der Doppelzüngigkeit des Westens, um weiter ungestört die eigene Bevölkerung zu schikanieren. Vor allem Putin und die russische Propaganda bedienen sich oft surrealer, vor Hass triefender antiwestlicher Klischees, um die eigene Herrschaft zu festigen. Doch das schafft die Frage nach der Doppelmoral des Westen nicht aus der Welt. Im Gegenteil.
Es gibt in der jüngeren Geschichte in der Tat einen glanzvollen Augenblick, in dem es dem Westen gelungen ist, Menschenrechte produktiv als außenpolitischen Faktor einzusetzen. 1975 verpflichteten sich in der KSZE-Schlussakte auch die realsozialistischen Regime darauf, die „universelle Bedeutung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten“ zu achten.
Damit wurden Menschenrechte eine Art politischer Hartwährung im Ost-West-Konflikt, mit subversiver Kraft. Die Bürgerbewegungen im Osten nutzten die KSZE-Schlussakte, um die eklatanten Widersprüche der staatssozialistischen Regime bloßzulegen. Der Kalte Krieg war auch eine Konkurrenz von zwei Systemen, die beide universelle Geltung beanspruchten. Der Kampf wurde auch auf dem Feld von Ideen und Werten ausgetragen.
Es spricht allerdings nichts dafür, dass es in dem prägenden Konflikt des 21. Jahrhunderts zwischen China und den USA einen KSZE-Moment geben wird. Peking hat, anders als der Staatssozialismus, keine Botschaft. Es will Handelsstraßen, Absatzmärkte und Einflusszonen, aber kein Modell für andere Länder sein. Weil es keine universell angelegte chinesische Erzählung gibt, die durch Realitätschecks blamiert werden könnte, ist Peking unempfindlich gegen moralische Vorhaltungen. Eine auftrumpfende Menschenrechts- und Demokratierhetorik des Westens hat somit nur begrenzte Reichweite. Womöglich kann sie sogar schaden.
Die Freund-Feind-Logik schadet
Denn das Passepartout „Demokratie versus Diktatur“ verstellt den Blick auf das, was realpolitisch passiert. Der Konkurrenzkampf zwischen der Supermacht des 20. Jahrhunderts und der aufsteigenden Macht des 21. Jahrhunderts ist keiner zwischen Gut und Böse, sondern ein Ringen um geopolitische Einflusszonen. Wenn man sich Paul Kennedys Studie „Aufstieg und Fall der großen Mächte“ vergegenwärtigt, so ist die Geschichte der Imperien durch einen wiederkehrenden Rhythmus von Aufstieg, Überdehnung, Erschöpfung und Abstieg gekennzeichnet. Die USA verlieren derzeit ihren Status als einzige Supermacht, China steigt politisch, ökonomisch und militärisch zum globalen Konkurrenten auf. Die letzten 500 Jahre machen wenig Hoffnung, dass solche gleichzeitigen Auf- und Abstiege unblutig verlaufen.
Auch das spricht dagegen, sich eine schlichte Freund-Feind-Logik, Demokratie gegen Diktatur, zu eigen zu machen. Diese Blickverengung erschwert jene Kompromissbildungen, die nötig sind, um die Rivalität zwischen den USA und China zu entschärfen und in zivile Bahnen zu lenken. Zudem existiert mit dem Klimawandel etwas welthistorisch Neues – auch ärgste Gegner sind gezwungen zu kooperieren.
Der Westen wird ein Machtblock unter mehreren werden. Er wird sich gegen aggressive Autokraten behaupten müssen. Seine zentrale Aufgabe aber wird sein, den eigenen Abstieg klüger zu managen als seinen Sieg 1990. Er muss sich von dem zerstörerischen Traum verabschieden, dass es seine Mission ist, die Welt nach seinem eigenen Bild zu formen. Der Westen sollte die universellen Menschenrechte keinesfalls aufgeben, aber aufhören, sie wie einen moralischen Besitzstand zu verwalten, den man in passenden Momenten einsetzt. Der Westen muss, will er eine Zukunft haben, seine eigene Hybris einhegen. Schreibt TAZ.
6.5.2023 - Tag der zerfallenden Imperien
Ein interessanter Artikel der TAZ, den übers Wochenende zu lesen sich lohnt. Thematisiert wird u.a. die inzwischen längst ebenso unerträgliche wie lächerliche Scheinheiligkeit der westlichen «Wertegemeinschaft». Werte, die je nach ultra-neoliberaler Interessenlage seit jeher mit den Füssen getreten werden.
Wer Paul Kennedys Buch «Aufstieg und Fall der grossen Mächte» aus dem Jahr 1987 zitiert, sollte Emmanuel Todd und seine zwei Bücher «Die neoliberal Illusion» (1999) und «Weltmacht USA. Ein Nachruf» (2002) nicht vergessen.
Todd behandelt nicht nur die «universalisierend-arrogante Fassade des Ultraliberalismus der USA», sondern nennt auch nebst den von Paul Kennedy genannten Gründen für den Untergang von Imperien weitere Fakten wie Zerfall der Demokratie, Korruption querbeet durch alle gesellschaftsrelevanten Institutionen wie Politik, Industrie und Wirtschaft sowie eine überbordende Dekadenz.
Es hängt eben tatsächlich alles mit allem zusammen. Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann auf der anderen Seite der Erde ein Erdbeben auslösen. Das lernen wir gerade jetzt wieder mit der Bankenkrise. Scheinbar haben die Verantwortlichen an den Schalthebeln der Macht aus dem «Schwarzen Freitag» am 25. Oktober 1929 nichts gelernt.
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Ein Adolf Hitler ist 1933 ebenso wenig vom Himmel gefallen wie 2017 Donald Trump.
(Anmerkung: Vergleichen heisst nicht gleichsetzen)
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Pierre Maudet trotz Korruption in Genf wiedergewählt
Die Genfer Regierungskollegen geben ihm Kredit – doch Pierre Maudet muss nun zeigen, dass er ihr Vertrauen verdient.
Pierre Maudet ist zurück in der Genfer Regierung – obwohl er wegen Vorteilsannahme verurteilt wurde und obwohl er die Genfer Bevölkerung und seine Regierungskollegen angelogen hat.
Drei der sechs anderen Mitglieder der Regierung haben den tiefen Fall Maudets in der vergangenen Legislatur miterlebt – und jetzt müssen sie wieder mit ihm zusammenarbeiten.
Einer von ihnen ist der Grüne Antonio Hodgers. Seit seiner Jugend politisiert er Seite an Seite mit Maudet. Die beiden kennen sich schon seit Jahrzehnten. Maudet hatte die Genfer Regierung über seine Reise nach Abu Dhabi angelogen – und auch über Steuertricks. Diese Vorgänge hätten ihn tief verletzt, sagt Hodgers. «Ich werde mit Maudet zusammenarbeiten – doch das Vertrauen kann man nicht per Dekret verfügen», betont der grüne Genfer Staatsrat. Dieses müsse vielmehr wieder aufgebaut werden.
Auch der wiedergewählte Thierry Apothéloz von der SP hat die Affäre Maudet nahe miterlebt. Für ihn ist klar: «Es ist jetzt an Pierre Maudet, zu zeigen, dass er auch anders kann.»
Für Nathalie Fontanet von der FDP war die Affäre Maudet noch dramatischer: Sie erlebte sie nicht nur in der Regierung, sondern auch innerhalb ihrer Partei. Maudet war nach langem Tauziehen im Juli 2020 aus der FDP ausgeschlossen worden.
Maudet: Zähler wieder auf null
Für Fontanet ist klar: In einer Demokratie hat das Stimmvolk das letzte Wort. Deshalb werde sie mit Maudet wie mit allen anderen Regierungskolleginnen und -kollegen zusammenarbeiten.
Auch Pierre Maudet selber sieht durch seine Wahl den Zähler wieder auf null zurückgestellt. Doch auch er sagt: «Das Vertrauen kann nicht per Dekret verfügt werden.» Die Narben der vergangenen Legislatur werden auch in der kommenden Amtszeit noch zu spüren sein. Schreibt SRF.
28.4.2023 - Tag der Krähen die sich gegenseitig kein Auge aushaken
Nach dem Ibiza-Skandal der österreichischen FPÖ durch den damaligen FPÖ-Vizekanzler Strache sprach der österreichische Bundespräsident Van der Bellen vor laufenden Kameras von einem «empörenden Sittengemälde», das er aber im gleichen Atemzug mit der Bemerkung «So sind wir nicht» (Anmerkung: die österreichische Gesellschaft) abschwächte.
Doch genau so ist die österreichische Gesellschaft! Anders kann man sich nicht erklären, dass ebendiese FPÖ, die mit ihrem skandalösen, unsittlichen und korrupten Verhalten beim Ibiza-Skandal 2019 die damalige Türkis-Blaue Regierung sprengte, inzwischen sämtliche Meinungsumfragen anführt, bei sämtlichen Regionalwahlen im zweistelligen Bereich zulegt und vermutlich 2024 mit dem rechtsextremen FPÖ-Parteipräsident Herbert Kickl den nächsten Bundeskanzler Österreichs stellen wird.
Die Verlotterung der moralischen und ethischen Werte findet nicht nur in Österreich statt, sondern weltweit in allen Demokratien. Auch bei der Vorzeigedemokratie Schweiz, die sich gerne bei jeder Gelegenheit im In- und Ausland wortgewaltig als Leuchtturm der Demokratie präsentiert.
Die neuerliche Wahl eines abgewählten korrupten Lügners wie Pierre Maudet in Genf beweist den Zerfall der hehren Werte der Schweizer Parteien, die querbeet durch alle Parteiangehörigkeiten wie eine Monstranz vor sich hergetragen werden. Korruption und Lügen wie gedruckt sind inzwischen nicht nur bei der politischen Elite toleriert und als Kavaliersdelikte eingestuft, sondern auch mitten in der Dekadenz einer moralisch verwahrlosten Gesellschaft angekommen.
Dass der Fisch vom Kopf her stinkt ist leider nur ein geflügeltes Wort. Die Korruption hat längst auch bei den unteren Rängen der Behörden systemische Ausmasse erreicht. Ich könnte Ihnen hier eine wahrhaftige Geschichte eines Gemeinderats schildern. Über vier Jahre hinweg plünderte er die Kassen einer Luzerner Gemeinde, die notabene mit einem der höchsten Steuersätze des Kantons Luzern glänzt, um knapp 200'000 Franken.
Zwar dank willfährigen Kollegen*innen aus dem Gemeinderat und fehlender Kontrolle am richtigen Ort als legal durchgewunken, ist der Raubzug letztlich nichts anderes als eine moralische Bankrotterklärung. Dass der ebenso smarte wie auch intrigante und erfindungsreiche Gemeinderat der FDP angehört spielt keine Rolle. Denn die anderen, ebenfalls im Gemeinderat vertretenen Parteien, legalisierten durch ihr passives Nichtstun den Raubzug. Dass eine Krähe der andern Krähe kein Auge aushackt ist tatsächlich mehr als nur ein geflügeltes Wort.
Diejenigen 50 bis 60 Prozent, die von dieser Entwicklung in Politik und Gesellschaft nur noch angeekelt sind, schweigen und wenden sich frustriert von der politischen Teilhabe wie Wahlbeteiligung etc. ab. Psychologisch verständlich, auch wenn es der falsche Weg ist.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Was wäre, wenn ab morgen niemand mehr fliegen würde?
Fliegen ist klimaschädlich. Sofort damit aufzuhören, hätte immense wirtschaftliche Folgen, sagt ein Aviatikexperte.
Der Flugverkehr sei eines der Sorgenkinder des Klimaschutzes, sagen Expertinnen und Experten. «Der CO₂-Ausstoss der Fliegerei macht weltweit etwa zwei bis drei Prozent aus. Mit den indirekten Effekten wie Russ- und Kondensstreifen sind wir bei 5 Prozent», sagt Reto Knutti, Klimaforscher an der ETH Zürich.
Das töne nach relativ wenig. Aber das Wachstumspotenzial sei riesig, betont Knutti: «In der Schweiz sind das schon 20 Prozent. Wenn alle so viel fliegen möchten wie wir in der Schweiz, dann wären das riesige Zahlen.»
In der Tat benutzen jährlich nur 11 Prozent der Weltbevölkerung ein Flugzeug. Da der wohlhabende Mittelstand in vielen Ländern wächst, wächst auch die Zahl der Vielfliegerinnen und -flieger – und damit der CO₂-Ausstoss.
Kraftstoff-Alternativen problematisch
Beim Auto versuchen die Technikverantwortlichen fieberhaft, neue Antriebsmotoren zu entwickeln. Der Fortschritt bei Elektroautos ist rasant.
Doch in der Fliegerei sei das nicht so einfach, sagt Knutti. «Es gibt biologische Treibstoffe, zum Beispiel aus Zuckerrohr. Die sind aber problematisch, weil wir damit die Nahrungsmittelversorgung konkurrieren.»
Daneben gibt es noch synthetische Treibstoffe aus Sonnenlicht oder Strom. «Diese wären im Prinzip dann CO₂-neutral», sagt der Klimaforscher. Allerdings seien diese im Moment sehr teuer und nur in kleinsten Mengen verfügbar.
Wirtschaft würde auf den Kopf gestellt
Deshalb verzichten viele Leute bewusst aufs Fliegen und wählen andere Fortbewegungsmittel. Was wäre nun, wenn morgen alle Menschen aufs Fliegen verzichten würden? Wenn global kein einziges Flugzeug mehr abheben würde?
Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären immens, sagt Michael Weinmann, Hobbypilot und SRF-Aviatikexperte. «Es arbeiten um die 27’000 Menschen am Flughafen Zürich. 8000 alleine bei der Swiss.» Diese wären alle auf den nächsten Tag arbeitslos.
Die Firmen würden Konkurs gehen und liquidiert werden. Gleichzeitig würde das einen Flächenbrand auslösen: «Es verlieren nicht nur die Leute, die bei einer Fluggesellschaft oder am Flughafen arbeiten, ihren Job. Sondern es würde sich auf ganz viele andere Branchen auswirken», sagt Weinmann.
Auch global würde die ganze Wirtschaft auf den Kopf gestellt, so der Aviatik-Experte. Der Übersee-Tourismus würde über Nacht einbrechen: Die Malediven wären plötzlich wieder ein Fischerdorf.
Auch wertvolle und verderbliche Waren, wie zum Beispiel Medikamente, müssten plötzlich mit dem Schiff transportiert werden, ergänzt Weinmann. Waren, zum Beispiel Handys, müssten wieder dort hergestellt werden, wo sie gebraucht werden – und nicht in China.
Kaum realistisch, dennoch nützlich
Diese Beispiele zeigen, dass ein totaler Flugstopp kaum realistisch ist. Die Gedankenexperimente könnten trotzdem nützlich sein, meint Klimaforscher Knutti. Die Pandemie habe aufgezeigt, dass auch grosse Veränderungen – wenn nötig – in sehr kurzer Zeit realisierbar seien. Schreibt SRF.
28.4.2023 - Tag der Klimaschutzlügen
Das ist eine reine Phantomfrage, auf die es keine Antwort gibt, ausser, dass wir uns Klimaschutz derzeit gar nicht leisten können. Weltweit. Nicht nur in der Schweiz. So viel Ehrlichkeit müsste schon sein. Aber damit würden wohl einige Grünparteien aus den Parlamenten fliegen. Klimaschutz ist Wissenschaft und nicht Ideologie.
Wir können in der jetzigen Phase der verfügbaren Techniken lediglich einen Heftpflaster-Klimaschutz betreiben. Da ein Pflästerli, dort ein Pflästerli. Dennoch sollte niemand die Hoffnung aufgeben. Forschung und Wissenschaft sind weltweit gefordert, nicht das Ei des Kolumbus sondern viele Eier zu finden. Es müssen ja nicht unbedingt die Eier von Kolumbus sein.
Aber um diese Synergien zwischen Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie herzustellen, braucht es etliche Köpfe vom Format Albert Einsteins und nicht Politiker*innen. Doch bedenken Sie stets, dass die Relativitätstheorie auch nicht an einem Tag entwickelt wurde. Geben Sie der Forschung Zeit. Oder etwas fatalistisch ausgedrückt: Sie werden wohl oder übel noch etliche Jahre schwitzen müssen.
Kurzfristig könnte der CO₂-Ausstoss der Flugzeuge vermutlich durch eine massive Verteuerung der Flugtickets etwas gebremst werden. Aber wer will das schon? Nicht einmal die «Letzte Generation», die für ihre Ferien auf der Insel Bali ja auch das Flugzeug benutzen und nicht hinschwimmen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Kreuzfahrt-Crew lässt Leiche in Kühlschrank verwesen
Auf einer Kreuzfahrt in der Karibik erlitt der Mann von Marilyn Jones einen Herzinfarkt. Der US-Amerikaner war sofort tot. Statt den leblosen Körper im Leichenkühlraum aufzubewahren, landete er auf dem Schiff in einem Getränkekühlschrank – und begann zu verwesen.
Ihre Traumferien wurden zum Albtraum: Robert und Marilyn Jones aus den USA wollten letzten Sommer eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff geniessen. Doch während der Fahrt auf der Celebrity Equinox erlitt der Ehemann (†78) einen Herzinfarkt. Er war auf der Stelle tot.
Daraufhin bot die Kreuzfahrt-Crew der Witwe an, ihren Mann bis zum nächsten Stopp in der Leichenhalle des Schiffes in einer entsprechenden Kühlvorrichtung aufzubewahren. Als Jones sechs Tage später in Florida von Bord gehen wollte, musste sie mit Entsetzen feststellen, dass die Crew der Leiche ihres Mannes alles andere als Sorge getragen hatte. Statt ihn in der Leichenhalle aufzubewahren, verstauten sie seinen leblosen Körper einfach in einem Getränke-Kühlschrank. Das berichtet die «New York Post».
Witwe verklagt Unternehmen auf eine Million Dollar
Dass die Leiche nicht in einem dafür vorgesehenen Kühlschrank gelagert wurde, war für die Mitarbeitenden eines Bestattungsunternehmens schnell klar. Sie fanden die Leiche auf dem Boden des Kühlschranks in einem blutbespritzten Beutel. Sie wies bereits grüne Flecken auf und war aufgebläht. Den Bestattern zufolge war offensichtlich, dass sich die Leiche in einem «fortgeschrittenen Stadium der Verwesung befand und nie bei einer Temperatur gelagert wurde, die geeignet war, die Verwesung zu verhindern».
Marilyn Jones und ihre Familie verklagen die Kreuzfahrtgesellschaft deshalb nun auf eine Million Dollar Schmerzensgeld. In der Anklageschrift heisst es, dass sich der leblose Körper von Robert Jones nicht in der Leichenhalle des Schiffes befunden hätte. «Stattdessen war seine Leiche zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt aus der Leichenhalle des Schiffes in einen Kühlschrank auf einem anderen Stockwerk gebracht worden.»
Dieser hätte keine angemessene Temperatur gehabt, um den Leichnam vor der Verwesung zu schützen, heisst es in der Anklage weiter. Dadurch seien seine Angehörigen daran gehindert worden, eine Beerdigung im offenen Sarg durchzuführen, «was ein langjähriger Familienbrauch war und was sich seine Familie gewünscht hatte».
Eines ist klar: Hätten die Angehörigen von Robert Jones gewusst, dass es auf dem Schiff kein funktionierendes Leichenschauhaus gab, hätten sie seinen Leichnam früher vom Schiff holen lassen. Eine Anfrage der «New York Post» blieb vom Kreuzfahrtunternehmen unbeantwortet. Schreibt Blick.
25.4.2023 - Tag der Kühlschrankleichen
Wo, wenn nicht im Kühlschrank, sollte man denn eine Leiche aufbewahren, wenn das Leichenschauhaus auf dem Kreuzfahrtschiff kühltechnisch gerade mal nicht funktioniert? Dass Kühlschränke nicht mehr das sind, was sie früher mal waren, ist eine andere Geschichte. Allerdings werden Kühlschränke ja nicht unbedingt für die Aufbewahrung von Leichen produziert.
Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs hätte Marilyn Jones ja auch eine «Seebestattung» mit allem Drum und Dran vorschlagen können. Wäre für Marylin Jones sicher ein exklusiver Abschied mit Stil gewesen. Kreuzfahrt mit Seebestattung des Ehemannes erlebt man schliesslich nicht aller Tage. Auch mit dieser Version wäre Marylin jetzt in aller Munde. Aber dafür gibt es halt keine Dollars.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
«Electro-Boy im leuchtenden Putinland»: Roger Köppel provoziert aus Moskau
Am Donnerstag hat das EDA den russischen Botschafter einbestellt. Dieser hatte einem «NZZ»-Journalisten wegen dessen Berichterstattung mit Gefängnis gedroht. Zwei Tage später sendet SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel aus Moskau.
SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel provoziert. Mal wieder. Am Wochenende meldete er sich über Twitter – aus der russischen Hauptstadt Moskau. Dort hat er am Samstag sein Videoformat «Weltwoche Daily» aufgenommen. Er kritisiert darin unter anderem einmal mehr das «sehr einseitige Bild, dass wir in unseren Medien präsentiert bekommen».
Die Russen bekämen alles, was sie wollen, spricht Köppel auf einer Shoppingmeile im Zentrum Moskaus in seine Kamera. «Keine Rede davon, dass Russland hier irgendwie am Boden liegen würde.» Im Gegenteil, alle westlichen Produkte seien verfügbar, fährt der Nationalrat gut gelaunt fort.
Der Zeitpunkt ist brisant. Nur zwei Tage, nachdem das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) den russischen Botschafter in Bern einbestellte, sendet Köppel also aus Moskau.
Provokation nach EDA-Rüffel
Der russische Botschafter Sergej Garmonin musste vergangenen Donnerstag antraben, nachdem dieser einem Journalisten der «NZZ» im Zusammenhang mit dessen Berichterstattung über die russische Aggression gegen die Ukraine mit rechtlichen Massnahmen in Russland gedroht hatte.
Schliesslich schiesst er auf Twitter auch gegen unseren nördlichen Nachbarn. «Deutschland aufgepasst: In Moskau leuchten nicht nur die Lampen (viel Strom). Auch das Handynetz ist viel schneller als in Berlin. Viel schneller», twittert er aus einer hell beleuchteten Einkaufsstrasse.
Nadelstiche auch gegen politische Gegner
Und auch der politische Gegner kriegt aus Moskau sein Fett weg: «Kein Fussbreit den Grünen», twittert Köppel. Garniert ist der Tweet mit einem Selfie vor der Marvel-Figur Hulk.
Köppels Provokationen kommen nicht gut an. So schreibt etwa Grüne-Nationalrätin Meret Schneider (30) auf Köppels Strom-Tweet: «… und mangels demokratischer Prozesse kann auch politisch viel schneller agiert werden. Viel schneller. Schrei′n oder nicht schrei’n, das ist die Frage.» Komiker Viktor Giacobbo (71) doppelt nach: «Happy Electro-Boy mit schnellem Handy im leuchtenden Putinland!»
Auch Michael Durrer (39), Präsident der Grünen im Kanton Baselland, ist nicht begeistert. Er twittert: «Roger Köppel in gewohnt widerlicher Manier.»
Zahlreiche andere Twitter-User verurteilen Köppels Besuch in Moskau und werfen ihm Unterstützung Putins vor. Sie vergleichen den Trip des Nationalrats mit einer Reise von 2018 nach Chemnitz (D). Damals wurde Köppel mit Notizblock neben einem verurteilten Neonazi fotografiert. Schreibt Blick.
24.4.2023 - Tag der nützlichen Idioten von Putin und dem Herrliberg
Als «sexiest man alive» wird Köppel wohl nie gewählt werden, als Witzfigur oder Vollpfosten der Nation schon eher. Blochers Ziehsohn war früher intellektuell und rhetorisch eine Grösse für sich. Inzwischen mutiert er ausserhalb seines Fanclubs nur noch zur unsäglichen Lachnummer.
Unvergessen, wie er in Zürich dem ultrarechten ehemaligen Berater von Donald Trump, Steve Bannon, hinterherhechelte. Oder sein offener Brief an den österreichischen FPÖ-Politiker und ehemaligen Vizekanzler Österreichs, HC Strache, nachdem dieser als Folge des Ibiza-Skandals zurücktreten musste und inzwischen in der politischen Versenkung verschwunden ist.
Es würde einen nicht wundern, wenn dieser verirrte Weltwochen-Geist und nützliche Idiot Putins sein rechtsradikales Klein-Imperium mit finanzieller Unterstützung aus Russland aufgebaut hätte. Seine Methode «wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing» könnte (bitte Konjunktiv beachten!) durchaus damit zusammenhängen. Muss aber nicht. Es gibt ja schliesslich noch die Herrliberger Bank für verwirrte Geister, sofern sie dem Godfather Don Christoph und seiner Partei dienen. Nützliche Idioten wie Köppel sind nicht nur im Kreml willkommen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Zentralschweizer «Solarstrom-Traum» ist schon wieder vorbei
Tausende Solarstromproduzenten wechselten letzten Herbst zur CKW, da sie mehr bezahlten. Nun folgt die Ernüchterung.
Herbst 2022: Die ganze Schweiz spricht von einer Energiekrise. Die Strompreise sind so hoch wie noch nie. Diese Gelegenheit nützen die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW). Sie bieten Besitzerinnen und Besitzern von Solaranlagen besonders viel Geld für deren überschüssigen Strom, also jenen Strom, der nicht für den Eigengebrauch benötigt wird und ins Stromnetz eingespeist wird.
Ansturm auf die CKW
Das Ziel der CKW: möglichst viele neue Solarstromproduzenten dazu gewinnen. Die Rechnung geht auf. Rund 3000 Besitzer von Solaranlagen haben die Zusammenarbeit mit ihrem lokalen Energieversorger beendet und sind zur CKW gewechselt.
Der CKW-Geschäftsführer sagte damals gegenüber SRF: «Wir wollen den Solarausbau fördern. Wir finden es stossend, dass es in der aktuellen Situation mit den hohen Strompreisen einzelne Produzenten von Solarstrom eine sehr tiefe Vergütung erhalten.»
Doch nun, nur wenige Monate später, zeigt sich: Die CKW zahlt mittlerweile selbst tiefe Tarife. Über 30 Rappen pro Kilowattstunde haben sie im Herbst für eingespeisten Solarstrom bezahlt. Momentan sind es noch etwas mehr als zehn Rappen.
Fragwürdige Preispolitik
Beim Verband für Sonnenenergie Swissolar heisst es dazu, dass sich die Solarstromproduzenten solchen Schwankungen am Strommarkt grundsätzlich stellen müssten. Die Solarstrombranche wolle auf eigenen Beinen stehen. Ein Schutz vor Preisschwankungen lehne man deshalb ab.
Vom Verhalten der CKW ist Swissolar-Geschäftsführer, David Stickelberger trotzdem irritiert: «Es ist tatsächlich fragwürdig, dass man solch grosse Preisschwankungen weitergibt und den Eindruck erweckt, dass der Preis so hoch bleibt. Es war eigentlich klar, dass der Preis nicht so hoch bleiben kann.»
Angesprochen auf diese Kritik verweist der CKW-Geschäftsführer Martin Schwab auf die Strompreise, die in den letzten Monaten wegen des milden Winters gesunken sind. «Wir haben im letzten Herbst sehr klar kommuniziert, dass wir Marktpreise zahlen und dass der Tarif abhängig ist von dem, was der Markt hergibt. Das führt natürlich dazu, dass wir bei einem hohen Preis eine hohe Entschädigung zahlen und bei einem tiefen Preis eine tiefe Entschädigung.»
CKW stellt Marketing-Streich in Abrede
Kritiker sagen, die CKW hat die hohen Strompreise im Herbst ausgenutzt, um den anderen Schweizer Energieversorgern tausende Solarstromproduzenten abzuwerben. Doch von einem Marketing-Streich will Martin Schwab nichts wissen. «Das ist alles andere als ein Marketingcoup. Das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass andere Stromunternehmen, die Solarstrom abnehmen, ihre Tarife erhöht haben. Das war sehr gut für Solarstromproduzenten.»
Mit diesem Thema befasst sich derzeit auch die Politik. Das eidgenössische Parlament will einen schweizweit einheitlichen Tarif für Solarstrom einführen. Preisschwankungen wären dann immer noch möglich. Dass, ein Energieversorger viel mehr für eingespeisten Solarstrom zahlt als ein anderer, aber nicht mehr. Schreibt SRF.
20.4.2023 - Tag der Träume von der eierlegende Wollmilchsau
Träume sind Schäume. Besonders dann, wenn sich die Einen auf Kosten der Andern bereichern wollen. Denn letztendlich bezahlt nicht CKW den höheren Preis für Solarstrom, den sie an die Solar-Stromproduzenten bezahlt, sondern die Strom-Konsumenten, die den in die Strom-Netzwerke eingespeisten Strom verbrauchen. Egal, ob das nun Solar-, Atom- oder sonstiger «grüner» Strom ist.
Natürlich war die Aktion von CKW nichts anderes als ein cleverer Marketing-Gag. Was denn sonst? 3000 «Solar-Stromer» sind auf das Lockangebot hereingefallen. Wer an das Gute in einem Stromerzeuger wie CKW glaubt, ist wirklich selber schuld und hat wohl noch nie etwas von der «totalen Gewinnmaximierung auf Teufel komm raus» bei Konzernen gehört. Die CKW ist in ihrem Geschäftsbereich längst ein kleiner Konzern und entsprechend handelt sie. Das kann man ihr auch nicht vorwerfen. Die CKW ist eine Aktiengesellschaft und nicht ein Wohltätigkeitsverein im Sinne von Mutter Theresa.
Die eierlegende Wollmilchsau war noch nie etwas anderes als eine Illusion.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Swissair, GC und CS heruntergewirtschaftet – am Sechseläuten wieder hoch zu Ross: Zürcher Elite zelebriert ihren Zerfall
Der Zürcher Filz war ein mächtiger Kreis, von dem die ganze Schweiz profitiert hat. Mit dem Untergang der Credit Suisse bricht eine weitere Säule der Macht weg. Erklären lässt sich der Zerfall mit der Globalisierung – und mangelnder Demut.
Heute reiten sie wieder, am Zürcher Sechseläuten. Männer in engen Hosen und hohen Stiefeln galoppieren um einen Scheiterhaufen, bis die Flammen den Böögg verschluckt haben. Am festlichen Umzug stolzieren sie vorbei am Volk, das ihnen vom Strassenrand aus Blumen zuwirft.
Es ist ein Fest, bei dem sich die Mächtigen Zürichs selbst feiern.
Ihre Macht aber ist brüchig geworden. Ein Wort fällt oft: «zerbröselt». Der Einfluss des Zürcher Filzes sei zerfallen.
Eine Bank aus Basel hat Mitte März die Credit Suisse für einen Notgroschen gekauft, seit 167 Jahren der Stolz der Zürcher Eliten. Die staatlich gestützte Übernahme durch die UBS bewahrte die Hausbank des Freisinns vor dem Konkurs.
Die CS ist nicht die einzige Säule der Macht, die in Zürich eingestürzt oder beschädigt ist:
• Die Swissair fliegt seit über 20 Jahren nicht mehr. Ihre Nachfolgerin, die Swiss, gehört der deutschen Lufthansa.
• Beim Grasshopper Club, nostalgisch «Rekordmeister» genannt, traf sich die Elite einst hinter der Haupttribüne des Hardturms bei Kalbsbratwurst, Bürli und Senf. Heute gehört GC einem chinesischen Grosskonzern und ist sportlich nicht mal mehr Mittelmass.
• Der Hardturm ist abgerissen, der Spatenstich für ein neues Stadion nicht in Sicht.
• Der Stimmenanteil der FDP sank in der Stadt Zürich von knapp 40 Prozent vor dem Ersten Weltkrieg auf noch 17,5 Prozent.
• Intrigen und Skandale plagten in den letzten Jahren das Universitätsspital.
• Das Kunsthaus, das der Elite besonders am Herzen liegt, geriet international in die Schlagzeilen, weil es die Herkunft einiger Gemälde der Sammlung Bührle nicht ordentlich abgeklärt haben soll.
• Die Zünfte, die Wirtschaftsgilden der Stadt und ursprünglich Zentrum der Macht, haben Nachwuchssorgen und sind nicht viel mehr als Reiter in Kostümen.
Was ist los mit dem Filz? «Wir erleben in Zürich gerade einen weit grösseren gesellschaftlichen Wandel, als viele wahrhaben wollen.» Das sagt eine Person, die an der Limmat seit Jahrzehnten die Fäden zieht und das bewusst im Hintergrund tut. Ein solcher Wandel sei «im schlechtesten Sinne ein Zerfall, bei dem nichts nachkommt. Oder es ist eine Metamorphose, bei der etwas Neues entsteht.» Aktuell sei aber «himmeltraurig», was passiere: «Die Alten sterben, die Jungen wollen und können nicht übernehmen.»
Und das sei gefährlich, nicht nur für Zürich, sondern für die ganze Schweiz. Von keiner anderen Stadt gingen in den letzten Jahrhunderten vergleichbare wirtschaftliche und gesellschaftliche Impulse aus. Um überdurchschnittlich bleiben zu können, brauche es urbane Eliten, die vorangingen. «Ebnet man diese Führung ein, fällt ein Land ins Mittelmass.»
Pflichtbewusst, loyal, zwinglianisch
Lange Zeit brachten die zwinglianisch geprägten Züricherinnen und Zürcher genau das mit, was nötig war, um Banken und Betriebe aufzubauen und erfolgreich zu leiten, um das politische und das akademische Geschehen zu bestimmen. Zwar galten sie als humorlos, dafür als fleissig, gegen aussen bescheiden, sie waren pflichtbewusst und loyal.
An den einflussreichen Zürcher Mittelschulen begannen sie, ihre Netzwerke zu knüpfen, an der Hohen Promenade, am Gymnasium Rämibühl. Engmaschiger wurden die Geflechte an der Universität und an der ETH. Nach dem Lizenziat ging einer zur Kreditanstalt, die andere zur Schweizerischen Rückversicherung, der nächste wurde Redaktor bei der NZZ, einer promovierte und blieb als Professor an der Universität, viele politisierten im Bundeshaus, darunter mächtige Frauen wie Vreni Spoerry (85) und Elisabeth Kopp (1936–2023).
Das Vorbild aller war Alfred Escher (1819–1882), diese schweizerische Jahrhundertfigur, die gründete, gestaltete, führte. Ohne ihn wären ETH, CS, SBB und Swiss Life nie oder viel später und anders entstanden. Die Erben Eschers teilten Werte sowie politische und gesellschaftliche Ansichten. Es gehörte dazu, sich für die hohe Kultur zu engagieren, für Kunst- und Opernhaus sowie die Tonhalle. Man konnte sich aufeinander verlassen, setzte sich für das Kinderspital ein. Die Männer stiegen im Militär zu Offizieren auf. Man traf sich im Rotary Club, beim Golfen am Dolder, bei der FDP, an der Generalversammlung der NZZ, nahm den Sohn mit zum GC-Match und stellte ihn dort dem Herrn Bankdirektor vor. Den Nachwuchs fand die Elite in den eigenen Reihen.
Jahrzehntelang bildeten die Universitäten gute, wenn nicht brillante Leute aus. Gepaart mit dem protestantischen Arbeitsethos vermochten sie die Konzerne ordentlich zu führen. Zumal sie treu blieben, was jedes Unternehmen stärkt.
Es war ein Kreis, der das Land prägte – vor allem im Guten. Ohne diese Zürcher Wirtschaftsgemeinschaft wäre die moderne Schweiz kaum denkbar.
Der Zerfall begann mit der Globalisierung
Der Fall der Berliner Mauer 1989 änderte vieles. Die Welt liess sich nicht mehr in Gut und Böse zweiteilen. Die Globalisierung schien Chancen zu eröffnen. Manchem wurden Zürich und die Schweiz zu klein. Mit dem Zuger Rainer Gut (90) war es ein Katholik aus der Zentralschweiz, der als Präsident die protestantische Kreditanstalt hinaus in die Welt trug. Im grossen Stil expandierte er in den 1980er- und 1990er-Jahren nach Amerika, was die Kultur in Zürich änderte.
Mit der First Boston kam das Investment Banking dazu, ein Geschäft, das man bei der CS nie ganz verstand und nie richtig betreiben konnte. Die Aktionäre segneten Gehälter und Boni am Paradeplatz ab, wie sie sonst an der Wall Street in New York üblich sind. Nur so könne man fähiges Personal holen und halten, als seien die bewährten heimischen Talentschmieden nicht mehr gut genug.
Fortan war wichtiger, was jemand konnte, als woher er kam. Der Wettbewerb um Talente und Jobs wurde global. Genügte der Sohn des GC-Anhängers nicht, holte der Bankdirektor halt jemanden aus Deutschland. Für die Eliten war es nicht mehr zwingend, die eigenen Kinder zu fördern. Die Personenfreizügigkeit behob den Fachkräftemangel. Die Jungen konnten sich nicht mehr auf die alten Seilschaften verlassen und verloren das Interesse daran. Eine Karriere in Rio oder Rom schien prickelnder als das Pult am Paradeplatz und das Znacht im Zunfthaus.
Man kommt und geht. Ob Bank, Versicherung oder Hörsaal: Es sind internationale Plattformen geworden, auf denen man sich trifft, sich intensiv auf Englisch austauscht und nach einer Weile wieder auseinanderdriftet. In einem solchen Umfeld gedeihen keine lokalen Eliten. Zumal es vielen reicht, 60 oder 80 Prozent zu arbeiten.
Damals, als die Globalisierung begann, publizierten Banker und Unternehmer ihre neoliberalen Weissbücher. Sie glaubten, die Schweiz würde den Anschluss verpassen, wenn man nicht globaler denken würde. Aus Angst, abzusteigen, begannen viele, den Standort Schweiz geringzuschätzen. «Man wollte grösser sein, als man ist», sagt der ehemalige Bankier Konrad Hummler (70). Er spricht von einem «Master-of-the-Universe-Syndrom», an dem die Zürcher Macht zerfallen sei.
Als CS-Präsident Urs Rohner (63) einen Nachfolger für seinen amerikanischen Chef Brady Dougan (63) brauchte, schaute er sich in der City in London um. Rohner, selbst kein Banker, holte Tidjane Thiam (60), ebenfalls kein Banker. Der Franzose passte weder zur CS noch nach Zürich. Nach ihm führten zwei Nummer-2-Typen die torkelnde Bank.
Die alten Eliten aber konnten führen. Sie waren gut und klug genug, das nicht laut zu sagen. Gerade weil sie im Stillen wirkten, erreichten sie mehr. Ausser am Sechseläuten zeigten sie sich kaum öffentlich. Solange sie achtsam agierten, funktionierte vieles. «Dann verloren die Besten die Bodenhaftung», sagt der einstige NZZ-Präsident Hummler. «Zuletzt bewegten sie sich nur noch an der Oberfläche, statt in die Tiefe zu gehen.»
Allein in den letzten zwölf Jahren geschahen in Zürich Dinge, die nicht hätten passieren dürfen. Die Frau des damaligen Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand (59) handelte mit Dollar, während er mithalf, die Wechselkurse zu steuern. Credit-Suisse-Chef Dougan gestand in Washington ein, dass seine Banker jahrzehntelang Gelder vor dem amerikanischen Fiskus versteckt hatten. Die CS wurde Hauptsponsorin des Zurich Film Festivals, das die Partnerin von CS-Präsident Rohner leitete. Die Bank liess einstige und aktuelle Mitarbeiter von Detektiven beschatten; es kam zu einem Suizid.
Aus Sicht der Zürcher Elite sind all das Zeichen eines moralischen Zerfalls. Die Vorbilder hatten versagt. Es entstand ein Vakuum, das auf der politischen Ebene Linke und Grüne auffüllten.
Keine Fehlerkultur mehr
Als stossend empfindet es Hummler, dass die Eliten nicht mehr hinstehen und Fehler zugeben. Wie einst, als Heinz Wuffli (1927–2017) nach dem Chiasso-Skandal 1977 die Verantwortung übernahm und seinen Posten als Generaldirektor der Kreditanstalt räumte. «Es kann passieren, dass man 99 Prozent des Kapitals vernichtet», sagt Hummler. «Aber dann musst du sagen: ‹Das war nicht gut›.»
Stattdessen verstummen die von den Medien als Versager dargestellten Personen, ausrangiert von den alten Machtzirkeln, gesellschaftlich geächtet. Im Vorfeld des diesjährigen Sechseläutens war durchgesickert, die Zunft zur Meisen habe zwei ehemaligen CS-Präsidenten nahegelegt, nicht mehr aufzutauchen. «Niemand will vom Schattenwurf getroffen werden, der von ihnen ausgeht», erklärt es die Person im Hintergrund. «Dass sie weder Demut noch Einsicht zeigen, ist nicht verwunderlich. Diese Menschen sind in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gross und mächtig geworden. Immer ging es aufwärts. Sie lernten nicht, bescheiden zu sein. Zuletzt überstieg die Arroganz das zulässige Mass.»
Hochmut hat den Fall begünstigt.
Ist eine Metamorphose möglich, eine Zürcher Renaissance? Zumindest ist die ETH noch immer eine Hochschule mit Weltrang, die NZZ ein führendes Medium im Land. Einen Sitz im Bundesrat aber hat Zürich derzeit keinen mehr. Die UBS setzt mit Sergio Ermotti (62) auf einen erfahrenen und geerdeten Handwerker aus dem Tessin. Die starke Frau im Freisinn – Bundesrätin Karin Keller-Sutter (59) – wuchs in Wil in St. Gallen auf, der starke Mann – Parteipräsident Thierry Burkart (47) – in Kirchdorf im Kanton Aargau. Sie alle kommen aus der Provinz.
Aus dem urbanen Zürich ist weit und breit niemand in Sicht. Schreibt Blick.
17.4.2023 - Tag der Schweizer Eliten quer durch die Gesellschaft
Der Blick-Artikel von Peter Hossli malt ein Sittengemälde über die moralische und ethische Verkommenheit querbeet durch die Zürcher Elite, das aber in vielen Punkten auf alle elitären Gesellschaftsschichten in sämtlichen Schweizer Landesteilen zutrifft.
Die Gesellschaft der Schweizer Normalsterblichen hat es ihnen allen aber auch leicht gemacht. Wenn inzwischen, wie kürzlich bei den Luzerner Kantonsratswahlen, gerade noch knapp 40 Prozent der Wahlberechtigten ihr Votum an der Urne abgeben, wovon wiederum mehr als 50 Prozent der Altersgruppe der Ü50-Jährigen angehören, deckt das den langsamen aber unaufhörlichen Zerfall der Schweizer Demokratie in erschreckender Deutlichkeit auf.
Wir, die Normalsterblichen, lassen es zu, dass die von widerwärtigen Eliten und unfähigen Selbstdartsellern*innen gesteuerten Parteien weiterhin schalten und walten können, wie es ihnen beliebt. Und die 60 Prozent Wahlverweigerer*innen jammern nach den Wahlen stets über die «Arschlöcher», die von den 40 Prozent gewählt wurden.
Noch ist es nicht zu spät, Veränderungen an der Wahlurne herbeizuführen. Denn auch politische Eliten, ja selbst Parteien, können abgewählt werden. Man muss es nur tun. Dann würde es auch möglich sein, das unselige Konstrukt der Konkordanz aus vergangenen Zeiten abzuschaffen. Dass Opposition und Regierung in Einem langfristig den Herausforderungen der heutigen Zeit nicht mehr gewachsen sind, hat sich längst herausgestellt. Das «Söihäfali / Söideckali»-Gekeife ist nicht nur unerträglich, sondern verhindert auch eine lebendige Demokratie.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Schweizer Spitäler bluten aus - Berrn schliesst Spitäler
In Schweizer Spitälern wird das Geld knapp. In Bern werden darum Spitäler geschlossen, in St. Gallen ist das schon passiert – genützt hat es bislang wenig.
Wenn Alexander Stibal zum Messer greift, geht es um Millimeter. Der Chirurg operiert am Spital in Münsingen an Wirbelsäule und Nervensystem. Schon bald könnte er aber auch mit Zahlen, Abrechnungen und Aktenbergen hantieren. Doktor Stibal will nämlich das Spital Münsingen BE kaufen. Zusammen mit anderen Ärzten und einem Ökonomen, politisch unterstützt von den Gemeindepräsidenten der Region.
Die Insel-Gruppe will das Spital Münsingen schliessen, ein Finanzloch über die gesamte Gruppe zwingt es dazu. Doch Stibal sagt: «Münsingen braucht ein eigenes Spital, allein schon wegen des Notfallbetriebs. Ein 90-jähriges Grosi kann in der Nacht nicht alleine in ein Spital nach Bern fahren.»
Kein Einzelfall
Münsingen BE ist kein Einzelfall. Das Schweizer Spitalwesen hängt an den Schläuchen. Die Insel-Gruppe verzeichnete im vergangenen Jahr ein Minus von 80 Millionen Franken. Darum muss neben Münsingen auch das Spital in Tiefenau BE dran glauben. Rund 200 Mitarbeitende dürften ihren Job verlieren.
Bereits Spitäler geschlossen hat der Kanton St. Gallen. Genützt hat es bislang wenig. Anfang März meldeten die St. Galler Spitäler für 2022 einen Gesamtverlust von 53 Millionen Franken. Auch das Kantonsspital Aarau braucht Geld. 240 Millionen muss der Kanton einschiessen. Für den zuständigen Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (56) alternativlos, sonst droht der Konkurs.
Vielfältige Gründe
Die Gründe für die Misere sind vielfältig. «Es gab in einigen Spitälern sicher Fehlinvestitionen. Dazu kommen die Pandemie und generell niedrige Tarife», sagt Gesundheitsökonom Simon Wieser von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Auf Tariferhöhungen aber sollen die Kantone verzichten, fordert der Bundesrat. Er befürchtet noch höhere Krankenkassenprämien.
Der Fachkräftemangel tut sein Übriges. Pflegerinnen und Pfleger sind gesucht, wenn sie fehlen, müssen temporäre Aushilfen einspringen. Die seien deutlich teurer, sagt Wieser. Mit den Spitalschliessungen kann zumindest administratives Personal gespart werden.
Notfall und Operationen
Trotz aller Probleme: Chirurg Stibal ist überzeugt, dass es möglich ist, mit dem Spital Münsingen Gewinn zu machen. «Wir können dank einer schlanken Organisation effizienter arbeiten.» Er verweist auf das Spital Emmental, das schwarze Zahlen schreibt.
Auch vor dem Fachkräftemangel hat Stibal keine Angst. «Es hat genügend fähiges Personal im Spital. Wir sind überzeugt, dass die bestehenden Teams bei uns bleiben.»
Wenn der Kauf klappt, wollen Stibal und seine Mitstreiter einen normalen Spitalbetrieb anbieten: «Wir werden zusammen mit den Hausärzten einen ordentlichen 24-Stunden-Notfalldienst sicherstellen. Es hat viele Altersheime in der Nähe, da braucht es das. Dazu kommen die Operationen.» Diese sind nötig, damit ein Spital rentiert. «Der Notfalltarif ist zu tief. Man muss die Notfälle mit Operationen querfinanzieren.»
Zweischneidiges Schwert
Die Forderung nach höheren Spitaltarifen ist nicht neu. Tariferhöhungen seien durchaus hilfreich für die Spitäler. «Irgendwann kann man nicht mehr effizienter werden», sagt Gesundheitsökonom Wieser. Wenn die Tarifkosten für stationäre Behandlungen erhöht werden, müssen gleichzeitig auch die Kantone mehr bezahlen.
Steigen die Tarife, belastet das aber auch die Krankenkassenprämien. Die sind schon jetzt eine riesige Belastung für viele Menschen und dürften 2024 nochmals um rund 7,5 Prozent steigen, wie der SonntagsBlick schrieb.
Schliessungen dürften weitergehen
Die Krise in den Spitälern dürfte sich also weiter verstärken – und auch die Spitalschliessungen weitergehen, sagt Wieser. «Es macht sicher Sinn, die Infrastruktur nicht doppelt zu bezahlen. Auch die Patienten gehen lieber in Spitäler, wo häufiger operiert wird.»
Zumindest die Schliessung von Münsingen will Chirurg Stibal verhindern. Er hat vor vier Jahren schonmal versucht, das Spital zu kaufen. Damals ist er abgeblitzt. Jetzt laufen die Verhandlungen mit der Spitalgruppe noch, darum gibt man sich allerorts zurückhaltend.
Doch selbst wenn Münsingen geschlossen wird: Die Notfallversorgung sei grundsätzlich sichergestellt, sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion. Die Kapazitäten am Inselspital sollen erweitert und allfällige Notfallspitzen ausgeglichen werden.
Klar ist schon jetzt: Klappt die Übernahme, muss es schnell gehen. «Wir brauchen eigentlich mehr Zeit, um das Spital zu retten», sagt Stibal. Dennoch ist er überzeugt, dass das Spital Münsingen bestehen bleiben muss. «Bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung wird es sehr schnell sehr gefährlich. Darum braucht Münsingen ein Spital.» Schreibt SonntagsBlick.
16.4.2023 - Tag der Systemrelevanz
Spitäler, und damit die Schweizer Bevölkerung, haben ein Problem: Beide sind nicht systemrelevant wie beispielsweise Grossbanken.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Putin ist ein «wandelnder Toter»
Der ehemalige CIA-Spionageabwehrchef James Olson glaubt, dass die Tage von Wladimir Putin gezählt sind. Für Russland gebe es nur noch zwei Optionen: den Tod oder den Sturz des Machthabers.
Ein Bombenanschlag mitten in seiner Heimatstadt St. Petersburg, eine gescheiterte Winteroffensive in der Ukraine, ein ehemaliger guter Freund, der sich als Nachfolger platzieren will und ein internationaler Haftbefehl: Für Russlands Präsidenten Wladimir Putin (70) wird die Luft dünn.
«Es läuft ganz und gar nicht gut für Russland», stellt der frühere Chef der CIA-Spionageabwehr, James Olson, im Gespräch mit der britischen Boulevardzeitung «The Sun» fest. Er sieht Putin in einer aussichtslosen Situation. Und: Er geht davon aus, dass die Tage des Präsidenten gezählt sind – auf die eine oder andere Weise.
Jede Menge Gegenwind für Putin
Der Kremlherrscher bekommt immer mehr Gegenwind. Gagik Melkonyan (66), Abgeordneter der armenischen Nationalversammlung und Mitglied der Regierungspartei des einstigen russischen Verbündeten Armenien, forderte vor kurzem: «Wenn Putin nach Armenien kommt, sollte er verhaftet werden.»
Und: Jewgeni Prigoschin (61), einst als «Putins Koch» bekannt geworden, inszeniert sich plötzlich wie ein Staatsmann. Laut dem US-Thinktank Institute for the Study (ISW) hat er Ambitionen, Putins Nachfolger zu werden.
«Das russische Volk leidet»
Olson glaubt, Putins Zukunft hängt von seinem Erfolg oder Misserfolg in der Ukraine ab. Er ist überzeugt: Solange Putin an der Macht ist, wird der Krieg weitergehen. Um die Kämpfe zu beenden, gebe es nur zwei Optionen: den Tod oder den Sturz des Präsidenten.
«Wenn Putin an der Macht bleibt, wird es einen langen Krieg geben, weil er nicht aufgeben wird. Aber: Ich glaube nicht, dass Putin an der Macht bleiben wird. Ich glaube, dass er entfernt wird», betont Olson.
Olson weiter: «Ich denke, dass Putin getötet wird.» Russlands Präsident sei ein «wandelnder Toter». Der Ex-Agent will ein Attentat nicht ausschliessen. «Das wäre dann das Ende des Krieges. Denn das russische Volk leidet.» Putin könne Russland nicht ewig ausbluten lassen. Früher oder später würden sich seine Oligarchenfreunde oder das Militär gegen ihn wenden.
Wenn es Putin doch irgendwie gelingen sollte, an der Macht zu bleiben, könnte sich der Krieg laut Olson weiter ausbreiten. Dann bestehe ein «extremes Risiko», dass Russland weitere Länder angreife. Als mögliches nächstes Ziel nennt Olson die Republik Moldau. Schreibt Blick.
15.4.2023 - Tag der Totgesagten im Blick-Liveticker
Totgesagte leben länger. An dieser alten Volksweisheit ändern auch die täglichen Liveticker-Nachrichten von Blick über Putins Gesundheitszustand und allfällige Palastrevolten im Kreml nichts.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Credit Suisse Debakel: Im Parlament gingen die Emotionen hoch
National- und Ständerat beschäftigen sich an der ausserordentlichen Session in dieser Woche ausschliesslich mit dem Debakel rund um die Credit Suisse. Am Dienstag zeigte sich ein Gefühlsbad der Emotionen im Parlament.
Drei Tage lang hat das Parlament einberaumt, um das Ende der Credit Suisse politisch zu besiegeln. Die Diskussion verlief am ersten Sessionstag emotional und dauerte bis spät in die Nacht.
Die zuständige Finanzministerin Karin Keller-Sutter (59) sagte in ihrem Statement im Ständerat, dass sie die Gemütslage des Parlaments gut nachvollziehen könne. «Ich habe Wut gehört, Frustration, teilweise Ratlosigkeit.» Sie habe dieselben Gefühle in den letzten Wochen erlebt, führte sie aus. «Meine Motivation war, Schaden von diesem Land abzuwenden.»
Der erste Sessionstag in fünf emotionalen Akten.
Ohnmacht
Am Dienstag ging es in beiden Räten grossteils um Symbolpolitik. Denn der Bundesrat hat die besprochenen Kredite für Bundesgarantien im Umfang von 109 Milliarden Franken bereits beschlossen. Die Räte können daran nicht mehr rütteln.
Trotzdem war im Parlament das Redebedürfnis gross. Mehrmals war die Rede davon, dass es unbefriedigend sei, dass der Bundesrat erneut zu Notrecht habe greifen müssen – und das Parlament damit nicht mehr viel zu sagen habe. Gleichzeitig warnte etwa der FDP-Präsident und Ständerat Thierry Burkart (47) vor zu grossen Erwartungen. «Gewisse Dinge können nämlich nie reguliert werden, dazu gehören: Anstand, Vertrauen und Demut.»
Wut
Die Wut der Parlamentarier bekam besonders die Teppichetage der CS zu spüren. Diese seien der «Gier nach mehr Gewinn verfallen und zu grosse Risiken eingegangen», kritisierte etwa der Mitte-Ständerat Peter Hegglin (62). Die Bankverantwortlichen hätten Risiken ausgeblendet und nichts aus der Vergangenheit gelernt.
SP-Ständerat Roberto Zanetti (68) sprach gar von «Bankstern» in Anlehnung an den Begriff Gangster. Er habe mehr Achtung vor einem «ordinären Bankräuber», denn «der nimmt doch ein beträchtlich höheres unternehmerisches Risiko in Kauf als all diese Klugscheisser der Bahnhofstrasse und der Wall Street», wütete er in der «Chambre de Réflexion». Die Banker hätten sich als «Besserwisser inszeniert und jetzt bereits zum zweiten Mal eine Bank an die Wand gefahren».
Auch SVP-Präsident Marco Chiesa (48) sprach mit einer Menge Wut im Bauch ins Mikrofon: «Basta», rief er in den Saal. Das Parlament müsse nun dafür sorgen, dass sich so etwas nicht wiederhole. Noch schwerwiegender als der Zerfall der traditionellen und repräsentativen Bank sei jedoch der Verlust des Vertrauens in die Schweiz, sagte Chiesa. «Die Schweiz als unerschütterlicher Hort der Stabilität und der Sicherheit schmilzt dahin wie Schnee in der Sonne.»
Enttäuschung
Der Untergang der CS sei eine «grosse, bitter-herbe Enttäuschung für die ganze Schweiz», kommentiert Mitte-Ständerätin Heidi Z'graggen (57) die Geschichte um die CS. Es habe aber nicht nur die Chefetage der Bank Schuld, sondern es sei eine Kumulation verschiedener einzelner Versäumnisse, die «zum Totalabsturz des Systems der Bank Credit Suisse» geführt habe.
Die gewählte Lösung sei kurzfristig und könne nicht noch ein zweites Mal auch für eine taumelnde UBS zum Einsatz kommen, warnte EVP-Präsidentin und Nationalrätin Lilian Studer (45). Es brauche nun eine Untersuchung, wie es so weit habe kommen können, tönte es aus dem Rat. Zudem forderten die enttäuschten Politikerinnen in ihren Voten, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Hoffnung
Auch wenn die negativen Gefühle und Voten deutlich im Rat überwogen: Zwischendurch blitzte auch ein Hoffnungsschimmer durch. Bundesrätin Karin Keller-Sutter machte im Ständerat noch einmal klar: «Wir haben am Schluss die gewählte Lösung als die unter den gegebenen Umständen beste betrachtet.»
Unterstützung erhielt die FDP-Magistratin unter anderem von ihrem Parteikollegen, dem Glarner Ständerat Thomas Hefti (63). Er habe Mühe damit, dass die gefundene Lösung «vielerorts umgehend schlechtgeredet wurde». Er hoffe, dass die «verordnete Behandlung greift», gerade für die Angestellten der CS. Stimme es, dass überall Fachkräfte fehlen und Personal gesucht werde, «besteht vielleicht doch ein Funke Hoffnung».
Und Hoffnung haben auch die Grünen. Sie wiederholten angesichts des CS-Debakels ihre Forderung nach der Entflechtung von Geschäfts- und Investmentbanken. «Ich hoffe, dass sich dieses Mal eine Mehrheit dafür ausspricht», sagte Grünen-Ständerätin Adèle Thorens Goumaz (51). Schreibt Blick.
12.4.2023 - Tag der Pöstchenjäger*innen am Futtertrog der Nation
Herrlich! Dieses Gekeife im ach so Hohen Haus von und zu Bern deckt mit aller Brutalität die lächerliche Unfähigkeit des Schweizer Parlaments auf. Der Schweizer Nationalrat lehnt den 109-Milliarden-Kredit für die CS-Fusion ab. Wohlwissend, dass die Ablehnung rein gar nichts bedeutet, weil sie für den Bundesrat nicht bindend ist. Der gestrige (und heutige) Klamauk der Parlamentarier*innen dient einzig und allein der Positionierung für die kommenden National- und Ständeratswahlen im kommenden Herbst.
Nie wird so viel gelogen wie vor Wahlen. Mann/Frau will ja schliesslich den Platz am Futtertrog der Nation nicht verlieren. Und das Schweizer Wahlvolk ist auch noch so dämlich und wählt solche Muppetfiguren. Kein Wunder lachen die Diktatoren über die Demokratien. Da braucht man sich auch nicht mehr zu wundern, wenn Populisten wie Pilze aus dem Boden schiessen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Freddy Quinn will mit 91 Jahren noch heiraten
Er ist 91 Jahre alt und will nun wohl bald vor den Traualtar treten: Freddy Quinn. Seine Freundin? Ist fast 30 Jahre jünger als der Sänger.
Der österreichische Sänger, Schauspieler und Entertainer Freddy Quinn, 91, hat offenbar vor, seine Freundin zu heiraten. Das meldet die »Bild«-Zeitung . Demnach heißt die Frau an Quinns Seite Rosi und ist 64 Jahre alt.
Einen offiziellen und romantischen Antrag habe es nicht gegeben. Quinn habe das wohl einfach so vorgeschlagen, sagte Rosi der Zeitung.
Anfang der Fünfzigerjahre trat Freddy Quinn als Sänger in Hamburg auf und wurde berühmt. Seine Schallplatte »Heimweh« wurde rund acht Millionen Mal verkauft. Bekannt wurde Quinn durch Lieder wie »Junge, komm bald wieder« und »La Paloma«. Auch als Schauspieler (»Der Junge von St. Pauli«) konnte Quinn Erfolge feiern.
Quinn achtete stets darauf, nicht zu viel Privates von sich preiszugeben. Erst nach der Jahrtausendwende wurde bekannt, dass die Hamburger Geschäftsfrau Lilli Blessmann Quinns Lebensgefährtin war. Blessmann starb im Jahr 2008. Schreibt DER SPIEGEL.
11.4.2023 - Tag des Alten Testaments
Der Herr hatte es ja versprochen: Abraham und Sara bekamen einen Jungen. Sie nannten ihn Isaak. Abrahams Frau Sara gebar ihren Sohn Isaak, als sie schon über 90 Jahre alt war. Und Sara sagte: «Gott hat mir ein Lachen bereitet; jeder, der es hört, wird mir zulachen.»
Sara wurde 127 Jahre alt. Sie überlebte ihren älteren Gatten Abraham, der im Alter von 175 Jahren starb. So steht's geschrieben im Alten Testament (Abraham und Sara, Genesis 11-15; 17; Abraham 1 und 2). Dann wird es ja wohl auch stimmen! Milliarden von Juden, Muslimen und Christen können nicht irren.
Geschätzter Freddy Quinn: Sie sehen, da ist noch viel Luft nach oben! Vor allem, wenn man bedenkt, dass Ihre «Rosi» gerade mal 64 lächerliche Jährchen alt ist.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
US-Kanzlei will anscheinend gegen Finma klagen
Die AT1-Anleihen der Credit Suisse werden bei der Übernahme durch die UBS vollständig abgeschrieben. Die Besitzer dieser Anleihen erleiden dadurch einen Totalverlust.
Kaum war die Übernahme kommuniziert, hat die US-Anwaltskanzlei Quinn Emanuel angekündigt, juristische Schritte zu prüfen. Sie hat die Besitzer von AT1-Anleihen aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Das scheint gefruchtet zu haben: «Offenbar ist jetzt genug Fleisch am Knochen, um zuerst ein Verfahren gegen den Finma-Entscheid anzustrengen. Später könnte eine Klage gegen die Credit Suisse beziehungsweise ihre neue Besitzerin, die UBS, folgen», schrieb die NZZ am Freitag.
Der Kreis der Betroffenen sei gross: Über 1000 E-Mails von Bondhaltern seien bei der Kanzlei aus Kalifornien eingegangen – darunter auch viele Mails von Schweizer Kleinanlegern. Mindestens 15 Grossinvestoren hätten gemeinsam entschieden, die Verfügung der Finma juristisch anzufechten.
Auch die Migros Pensionskassen haben mit Credit-Suisse-Papieren viel Geld verloren – 99 Millionen alleine wegen AT1-Anleihen. Schreibt Blick im CS/UBS-Liveticker.
29.3.2023 - Tag der mündelsicheren Pensionskassenanlagen
Dass im Zusammenhang mit den AT1-Anleihen der Credit Suisse eine US-Sammelklage kommen wird war von allem Anfang an so sicher wie das Amen in der Kirche. Ist jetzt als Live-Ticker-News nicht unbedingt aufregend und somit nicht mal eine Schnappatmung wert.
Mehr Gedanken sollten wir uns über den gewaltigen Verlust der MIGROS-Pensionskasse machen, die beim CS-Desaster fast 100 Millionen Schweizer Franken verloren hat. Einmal mehr wird der Systemfehler aufgedeckt, der seit der Einführung der obligatorischen Pensionskasse ein Risiko sondergleichen für die Pensionskassen darstellt.
Doch hier schweigt die Politik. Warum eigentlich? Denken Sie darüber nach, wie viele Schweizer Parlamentarier*innen mit den Pensionskassen verbandelt sind. Von der anfänglich gepredigten «Mündelsicherheit*» der Pensionskassen-Anlagen ist im Laufe der Zeit des brachialen Neoliberalismus rein gar nichts mehr übrig geblieben. Ein weites Feld, über das sich ein Buch mit vielen Seiten schreiben liesse.
*Als mündelsicher gelten Finanzprodukte, die vom Gesetzgeber ausdrücklich als besonders risikoarm erklärt werden.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
«Kommissar Rex»-Star liebt zwei Frauen
Gedeon Burkhard orientiert sich nicht am klassischen Beziehungsmodell. Der «Kommissar Rex»-Star liebt nämlich zwei Frauen gleichzeitig.
Alle guten Dinge sind drei: Getreu nach diesem Motto lebt Gedeon Burkhard (53). Der «Kommissar Rex»-Star führt nämlich eine Beziehung zu dritt, wie er der «Bunte» erzählt hat. Er liebt sowohl Ann-Britt Dittmar als auch Sascha Veduta.
Dabei geht es nicht nur um Sex. «Und ich bin hier jetzt nicht der grosse Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit», erklärt er der deutschen Zeitschrift.
Keine weitere Person mehr in der Beziehung
Gemeinsam leben die beiden Frauen mit Burkhard in einer Wohnung in Berlin. Das einzige Problem, das die drei haben, ist beim Schlafen. Denn das 1,80 Meter grosse Bett sei zu klein für drei Personen. Der Schauspieler will es deshalb auf beiden Seiten um 40 Zentimeter vergrössern.
Doch auch wenn der Schlafplatz grösser wird: Eine weitere Person in der Beziehung wird es nicht geben. «Noch jemand passt nicht mit ins Bett», finden die beiden Frauen.
Gedeon Burkhards Mutter lebt auch in der Wohnung
In ihre Wohnung haben sie dennoch eine weitere Frau gelassen. Neu lebt nämlich auch Gedeon Burkhards Mutter Elisabeth von Molo (79) dort. «Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken», sagt Burkhard. Nun scheint also alles gut zu sein in der Wohngemeinschaft. Schreibt Blick.
28.3.2023 - Tag der Vielweiberei
Ja und? Ist jetzt wirklich nichts Neues im Westen. Schon der Schweizer Rennfahrer und Rennstallbesitzer Walter Brun aus dem Entlebuch lebte in seiner Villa in Kastanienbaum mit der geschiedenen Ex-Frau und der neuen Flamme einträchtig zusammen.
Der österreichische Liedermacher André Heller sang 1973 in seinem Lied «Ich will dass es alles gibt was es gibt»: «Und wenn ein Hirte sein Lamm liebt, soll er es lieben, wenn er es liebt.»
Ob Heller diese Textzeile für die Muslime schrieb, denen Allahu akbar sogar vier Frauen gleichzeitig zubilligt, ist nicht bekannt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
«Herr Rohner ist für mich ein Räuber»: Auch SVP-Giezendanner verlor beim CS-Debakel richtig viel Geld
Der ehemalige SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner verlor mit CS-Aktien 200'000 Franken, wie er in einem Interview sagte. Hauptverantwortliche seien im Management der Bank zu finden, klagt er.
In der Sendung «Talk Täglich» packt der ehemalige SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner (69) über seine unerfreulichen Erlebnisse der letzten Tage aus. Der Ex-Geschäftsführer der Giezendanner Transport AG hat nämlich eine Stange Geld verloren: 200'000 Franken seien ihm aufgrund des CS-Debakels flöten gegangen.
Damit geht es ihm wie Unternehmer Hausi Leutenegger (83). Dieser erzählte Blick diese Woche, dass er Aktien im Wert eines Porsches verloren habe.
«Klar bin ich selber schuld»
Im November, als der Kurs der Credit Suisse unaufhaltsam stürzte, hat Giezendanner praktisch alle Aktien verkauft, wie er im Interview erzählt. Doch mit dem Saudi-Deal habe er wieder etwas Hoffnung in die Bank gefasst und 100'000 neue Aktien erworben, zum Stückpreis von 2.52 Franken.
«Klar bin ich selber schuld», sagt Giezendanner im Nachhinein selbstkritisch. Wer Aktien besitze, der trage ein Risiko. «Aber wenn die Finma und Karin Keller-Sutter eine saubere Rolle gespielt hätten, hätten die CS-Aktionäre nichts verloren», findet er. Die Finma habe in ihrer Aufsicht total versagt und Nationalbankchef Thomas Jordan sei kein Geschäftsmann. «Sonst hätte er die CS nicht so billig verkauft.»
Bei all seiner Kritik an den Behörden seien die eigentlichen Verantwortlichen in der Bank zu finden, so der SVP-Mann. «Herr Rohner ist für mich ein Räuber.» Er meint damit Urs Rohner (63), den früheren Verwaltungsratspräsidenten der Bank. Er, die anderen Verwaltungsräte und CEOs der Credit Suisse seien die Hauptschuldigen des Debakels. Dort seien «Gauner und Räuber» am Werk, die sich bedient hätten.
Kritik an Ueli Maurer
Zwar glaubt der SVPler, dass die CS ohne die Übernahme durch die UBS nicht überlebt hätte: Doch habe man das nicht erst am 17. März gewusst. «Das hätte der Bundesrat doch spätestens seit Januar wissen müssen», so Giezendanner. Und so bekommt mit SVP-Bundesrat Ueli Maurer (72) auch ein Parteikollege sein Fett weg: «Auch er hätte sich orientieren lassen sollen.»
Dass der frühere Finanzminister noch Ende Jahr zu SRF sagte, man müsse die CS und die UBS jetzt einfach ein Jahr oder zwei in Ruhe lassen, kritisierten bereits weite Kreise. Schreibt Blick.
27.3.2023 - Tag der Toupetträger und Besserwisser vom Dienst
Melden sich jetzt alle ehemaligen Toupet-Träger, Polit-Clowns, Ü69- bis Ü100-Jährigen und sonstigen Trychler- und SVP-Sympathisanten bei Blick, um bei der Boulevard-Mutter Theresa von der Zürcher Dufourstrasse ihr leidgeprüftes Herz auszuschütten, weil sie beim CS-Crash ein paar Tausend Fränkli verloren haben? Sind das nicht die Gleichen, die noch vor kurzem von den CS-Dividenden profitiert haben? No Risk, No Fun.
Der ehemals als «ewiger Besserwisser vom SVP-Dienst» und «wandelndes Toupet» bei allen Arena-Sendungen und sonstigen Polit-Fasnachtsverstaltungen bekannte Giezendanner konnte es also nicht verhindern, dass er 200'000 Fränkli mit CS-Aktien verlor? Ausgerechnet er, der doch immer alles besser wusste als alle anderen Erdenbürger dieser Welt?
Der «Giezi», wie er von Chauffeuren liebevoll genannt wurde, der selbst einem Einstein bezüglich Relativitätstheorie lauthals widersprochen hätte, als wehleidige Jammertante? Die lächerlichen 200'000 Fränkli wird der Multimillionär ja wohl noch verkraften können.
Aber eines muss man «Giezi» doch lassen: Trotz seiner 200'000-Fränkli-Blamage, die ja eher gegen ihn als für ihn spricht, und als einer der ehemals treuesten Vasallen des geheiligten Evangeliums vom Herrliberg kommt sein Parteikollege und ehemaliger SVP-Bundesrat Ueli Maurer nicht ganz ungeschoren davon. Was einmal mehr die alte Floskel bestätigt: Bei Geld hört die Freundschaft auf.
Seinem Freund «Giezi» hätte doch der «Trychler»-Ueli den freundschaftlichen Ratschlag in die Ohren flüstern können, sich seiner CS-Aktien zu entledigen, so wie er seinerzeit sein Toupet klammheimlich und ohne das übliche Getöse exekutiert hat.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Blick-Leser und Rentner verliert mit CS-Aktien über 50'000 Franken
Frustriert und verärgert. Das ist die Gefühlslage von Blick-Leser und Rentner Bruno G.* nach der CS-Übernahme durch die UBS. Als langjähriger Aktionär hat er viel Geld verloren.
Der Niedergang der Credit Suisse (CS) ist kostspielig. Für den Finanzplatz Schweiz, für die Grossaktionäre aus Saudi-Arabien und Katar, aber auch für die vielen Kleinaktionäre in der Schweiz.
Einer von ihnen ist Blick-Leser und Rentner Bruno G.* (75) aus Basel. Mehr als 50'000 Franken hat der langjährige CS-Aktionär durch die plötzliche Übernahme der CS durch die UBS verloren. Mitspracherecht hatte er keins – weil der Bundesrat Notrecht angewendet hat, konnten sich Aktionäre wie G. nicht zum Deal äussern.
Einerseits ist G. über die Verantwortlichen der CS verärgert, andererseits auch über die Regierung, die seiner Meinung nach «unklar» informierte. Der Rentner bezeichnet das Vorgehen als «Riesensauerei» und als «faktische Enteignung». «Das Ganze ist ein Bschiss», sagt er zu Blick.
CS-Aktien überstürzt nach UBS-Deal verkauft
G. stört sich besonders an der Kommunikation der Verantwortlichen, die ihn letztlich Geld gekostet habe. Er spricht die Pressekonferenz am Sonntagabend vor einer Woche und die Frage an, ob die CS-Aktien am Tag nach der Übernahme durch die UBS noch gehandelt werden können. Finma-Direktorin Marlene Amstad (54) wollte – oder konnte – das an der Pressekonferenz nicht beantworten.
«Ich habe darum gleich am Montagmorgen meine Aktien für etwas über 70 Rappen verkauft, damit ich überhaupt noch etwas kriege», sagt der Rentner. Pikant: Die UBS bezahlt CS-Aktionären 76 Rappen pro Aktie in UBS-Aktien. Doch der Aktienkurs der Credit Suisse stürzte am Montagmorgen trotzdem kurzzeitig unter die 70-Rappen-Marke. «Wäre klarer kommuniziert worden, hätte ich meine Aktien behalten und nicht überstürzt verkauft», sagt G.
Schweizer Kleinaktionäre wollen klagen – aber können sie?
Noch am Freitag hatte er die Einladung für die Generalversammlung der CS erhalten. Diese hat er inzwischen im Altpapier entsorgt. Ob er klagen wird, weiss der Rentner noch nicht. Vielleicht schliesst er sich dem Kleinaktionär und Anwalt Perica Grasarevic an, der klagewillige Aktionäre kostenlos unterstützen will und bereits die Plattform notrecht.com aufgeschaltet hat.
Das Interesse daran sei gross und übertreffe jede Erwartungen, so Grasarevic auf Twitter. «Wir hatten in Peak-Zeiten über 300 Anfragen pro Stunde.» Dass für die Kleinaktionäre in der Schweiz etwas zu holen ist, bleibt unwahrscheinlich. Anders als in den USA gibt es in der Schweiz das Instrument der Sammelklage nicht.
G. macht sich denn auch wenig Hoffnung: «Eine Einzelklage ist in der Schweiz schwierig und kostet Zeit und Geld.» Schreibt Blick.
26.3.2023 - Tag der Blick-Leser
Der Zyniker in mir würde jetzt wohl sagen, das kommt davon wenn man den Blick liest.
Der Realist hingegen hält fest, dass der Blick-Leser und Rentner vom Verlust der 50'000 Franken mit seinen CS-Aktien selbst dann eingeholt worden wäre, wenn er seine Informationen rund um die CS-Tragödie aus der NZZ bezogen hätte.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Gerhard Pfister vollzieht Kehrtwende bei der Bankenregulierung: «Es wäre anständig, wenn die Banken-Manager etwas zurückzahlen würden»
Nach dem CS-Desaster macht sich der Mitte-Präsident für eine linke Forderung stark, gegen die sich Mitte, FDP und SVP immer wehrten. Die Politik müsse aufhören, Ideen abzulehnen, nur weil sie vom Gegner kommen, sagt er.
Wie viel Eigenkapital muss eine Grossbank ausweisen? Wie viel Risiko darf sie für den Profit auf sich nehmen? 15 Jahre lang scheiterte die Linke am bürgerlichen Widerstand, hier Verschärfungen anzusetzen. Mit Mitte-Präsident Gerhard Pfister (60), der im Gespräch mit SonntagsBlick seinen Meinungswechsel ankündigt und erklärt, könnten sich in dieser Frage nun die politischen Mehrheitsverhältnisse ändern. Doch ist der Gegendruck bereits programmiert – und damit die Debatte über die Finanzplatzregulierung.
SonntagsBlick: Herr Pfister, seit letztem Sonntag hat die Schweiz nach einer spektakulären Rettung durch die UBS eine Grossbank weniger. Ihre Noten für die Politik?
Gerhard Pfister: Man muss den Verantwortlichen immerhin zugutehalten, dass sie etwas erreicht haben, nämlich dass aus der Schweiz heraus kein internationaler Bankencrash erfolgt ist. Diesem Ziel hat man vieles untergeordnet. Etwas hat mich aber an der Medienkonferenz am Sonntagabend richtig geärgert.
Was meinen Sie?
Es machte mich betroffen, dass zwei Gruppen kaum erwähnt wurden: die Kundinnen und Kunden und die Mitarbeitenden der Credit Suisse. Ich finde es schon bemerkenswert, dass man bei einem so schwierigen Entscheid den Fokus ganz auf das Technische, auf die Finanzmärkte richtet, aber die betroffenen Menschen nicht anspricht. Das hätte man unbedingt machen müssen – egal ob Bundesrätin Keller-Sutter oder die Chefs von CS oder UBS.
Sonst sind Sie zufrieden mit dem Vorgehen?
Man stellt sich als Parlamentarier schon einige Fragen. Uns hat man immer gesagt, dass die jetzige Regulierung reicht, und jetzt sieht man: Es hat eben doch nicht gereicht.
Sie meinen die «Too big to fail» Gesetzgebung.
Ich kann mich gut erinnern, als man uns nach der UBS-Rettung 2008 sagte: Das wird jetzt nicht mehr passieren …
Wer ist «man»?
Natürlich hat das CS-Management dieses Debakel verursacht. Aber der Regulator steht auch in der Verantwortung, also die Aufsicht, die Nationalbank, der Bundesrat. Ich sage: Wenn es der politische Wille ist, dass so was nicht mehr passiert, muss man Gesetze machen, die das verhindern. Ich glaube, dass die Bevölkerung wissen will, was wir machen, damit wir nach 2008 und 2023 kein drittes Mal eine Grossbank retten müssen.
Und zwar einen noch viel grösseren Konzern.
Ein Gebilde, das von vielen als «too big to be rescued» (zu Deutsch: zu gross, um gerettet zu werden) beurteilt wird. Wären wir dann überhaupt noch in der Lage, so etwas abzuwickeln? Es geht um Steuergelder. Im Parlament tragen wir manchmal harte Kämpfe wegen ein paar hunderttausend oder einer Million Franken aus. Und dann werden über Nacht mal schnell per Notrecht 209 Milliarden Franken locker gemacht. So droht ein Glaubwürdigkeitsschaden für Wirtschaft und Politik.
Hoffen Sie, dass das Ganze die Haltung in den Teppichetagen ändern wird?
Am Sonntag verteufelt man den Staat, und am Montag ruft man nach ihm. Diese Mentalität geht nicht mehr, darum appelliere ich an die Verantwortlichen in der Wirtschaft, sich in Zukunft differenzierter zur Rolle des Staates zu äussern. Die Überheblichkeit gewisser Banker, die mit dem Geld anderer Leute bei der Weltspitze mitspielen wollen, funktioniert nicht. Ich habe mit grosser Zufriedenheit gehört, dass der Präsident der UBS sagte, ein guter Banker müsse langweilig sein. Und ich hoffe sehr, dass die grosse UBS sehr langweilig bleibt. Denn eine langweilige Bank ist eine solide Bank. Wenn aber die Leute an der Spitze ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind, kann auch die strengste Regulierung nicht helfen.
Womit wir wieder beim Stichwort Regulierung sind. Wie soll diese verändert werden, um einen nächsten Grossbanken-GAU zu verhindern?
Die vorgegebene Höhe des Eigenkapitals ist für mich der zentrale Punkt. Wer eine Wohnung kaufen will, muss 20 Prozent Anteil des Kapitals selbst einbringen, bevor die Bank überhaupt bereit ist, für eine Hypothek ins Risiko zu gehen. Ich bin überzeugt, dass eine hohe Eigenkapitalquote für Banken ganz viele Regulierungsvorschriften ersetzt und die richtigen Anreize setzt.
Laut Kritikern würde dies aber die Wettbewerbsfähigkeit einschränken.
In der heutigen Zeit ist eine solide Eigenkapitalbasis das, was die Kunden wollen. Zu wenig Eigenkapital bringt Risiken, die wir den Steuerzahlenden nicht mehr zumuten können. Tiefes Eigenkapital ist ein falscher Anreiz für ein höheres Risiko, damit die kurzfristig Eigenkapitalrendite höher ausfällt. Damit wiederum rechtfertigen die Chefetagen die hohen Boni. Geht das Ganze schief, müssen die Steuerzahlenden einspringen. Deshalb, bin ich überzeugt, ist der Kern des Problems die mangelnde Ausstattung mit Eigenkapital. Die Regulierungen haben den Nachteil, dass sie eigentlich ums Risiko herum regulieren, den Kern des Risikos aber nicht treffen.
Heute muss das Eigenkapital der Geldinstitute fünf Prozent ihrer Bilanzsumme betragen. Was fordern Sie?
Es braucht eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent, das wird von diversen renommierten Fachleuten für vernünftig gehalten.
Ihr Positionswechsel ist beachtlich. Die Linke verlangt das schon lange, fand aber wegen dem Widerstand der Bürgerlichen nie eine Mehrheit.
Wir müssen in der Politik aufhören, eine Idee schon deshalb abzulehnen, weil sie vom politischen Gegner kommt.
Das Ansinnen hatte also keine Mehrheit, weil es von links kam?
Das lag sicher auch am Absender. Natürlich gibt es schon jetzt wieder Interessenvertreter, die dagegen lobbyieren, aber jetzt müssen wir überparteilich das Wohl des Landes im Auge behalten. Da erwarte ich von allen Parteien, dass sie wenn nötig über den eigenen Schatten springen. Als gewählter Parlamentarier und Parteipräsident habe ich eine Rechenschaftspflicht gegenüber meinen Wählerinnen und Wählern und meinem Land, dann kann ich doch nicht sagen: Ich habe keinen Fehler gemacht.
Im Umkehrschluss werfen Sie Mitte, FDP und SVP vor, die letzten 15 Jahre falsch gelegen zu haben. Das ist für den sogenannten Schulterschluss im Wahljahr wenig förderlich.
Ich finde diese Schulterschlussdiskussion, diese Blockhaltung nicht mehr zeitgemäss. Wer da als Bürgerlicher sagt, er habe keine Fehler gemacht, macht meines Erachtens denselben Fehler, den er dem CS-Management vorwirft.
FDP-Präsident Thierry Burkart und SVP-Nationalrat Thomas Matter wollen die CS Schweiz heraustrennen und als eigene Bank retten. Ihre Meinung?
Wir sind uns einig, dass die UBS eine kritische Grösse erreicht hat. Wenn man den Schweizer Teil abtrennt, ist die UBS allerdings nicht wahnsinnig viel kleiner. Und könnte die Politik die UBS überhaupt dazu zwingen? Aber wir müssen alle Optionen diskutieren, wie auch das Trennbankensystem. Dazu kommt: Wenn die UBS dieser Koloss bleibt, dann wird ihr die Politik regulatorische Fesseln anlegen …
… eine Lex UBS.
Richtig, dann wird es eine Lex UBS geben. Dann wird sich die Bank wohl gut überlegen, ob sie ihre Grösse aufgeben oder die Regulatorien über sich ergehen lassen will, mit denen die Schweiz sicherstellt, dass nicht auch diese Bank eines Tages zu Lasten der Steuerzahlenden gerettet werden muss.
Es ertönen Geldforderungen an die ehemaligen CS-Manager. Unterstützen Sie das?
Ich fände es sehr sinnvoll und anständig, wenn die sehr gut besoldeten Manager freiwillig etwas zurückzahlen würden. Wenn dies nicht passiert, muss man prüfen, was sich auf dem Rechtsweg machen lässt. Es geht wie gesagt um das Vertrauen der Bevölkerung in Wirtschaft und Politik. Schreibt SonntagsBlick.
25.3.2023 - Tag der schuldigen Schweizer Unschuldslämmer aus der Politik
Was man als geschmeidiger/geschmeidige Politiker/Politikerin seit dem CS-Crash so alles dahinplappert, wenn im Herbst nationale Wahlen bevorstehen, geht auf keine Kuhhaut mehr und löst wohl bei vielen Schweizerinnen und Schweizern einen Brechreiz aus. Von einer Stunde zur andern wandeln sich alle, aber wirklich alle aus diesem unappetitlichen Politverein vom Saulus zum Paulus, beziehungsweise von der Saula zur Paula.
Besonders putzige Forderungen stellt der bislang nur als abartig Neoliberaler in Erscheinung getretene Mitte-Präsident Gerhard Pfister an die Bankster. Mit den Worten «Es wäre anständig, wenn die Banken-Manager etwas zurückzahlen würden» formuliert er sein Geschwurbel im Sinne von «ich wasche dir den Pelz aber mache dich nicht nass». Wieviel darf es denn sein, Herr Pfister?
Wie wäre es, wenn alle Schweizer Parteien bis hin zur SP nicht nur «etwas», sondern die gesamten Zuwendungen (früher «Schmiergelder» genannt) vollumfänglich zurückzahlen würden, die sie und ihre Abgeordneten je nach Parteistärke über Jahrzehnte hinweg von beinahe allen Schweizer Banken empfangen haben? Da würden sich Millionen im zweistelligen Bereich zusammenläppern.
So soll allein die CS als höchster «Schmierlappen» der Schweizer Bankenszene laut einer Umfrage von SRF pro Jahr eine Million Schweizer Franken an die Parteien und deren Funktionäre «ausgeschüttet» haben, gefolgt von der UBS mit 750'000 Franken. Das sind, wohlverstanden, nur die offiziellen Beiträge der Banken an die Parteien und deren Personal. Welche Summen bei den Hinterzimmer-Gesprächen zwischen Banken und Politeliten geflossen sind, bleibt wohl für immer ein Geheimnis.
Liebe Politiker und Politikerinnen, spart Euch Eure flammenden Wahlkampfreden mit dem Narrativ «haltet den Dieb» im Zusammenhang mit der CS-Pleite. Ihr seid am Debakel genau so schuldig wie die Bankster. Hört auf mit Eurer widerwärtigen Augenwischerei, bevor Eure Wendehälse einen Kropf bekommen, der irgendwann einmal platzen wird. Hoffentlich am Wahlabend im kommenden Herbst 2023! Die mangels seriöser Wahl-Alternativen äusserst geringe Hoffnung stirbt bekannterweise zuletzt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Jan Fleischhauer: E bitzeli käuflich, e bitzeli feig: So ist sie, die Schweiz. Leider
Die Schweiz bildet sich viel auf ihre Rechtschaffenheit ein. Es braucht nicht die Credit Suisse, um Zweifel zu bekommen. Schon das Verhalten gegenüber der Ukraine hat gezeigt, dass die Moral oft nur bis zum nächsten Geldautomaten reicht.
Mit der Schweiz verhält es sich ein wenig wie mit China. Spektakuläre Natur. Jeder erdenkliche Luxus für diejenigen, die es sich leisten können. Überhaupt ist touristisch einiges geboten. Man darf nur nicht nach den Grundsätzen fragen, die das Ganze zusammenhalten.
In China war ich zwei Mal in meinem Leben. Ich kann nicht sagen, dass es mir gefallen hätte. Dass die Leute ständig auf den Boden spucken, lässt sich noch unter „regionale Eigenheit“ abbuchen. Aber dass sie einen am laufenden Band wissen lassen, dass sie das auserwählte Volk seien, ist auf die Dauer etwas enervierend. Es gibt, soweit ich das sehe, keine andere Nation, bei der Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung so weit auseinanderfallen.
Ich war immer gerne in der Schweiz
Der Schweizer spuckt nicht auf den Boden, davor bewahrt ihn schon die Nähe zu seinen Nachbarn. Wer weiß, wenn er könnte, wie er wollte, wäre er möglicherweise in Versuchung. Aber die Lage zwischen Italien, Frankreich und Österreich ist an dem kleinen Bergvolk nicht spurlos vorübergegangen. Der Schweizer reibt einem auch nicht ständig unter die Nase, dass er die Schweiz für den Nabel der Welt hält. Sich allen überlegen zu fühlen, ist das eine – es bei jeder Gelegenheit herumzuposaunen etwas ganz anderes.
Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich war, anders als in China, immer gerne in der Schweiz. Die Berge sind toll. Es gibt ordentliche Weine und prima Käse. Fledermäuse sind von der Speisekarte ausgenommen. Außerdem ist alles sehr sauber und aufgeräumt. Im Grunde so wie in Baden-Württemberg, plus Alpen und Paradeplatz. Manche Leute beklagen sich über den Dialekt, aber in der Hinsicht bin ich pragmatisch: Sprachbarrieren können einen auch vor Enttäuschungen bewahren.
Man sollte nur nicht genauer nachfragen, womit sie ihr Geld verdienen, wenn man sich sein Schweiz-Bild erhalten möchte. Niemand sagt das so offen, aber ein nicht unbeträchtlicher Teil des Reichtums verdankt sich der Tatsache, dass man in der Schweiz Leute akkommodiert, denen man andernorts nicht mal den kleinen Finger reichen würde.
Raten Sie mal, mit wem die Credit Suisse groß geworden ist, jenes berühmte Geldinstitut, das gerade für ein mittleres Bankenbeben in Europa gesorgt hat. Mit der Vermögensvermehrung ehrbarer Handwerker und Kaufleute, die ihr Erspartes brav zum Bankangestellten ihres Vertrauens trugen?
Nationalheiligtum der Schweiz ist die Neutralität
So steht es vielleicht in der Firmenchronik. In Wirklichkeit war die Credit Suisse immer schon eine erste Adresse für alle, die ihr Geld aus, sagen wir, inoffiziellen Quellen beziehen. Es würde mich nicht wundern, wenn die neuen Besitzer bei einer Besichtigung des Tresorraums auf Schließfächer stießen, auf denen sich noch die Namen von Albert Speer oder Idi Amin finden.
Das Nationalheiligtum der Schweiz ist die Neutralität. Auf kaum etwas ist man so stolz wie auf die Tatsache, dass man sofort die weiße Flagge hisst, wenn es irgendwo Ärger gibt. Neutralität klingt so schön vornehm, ein wenig nach Rotem Kreuz und Internationalem Gerichtshof. Tatsächlich ist es nur ein anderes Wort für die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs unter veränderten Bedingungen. So wie sie in der Schweiz Neutralität verstehen, ist es ein Freibrief, es sich unter keinen Umständen mit jemandem verderben zu lassen, auch nicht mit den übelsten Halsabschneidern und Blutsäufern.
Vor ein paar Wochen mussten die Schweizer entscheiden, ob sie der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen helfen sollen. Die Hürde war denkbar niedrig. Sie hätten noch nicht einmal selbst helfen müssen. Sie hätten nur erlauben müssen, dass Deutschland die Panzermunition, die man in der Schweiz für den Gepard gekauft hat, an Kiew weitergeben darf. Der Gepard spielt bei der Verteidigung der Ukraine eine wichtige Rolle. Dass es dem geschundenen Land bislang gelungen ist, den russischen Drohnenangriffen einigermaßen standzuhalten, verdankt sich nicht zuletzt den Kanonen des deutschen Flugabwehrpanzers.
Moral reicht nur von hier bis zum nächsten Geldautomaten
Auch in der Schweiz ist man selbstverständlich für das Selbstverteidigungsrecht eines Volkes. Man will halt nur nicht dabei erwischt werden, dass man etwas dafür tut, dass sich jemand auch verteidigen kann. Nicht auszudenken, was Wladimir Putin denken würde, wenn er erfährt, dass die Schweiz dabei geholfen hat, Kinder vor dem sicheren Bombentod zu retten!
Also taten sich die Schweizer Volkspartei und die Grünen zusammen und brachten die Liefergenehmigung zu Fall. Von der SVP weiß man, dass die Moral nur von hier bis zum nächsten Geldautomaten reicht. Dass sich auch die Grünen zu den Russlandhelfern gesellt haben, hat manche überrascht. Bei der SVP denken sie, dass sie die Schweiz verkörpern würden. Aber in Wirklichkeit kommt der Schweizer in den Grünen zu sich selbst: ein bisschen käuflich, ein bisschen feig, aber dafür immer unterwegs mit erhobener Nase.
Selbstverständlich trägt man in der Schweiz auch nur widerwillig die Sanktionen mit. Wo fühlt sich der Oligarch besonders wohl? Richtig, am Genfer See. Praktischerweise bringt die Schweiz alles mit, was der russische Oligarch schätzt: urige Chalets, teure Uhren, viele Millionäre, mit denen er sich messen kann, und gemäßigte Temperaturen, die seiner Körperfülle entgegenkommen. Die Mädels gibt’s obendrauf.
Mantel der Rechtschaffenheit
Wie schade wäre es, diese lukrative Beziehung aufs Spiel zu setzen, nur weil die Amerikaner darauf drängen. Dass man den Weggefährten des russischen Diktators andernorts die Häuser und Jachten konfisziert, gilt in den einschlägigen Publikationen des Landes als himmelschreiendes Unrecht. Muss man noch erwähnen, dass Putins Freundin Alina Kabajewa unter allen Ländern der Welt die Schweiz als bevorzugten Überwinterungsort gewählt hatte? Wie man liest, besitzt sie sogar die Schweizer Staatsbürgerschaft.
Wenn sie in der Schweiz sagen würden: Seht her, uns gehen die eigenen Interessen über alles – das würde man verstehen. Nicht gut finden, aber verstehen. Aber so ist der Schweizer nicht. Er will gleichzeitig als guter Europäer gelten, dem die Werte des Westens am Herzen liegen. Also kleidet er seine Weigerung, Bedrängten zur Hilfe zu kommen, in den Mantel der Rechtschaffenheit.
Wer weiß, heißt es jetzt, vielleicht ist man noch einmal dankbar, dass sich die Schweiz herausgehalten hat, wenn man einen neutralen Verhandlungsort braucht. Hat es sich nicht schon im Dritten Reich als Segen erwiesen, dass es ein Land in der Mitte des Kontinents gab, in dem die Nazis nichts zu sagen hatten?
Auch Hitler war die Schweiz letztlich zu unbedeutend
Beim Dritten Reich landet man unweigerlich, wenn man mit Schweizern redet. Die Hunderttausende, die man angeblich vor der Verfolgung gerettet hat, waren bei Licht besehen nur mehrere Tausend. Lieber als jüdische Flüchtlinge waren einem ohnehin jüdische Vermögen. Leider hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg dann vergessen, dass auf den Konten beträchtliche Guthaben lagerten, deren Besitzer als verschollen galten. Es war übrigens die Credit Suisse, die sich auch beim Vergessen der „nachrichtenlosen Vermögen“ besonders hervortat.
Dass die Sache aufflog und in einem Milliardenvergleich mit der Jewish Claims Conference endete, verdankte sich einem Zufall. Ein Nachtwächter der Schweizerischen Bankgesellschaft, dem bei einem Kontrollgang Akten aufgefallen waren, die man zum Schreddern vorgesehen hatte, nahm einige Dokumente an sich und übergab sie einer jüdischen Organisation in Zürich. Dass sich der Wachmann anschließend nur durch Asyl in den USA vor der Verfolgung durch die Schweizer Behörden wegen Verletzung des Bankgeheimnisses retten konnte, rundet die Sache auf bezeichnende Weise ab.
Die Schweizer leben in der Vorstellung, dass es sie nichts angeht, wenn ein Land den Nachbarn überfällt. Sollte der Russe morgen, wie angekündigt, Ostdeutschland übernehmen, dann stellt man in den Geschäftsbeziehungen eben auf Rubel um. Wer weiß, vielleicht haben sie recht. Auch Hitler war die Schweiz letztlich zu unbedeutend, um einzumarschieren. Die Schweizer Legende will es, dass der Führer vor der Alpenfestung zurückschreckte. Die Wahrheit ist: Er bekam auch so, was er wollte. Schreibt Jan Fleischhauer in FOCUS.
24.3.2023 - Tag der Schweizer Rechtschaffenheit ohne Moral
Jan Fleischhauer ist ein kompromissloser Journalist der der alten Schule. Er schreibt mit scharfer Klinge und macht keine Gefangenen. Dass er damit nicht everybody's Darling sein kann, nimmt er als Kollateralschaden in Kauf.
Der Artikel Fleischhauers über die Käuflichkeit der Schweizer Eliten und deren fehlende Moral bringt trotz seiner Kürze so manches auf den Punkt. In der Kürze liegt bekannterweise die Würze.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
SVP und FDP geben sich gegenseitig Schuld am CS-Debakel
Mitglieder von FDP und SVP sind durch Mandate oder beruflich eng mit den Banken verbunden. Doch Selbstkritik üben sie wenig.
In Finanzfragen sind sich die SVP und FDP häufig einig. Doch nun streiten sie sich wegen der Credit-Suisse-Übernahme durch die UBS.
Kurz nach dem Bundesrat-Auftritt am Sonntag findet die SVP klare Worte zu den Schuldigen. «Die Credit-Suisse-Krise ist eine Folge von Misswirtschaft und FDP-Filz», schreibt sie in einer Medienmitteilung. Darin verweist die SVP unter anderem auf den ehemaligen CS-Verwaltungsratspräsidenten Walter Kielholz. Bis heute gehöre er zu den wichtigsten Vertretern des Zürcher Freisinns und finanziere die FDP mit Millionen Franken.
FDP schlägt zurück
Als FDP-Präsident Thierry Burkart in der Arena auf die Kritik angesprochen wird, kontert er umgehend mit dem Verweis zur UBS-Rettung. «Der damalige UBS-Präsident war Herr Ospel – ein SVP-Mitglied. Weil jemand Mitglied ist, ist das nicht die Verantwortung der Partei.»
Weitere Kritik an der SVP übte Burkart auch in «20 Minuten». Dort kritisierte er den ehemaligen SVP-Finanzminister Ueli Maurer. Es sei jetzt zu klären, ob die Finanzmarktaufsicht ihre Arbeit gemacht habe beziehungsweise aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen überhaupt habe machen können.
Unterstützt wird Burkart heute vom Gewerkschafts-Präsident und SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard. Maurer sei politisch mitverantwortlich, sagt er heute zu SRF: «Der Bundesrat hat die Situation immer schöngeredet. Ebenso die Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht. Dazu gab es auch falsche Analysen.»
Unkritisch gegenüber CS-Strategie
Noch im vergangenen Oktober änderte die neue Führung der CS die Strategie. Diese fiel allerdings bei den Anlegerinnen und Anlegern durch. Überzeugt hingegen schien Ueli Maurer. «Die CS hat jetzt Massnahmen gemacht, um das Problem selber zu lösen», sagte er. «Man muss sie jetzt einfach ein, zwei Jahre in Ruhe lassen und nicht jeden Tag eine Sensation suchen, weil die gibt es nicht mehr.» Die Karten seien offen auf dem Tisch.
Während SVP und FDP einander beschuldigen, kritisiert die Linke beide Parteien gleichermassen. «Es ist mindestens ein FDP-SVP-Debakel», twittert Co-Präsident der SP, Cédric Wermuth.
Den Banken nahe stehen beide bürgerliche Parteien. In der Vergangenheit wollten sie bei den Eigenkapitalanforderungen nicht zu stark regulieren. Je 14 Parlamentarierinnen und Parlamentarier von SVP und FDP sind laut Lobbywatch direkt oder indirekt mit einer Bank, einem Anlagefonds oder einer Kapitalgesellschaft verbunden.
Selbstkritik üben jedoch beide Parteien wenig. Schliesslich ist Wahljahr. Schreibt SRF.
23.3.2023 - Tag der Esel, die sich gegenseitig Langohr nennen
Wozu brauchen wir eigentlich noch Comedians, wenn unsere «staatstragenden» Parteien jedwelcher Couleur diese Domäne, die früher noch unter der Sparte «Kunst» figurierte, längst übernommen haben? Besonders auffällig wird die Lächerlichkeit unserer Polit-Eliten bei den gegenseitigen Schuldzuweisungen im Gerangel um Parlamentssitze bei den inzwischen permanent anstehenden Wahlen.
Es geht längst nicht mehr um die besten Lösungen für das Land und die Bevölkerung, sondern nur noch um die Parteistärke im Parlament. Regierungspartei und Opposition als «Konkordanz» in einer Kiste verpackt, kann auf die Dauer nicht funktionieren und hat sich längst zum Kollateralschaden der Schweizer Demokratie entwickelt. Politikverdrossenheit und Hinwendung zu konfusen Gruppierungen wie «Trychler» und sonstigen Spinnern sind die Folgen davon.
Und so passiert es beinahe täglich, dass im Lachfigurenkabinett der Schweizer Parteien der eine Esel den andern Esel ein Langohr nennt. Wobei es die fleissigen Tiere mit den langen Ohren wahrhaftig nicht verdient haben, in einem Atemzug mit Politikern und Politikerinnen genannt zu werden.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Schädigt das Notrecht die Demokratie?
Bei der Rettung der Credit Suisse kam es einmal mehr zum Zug: das Notrecht. Damit kann der Bundesrat, ohne Parlament und Volk zu berücksichtigen, Verordnungen entlassen. Das Werkzeug gilt eigentlich als Ultima Ratio, dennoch hat es der Bundesrat in den vergangenen Jahren immer häufiger angewendet – alleine in der Pandemie 18 Mal. Was macht diese Enteignung von Parlament und Volk mit unserer Demokratie? Andreas Glaser, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, ordnet ein.
SRF News: Wieso hat der Bundesrat überhaupt die Möglichkeit, Notrecht anzuwenden?
Andreas Glaser: Notrecht braucht es für Situationen, in denen sehr schnell gehandelt werden muss. Deshalb hat man das in der Bundesverfassung verankert. Aber es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Es kann gut sein: Für die Bewältigung von Einzelereignissen ist es wichtig. Aber es darf natürlich nicht ausarten, es darf nicht zu oft das Notrecht genutzt werden.
Wendet der Bundesrat Notrecht denn tatsächlich häufiger an?
In den letzten Jahren können wir eine deutliche Häufung feststellen. Die UBS-Rettung 2008 war noch ein Einzelfall. Dann hatten wir natürlich die Covid-Pandemie mit einer Explosion der Anwendungen von Notrecht. Es folgten der Rettungsschirm für die Axpo und jetzt die CS-Rettung. Wir haben eine Häufung, die wir vorher so nicht kannten.
Was bedeutet das?
Das bedeutet eine Machtverschiebung weg vom Parlament und von den Stimmberechtigten hin zum Bundesrat. Der Bundesrat hat jetzt eindeutig mehr Macht als in einer Normalsituation.
Der Bundesrat hat mehr Macht – ist das Anlass zur Sorge?
Wir müssen uns immer Sorgen machen, wenn die normale Demokratie nicht so funktioniert, wie wir sie kennen. Aber man muss es auch in der historischen Perspektive sehen: Wenn es Krisen gab, fand eine solche Machtverschiebung zum Bundesrat statt. Am massivsten war das während und nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 1990er- und 2000er-Jahren hatten wir aber sehr ruhige Phasen, in denen alles im Normalbetrieb lief. Jetzt, mit der Häufung von Krisen, haben wir auch wieder mehr Macht beim Bundesrat.
Kann dies unsere Demokratie gefährden?
Allein durch die Häufung des Notrechts haben wir natürlich eine Entmachtung des Parlaments und der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Im Einzelfall ist das nicht schlimm, aber wenn es natürlich so häufig vorkommt, kann es zu einem Problem für die Demokratie insgesamt werden.
Mit Notrecht regiert der Bundesrat quasi in Eigenregie. Riskiert er so nicht ein Vertrauensverlust bei der Bevölkerung?
Wir haben bereits während der Pandemie gesehen, dass Kritik aufgekommen ist und das Vertrauen in den Bundesrat verloren ging. Ich denke, das ist aber auch ein Kontrollventil gegenüber des Bundesrates. Dieser muss immer im Auge behalten, dass die Stimmbürgerinnen und -bürger nicht vergessen gehen. Ansonsten kann es natürlich passieren, dass sie beispielsweise mit einer Volksinitiative reagieren und sagen: Diese Notrechtsbefugnisse des Bundesrates gehen zu weit. Schreibt SRF.
22.3.2023 - Tag des Schweizer Notrechts
Es ist nicht das Notrecht, das unsere (westlichen) Demokratien gefährdet. Man stelle sich das Palaver des Parlaments vor, wenn Entscheide blitzschnell getroffen werden müssen. Wie beispielsweise bei der Pandemie. Wenn die Bürgerinnen und Bürger eines Landes ihrer Regierung nicht mehr trauen können, speziell in Zeiten von Krisen, ist die Demokratie ohnehin verloren.
Nein, es sind die mächtigen «Influencer», die hinter den höchsten, aber leider nicht zwangsweise fähigsten, dafür aber manipulierbaren Magistraten*innen der Schweiz stehen, jedoch keinem Parlament angehören und sich demzufolge auch nicht verantworten müssen. Dieser Dunstkreis aus Macht, Gier, Korruption und Verantwortungslosigkeit gefährdet die Demokratien nicht nur, sondern wird sie auf absehbare Zeit zerstören.
Die Schweizer Konkordanz leistet ebenfalls ihren Beitrag dazu. Welche Partei will den schon durch eine PUK (Parlamentarische Untersuchungskommission) einen Bundesrat*in und damit den Platz am Futtertrog der Nation verlieren?
«Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht!», soll Matthäus gesagt haben. Fürwahr!
Wenn einer der übelsten Rechtspopulisten aus Österreich, Herbert Kickl, Parteichef der vom österreichischen SS-Brigadeführer und Alt-Nazi Anton Reinthaller gegründeten FPÖ, mit der momentan stärksten Partei Österreichs nach dem Kanzleramt greift, sollte das demokratischen Politikern*innen eine Warnung sein.
Doch weit gefehlt. Machtgeile Parteien Österreichs wie die ÖVP schliessen inzwischen sogar Koalitionen mit der FPÖ, um in einzelnen Bundesländern an der Macht zu bleiben und damit am schleichenden Untergang der Demokratie mitzuwirken.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Nationalratskommission fordert 5 Milliarden Franken für Ukraine
Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK-N) möchte die Ukraine mit mindestens 5 Milliarden Franken unterstützen. Das Geld soll für die humanitäre Hilfe, den Schutz der Zivilbevölkerung, die Minenräumung und die Friedensförderung eingesetzt werden.
Die APK-N hat mit 13 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung eine entsprechende Motion eingereicht, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Zuvor hatte sie die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine, insbesondere im humanitären und sicherheitspolitischen Bereich, diskutiert.
Die Kommissionsmehrheit ist gemäss Mitteilung der Auffassung, dass die Ukraine eine umfangreiche finanzielle Unterstützung benötigt. Die Minderheit hingegen ist der Ansicht, dass zahlreiche Fragen betreffend den Wiederaufbau der Ukraine und die diesbezügliche internationale Zusammenarbeit noch geklärt werden müssten. Schreibt SRF im Ukraine-Liveticker.
21.3.2023 - Tag des Schweizer Goldesels
Putin führt einen Angriffs-Krieg in der Ukraine und die Schweiz bezahlt die Minenräumung.
Nach den 100 Milliarden Schweizer Franken (bzw. maximal 200 Milliarden, je nach Ausgangslage) für die CS-Bankenrettung sind fünf lächerliche Milliarden ja wirklich nur noch Peanuts.
Geht's uns schlecht – abgesehen von dieser einen Milliarde Unterdeckung der AHV? Nein, denn die Unterdeckung der AHV wurde ja mittels einer Volksabstimmung und einer Erhöhung der Mehrwertsteuer gelöst.
Oh, damit das nicht ganz untergeht: Laut Berechnungen des «Tages-Anzeiger» machte die CS in den letzten zehn Jahren insgesamt über 3 Milliarden Franken Verlust. Im selben Zeitraum bezahlte sie aber trotzdem 32 Milliarden Franken Boni an Top-Manager. Und laut SRF zwölf Milliarden Franken Bussen, vorwiegend an die USA.
Frei nach Inspektor Colombo: Eine Frage hätt' ich noch, Sir: Sind die auf dem Bild unten aufgeführten Personen wirklich die beste Wahl, die wir mittels unseren Stimmzetteln an den Urnen getroffen haben?
Ich frage für einen Freund. Er ist Vize-Präsident einer FDP-Ortspartei, verheiratet, Vater von drei minderjährigen Kindern und macht sich Sorgen um deren Zukunft. Irgendwie ja auch verständlich, oder etwa nicht?
Falls Sie gegenteiliger Ansicht sind, schreiben Sie mir einfach (siehe unten). Ich werde Ihren Kommentar veröffentlichen. Ohne Ihren Namen. Versprochen!
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube

Muppet-Show oder Gruselkabinett?
Putin verdient sich eine goldene Nase: Noch nie so viel russisches Gold importiert wie im Februar
Weil Wladimir Putin kein Öl mehr exportieren kann, will er mit Gold Kohle machen. Und das scheint zu funktionieren: Die Schweiz hat seit der ersten Erfassung noch nie so viel Gold importiert wie diesen Februar. Sanktionen wurde aber keine verletzt.
Die Schweizer Importe aus Russland sind im Februar sprunghaft angestiegen. Das ist auf deutlich höhere Käufe von russischem Gold zurückzuführen. Weil das Gold über den Londoner Edelmetallmarkt gekauft und in die Schweiz transportiert wurde, fällt es nicht unter die von der EU übernommenen Sanktionen.
Die Importe aus Russland im Februar 2023 weist das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mit 1052 Millionen Franken aus. Davon entfielen über eine Milliarde auf Gold russischen Ursprungs. Insgesamt kaufte die Schweiz 18,9 Tonnen des Edelmetalls, das ursprünglich aus Russland stammte.
Darüber dürfte sich Kreml-Chef Wladimir Putin (70) freuen. Wegen der Sanktionen kann Russland keine raffinierten Erdölprodukte mehr in die Schweiz oder nach Europa exportieren. Die fehlenden Einnahmen will er nun durch Gold wieder wettmachen. Und Russland hat noch einiges in petto: 551 Tonnen Gold hält der Staat laut Angaben des Finanzministeriums als Reserve, wie der Blick Anfang Februar bereits geschrieben hat.
Noch nie so viel russisches Gold imporiert
So hoch wie im Februar lagen die Goldimporte aus Russland seit Beginn der Erfassung durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit im Jahr 2021 noch nie! Noch im Januar 2023 etwa wurden nur 5,6 Tonnen russischen Goldes in die Schweiz eingeführt mit einem Gesamtwert von 312 Millionen Franken – also dreimal weniger.
Der Goldmarkt dürfte damit aber noch nicht gesättigt sein. Gold gilt als sichere Anlage in unsicheren Zeiten. Seit dem Bankenbeben und der daraus resultierenden Übernahme der Credit Suisse durch die UBS hat der Goldpreis nochmals deutlich angezogen.
Sicher ist: Die Schweiz ist die weltweit grösste Drehscheibe, wenn es ums Schmelzen von Gold geht. Dass viel Gold importiert wird, ist deshalb nicht überraschend. Nach der russischen Invasion der Ukraine versiegte der Import von Gold aus Russland, bevor er ab Herbst 2022 wieder anzog.
«Alles geht mit rechten Dingen zu»
Statistiken des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit zufolge entfielen im Februar 4,1 der 18,9 Tonnen Gold auf «andere Zwecke», sind also gar nicht zur Raffinierung oder Weiterverarbeitung gedacht. Trotzdem gehe hier alles mit rechten Dingen zu, erklärt das BAZG auf Anfrage. Es liege kein Verstoss gegen Sanktionen vor.
Angaben zu den Importeuren des Goldes darf das BAZG aus rechtlichen Gründen nicht machen. Die im Tessin und in der Westschweiz ansässigen Raffinerien – Argor Heraeus, Metalor, MKS Pamp und Valcambi – verarbeiten nach Schätzungen des WWF bis zu 70 Prozent des weltweit geförderten Goldes. Schreibt Blick.
20.3.2023 - Tag des Schweizer Goldrauschs
Wann immer es irgendwo auf der Welt um Gold geht, steht die Schweiz als verlässliche Aufkäuferin stets zur Verfügung. Dass es sich bei den Edelmetallverkäufern öfters um Diktatoren übelster Prägung handelt, spielte noch nie eine Rolle.
Ohne mit den Wimpern zu zucken, kauften die Goldhändler der Schweizer Nationalbank im Zweiten Weltkrieg von Adolf Hitler vom Raubgold bis hin zum Zahngold aus den Konzentrationslagern – auch Totengold genannt – so ziemlich alles was golden glänzte* und versorgten damit den deutschen Diktator mit den notwendigen Devisen.
Die Schweizer Neutralität bietet tatsächlich gewisse Vorteile. Da hat der Herr Blocher vom Herrliberg schon recht.
* Die Hauptspur des Nazi-Goldes führt in die Schweiz
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Die Bankenaufsicht hat versagt und ihr größtes Versprechen gebrochen
Die Rettung der Credit Suisse offenbart ein kollektives Versagen. Der jahrelange Aufwand der Aufsichtsbehörden lief in die völlig falsche Richtung. Mit der Folge, dass erneut Steuerzahler für eine gescheiterte Bank einstehen müssen. Jetzt braucht es Antworten – und die sind ganz einfach.
Die Rettung der Credit Suisse ist ein gebrochenes Versprechen. Mit ihr ist exakt das passiert, was nach der Finanzkrise 2008 nie wieder passieren sollte: Steuerzahler sind bei einer strauchelnden Bank ins Risiko gegangen, um das – angeblich – größere Risiko ihrer Abwicklung zu vermeiden. Unabhängig davon, ob ein solches Vorgehen eine womöglich globale Finanzkrise verhindert, sollte das niemand beschönigen. Die Causa soll und muss Folgen haben.
Dabei hatten Vertreter der europäischen Finanzbranche noch vor wenigen Tagen selbstgefällig Richtung Kalifornien geblickt. Dort war überraschend die auf Gründer spezialisierte Silicon Valley Bank (SVB) kollabiert, was die Frage aufwarf, ob sich ein ähnliches Szenario anderswo wiederholen könnte. Die Antwort vor wenigen Tagen lautete fast übereinstimmend: Nein.
Schließlich, so hieß es, habe die SVB nicht nur ein sehr spezielles Geschäftsmodell verfolgt. Sie sei auch schlechter auf eine mögliche Schieflage vorbereitet gewesen. Die Behörden in den USA hatten nämlich einige regulatorische Vorgaben gelockert. In Europa dagegen waren die Beamten standhaft geblieben. Das, so die verbreitete Meinung, würde sich nun auszahlen.
Von wegen. Nur eine Woche später hat sich das Bild dramatisch gedreht. Mit der Credit Suisse hat sich eine der wichtigsten Banken der Welt in eine staatlich orchestrierte Zwangsfusion mit dem ewigen Rivalen UBS geflüchtet. Ihren unfreiwilligen Einsatz lässt sich die Retterin gebührend absichern.
Die Nationalbank stellt insgesamt 200 Milliarden Franken Liquidität bereit. Und die Regierung in Bern garantiert mit neun Milliarden Franken für mögliche Verluste. Wie hoch die Hürden dafür sind, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass es sich einmal mehr um Steuergeld handelt.
Und genau das sollte es nie wieder geben – eigentlich. Dafür haben die Aufsichtsbehörden weltweit seit mehr als einem Jahrzehnt enormen Aufwand betrieben. In einem komplexen Verfahren identifizieren sie jährlich die riskantesten Banken der Welt. Die Credit Suisse rangierte hier zuletzt auf Platz 23 von 30. Um keine Zweifel an ihrer Stabilität aufkommen zu lassen, müssen diese riskanten Banken härtere Vorgaben erfüllen als andere. Zudem haben Banken weltweit sogenannte „Testamente“ verfasst, die für jede Ländergesellschaft detailliert beschreiben, wie sie im Krisenfall schonend abzuwickeln sind.
Alles, was helfen sollte, hat nicht geholfen
Außerdem existieren sogenannte Bail-in Bonds, die im Krisenfall in Eigenkapital gewandelt und dadurch einen zusätzlichen Verlustpuffer bereitstellen sollen. Nichts davon konnte verhindern, dass die Schweizer Bank rasend schnell an Vertrauen verlor – nichts davon kam zum Einsatz.
Stattdessen hat ausgerechnet die Schweiz elementare Rechte wie die Wettbewerbskontrolle und die Beteiligung von Aktionären an einer Übernahme kurzerhand außer Kraft gesetzt. Welche Folgen das für einen Standort haben wird, der wie kein anderer vom Versprechen der Neutralität und Rechtssicherheit profitiert, ist kaum absehbar.
Die Fragen, die sich aus dem Debakel ergeben, reichen aber weit über die Schweiz hinaus. Wenn sich der akute Sturm gelegt hat, müssen die richtigen Lehren gezogen werden. Einfach nur noch mehr und noch detailliertere Vorgaben für Banken zu machen, ist nicht zwangsläufig die richtige Lösung. Die Regulierungsdichte ist schon jetzt kaum überschaubar und nicht geeignet, um verunsicherte Investoren zu beruhigen.
Zudem ist fraglich, ob die Credit Suisse stabil geblieben wäre, wenn sie ein paar Prozentpunkte mehr Eigenkapital oder einige Milliarden mehr Liquidität hätte vorweisen können. Die geltenden formalen Vorgaben hat sie bis zum Schluss allesamt erfüllt. Zur Strecke gebracht hat sie die Angst ihrer Kunden und Geschäftspartner.
Es kann auch nicht die Antwort sein, dass sich Politik und Aufsicht stärker in die konkrete Geschäftspolitik der Kreditinstitute einmischen. In der Krise vor 15 Jahren haben die deutschen Landesbanken schließlich eindrucksvoll gezeigt, welch fatale Folgen dieses Engagement haben kann.
Die richtigen Antworten sind viel einfacher. Sie fangen wie so oft bei Kontrolle und Kultur innerhalb eines Unternehmens an. Über gute Corporate Governance wird seit mittlerweile 20 Jahren diskutiert. Die formalen Anforderungen an Unabhängigkeit und Qualifikation von Aufsichtsräten sind seitdem ständig gestiegen. Dennoch ist die Nähe des Kontrollgremiums zur operativen Unternehmensführung oft noch viel zu groß. Die Credit Suisse zeigt eindrucksvoll, wohin das führen kann.
Unter dem im Bankgeschäft weitgehend unerfahrenen und konfliktscheuen Anwalt Urs Rohner, der sich zuvor unter anderem in Deutschland als Chef des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1. versucht hatte, konnte sich eine Kultur der rücksichtslosen Profitmaximierung etablieren. Immer neue Skandale waren die Folge.
Und das seit vielen Jahren. Die Aufseher in der Schweiz blieben deshalb zwar nicht untätig. Sie erkannten aber kaum, welch existenzielle Bedrohung diese Skandale für die Bank darstellten. Denn sie ramponierten deren wichtigstes Kapital, das sich mit keiner noch so ausgeklügelten Checkliste erfassen lässt: das Vertrauen ihrer Kunden.
Wie angeknackst das war, war längst unübersehbar. Schon im vergangenen Jahr hatten Anleger und Unternehmen nicht nur Wertpapiere im Wert von weit mehr als hundert Milliarden Franken aus den Depots abgezogen, sondern zudem eine noch bedeutend höhere Summe von Konten abgehoben.
Aufseher müssen früh und konsequent einschreiten
Die richtige Reaktion kann deshalb nur ein früheres, konsequenteres Einschreiten sein. Der Blick der Kontrolleure darf sich nicht im Dickicht der Regularien verlieren, sondern muss sich stärker auf die konkreten Umstände fokussieren. Ein Skandal ist fast nie ein Einzelfall, sondern fast immer ein Symptom dafür, dass etwa grundsätzlich falsch läuft. Dem müssen die Aufseher künftig mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit schenken wie ihren formalen Vorgaben.
Zudem braucht es schlicht mehr Mut. Die sorgsam ausgearbeiteten Abwicklungsregeln ausgerechnet an der Credit Suisse zu testen, wäre in der aktuellen Situation vermutlich ein Experiment mit zu hohem Einsatz gewesen. In anderen Fällen – etwa bei den deutschen Landesbanken HSH Nordbank und NordLB – wäre es jedoch möglich gewesen. Dennoch schreckten die Beteiligten zurück und flüchteten sich in Kompromisse, die in letzter Minute ausbaldowert wurden.
Die Lehren muss auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin ziehen. Deren Chef Mark Branson kann immerhin auf hoffentlich hilfreiche Erfahrungen zurückblicken. Vor seinem Wechsel nach Deutschland im Sommer 2021 leitete er schließlich eine Behörde, die damals als international vorbildlich galt: die für die Credit Suisse verantwortliche Finma in der Schweiz. Schreibt DIE WELT.
19.3.2023 - Tag der Corona-, Klima- und Bankexperten
Es ist zwar, frei nach Karl Valentin, über die momentane Bankenkrise im Allgemeinen und die Credit Suisse im Besonderen ziemlich alles gesagt, aber noch nicht von allen. Und so meldet sich, man lese und staune, auch ein freier Mitarbeiter mit dem Namen Cornelius Welp ausgerechnet in DIE WELT zu Wort. Das erstaunt. Die zum Axel Springer Verlag gehörende Zeitung DIE WELT ist nicht unbedingt bekannt dafür, den Neoliberalismus in seiner abartigsten Form zu kritisieren. Doch genau das tut Cornelius Welp. Wenn auch mit Samthandschuhen.
Gegen die unerträglichen Auswüchse der Superbanken und deren Geschäfte, die, seien wir mal ehrlich, ausser den Bankstern aus der obersten Etage des Casinos kein Mensch mehr versteht, auch nicht unsere Aufsichtsbehörden und schon gar nicht die Polit-Elite, hat er wenig auszusetzen. Irgendwie auch logisch. Wie will man etwas kritisieren, was systemrelevant ist? Nicht nur für die Schweiz, sondern für den gesamten globalen Finanzmarkt.
Für Welp sind die Aufsichtsbehörden und deren Nähe zu den Verantwortlichen der Dinosaurier-Banken das eigentliche Übel. Das stimmt sicher bis zu einem gewissen Grad. Doch die Frage, wie weit Aufsichtsbehörden bei den unantastbaren Göttern der Finanzwirtschaft überhaupt gehen dürfen um nicht von den übergeordneten Eliten zurückgepfiffen zu werden, von denen es ein undurchschaubares Sammelsurium neoliberalster Gestalten im Hintergrund gibt, lässt er offen.
Kaum eine andere Branche verteilt derart üppige Bonuszahlungen an ihre obersten Kader wie die Finanzwirtschaft. Wo aber weder Moral noch Ethik herrscht, sind auch die Zuwendungen, in früheren Zeiten Schmiergelder genannt, an die herrschenden Eliten nicht weit. Damit wird auch verständlich, weshalb die hehren Versprechen der Politik bezüglich strikteren Regulierungsmassnahmen anlässlich der vor 15 Jahren herrschenden Finanzkrise nicht nur niemals eingeführt, sondern, wie beispielsweise unter Präsident Trump, sogar gelockert wurden.
Nur die Aufsichtsbehörden zu prügeln ist aus der Sicht von DIE WELT zwar verständlich, aber es ist nur die halbe Wahrheit, während sich die Hauptverantwortlichen unbehelligt von der Justiz ihre schmutzigen Hände in Unschuld waschen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Bersets «Gotte» Ruth Lüthi über den Bundespräsidenten: «Ich könnte Alains Rücktritt nachvollziehen»
Die SP hadert mit Alain Berset. Die Entfremdung zwischen der Partei und ihrem Magistraten hat auch mit seinen Wurzeln in Freiburg zu tun. Dort steht man treu zu ihm, auch seine Förderin Ruth Lüthi. Die öffentliche Distanzierung der SP-Spitze hat sie «erstaunt».
Es ist schon reichlich bemerkenswert, wenn ein Parteipräsident öffentlich auf Distanz zu seinem Bundesrat geht. Noch genaueres Hinsehen ist geboten, wenn es sich um die Sozialdemokraten mit ihrer notorischen Wagenburgmentalität handelt – erst recht dann, wenn sich gleich beide Mitglieder der Doppelspitze zur öffentlichen Schadensbegrenzung im Wahljahr bemüssigt fühlen.
Geschehen ist das vergangenen Dienstag, und der Anlass war – wieder einmal – Alain Berset (50), der zuvor in «Le Temps» und dann in der «NZZ am Sonntag» jene Leute eines «Kriegrauschs» bezichtigt hatte, die sich zumindest für eine indirekte Rüstungshilfe für die Ukraine aussprechen. Der Bundespräsident bediente sich damit beim Deutungsmuster dieser eigenartigen neuen Friedensbewegung, die sich von Europas Rechtspopulisten bis zu deutschen Berufsdiskutanten wie Alice Schwarzer (80) und Sahra Wagenknecht (53) erstreckt.
«Ich habe eine andere Haltung als Alain Berset», stellte Co-Präsidentin Mattea Meyer (35) auf SRF unverhohlen deutlich klar. Er teile «weder seine Analyse noch die Schlussfolgerungen», sagte Co-Präsident Cédric Wermuth (37) in der «NZZ» über seinen Genossen in der Landesregierung.
Die Schlüsselfigur an seiner Seite
Das Rencontre zwischen SP-Führung und Magistrat markiert nach einer Serie von Skandalen und Skandälchen einen neuen Höhepunkt der Entfremdung zwischen der linken Volkspartei und ihrem Regierungsmitglied, und nicht nur Bundesbern fragt sich, ob es sich bei Berset, der trotz seiner jungen 50 Jahre schon den Spätherbst seiner politischen Karriere erreicht zu haben scheint, um die Selbstherrlichkeit eines langjährigen Bundesrats, gar um einen Hauch von Cäsarenwahn oder doch eher um die Manövrierkünste eines begnadeten Taktikers handelt.
Wer mehr über Berset wissen will, kommt nicht um Ruth Lüthi (75) herum. Sie gehört zur Politprominenz an der Saane, sass 15 Jahre lang für die SP in der Freiburger Regierung und kandidierte bei den Bundesratswahlen 2002 als Nachfolgerin von Ruth Dreifuss (83).
Ihren Unterstützern war es seinerzeit egal, dass ihr Kanton bereits mit Joseph Deiss (77) in der Landesregierung vertreten war, was viel über den Stolz der Freiburger Sozialdemokratie aussagt. In einem damaligen SRF-Beitrag gab sich die kantonale SP-Präsidentin selbstbewusst. Lüthi sei die Richtige, auch wenn sie eine gebürtige Grenchnerin sei: «Für uns ist sie genug Romande, um uns in Bern zu repräsentieren.»
Die damalige Taktgeberin heisst Solange Berset (71). Zu jenem Zeitpunkt begleitete ihr damals gerade mal 30-jähriger Sohn Alain Kandidatin Lüthi als Wahlkampfstratege durch die Wandelhalle des Bundeshauses. Lüthi war so angetan vom jungen Berset, der ihr bei Hearings und TV-Interviews zur Seite stand, dass sie ihn ein Jahr später für den Ständerat vorschlug, was sich 2003 als goldrichtiger Tipp entpuppen sollte. Dank Bersets sensationeller Wahl gilt Lüthi als Schlüsselfigur in der politischen Laufbahn des heutigen Bundespräsidenten. Er nennt sie ehrfurchtsvoll «ma marraine», auf Deutsch «meine Gotte».
Von SonntagsBlick auf die jüngsten Schlagzeilen über ihren politischen Ziehsohn beziehungsweise Gottenbub angesprochen, spricht die Grande Dame von einer «Kampagne» gegen ihn. «Ich unterstütze ihn sehr, er ist ein loyaler Wegbegleiter.» Er habe als Gesundheitsminister während der Pandemie «hervorragende Arbeit» geleistet: «Dank ihm ist die Schweiz so gut durch die Corona-Zeit gekommen.»
Sie ist überzeugt, dass dies der Grund sei, weshalb er im Visier seiner Gegner steht.«Man bastelt aus allem einen Skandal, weil man ihn weghaben will.» Die Intervention der SP-Spitze habe sie darum «sehr erstaunt», nicht zuletzt deshalb, weil das Thema Rüstungsexport «keine einfache Frage» sei und sie eher zur Linie von Herrn Berset neige; der Bereich humanitäre Hilfe läge «viel mehr in unserer Verantwortung», findet sie.
Er habe «den Durchblick» bewahrt
Lüthi steht damit keineswegs alleine da, im Gegenteil: im Welschland ist der traditionelle Pazifismus in der Linken noch viel tiefer verankert als in der Deutschschweiz, weshalb Berset mit seinen Ukraine-Äusserungen auch den neutralitätspolitischen Graben innerhalb seines politischen Lagers verkörpert, was den Strippenziehern in der Partei nicht allzu sehr ins Drehbuch passt.
Dazu kommt der Zusammenhalt der Freiburger. Urs Schwaller (70) sass von 2004 bis 2011 mit Berset im Ständerat. Der CVP-Politiker lehnt es partout ab, «Persönliches und Politisches» zu ihm zu sagen, mit dem er auch als Bundesrat «sehr gut zusammengearbeitet» habe. Es ist ein sehr aussagekräftiges Schweigen von Schwaller, ein Zeugnis der Treue.
Mit Schwaller zusammen trieb Berset seine Machiavelli-Manier zur Höchstform. Erst waren es Hinterzimmer-Absprachen der normalen Hubraumklasse; so sorgte Berset für linke Unterstützung bei der Ernennung von Christdemokratin Corina Casanova (67) zur Bundeskanzlerin, während im Gegenzug ein Genosse mit CVP-Support Generalsekretär der Bundesversammlung wurde.
Diese christlichsoziale Achse sollte die Basis für eine der markanteren Aktionen in der jüngeren Schweizer Geschichte werden: die Abwahl von SVP-Tycoon Christoph Blocher (82) aus dem Bundesrat 2007.
Die Kunst des Taktierens und Bündnis-Schmiedens hatte Berset im Freiburger Verfassungsrat gelernt. Dort wurde er im Jahr 2000 mit 28 Jahren hineingewählt, wo er vier Jahre lang mit seinem Freund Christian Levrat (52) wirkte. Im Bundeshaus wurden die zwei zum Dream-Team: Hobbyläufer Berset im Ständerat (Mutter Solage war Schweizer Meisterin im Marathon, Sohn Alain Uni-Meister über 800 Meter) und Schachspieler Levrat als SP-Präsident.
Ruth Lüthi sagt, dass sie schon in seiner Zeit als Wahlkampfstratege an Berset geschätzt habe, dass er in den Geschäften «trotz allem immer den Durchblick» bewahrt habe.
Vier Jahre nach dem Blocher-Coup wurde Berset selber in die Landesregierung gewählt, wo er als Sozialminister nur mässig Glück hatte, so war die Abstimmungsniederlage 2017 zur Reform der AHV ein schwerer Dämpfer. Dafür agierte er immer wieder erfolgreich gegen den freisinnigen Aussenminister Ignazio Cassis (61), der sich glanzlos am Europadossier abarbeitet und zuletzt mit seiner Kopftuchdiplomatie in Iran weltweit für Unverständnis gesorgt hat.
Es folgt die grosse Krise
Schicksalhaft für Berset war das Jahr 2020, als die Pandemie die Schweiz erreichte. Als Gesundheitsminister steuerte er die Nation durch die historische Krise, seine Beliebtheitswerte sprangen nach oben, aus dem einstigen Politnerd mit Brille und Resthaar wurde Borsalino-Berset. Er zeigte sich am liebsten mit Hut in der Pose des besonnenen Landesvaters.
So viel Aufwind ist Gift für jemanden mit einer derart ausgeprägten Eitelkeit. Schon in seinem ersten Präsidialjahr liess er gleich zwei Fotobände über sich erstellen und als Covid-Bekämpfer stellte er sich für ein ganzes Interview-Buch eines «NZZ»-Journalisten zur Verfügung. Berset erhielt immer mehr das Image eines Bourgeois und Bonvivant, er erinnerte zunehmend an den Typus des linken französischen Spitzenpolitikers, der sich in seinen Reden für das Proletariat starkmacht, aber selber lieber im Gourmettempel als in der Arbeiterbeiz verkehrt.
Diese Entwicklung vergrösserte die Kluft zu seiner Partei und ihrem Gewerkschaftsflügel, die vielen Affären waren dabei nicht hilfreich. Die «Weltwoche» enthüllte den Erpressungsversuch einer ehemaligen Geliebten, der Blick deckte auf, wie sich der Gesundheitsminister in seinem Wohnort gegen eine 5G-Antenne starkmacht, während der Bund den Ausbau dieses Netzes vorantreibt, und im Juni 2022 verliess sein Medienchef das Departement, nachdem bekannt geworden war, dass dieser während der Pandemie die Medien mutmasslich mit vertraulichen Informationen aus dem Bundesrat versorgt hatte – namentlich die Spitze des Ringier-Verlags, der auch den SonntagsBlick herausgibt. Ob Berset von den Indiskretionen wusste, untersucht derzeit die Geschäftsprüfungskommission.
Zum Fasnachtssujet wurde Bersets Privatflug in den französischen Luftraum, der von Kampfjets beendet worden war. Seinen Genossen mit ihrer Umweltpolitik erwies er damit einen Bärendienst.
Ist Meyers und Wermuths öffentliche Korrektur von Bersets Waffenvotum Anfang Woche nun ein Signal für den baldigen Abgang des schillernden Magistraten mit dem Salonsozialisten-Anstrich?
Im Umfeld seines Departements wiegelt man ab; der Chef habe in seinen Interviews doch bloss die Haltung des Bundesrats widergespiegelt, der sich aufgrund des Neutralitätsrechts gegen indirekte Rüstungshilfe ausspricht. Trotzdem wetzen die Gegner die Messer. Für die Grünliberalen ist die SP im Bundesrat sowieso übervertreten, und bei den Grünen kursiert schon die Frage, wer denn das Zeug zum Kandidaten habe. Parteichef Balthasar Glättli (51) jedenfalls glaubt niemand mehr, wenn er seine Ambitionen abstreitet. Er rede bei seinen Auftritten auffällig oft französisch, um staatsmännisch zu wirken, heisst es.
Ruth Lüthi will nicht über einen möglichen Abtritt spekulieren. Noch vor einem halben Jahr hätte sie das völlig ausgeschlossen, sagt sie. «Aber ich könnte es nachvollziehen, wenn er Ende Jahr sagen würde: ‹Ich habe meine Arbeit getan.›» Schreibt Blick.
18.3.2023 - Tag des nevernding Berserkers
Im Gegensatz zu Berserkers Gotte wäre vermutlich für viele Schweizerinnen und Schweizer der Rücktritt dieser selbstherrlichen und abgehobenen Witzfigur nicht nur nachvollziehbar, sondern eine Erlösung.
Anders ausgedrückt: lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
US-Präsident Joe Biden begrüsst den Putin-Haftbefehl
US-Präsident Joe Biden hat den Erlass eines Haftbefehls gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin durch den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) als «gerechtfertigt» bezeichnet. Der Schritt sende «ein sehr starkes Signal», sagte Biden am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten in Washington.
Der IStGH hatte am Freitag verkündet, wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland im Ukraine-Krieg Haftbefehl gegen Putin und dessen Kinderrechtsbeauftragte Maria Alexejewna Lwowa-Belowa erlassen zu haben.
Weder die USA noch Russland erkennen die Legitimität des IStGH an. Schreibt SRF im Ukraine-Liveticker.
17.3.2023 - Tag der amerikanischen Scheinheiligkeit
Schön, dass Joe Biden den Haftbefehl gegen Putin für gerechtfertigt hält. Einen Schönheitsfehler hat die Aussage des US-Präsidenten allerdings: Wie Russland anerkennen auch die USA den Internationalen Strafgerichtshof von Den Haag nicht an.
Wohlwissend, dass da auch etliche Haftbefehle gegen Personen aus den USA bezüglich Kriegsverbrechen fällig wären. So viel Wahrheit muss schon sein. Denken wir nur an den Vietnamkrieg («Agent Orange) und den Irakkrieg (Abu-Ghuraib-Folterskandal), vom Waterboarding in Guantanamo ganz zu schweigen.
Was lernen wir daraus? Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Rechtfertigt aber Putins Kriegsverbrechen in keiner Art und Weise.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Strafgerichtshof ICC erlässt Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen
Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) hat einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten erlassen. Als Grund geben die Richterinnen und Richter «Kriegsverbrechen» an. Konkret verdächtigen die Strafverfolger den russischen Präsidenten der Mitschuld an der Deportation ukrainischer Kinder in die russische Föderation.
Die Richter haben einem entsprechenden Antrag des Chefanklägers Karim Khan stattgegeben. Putin sei «mutmasslich verantwortlich für das Kriegsverbrechen der rechtswidrigen Deportation von Kindern und des rechtswidrigen Transfers von Kindern aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation».
Das Gericht erliess ausserdem einen Haftbefehl gegen Maria Alekseyevna Lvova-Belova, die Beauftragte für Kinderrechte im Büro des Präsidenten der Russischen Föderation, wegen ähnlicher Vorwürfe.
Putin soll Verantwortung für Deportationen tragen
Der ICC teilte mit, dass seine Vorverfahrenskammer «hinreichende Gründe für die Annahme hat, dass jeder Verdächtige die Verantwortung für das Kriegsverbrechen der rechtswidrigen Deportation der Bevölkerung und des rechtswidrigen Transfers der Bevölkerung aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation trägt, zum Nachteil ukrainischer Kinder».
In der Erklärung des Gerichts heisst es, es gebe «hinreichende Gründe zu der Annahme, dass Putin die individuelle strafrechtliche Verantwortung» für die Kindesentführungen trägt, «weil er die Taten direkt, gemeinsam mit anderen und/oder durch andere begangen hat (und) weil er es versäumt hat, die zivilen und militärischen Untergebenen, die die Taten begangen haben, ordnungsgemäss zu kontrollieren.»
Der Staatsanwalt am Strafgerichtshof, Karim Khan, hatte vor einem Jahr Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet. Khan war dreimal persönlich in der Ukraine, unter anderem in der Region Kiew, wo es in Butscha ein Massaker gegeben haben soll.
Ein Urteil mit Symbolcharakter
Die Haftbefehle sind ein erster Schritt hin zu einem möglichen Prozess gegen Putin. Ein solcher liegt noch in weiter Ferne, da Moskau die Zuständigkeit des Gerichtshofs nicht anerkennt und seine Staatsangehörigen nicht ausliefert.
Aus früheren Verfahren wird deutlich, dass es schwierig ist, hochrangige Vertreter zur Rechenschaft zu ziehen. In mehr als 20 Jahren gab es lediglich fünf Verurteilungen wegen sogenannter Kernverbrechen. Bei keinem der Verurteilten handelt es sich um oberste Vertreter eines Machtapparats.
Obgleich die Ukraine das Römische Statut des Internationalen Gerichtshofs nicht ratifiziert hat, erkennt Kiew die Befugnis der Richter für seit 2014 auf ukrainischem Staatsgebiet verübte Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen die Ukraine an. 2015 übergab der ukrainische Aussenminister Pawlo Klimkin in Den Haag eine entsprechende Erklärung. Kurz nach Ausbruch des Krieges hatte Chefankläger Khan bereits Ermittlungen in der Ukraine aufgenommen.
Reaktion aus Moskau
Der Kreml reagierte umgehend auf das Urteil. Dieses sei bedeutungslos. «Die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs haben keine Bedeutung für unser Land, auch aus rechtlicher Sicht», so die Sprecherin des Aussenministeriums, Maria Zakharova, auf ihrem Telegramm-Kanal. «Russland ist keine Vertragspartei des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs und hat keine Verpflichtungen daraus.»
16.3.2023 - Tag der Justizmühlen, die langsam mahlen
Man hofft natürlich, dass sich diese beiden Schreckgestalten aus Russland, Diktator Putin und seine willfährige Beauftragte für Kinderrechte Maria Alekseyevna Lvova-Belova, für ihre furchtbaren Verbrechen gegen Kinder vor den Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs verantworten müssen. Keine Frage.
Doch dieser beiden verbrecherischen Gestalten habhaft zu werden dürfte – Stand heute – ein Ding der Unmöglichkeit sein. Einerseits. Andererseits sind bis zum heutigen Tag doch einige Politgrössen in Den Haag gelandet, die das nie für möglich hielten. Man denke nur an die Schlächter aus dem Jugoslawienkrieg.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Trainspotting wurde Michail Korotkow zum Verhängnis: Er fotografierte Putins Panzerzug – und musste flüchten
Als Trainspotter war Michail Korotkow stets auf der Suche nach der aussergewöhnlichsten Eisenbahn. Dann schiesst er ein Foto von Putins Panzerzug – und muss ins Exil flüchten.
Michail Korotkow (31) liebt Züge. Immer wieder fotografierte er die aussergewöhnlichsten Eisenbahnen – bis er 2018 das erste Bild eines Panzerzugs schoss. Wer sich genau in den Abteilen aufhielt, wusste er damals nicht. Doch ihm war klar: «Normalsterbliche fahren nicht mit einem solchen Zug», schrieb er in seinem Blog. Die Verfolgung des Panzerzugs wurde für ihn zur gefährlichen Obsession.
Korotkow wurde zum Trainspotter, liebte die Herausforderung, das Adrenalin, wenn er auf die Jagd ging, sagt er zur «Washington Post». An die Konsequenzen habe er nie gedacht. «Ich war so vertieft in mein Hobby», erklärt er. Über Jahre verfolgte Korotkow den aussergewöhnlichen Zug. «Er rast wie ein Verrückter, und alle anderen planmässigen Züge machen ihm Platz», schrieb er 2021 in seinem Blog.
Dieser Zug ist ein Staatssicherheitszug, der nur für hochrangige Mitglieder der Regierung bestimmt ist. Der Fahrgast im Fall von Korotkow war kein Geringerer als Kremlchef Wladimir Putin (70). Spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs zieht das russische Staatsoberhaupt die Bahn anderen Verkehrsmitteln vor. Denn diese lässt sich weniger leicht verfolgen als ein Flugzeug. Doch Korotkow klebte sich an die Fersen des Staatsoberhauptes. Und riskierte damit sein Leben.
Russischer Geheimdienst nimmt ihn ins Visier
Die Recherche von Korotkow war dem Kremlchef ein Dorn im Auge. Schliesslich soll Putin sogar Zugstrecken zwischen seinen privaten Liegenschaften gebaut haben – von deren Existenz niemand wissen sollte.
Doch Korotkow hörte trotz Risiken nicht auf – bis etwas Ungewöhnliches passierte: Auf Youtube sah er Transkripte seiner persönlichen Telefonate in den Kommentaren. «Als ich diese Unterhaltungen in meinen Kommentaren sah, war mir das unheimlich», sagte er. Für Korotkow war klar, dass der russische Geheimdienst ihn ins Visier genommen hat.
Der Trainspotter bekam es mit der Angst zu tun. «In diesem Moment wurde mir klar, dass alles, was ich im Internet veröffentlicht hatte, gegen mich verwendet werden konnte.» Sein Blog könnte ihm zu Verhängnis werden.
Korotkow wird einberufen
Seine Trainspotting-Beiträge könnten Grund genug sein, ihn wegen Sabotage oder Terrorismus ins Gefängnis zu bringen, befürchtet er. Also stellte er im März 2022 seinen Blog ein. Korotkow versuchte das Kriegsgeschehen auszublenden, doch im September, als Putin die Teilmobilmachung ausrief, flüchtete er.
«Das Schwierigste war, endlich zu erkennen, dass die Auswanderung die einzige Lösung war, mein bisheriges Leben aufzugeben und bei null anzufangen», erzählt Korotkow. Als sein Marschbefehl kam, war er längst in Kasachstan. Bis sich alles normalisiert, will Korotkow mit dem Rucksack durch die Welt reisen. Schreibt Blick.
15.3.2023 - Tag von Doktor Schiwago, Strelnikof, Adolf Hitler und Vladimir Putin
Diktatoren scheinen eine Vorliebe für Panzerzüge zu haben und beflügeln Hollywood. Von Adolf Hitler mit seinem legendären, mit Krupp-Stahl gepanzerten «Sonderzug» mit dem Decknamen «Amerika» über Kim Jong-un bis hin zu Vladimir Putin.
Wer den Monumentalfim «Doktor Schiwago» von Regisseur David Lean aus dem Jahr 1965 kennt, erinnert sich vielleicht an den monströsen und rundum gepanzerten Zug, der während den Revolutionswirren durch die verschneite Landschaft Russlands rast und bei der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreitet. An Bord der russische Kommunist Pascha, der unter dem Decknamen «Strelnikof» Konterrevolutionäre jagt und Menschen terrorisiert, die anderer Meinung sind als die kommunistische Nomenklatura.
Das Drehbuch wurde nach dem gleichnamigen, politischen Buch von Boris Pasternak geschrieben. Den zeitgeschichtlichen Hintergrund des Romans bilden nebst dem tragischen Helden Doktor Schiwago der Erste Weltkrieg, die Oktoberrevolution 1917 und der anschliessende Bürgerkrieg in Russland. David Lean hat aus der hochkomplexen Erzählung von Pasternak rund um die Geschichte des russischen Volkes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine herzzerreissende und äusserst erfolgreiche Liebesgeschichte fabriziert, die insgesamt fünf Oscars holte.
Hollywood schreibt manchmal fiktive Geschichten, die sich irgendwann tatsächlich in der Realität wiederholen. Mehr als hundert Jahre nach der Oktoberrevolution braust wieder ein Panzerzug durch Russland. Nur der Namen des Bordpassagiers, der die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt, hat sich geändert.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Berset zeuselt – und macht Rückzieher
Mit seiner Aussage, es herrsche «Kriegsrausch», hat Alain Berset nicht nur Parteigenossen vor den Kopf gestossen. Zwei Tage nach den harsch kritisierten Aussagen trat der Bundespräsident an der Uni St. Gallen auf. Und musste erstmals Stellung beziehen.
Vor Hunderten Studierenden konnte Alain Berset (50) kritischen Fragen nicht mehr aus dem Weg gehen. Der Bundespräsident war am Dienstagabend an die Uni St. Gallen (HSG) gekommen, um über die «Welt in der Krise» und die Rolle der Schweiz zu reden. Dabei musste er auch über eine Aussage sprechen, die er in der «NZZ am Sonntag» zum Ukraine-Krieg gemacht hatte und die weit über die Landesgrenzen hinaus für Empörung sorgt.
Berset hatte von einem «Kriegsrausch» gesprochen, den er «in gewissen Kreisen» spüre. Ohne näher darauf einzugehen, in welchen. Zudem sprach er sich für Friedensverhandlungen mit Russland aus – «je früher, desto besser». Parlamentarierinnen und Parlamentarier, ausser jene der SVP, zeigten sich entsetzt. Selbst die eigene Partei distanzierte sich von Bersets Aussagen.
Wortwahl sei unglücklich gewesen
Im Uni-Saal musste Berset Stellung zu seinen harsch kritisierten Aussagen nehmen. Während der SP-Bundesrat den Journalisten im Bundeshaus nicht Red und Antwort stehen wollte, konnte er einem HSG-Studenten nicht ausweichen. Was habe er mit seiner «Kriegsrausch»-Aussage sagen wollen, wollte dieser wissen. Von welchen «Kreisen» habe er gesprochen?
Berset räumte ein, dass die Wortwahl unglücklich gewesen sei. Angesichts der Reaktionen könne man die Frage stellen, ob er sich richtig ausgedrückt habe, so Berset. Um daraufhin klarzustellen: «Was ich sagen wollte: Ich hatte sehr viele Kontakte in den letzten Wochen, vor allem international.» Dabei habe er festgestellt, dass die Diskussion fast immer aus einer Kriegslogik heraus geführt werde. «Das verstehe ich voll und ganz. Viele Länder engagieren sich sehr stark militärisch. Aber es braucht auch noch andere Elemente.»
Er sprach damit die Rolle der Schweiz als Depositärstaat der Genfer Konventionen an, die die zentralsten Regeln in Kriegszeiten festhalten. Man müsse auch über den Schutz der Zivilbevölkerung reden, meinte der Innenminister. Hier sehe er eine besondere Rolle der Schweiz, zum Beispiel bei der Minenräumung.
Eine Erklärung lieferte Berset nicht
Es sind Argumente, die der Bundesrat in diesen Tagen immer wieder hervorholt, um Verständnis für die Haltung der Schweiz zu schaffen. Berset stellte es so dar, als habe er seine «Kriegsrausch»-Aussage rein aufs Ausland bezogen. Dabei hatte er in einem Interview mit «Le Temps», das schon gut eine Woche vor jenem in der «NZZ am Sonntag» erschienen ist, klargemacht, dass er auch die politische Debatte in der Schweiz kritisiert.
Er sei «sehr besorgt über das kriegerische Klima, das derzeit überall auf der Welt herrscht, auch in der Schweiz», hatte er damals gesagt. «Man hat den Eindruck, dass einige Akteure, selbst ehemalige Pazifisten, wie vom Rausch des Krieges mitgerissen werden», liess er sich zitieren.
Die Chance, sich zu erklären, nahm Berset in St. Gallen nicht wahr. Die Schweiz, sagte er zwar, müsse sich immer wieder die Frage stellen, ob sie genug tue, um die Ukraine zu unterstützen. Die Antwort, die er darauf gab, wird jedoch manch einen Parteigenossen gleich noch einmal vor den Kopf stossen: «Wir versuchen alles, was wir können.» Schreibt Blick.
14.3.2023 - Tag der Berserker in Slim-Fit-Anzügen mit Agenten-Hüten und Töff-Tätschkappen
Der Berserker vom Dienst, Bundespräsident Alain Berset, sieht nicht nur aus wie Gianni Infantilo. In seiner Besoffenheit über die eigene Wichtigkeit wirkt er auch wie ein Infantiler. Agenten-Hüte, Töff-Tätschkappen und Slim-Fit-Anzüge tragen das ihrige dazu bei.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Autor Marc Elsberg: «Das 1,5-Grad-Ziel ist tot»
In seinem Thriller "Celsius" übernimmt die Menschheit mit Geo-Engineering die Kontrolle über das Klima. Damit könnte sich Marc Elsberg auch in der Realität anfreunden – denn die Klimaziele liegen in weiter Ferne.
In den Romanen von Marc Elsberg kollabiert die Welt. Im Bestseller Blackout, inzwischen auch als Serie verfilmt, legt ein Hacker die Stromversorgung in ganz Europa lahm. In Elsbergs neuestem Thriller Celsius soll eine Technologie die Welt hingegen vor dem Kollaps bewahren: Staaten wenden das umstrittene Geoengineering an, um die Erderwärmung abzuschwächen. Zunächst ist es China, das im Buch mithilfe von Drohnen Chemikalien verteilt, die die Sonnenstrahlen abdämpfen – sogenanntes Solar Radiation Management.
STANDARD: Ihr Buch beginnt damit, dass mysteriöse Flugobjekte chinesischer Herkunft am Himmel auftauchen. Das erinnert erstaunlich an die Realität. Sind Sie froh, dass es in echt "nur" mutmaßliche Spionageballons waren?
Elsberg: Wahrscheinlich waren einige ja nur Forschungsballons und keine Spionageballons. Aber ja, das ist mir natürlich lieber, als es sind heimlich abgesprochene Geoengineering-Experimente.
STANDARD: Ist "Celsius" eine Warnung vor den Gefahren des Geoengineerings?
Elsberg: Celsius ist erst einmal ein Thriller. Ich habe mir wie üblich ein Thema gesucht, von dem ich das Gefühl habe, dass es in nächster Zeit stärker diskutiert werden wird. Dass ich mich da nicht ganz getäuscht habe, zeigt unter anderem der Umstand, dass die USA vergangenes Jahr einen Millionenetat freigegeben haben, um Geoengineering genauer zu erforschen. Ich finde es spannend, mich mit den gesellschaftlichen, ethischen Fragen auseinanderzusetzen, den Konflikten, die das Thema aufwirft. Aber bisher gibt es auf dem Feld, abgesehen von ein paar kleinen Experimenten, nur Theorie. Ich kann nicht vor etwas warnen, über das wir zu wenig wissen.
STANDARD: Dennoch wird Geoengineering bereits kontrovers diskutiert.
Elsberg: Ich denke aber, man sollte die Technik weiter beforschen. Einerseits läuft uns die Zeit davon. Für uns Mitteleuropäer ist Klimawandelanpassung bis zu einem gewissen Grad eine Option. Für viele andere Regionen nicht. Es würde mich daher nicht wundern, wenn die Initiative für Techniken wie Solar Radiation Management vom Globalen Süden ausgeht. Das ist auch die Geschichte, die Celsius erzählt. Forschung ist auch wichtig, damit wir wissen, womit wir zu rechnen haben, falls irgendjemand mal Geoengineering einsetzt.
STANDARD: Kritische Stimmen fordern deshalb, lieber Vollgas in Richtung Emissionsminderung zu gehen.
Elsberg: Natürlich. Aber zumindest in Österreich kündigte der Bundeskanzler persönlich ja gerade nur buchstäblich Vollgas in die andere Richtung an, Stichwort Verbrennungsmotoren. Warum bekommt man in einem halben Jahr ein Flüssiggasterminal an die deutsche Küste gestellt, aber keine Windräder, Solaranlagen, Energiespeicher und Wasserstoffanlagen? Es fehlt der politische Wille, und die verantwortliche Industrie hat jahrzehntelang sabotiert. Das 1,5-Grad-Ziel ist deshalb tot und das Zwei-Grad-Ziel in Wirklichkeit auch, das traut sich nur noch niemand zu sagen.
STANDARD: Wäre es ein realistisches Szenario, dass einzelne Länder das Weltklima beeinflussen, so wie im Buch beschrieben?
Elsberg: Es kommt drauf an, wie. Im Buch beginnt China mit ein paar Dutzend Drohnen – eine Zahl, deren Produktion man gerade noch geheim halten kann. Um einen wirklichen Effekt zu erreichen, also die Erderwärmung nachhaltig zu bremsen oder zu stoppen, müsste man dutzende oder hunderte Maschinen haben, die permanent fliegen. Das kriegt kein Staat unbemerkt hin. Es ist aber auch nicht undenkbar, dass eine Allianz aus Staaten des Globalen Südens sich zusammenschließt – so wie im Buch. Die wirken zunächst wie ein bunter Haufen, aber eigentlich institutionalisiert sich nur die Allianz gegen den Globalen Norden, die wir jetzt schon sehen, etwa wenn es um Sanktionen gegen Russland geht.
STANDARD: Angeblich haben sich viele nach der Lektüre von "Blackout" aus Sorge mit Gaskochern und Stromaggregaten eingedeckt. Was kaufen sich die Leserinnen und Leser nach dem Lesen von "Celsius"?
Elsberg: Hoffentlich nichts! Im Gegenteil, hoffentlich verzichten sie mal auf ein paar Sachen! (lacht) Nein, im Ernst: Ich habe ein Problem damit, die Klimakrise uns Einzelnen umzuhängen. Das ist auch das Problem der Klimaaktivistinnen und -aktivisten bei uns, die sich auf die Straße kleben und damit die Leute, die sie eigentlich als Unterstützerinnen bräuchten, gegen sich aufbringen, anstatt die eigentlich Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die gefährlichsten Männer der Welt stehen auf keiner CIA-Fahndungsliste, sondern sitzen in Riad, Moskau und bei den Ölkonzernen.
STANDARD: Sollte die Klimabewegung offener gegenüber Technologie werden – also Atomkraft, Gentechnik und vielleicht auch Geoengineering, so wie Sie es im Buch beschreiben?
Elsberg: Die Umweltbewegung hatte schon immer ein Problem mit Technologien, häufig aus irgendwelchen emotionalen Gründen. Ich glaube, es würde ihnen helfen, wenn sie ein bisschen offener werden – und ehrlicher. Denn ohne neue Technologien wird es nicht gehen. Ob das die sind, die ich in meinem Buch beschreibe, sei dahingestellt. Aber der theoretische Vorteil ist, dass Geoengineering vergleichsweise schnell entwickelt und gar nicht so teuer ist – mit allen Downsides natürlich. Das wird es für manche so verlockend machen, nach dem Motto: Einem Schwerkranken oder -verletzten muss ich auch erst einmal Erste Hilfe leisten, Medikamente gegen hohes Fieber etwa oder eine Herzmassage. Erst danach kann ich das Grundproblem bekämpfen. Schreibt DER STANDARD.
13.3.2023 - Tag der Fiktion vs. Realität
Das neue Buch «Celsius» des österreichischen Bestsellerautors ist zwar (noch) reine Fiktion, seine Aussagen über die zeitliche Erreichbarkeit der Klimaziele jedoch pure Realität. Auch wenn das unsere Politiker*innen und Klimaforscher*innen logischerweise anders sehen. Ideologien können nun mal nicht irren.
Und wir vertrauensseligen Erdenbürger*innen setzen weiterhin all unsere Hoffnungen für die Zukunft des Erdklimas ausgerechnet auf diejenigen, die uns in den Schlamassel hineingeritten haben.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Analyst ordnet Banken-Absturz ein: Was bedeuten die Turbulenzen für die Credit Suisse?
Die Anleger sind nervös und lassen die Aktien grosser Banken auf Tauchstation gehen. Besonders stark betroffen ist der Titel der Credit Suisse. Droht der Bank weiteres Ungemach? Vontobel-Analyst Andreas Venditti ordnet ein.
Unter den Anlegern herrscht nach der Pleite der US-Bank Silicon Valley Bank grosse Verunsicherung. Die UBS-Aktie fiel innerhalb einer Woche um 12,9 Prozent. Die beiden US-Grossbanken Morgan Stanley um 8,4 Prozent und Goldmann Sachs um 8,24 Prozent. Besonders hart traf es den Titel der Credit Suisse, der um 19,6 Prozent abgestürzt ist. Andreas Venditti (50), Analyst bei der Bank Vontobel, ordnet die Turbulenzen für Blick ein.
Droht im Bankensektor ein Flächenbrand?
Andreas Venditti: Das glaube ich nicht. Die US-Regierung hat für die Kundengelder der Silicon Valley Bank eine Staatsgarantie erklärt. Ich hätte aber erwartet, dass die Rettungsaktion die Märkte stärker beruhigt.
Die Credit Suisse hat es besonders stark getroffen. Die Aktie fiel am Montag vorübergehend auf 2.14 Franken. Wie tief könnte es noch gehen?
Das kann man so nicht sagen. Die Credit Suisse ist im Vergleich zu anderen Banken bereits angeschlagen. Gerät eine Bank in Schwierigkeiten, schauen die Anleger, welche Banken sonst noch betroffen sein könnten. Aufgrund der bereits angespannten Situation sind die Kursausschläge bei der CS stärker. Entscheidend bei solchen Rückgängen ist aber, wie hoch die Kunden die potenzielle Gefahr einschätzen. Wie stark könnte die Bank betroffen sein, mit der man zusammenarbeitet?
Und wie stark könnte die Credit Suisse von der Pleite in den USA und den Folgen betroffen sein?
Die Silicon Valley Bank ist ein sehr spezieller Fall. Sie hat sich auf das Geschäft mit Start-ups und Risikokapitalgebern spezialisiert. Die Schweizer Banken sind in ihrem Geschäft viel breiter aufgestellt. Deshalb glaube ich nicht, dass von der Pleite eine unmittelbare Gefahr für die Credit Suisse ausgeht. Indirekt dürfte die CS aber sicher merken, dass der Risikoappetit bei den Investoren weiter abnimmt.
Die Credit Suisse befindet sich mitten in einem grossen Umbau. Bringt der strauchelnde Bankensektor hier neue Probleme?
Unmittelbar hat das keine Auswirkungen. Indirekt aber natürlich schon. Einige Ökonomen erwarten nun, dass die US-Notenbank vorübergehend von weiteren Zinserhöhungen absehen könnte. Steigen die Zinsen nun nicht wie erwartet weiter, verschlechtern sich die Ertragsaussichten für den Bankensektor. Auch die Credit Suisse müsste dann mit tieferen Einnahmen rechnen.
Wie lange dürften die Turbulenzen an den Aktienmärkten anhalten?
Das ist schwierig zu sagen. Gerade die europäischen Bankaktien sind seit letztem Herbst stark gestiegen. Viele Anleger dürften jetzt ihre Gewinne realisiert haben. Die Staatsgarantie in den USA sollte aber helfen, dass sich die Bankaktien in nächster Zeit wieder stabilisieren. Generell dürften die starken, gut kapitalisierten Institute als Gewinner hervorgehen. Schreibt Blick.
12.3.2023 - Tag der CS-Pennystockaktien bei den Pensionskassen
Die Credit Suisse Anlagestiftung (CSA) sowie die Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule (CSA 2) sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen und die gemeinsame Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern bezwecken. Die Anlagestiftungen wurden von der Credit Suisse AG als Stifterin gegründet und sind rechtlich unabhängig vom Unternehmen. Schreibt die Credit Suisse.
Na dann ist ja alles in bester Ordnung. Dass die CS-Aktie sich inzwischen den Penny Stocks nähert, dürfte den Pensionskassenstiftungen, die in CS-Aktien investiert haben, wohl schlaflose Nächte bereiten. Ein Lehman Brothers Revival scheint sich anzubahnen. Nur als Gedankenstütze: Die Pensionskasse der Stadt Luzern musste seinerzeit nach dem Crash von Lehman Brothers acht Millionen Schweizer Franken abschreiben.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Putin dürfte keine Freude haben: Prigoschin enthüllt Zukunfts-Pläne der Wagner-Gruppe
Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat neue Zukunftspläne für seine Gruppe vorgestellt. Im Kreml dürften diese wenig Freude auslösen.
Seit Wochen schwelen im Kreml heftige Konflikte zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (70) und dem Chef der berüchtigten Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin (61). Der Grund: Prigoschin lässt keine Gelegenheit aus, die ausbleibenden Erfolge der russischen Armee zu betonen und stattdessen die Erfolge seiner eigenen Miliz in den Vordergrund zu rücken.
Hinter den Kulissen tobt ein erbitterter Machtkampf. Nun wird bekannt: Nach den Erfolgen in der umkämpften Stadt Bachmut will Prigoschin den Ausbau seiner Wagner-Gruppe weiter vorantreiben – und ihr auch eine ideologische Denkweise verpassen.
Laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) plant Prigoschin, die Wagner-Gruppe «in eine militärische Organisation parallel zur russischen Armee» aufzustellen. Die Gruppe soll dabei «spezifisch für die Interessen der ideologischen Hardliner-Elite» kämpfen, heisst es in dem Bericht. Prigoschin schlägt sich damit – wenn auch wenig überraschend – offiziell auf die Seite der Hardliner-Kriegshetzer, die keinerlei Kompromisse eingehen wollen. Stattdessen setzen sie auf die vollständige Eroberung der Ukraine und den weiteren Ausbau ihrer Macht.
Propaganda-Anlässe für Kinder
Um sein Ziel zu erreichen, plant Prigoschin den Aufbau von dutzenden weiteren Rekrutierungszentren in Russland. Laut dem Wagner-Chef wurden jüngst in 42 russischen Städten Zentren zur Rekrutierung von Söldnern eröffnet. Diese sind unter anderem in Schulen platziert. Prigoschin will also auch Jugendliche für seine Ideen begeistern und in den Krieg ziehen lassen. In den kommenden Wochen sollen weitere Zentren in mehr Städten folgen, kündigte Prigoschin am Wochenende an.
Laut dem russischen Oppositionsmedium Sota planen die Behörden in verschiedenen Regionen auch Anlässe, um die Jugendlichen für die Ideologie der Wagner-Gruppe zu begeistern. Laut der Ankündigung sollten die Vertreter von Wagner bei dem Treffen insbesondere «Heldengeschichten» aus dem Krieg in der Ukraine erzählen.
Auch Sommerlager auf der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim seien geplant. Laut ISW verfolgen diese Anlässe das klare Ziel, «Kinder und Jugendliche für die Ideen der Wagner-Gruppe zu begeistern, ihnen extreme Ideologien einzuflössen und nicht zuletzt auch neues Personal für den Krieg zu rekrutieren.»
Unmut im Kreml
Präsident Putin dürfte diese Rekrutierungsoffensive kaum gefallen. Seine Armee verzeichnet in der Ukraine massive Verluste. Zudem melden sich kaum Freiwillige, um in die Armee einzurücken. Deswegen zwang der Kreml im vergangenen Herbst im Rahmen einer Mobilisierung über 300'000 zusätzliche Männer in den Krieg.
Erst vor wenigen Tagen sorgte der Kreml für Aufruhr. Der staatliche russische Energieversorger Gazprom stellt derzeit eine Freiwilligen-Armee auf die Beine. Laut dem ISW könnte die neue Gazprom-Einheit im besetzten Gebiet Donezk bereits in naher Zukunft um Rekruten werben. Dafür soll Gazprom eigens eine Ermächtigung beim Kreml eingeholt haben – sehr zum Unmut von Prigoschin.
Sollte Gazprom in Donezk eine Mobilisierungs-Kampagne durchführen, käme der staatliche Energiekonzern der Wagner-Gruppe in die Quere. Diese führt eine eigene Rekrutierungskampagne in der Region durch. Die Machtkämpfe im Kreml gehen somit weiter. Schreibt Blick.
11.3.2023 - Tag der Flatterfeigen, eingewachsenen Zehennägeln und aussergewöhnlichen Flatulenz im Kreml
Es ist erstaunlich was die westlichen Geheimdienste so alles über Putin und das Putin-System wissen. Allen voran unser aller Blick, der seit dem Ukraine-Krieg zu so etwas wie dem obersten Agent im Dienste ihrer Majestät, dem Konjunktiv, mutierte.
Von Flatterfeigen und eigewachsenen Zehennägeln bis hin zu einer aussergewöhnlich aktiven Flatulenz wurde dem Diktator aus dem Kreml vom Boulevardblatt an der Zürcher Dufourstrasse so ziemlich jedes Gebrechen angedichtet, was zu seinem baldigen Tod führen werde.
Der Konjunktiv gehört definitiv verboten.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
London: Moskau gehen die Raketen aus
Die Frequenz russischer Raketenangriffe auf die Ukraine dürfte nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten abnehmen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor.
Demnach gehen Moskau die Raketen aus. Hinweis darauf gebe, dass bei der jüngsten Welle an Raketenschlägen am Donnerstag eine Auswahl von verschiedenen Geschossen zum Einsatz kam, die teilweise zweckentfremdet wurden. Russland müsse jetzt eine kritische Masse an neu gefertigten Raketen direkt von der Industrie ansammeln, bevor es die Mittel für einen Schlag habe, der gross genug sei, um die ukrainische Luftabwehr zu überwältigen, heisst es in der Mitteilung. Schreibt SRF im Live-Ticker.
10.3.2023 - Tag des MI6 und James Bond
Seit Wochen verfolgt uns beinahe täglich diese Meldung in den Live-Tickern sämtlicher Medien. Besonders krass mutet einen diese immer wiederkehrende Behauptung des britischen Geheimdienstes an, wenn wieder mal – wie vor zwei Tagen – zig Häuser in zig ukrainischen Städten in Schutt und Asche gebombt werden. Mit russischen Raketen.
Der MI6 scheint auch nicht mehr zu sein, was er einmal zu Zeiten von James Bond war.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Weil sich viele Politiker erkältet haben: Ständerat-Gfrörlis drehen Heizung wieder auf 22 Grad
Die Bevölkerung wird zum Energiesparen angehalten. Im Bundeshaus hingegen sind die Heizungen aufgedreht worden. Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller hat wieder gemütliche 22 Grad Raumtemperatur angeordnet.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga (62) wollte mit gutem Beispiel vorangehen. Als sich die Schweiz vor einem Energiemangel fürchtete, ordnete die Bundesrätin an, in der öffentlichen Verwaltung den Heizkörper herunterzudrehen. Maximal 20 Grad Celsius war die Order. Auch das Parlament zog mit. Besonders in der Wintersession froren viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier.
Jetzt hat die Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller (64) genug gefröstelt: Sie hat angeordnet, die Temperatur wieder zu erhöhen, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Wegen der Zugluft seien viele Mitarbeiter und Ratsmitglieder erkrankt. Häberli-Koller hat als Ständeratspräsidentin das Hausrecht in der kleinen Kammer und ist damit Alleinherrscherin über Heizung und Thermostat.
Neu ist es im Ständerat wieder wohlige 22 Grad warm.
Bevölkerung soll sparen
Pikant: Die Schweizer Bevölkerung soll derweil weiterhin Energie sparen. «Die Energieversorgungssituation in der Schweiz und Europa bleibt weiterhin angespannt und dürfte im Winter 2023/24 noch herausfordernder werden als im laufenden Winter», erklärte das Bundesamt für Energie kürzlich in einer Mitteilung. Der Bundesrat will darum Energiesparkampagne weiterführen und beantragt einen Nachtragskredit von 7 Millionen Franken.
Im Nationalratsaal bleibt wird übrigens weiterhin weniger geheizt – faktisch ist es dort aber wärmer, weil viel mehr Leute im Saal sind. Böse Zungen behaupten, dass dort zudem sowieso mehr heisse Luft produziert werde als in der «chambre de reflexion».
Wir sind alle Stromspar-Muffel
Doch auch die Schweizerinnen und Schweizer mögen es gerne gemütlich. Das vom Bundesrat angepeilte Strom-Sparziel verfehlt das Land auch im Februar deutlich. Zehn Prozent sollten es in den Wintermonaten von Oktober bis März sein. Doch letzten Monat war es mit geschätzt 5,3 Prozent nur gut die Hälfte, wie die neusten Zahlen des Energie-Dashboards des Bundes zeigen.
Beim Gassparen sind wir übrigens besser: Knapp 4000 Gigawattstunden sollte die Schweiz in den Wintermonaten bis Ende März einsparen – also 15 Prozent des Gasverbrauchs. Schon Ende Januar war das Sparziel erreicht. Und im verhältnismässig warmen Februar wurde das Polster nochmals ausgebaut. Mit 5116 eingesparten Gigawattstunden ist das Sparziel schon zu 128 Prozent erfüllt. Schreibt BLICK.
9.3.2023 - Tag des «warmherzigen» Luzerner Ständerats Damian Müller
Dass ausgerechnet in den Räumlichkeiten der Ständeräte*innen die Heizung wieder auf 22 Grad hochgeschraubt wird, stimmt jetzt doch etwas nachdenklich. Laut hartnäckigen Gerüchten aus dem Hohen Haus von und zu Bern soll der warmherzige Luzerner Ständerat Damian Müller derart viel Wärme ausstrahlen, dass einige dieser Hohen Damen und Herren darüber nachdachten, die Heizungen gar auf Null zu stellen.
Vermutlich, aber wir wollen den Wärme-Experten des Bundeshauses nicht vorgreifen, stammt die ausgestrahlte Wärme von Damian Müller gar nicht aus seinem warmherzigen Herzen, sondern basiert lediglich auf einer Abstrahlung seiner Solarium-gebräunten Haut, die allerdings als Wärmequelle nur kurzfristig wirkt. Das weiss eigentlich jeder Physiker*in seit Einsteins Relativitätstheorie.
Womit die vor den National- und Ständeratswahlen 2019 von Damian Müller in jeder, aber wirklich jeder Zeitung geäusserte Beteuerung «ich bin nicht warmherzig» vermutlich doch den Tatsachen entspricht. Das erklärt denn auch, weshalb sich der bald 40-jährige Staatsmann keine Ehefrau leisten kann. Er ist nicht warmherzig sondern barmherzig. Einen wie ihn hat nun wirklich keine Frau verdient. Die Zeiten von Rex Gildo sind schliesslich vorbei. Hossa!
Liebe Gerüchteköche aus dem Bundeshaus, Ihr könnt Eure Schöpflöffel einpacken. Unser aller Damian ist nicht «warmherzig» sondern «barmherzig». Das bewies er vor allem mit seinem Einsatz gegen den «Vaterschaftsurlaub», der seinen Aussagen zufolge den Unternehmen nur Kosten verursacht. Wo Müller recht hat hat er recht. Väter sollen gefälligst arbeiten und nicht Kinder am Laufmeter produzieren und dann auch noch für ihre Lüsternheit belohnt werden. Das ist gelebte bürgerliche Barmherzigkeit.
Last but not least sollten alle Warmherzigen nie vergessen, dass es Ständerat Damian Müller war, der sich in seiner unerschöpflichen Barmherzigkeit unermüdlich und mit aller Vehemenz für die «Ehe für alle» in selbstloser Aufopferung beinahe Tag und Nacht eingesetzt hat. Unvergessen seine Kampagne «Love is liberal», also FDP. Wofür ihn Pink Cross gar mit einer Ehrenmitgliedschaft auszeichnen wolle, was allerdings auch wieder aus der Pfanne der Gerüchteköche aus dem Bundeshaus stammt.
Und was von Gerüchteköchen aus dem Bundeshaus zu halten ist, wissen Sie jetzt spätestens seit heute. Nichts und Alles.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube

Damian ich bin nicht warmherzig Müller
Dieser Tiktok-Filter macht makellos: Die hässliche Realität über einen neuen Trend
Ein neuer Tiktok-Filter ist gerade im Trend. Der «Bold Glamour»-Filter lässt jeden makellos erscheinen, bis zur Perfektion. Doch solche Beauty-Filter haben problematische Nebenwirkungen.
Der «Bold Glamour»-Filter stellt alle bisherigen Tiktok-Filter in den Schatten: Er macht Wimpern lang, Lippen voll, Augen gross und die Haut makellos. Bei mehr als 3,8 Millionen Videos auf Tiktok ist der Filter bereits angewendet worden. Doch der riesige Erfolg hat eine Kehrseite: Der Filter festigt ein unerreichbares Schönheitsideal, das viele User und Userinnen für Realität halten.
Experten und User sehen in den unrealistischen Schönheitsstandards eine Gefahr. «Ich habe mich nie so hässlich gefühlt», heisst es in Tiktok-Videos, oder «Das bin gar nicht ich. Das ist wirklich nicht gesund.» Psychotherapeutin und Sexologin Dania Schiftan sieht kein Problem darin, solche Filter als Jux anzuwenden: «Gefährlich wird es, wenn man sich selbst ohne Filter unattraktiv fühlt.» Dies kann laut Schiftan gerade bei jungen Menschen Auswirkungen auf die Psyche und die Sexualität haben. Sie würden sich in intimen Situationen unsicher fühlen und das Licht immer ausmachen wollen.
Userinnen fühlen sich «traurig oder hoffnungslos»
Die Wissenschaft ist sich einig: Je mehr Social Media benutzt wird, desto unzufriedener sind Menschen mit ihrem Aussehen. Die bearbeiteten Bilder prägen die eigene Wahrnehmung und beeinflussen, wie ein ideales Gesicht aussehen sollte. Wie eine aktuelle Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention zeigt, fühlen sich 57 Prozent der Userinnen, die im Teenageralter Filter benutzen «anhaltend traurig oder hoffnungslos».
Einige Länder reagieren bereits mit Gesetzen auf das Phänomen: Seit 2021 herrscht in Grossbritannien ein Verbot gegen das Bewerben von Kosmetikprodukten mithilfe von Filtern. Eine Welt ohne Filter ist aber nicht mehr möglich. Dania Schiftan sieht aber trotzdem nicht alles schwarz: «Solche Trends lösen automatisch Gegenbewegungen aus, die mehr echten Kontakt wollen. Diese Dinge sollten wir mehr schätzen. Auch wenn die Filter gefährliche Auswirkungen haben können, ist es wichtig, einen gesunden Umgang mit Videos und Fotos zu finden.» Schreibt Blick.
8.3.2023 - Tag der TikTok- und Handy-«Faltenglättise»
Es ist schon unglaublich, mit welchem hirnverbrannten Bullshit das Boulevardblatt von der Zürcher Dufourstrasse sein Online-Portal füllt. Dieser dem chinesischen Schwachsinn-«Social Media»-Tool TikTok zugeschriebene «Bold Glamour»-Filter ist schon seit Jahren auf jedem mittelmässigen Handy vorhanden.
Oder was glauben Sie, weshalb ich auf meinen Selfies stets faltenfrei wie ein knuspriger Jüngling daherkomme? Nein, es ist nicht TikTok. Im Gegensatz zur Schweizer Landesregierung bin ich auf dem chinesischen Spionage- und Kindskopf-Portal nicht vertreten. Es ist das serienmässig eingebaute «Faltenglättise» von meinem Handy, das sämtliche Falten, Leberflecke und Augensäcke wegzaubert.
Ganz abgesehen von all diesen Wunder-Apps: Alles, was TikTok und mein Handy-«Faltenglättise» in Sachen Bildbearbeitung und Retuschieren können, wäre auch auf dem Adobe-Photoshop machbar. Sogar noch besser. Professioneller. Und dies seit mehr als 40 Jahren. Sollten Sie Zweifel an meiner Aussage haben, fragen Sie mal unseren Hoffotografen Res Kaderli.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Ausfuhr von Kriegsmaterial durch Schweizer Unternehmen im Jahr 2022
Schweizer Unternehmen haben 2022 gestützt auf Bewilligungen des SECO für 955,0 Millionen Franken Kriegsmaterial in 60 Länder exportiert. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme um rund 29 Prozent und einem Anteil von 0,25* Prozent an der gesamten Warenausfuhr der Schweizer Wirtschaft.
Die gesamte Warenausfuhr** aus der Schweiz ist 2022 gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent höher ausgefallen. Die Kriegsmaterialausfuhren verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme, und zwar um 212,2 Millionen Franken auf 955,0 Millionen Franken. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber 2021 um rund 29 Prozent. Damals wurde Kriegsmaterial für 742,8 Millionen Franken exportiert.
Grösster Abnehmer ist Katar
Die fünf Hauptabnehmerländer waren Katar mit Lieferungen im Wert von 213,4, Millionen Franken, gefolgt von Dänemark mit 136,2 Millionen Franken, Deutschland mit 131,7 Millionen Franken, Saudi-Arabien mit 111,1 Millionen Franken und den USA mit 61,5 Millionen Franken.
Grössere Geschäfte in der Berichtsperiode waren die Ausfuhren von Flugabwehrsystemen nach Katar (194,3 Millionen), gepanzerten Radfahrzeugen nach Dänemark (130,3 Millionen), Lieferungen von Ersatzteilen zu Flugabwehrsystemen nach Saudi-Arabien (65,1 Millionen), diversen Munitionsarten und Munitionskomponenten nach Deutschland (52,2 Millionen) sowie der Export von gepanzerten Radfahrzeugen nach Botswana (33,3 Millionen).
Rund 56 Prozent (2021: 65 %) des ausgeführten Kriegsmaterials waren für die 25 Länder des Anhangs 2 der Kriegsmaterialverordnung (KMV) bestimmt, die allen vier internationalen Exportkontrollregimen für die Kontrolle strategisch sensibler Güter angehören (Gruppe der Nuklearlieferländer, Australiengruppe, Raketentechnologiekontrollregime, Wassenaar Vereinbarung)***.
Aufgeteilt nach Kontinenten machten die Exporte nach Europa 50,4 Prozent (2021: 65,0 %) aller Ausfuhren aus, nach Asien 36,1 Prozent (10,9 %), nach Amerika 7,1 Prozent (13,3 Prozent), nach Afrika 4,0 Prozent (9,6 %) und nach Australien 2,4 Prozent (1,2 %).
Betrachtet man die Kategorien von Kriegsmaterial (Anhang 1 der KMV), dann entfielen im Jahr 2022 26,5 Prozent auf Panzerfahrzeuge (Kat. KM 6) und 24,8 Prozent auf Munition und Munitionsbestandteile (Kat. KM 3). 18,2 Prozent entfielen auf Waffen jeglichen Kalibers (Kat. KM 2), 16,8 Prozent auf Feuerleiteinrichtungen (Kat. KM 5), 5,4 Prozent auf Kleinwaffen (Kat. KM 1) und 4,8 Prozent auf Bestandteile zu Kampfflugzeugen (Kat. KM 10).
Die restlichen 3,5 Prozent verteilten sich auf 7 weitere Kategorien.
Leichte Zunahme der erteilten Bewilligungen bei den besonderen militärischen Gütern
Das SECO veröffentlicht ebenfalls eine Statistik zu den erteilten Einzelbewilligungen von besonderen militärischen Gütern des Anhangs 3 der Güterkontrollverordnung (u.a. Schutzsysteme gegen Torpedos und Drohnen, Minenräumausrüstung, ABC-Schutzausrüstung, ballistische Schutzausrüstung). Der Gesamtwert der nach den Kriterien der Güterkontrollgesetzgebung neu erteilten Einzelbewilligungen belief sich 2022 auf 69 Millionen Franken (2021: 58 Mio.).
Kriegsmaterialexporte vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ukraine
Die Schweiz wendet im Verhältnis Russland–Ukraine seit der russischen Annexion der Krim 2014 das Neutralitätsrecht an, welches Teil des Völkergewohnheitsrechts ist. Dieses bleibt auch während der aktuellen militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine anwendbar.
Aufgrund des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots kann die Schweiz Anfragen um Weitergabe von Kriegsmaterial mit Schweizer Ursprung an die Ukraine nicht zustimmen, solange diese in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Zudem schliessen auch die Bewilligungskriterien des Schweizer Kriegsmaterialgesetzes, welche 2021 durch das Parlament verschärft wurden, die Lieferung von Kriegsmaterial an Länder aus, die in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind.
* Aufgrund der Berücksichtigung des Reparaturverkehrs und der temporären Ausfuhren lässt sich dieser Wert nicht mit den vor dem Jahr 2018 publizierten Werten vergleichen.
** Gesamter Aussenhandel, d.h. inkl. Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine sowie Kunstgegenstände und Antiquitäten.
*** Argentinien, Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA.
7.3.2023 - Tag des Parlament-Tanzes um die Schimäre «Schweizer Neutralität»
Das SECO veröffentlicht die Ausfuhr von Kriegsmaterial im Jahr 2022 durch Schweizer Unternehmen. Unter den fünf Hauptabnehmerländern steht noch vor den USA an vierter Stelle - man sehe und staune – Saudi Arabien. Der salafistische Unrechtsstaat führt seit Jahren einen mörderischen Krieg gegen Jemen und die Schweiz liefert ihm nicht nur Waffen, sondern bezahlt auch noch die durch den unsäglichen Krieg verursachten Leiden der jemenitischen Bevölkerung mit 14.5 Millionen Schweizer Franken. Das muss man sich in Zeiten wie diesen, in denen viele Menschen in der Schweiz nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, erst mal auf der Zunge zergehen lassen.
Während als das SECO die Kriegsmaterialausfuhren veröffentlicht, tanzen die Gesalbten mit der widerwärtigen Spreizwürde der Etablierten im Nationalrat einmal mehr um die lächerliche Schimäre mit dem Namen «Schweizer Neutralität» und untersagen jede Weiterlieferung von Schweizer Waffen durch Drittländer, die sie einmal vor Jahren im guten Glauben an die Redlichkeit der Schweiz erworben haben, an die Ukraine.
Wäre die ganze Situation nicht dermassen verlogen, könnte man ja immerhin noch über die Anhänger*innen der Gebrüder Grimm aus dem Schweizer Parlament und ihren Sagenmüll ein paar schale Witzchen machen. Doch die würden uns im Halse stecken bleiben. Wir wählen tatsächlich die Unfähigsten aller Unfähigen ins Parlament. Nationalräte*innen, Ständeräte*innen und Bundesräte*innen, die Sagenfiguren (Wilhelm Tell) und Schimären (Neutralität) wie eine Monstranz vor sich her tragen. Mit welcher von jeglichem Intellekt befreiten Kaste haben wir es hier eigentlich zu tun?
Mit einer Chuzpe sondergleichen liefert die hehre Eidgenossenschaft ohne Wimpernzucken Kriegsmaterial an einen Staat wie Katar, wo die Menschenrechte mit den Füssen der milliardenschweren Herrscher getreten werden und an den kriegführenden Unrechtsstaat Saudi Arabien. Doch Drittstaaten aus Europa dürfen die vor Jahren von der Schweiz gekauften Kriegswaffen nicht an die von Russland überfallene Ukraine weiterliefern. Diese verlogene Doppelmoral ist schlicht und einfach nicht mehr nachvollziehbar.
Nicht, dass ich mit meinem angeborenen Fatalismus etwas dagegen hätte, wenn die Schweiz zum Wohle der Schweizer Rüstungsindustrie und der damit verbundenen Arbeitsplätze die Wüste Sahara mit Waffen vollpeppen würde, bevor China, Amerika oder Russland es tun. Aber dann bitte ohne diese Scheinheiligkeit und dem gebetsmühlenartigen Zitieren von Mythen, die es so nie gegeben hat. Und dies von Leuten aus dem Hohen Haus von und zu Bern, deren geschichtlicher Background beim Rütlischwur aufhört.
Aber für die in jedes Mikrofon und Social Media-Portal bis hin zu TikTok hinein blökende Schafherde der Unbedarften des Schweizer Parlaments, für deren narzisstisches Gehabe und Dummheit man sich langsam aber sicher schämen muss, ist es halt viel einfacher, sich in einer selbstgebastelten Sagenwelt als grossartige Staatenlenker*innen und Hüter*innen des Heiligen Grals von der Rütliwiese zu inszenieren als endlich die derzeit herrschende Wirklichkeit und die gesellschaftlichen Probleme und Verwerfungen anzugehen, für die sie bisher ausser ideologischem Kauderwelsch aus der rhetorischen Fertigbauweise der Partei-Akademien keine vernunftgesteuerten Lösungsansätze präsentieren können. Kein Wunder, haben sie doch die derzeitigen Miseren zumindest mitverursacht.
Politikverdrossenheit und der weitverbreitete Ekel vor den Politeliten kommen nicht von ungefähr. Wahlverweigerung ist allerdings das falsche Mittel. Statt die Unfähigen durch Abwählen in die Wüste zu schicken, werden sie von parteihörigen Interessenvertretern*innen und sonstigen Mumien immer und immer wieder gewählt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Florian B. (17) aus Doppleschwand (LU) bleibt auf 2700-Franken-Schrott-HP-PC sitzen
Florian B. ist todunglücklich. Lange hat er für einen Computer gespart. Nur neun Monate nach dem Kauf bei Interdiscount machte der PC schlapp. Mehrere Reparaturen scheiterten. Interdiscount stellte sich quer und wollte dem Teenager nicht helfen – trotz Garantie.
Er hatte lange gespart, um sich seinen Traum zu erfüllen: Florian B.* (17) aus Doppleschwand LU kaufte sich im Dezember 2021 für 2700 Franken einen brandneuen Computer – für den Schüler eine Menge Geld.
Doch die Freude hielt nur kurz. Nur ein halbes Jahr nach dem Kauf fing der leistungsstarke PC an, immer wieder abzustürzen. «Die Lüftung klang wie ein alter Rasenmäher», sagt Mutter Priska H.* (47), die den Kaufvertrag für ihren Sohn bei Interdiscount abgeschlossen hatte. Der 17-Jährige erkannte schnell, woran es lag. Die Grafikkarte war schuld. B. zu Blick: «Selbst wenn kein einziges Programm lief, war die Karte voll ausgelastet.» Die Folge: Der Computer streikte.
Im Oktober 2022 brachte B. den Computer zur Reparatur. Die zweijährige Garantie, die eine defekte Grafikkarte abdeckt, war noch lange nicht abgelaufen.
Hersteller schickte kaputten PC zurück
Der PC ging zurück an den Hersteller HP. Einen Monat später folgte die böse Überraschung: Die Firma schickte den Computer zurück, und zwar ohne eine Reparatur vorgenommen zu haben, wie der Bericht des Kundenservice zeigt. Nur das Betriebssystem wurde aktualisiert, mehr nicht. Und der PC funktionierte weiterhin nicht. Florian B. konnte es nicht fassen. Der Rechner ist für ihn mehr als nur ein Spielzeug. Er produziert Videos und Livestreams. «Videobearbeitung auf hohem Niveau braucht eine enorme Rechenleistung. Deswegen habe ich mich für so ein teures Gerät entschieden.»
Also schickte B. den Computer mehrmals ein – ohne Erfolg. Entweder aktualisierte HP das Betriebssystem, oder tat gar nichts, wie weitere Kundenservice-Berichte zeigen. Mutter H. ist enttäuscht: «So eine Frechheit habe ich noch nie erlebt.»
Nebst einer Reparatur sieht die Interdiscount-Garantie eine Rückerstattung oder einen Ersatz vor, doch die Firma stellte sich quer. Auf H.s Anfrage machte die Firma klar, dass sie über «eigene allgemeine Garantiebestimmungen» verfüge, die beim Kauf als akzeptiert gelten würden. «Aus diesem Grund können wir Ihnen mit einer Rückerstattung oder einem Ersatz nicht entgegenkommen», schreibt Interdiscount an Florians Mutter. Nur: Selbst die eigenen Bestimmungen decken einen solchen Schaden eigentlich ab. Das war der Firma aber offenbar egal. Auf weitere E-Mails habe Interdiscount nicht mehr reagiert.
«Mein Sohn ist verzweifelt»
Als Notlösung nutzt der Schüler seitdem den Computer seiner Mama. Inzwischen ist der Pannen-PC zum fünften Mal beim Kundenservice. Viel Hoffnung habe B. aber nicht. Er ist nur noch sauer. «Mein angespartes Geld ist futsch. Ich warte und warte, aber es passiert nichts. Ich fühle mich inzwischen ziemlich hilflos.» Auch sein Mami leidet mit: «Es ist frustrierend. Mein Sohn ist verzweifelt, und ich kann ihm nicht helfen.»
Die Reparatur auf eigene Faust wäre zwar möglich, die Grafikkarte ist aber das Teuerste am PC: Ab 1500 Franken kriege man das Teil, erklärt der Schüler.
Interdiscount lenkt nach Konfrontation ein
Erst als sich Blick einschaltet und Interdiscount mit den Vorfällen konfrontiert, tut sich etwas. Plötzlich zeigt sich das Unternehmen reumütig: «Wir haben den Fall intern geprüft und verstehen die entstandene Enttäuschung der Kundin vollkommen. Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns gerne bei der Kundin entschuldigen», schreibt das Unternehmen auf Nachfrage von Blick.
Interdiscount bestätigt, dass sich der PC derzeit wieder in Reparatur befinde. Und die Firma verspricht: «Sollte der Defekt nun nicht final behoben werden können, werden wir der Kundin den Kaufpreis selbstverständlich zurückerstatten.» Auf die Zusammenarbeit mit HP angesprochen, schreibt Interdiscount: «Wir haben mit der Servicestelle Kontakt aufgenommen, um solche Fälle in Zukunft kundenorientierter lösen zu können.» Eine Blick-Anfrage an HP blieb bislang unbeantwortet.
Der Papierkrieg war schwer für die Familie. «Für den Rest meines Lebens muss mir nie wieder jemand mit einer Garantieverlängerung kommen.» Ihr Sohn nickt zustimmend: «Auch ich habe das Vertrauen verloren.» Schreibt BLICK.
6.3.2023 - Tag der Computer und deren Laufzeit bis die Garantie abläuft
Die Traditionsmarke HP wurde 1939 von William R. Hewlett und David Packard, beide Absolventen der Stanford Universität, im kalifornischen Palo Alto mit einem Kapital von 538 US-Dollar gegründet. Der Name HP steht denn auch für Hewlett-Packard.
Das erste Produkt dieses Unternehmens – ein Tonoszillator mit der Typenbezeichnung 200 A – wurde in einer Garage in Palo Alto gebaut. Diese Garage gilt bis heute als Geburtsort des Silicon Valley.
William R. Hewlett und David Packard setzten nicht nur neue Massstäbe in Sachen Produktequalität, sondern auch bezüglich Firmenkultur und Managementstil. So lehnten sie beispielsweise die «Hire and Fire»-Praxis der frühen 60er und 70er Jahre ab. David Packard formulierte diesen Entscheid mit folgenden Worten: «Ein Unternehmen hat eine Verantwortung, die über die Erzielung eines Gewinns für die Aktionäre hinausgeht. Es hat die Verantwortung, die Würde seiner Mitarbeiter als Menschen, das Wohlergehen seiner Kunden und die Gemeinschaft insgesamt anzuerkennen.»
Davon ist nicht viel übrig geblieben. So verkündete das Unternehmen im November 2022, dass bis zu 12 Prozent der globalen Belegschaft (Anmerkung: 50'000 Personen) bis 2025 entlassen werden. Immerhin keine Entlassung Knall auf Fall, sondern eine gezielte Reduzierung der Belegschaft. Verteilt auf drei Jahre.
Auch die Qualität der ehemals in ihrem Segment weltweit führenden HP-Produkte, die inzwischen längst in China, Taiwan, der Tschechischen Republik, der Türkei und Russland hergestellt werden, lässt Kundinnen und Kunden öfters verzweifeln.
Der Fall des 17-jährigen Schülers aus Doppleschwand ist nur ein Fall von vielen. Sehr vielen sogar. So gab auch bei meinem HP-Computer nach drei Jahren und vier Monaten Benutzung das Betriebssystem den Geist auf. Garantie also abgelaufen. So blieb mir nichts anderes übrig, als einen IT-Fachmann aufzubieten, der die Hard Disk des Festplattenlaufwerks gegen eine neue ersetzte und mir empfahl, auch gleich die Grafikkarte, die vermutlich der Grund für den Ausfall der Festplatte gewesen war, gegen eine neue zu ersetzen. So wirkliche neu scheint sie trotz dem hohen Preis nicht zu sein. Läuft doch seitdem der Adobe-Photoshop der neuesten Up-Date-Generation nicht mehr und musste auf die Adobe-Version vom Vorjahr zurückgesetzt werden.
Dass die Betriebslaufzeit neuerer PC-Generationen allein schon durch die rasante Entwicklung der IT auf wenige Jahre begrenzt ist, sollte uns nicht wundern. Ist die Garantie abgelaufen, folgen meistens die ersten Komplikationen. Jedes Betriebsjahr nach Ablauf der Garantie ist ein geschenktes Betriebsjahr. Das muss man akzeptieren, egal ob es einem passt oder nicht. Die Technik bleibt nicht stehen.
Ärgerlich hingegen sind Garantiefälle wie die des Schülers aus Doppleschwand und das Verhalten des Garantie-Gebers, in diesem Fall die COOP-Tochter Interdiscount. Aber auch gewisse IT-Fachleute lassen uns ab und zu über deren «angebliches Fachwissen» nur noch den Kopf schütteln.
Die Zeiten der ehemaligen VW-Käfer-Werbung aus dem Jahr 1961 «Und läuft und läuft und läuft» sind definitiv vorbei. Notabene auch für VW.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Russlands Haushaltsloch wird noch grösser als erwartet
Dem russischen Staatshaushalt droht in diesem Jahr ein noch grösseres Loch als ohnehin befürchtet. Der Haushalt weise nach den Monaten Januar und Februar bereits ein Defizit von 2.581 Billionen Rubel (über 30 Milliarden Franken) auf, teilte das Finanzministerium der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Das sind schon knapp 90 Prozent des für das Gesamtjahr eingeplanten Defizits.
Im Vorjahreszeitraum hatte Russland noch einen Überschuss von 415 Milliarden Rubel (rund 5 Milliarden Franken) erzielt. Problematisch für den russischen Haushalt ist vor allem der Einbruch bei den Öl- und Gaseinnahmen. Diese sind nach den vorläufigen Berechnungen des Ministeriums um fast die Hälfte gesunken. Schreibt SRF im «Ukraine-Liveticker.
5.3.2023 - Tag des russischen Haushaltlochs und der Putin-Versteher Köppel & Co.
Von wegen «Sanktionen nützen nichts»: Die Putin-Versteher werden sich grün und blau ärgern. Müssen sie doch jetzt eine neue Schwurbler-Geschichte bezüglich den westlichen Sanktionen gegen Russland erfinden. Wird aber Roger Köppel & Co. nicht schwerfallen.
Dass viele Sanktionen zuerst einmal die Staaten selbst treffen, die Sanktionen verhängen, ist eine alte Weisheit. Dass sie aber langfristig wirken ebenso.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
FDP-Nationalrätin gegen FDP-Nationalrätin: Eklat im Bundeshaus
Christa Markwalder wechselt ihren Platz im Nationalrat, um nicht mehr neben Doris Fiala sitzen zu müssen. Der Bruch hat auch mit Markwalders Mann zu tun.
Es menschelt in der Politik. Das ist an sich nichts Aussergewöhnliches, zumal unsere Gesetze nicht von Robotern gemacht werden. Was sich vergangene Woche im altehrwürdigen Nationalratssaal abspielte, übertrifft die alltäglichen Animositäten allerdings bei weitem – und wird wohl als eine der verrückteren Episoden in die Geschichte des Bundesparlaments eingehen.
Schauplatz war die FDP-Fraktion. Deren Mitglieder dürften sich beim Auftakt der Frühlingssession gewundert haben, als sie die plötzliche Rochade bemerkten: Die Berner Abgesandte Christa Markwalder (47) hatte ihren Platz geräumt und sich eine Reihe weiter vorn niedergelassen. Fortan sitzt sie neben dem St. Galler Marcel Dobler (42). Auf Markwalders bisherigem Stuhl nahm der Walliser Philippe Nantermod (38) Platz.
Verbündete im Europadossier
Das Manöver besiegelt den Bruch zwischen zwei langjährigen Weggefährtinnen: Wie SonntagsBlick in Erfahrung bringen konnte, hielt es Markwalder nicht mehr länger aus, neben Doris Fiala (66) zu sitzen.
Die Bernerin und die Zürcherin waren seit fünfeinhalb Jahren Nachbarinnen im Ratssaal und noch viel länger politische Freundinnen. In manchen Dossiers passte kein Blatt Papier zwischen die beiden.
Sie kämpften Seite an Seite für Gleichstellungs- und Gesellschaftsthemen, sie wischten einander die Tränen ab nach dem Aus des EU-Rahmenabkommens am 26. Mai 2021. «Sie sitzen im Nationalrat nebeneinander und verstehen sich trotz ihres Altersunterschieds von 20 Jahren sozusagen blind», schwärmte die SRF-Boulevardsendung «Gesichter & Geschichten» im November 2021.
Erste Verwerfungen im Zürcher Wahlkampf
Die Sitzordnung im Parlament ist Sache der Fraktionen. Über den Grund von Markwalders Aktion, wie man sie eher in einem Primarschulzimmer als in der höchsten Legislative des Landes erwartet hätte, wird eifrig spekuliert. Im näheren Umfeld der Fraktion heisst es übereinstimmend, dass die gescheiterten Politambitionen von Markwalders Gatten Peter Grünenfelder (55) eine wichtige Rolle gespielt hätten.
Der Chef der Denkfabrik Avenir Suisse kandidierte am 12. Februar für einen Sitz im Zürcher Regierungsrat, verpasste jedoch – nach einer angriffslustigen und entsprechend umstrittenen Kampagne – den Einzug. Beim Ehepaar Markwalder-Grünenfelder sitzt der Frust dem Vernehmen nach tief; bei ihr dürfte die Nichtwahl Erinnerungen an ihre zwei vergeblichen Versuche geweckt haben, den Sprung in den Ständerat zu schaffen.
Vielleicht trifft der Zorn Fiala auch besonders, weil sich schon während Grünenfelders Wahlkampf erste Verwerfungen mit der einstigen Mitstreiterin abzeichneten. Fiala gehörte früh zu den Förderinnen von Grünenfelders Politkarriere, lud ihn als Redner an Europa-Anlässe ein und lobbyierte bei der Zürcher FDP für seine Nomination.
Doch sein forscher Auftritt mit teils libertär anmutenden Positionen entsprachen nicht dem Profil der konzilianten Zürcher Kommunikationsberaterin; der Thinktank-Chef stiess mit seinen Salven gegen die Amtsinhaber viele im eigenen Lager vor den Kopf.
Auch die freisinnige Wirtschaftsvorsteherin Carmen Walker Späh (65) geriet in Grünenfelders Visier– sie war einst von Fiala zum Einstieg in die Politik ermuntert worden und gilt bis heute als enge Vertraute der Nationalrätin.
Beide treten im Herbst ab
Die Folge: Grünenfelders ehemalige politische Ziehmutter weibelte für Walker Späh, fehlte aber prominent in seinem Unterstützungskomitee – und stand stattdessen für Testimonials zugunsten der sozialdemokratischen Konkurrentin Jacqueline Fehr (59) hin. Fiala erklärt ihren Support für Kulturministerin Fehr mit ihrem Amt als Präsidentin des Branchenverbands Pro Cinema.
Für Markwalder indes ist das kein Grund zur Milde, im Gegenteil: Getreu dem Motto «Feind, Todfeind, Parteifreund» beschuldigte sie Fiala in ihrem Furor vergangene Woche in der Wandelhalle, hinter einem kritischen SonntagsBlick-Artikel über den Wahlkampfstil ihres Mannes zu stehen, was Fiala zu Recht bestreitet.
Auf Anfrage schweigt die Zürcherin beharrlich, sie äussere sich nicht zu Interna. Auch bei Markwalder heisst es: «No comment.» Immerhin eine Gemeinsamkeit bleibt ihnen: Beide Frauen haben erklärt, bei den Wahlen im Herbst nicht mehr anzutreten. Schreibt Blick.
4.3.2023 - Tag der fernöstlichen Influenzerin «Kasachstan-Christa» Markwalder
Ich möchte neben keiner von den beiden Polit-Grandinnen sitzen. Vor allem nicht neben «Kasachstan-Christa».
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Lohn, Sitzungsgeld & Gratis-1.-Klass-GA: Diese Benefits gibts für die Parlamentarier
Die höchsten Parlamentarier wollen sich selbst mehr Lohn auszahlen. Die Übersicht zeigt: Schon jetzt verdienen National- und Ständeräte üppig.
Geht es nach Ständerätinnen und Nationalräten, sollen sie schon bald mehr Lohn bekommen. Wegen der hohen Teuerung sollen die Entschädigungen für die Parlamentarier angepasst werden – während die Räte bei den AHV-Renten für die am Mittwoch noch geknausert hatten.
Schon jetzt verdienen National- und Ständeräte nicht schlecht: Im Durchschnitt bezieht ein Nationalrat heute 132'500 Franken im Jahr. Bei einer Ständerätin sind es 142'500 Franken. Der Betrag setzt sich aus folgenden Benefits zusammen:
1 – Lohn: 26'000 Fr. pro Jahr
Sich ins Thema einlesen oder kluge Reden schreiben: Die Arbeit im Parlament will vorbereitet werden. Zudem müssen die meisten National- und Ständeräte für die Parlamentsarbeit ihr sonstiges Arbeitspensum reduzieren. Als Ausgleich dafür gibt es einen Grundlohn von 26’000 Franken im Jahr. Das sind knapp 2200 Franken pro Monat.
2 – Sitzungsgeld: bis 47'845 Fr. pro Jahr
Für jeden Tag, den die Politiker im Rat oder in einer Kommissionssitzung verbringen, fliessen zusätzlich 440 Franken ins Portemonnaie. Es gibt mindestens vier Sessionen pro Jahr à 13 Tage, dazu sitzen die meisten Nationalräte in ein bis zwei Kommissionen. Wer eine Kommission präsidiert, bekommt 440 Franken zusätzlich pro Sitzung, für die Berichterstattung im Rat gibt es 220 Franken. Pro Jahr läppert sich das auf 43'237 Fr. (Nationalrat) beziehungsweise 47'845 Fr. (Ständerat) zusammen.
3 – Altersvorsorge: 13’652 Fr. pro Jahr
Zudem zahlt der Bund den Parlamentariern auch einen Zustupf an die Altersvorsorge: Ratsmitglieder erhalten bis zum vollendeten 65. Altersjahr 13’652 Franken; das Ratsmitglied muss ein Viertel davon aber selbst bezahlen.
4 – Persönliche Mitarbeiter: 33'000 Fr. pro Jahr
Nicht jeder Parlamentarier kann alles allein machen, manche stellen deshalb Mitarbeiter an. Als Beitrag zur Deckung dieser Ausgaben erhalten die Ratsmitglieder eine Jahresentschädigung von 33‘000 Franken.
5 – Gratis-GA: 6300 Fr. pro Jahr
Der Weg nach Bern ist je nach Wohnort lang. Die Parlamentarier dürfen 1. Klasse ins Bundeshaus reisen. Entweder mit dem GA (im Wert von 6300 Fr.) oder einer Pauschalentschädigung im Wert von 5040 Franken – für diejenigen, die mit dem Auto nach Bern fahren.
6 – Essen: bis 11'740 Fr. pro Jahr
Wer in Bern ist, muss sich auswärts verpflegen und – wenn er nicht gerade von einem Lobbyisten eingeladen wird – auch selbst dafür zahlen. Pro Sitzungstag erhalten Parlamentarier eine Mahlzeiten-Entschädigung von 115 Franken. Egal, ob sie gerade auf Diät sind oder nicht. Pro Jahr läppert sich das auf 10'651 Fr. (Nationalrat) beziehungsweise 11'740 Fr. (Ständerat) zusammen.
7 – Übernachtung: bis 10'625 Fr. pro Jahr
Sogar fürs Schlafen werden die Parlamentarier bezahlt: Pro Nacht, die sie zwischen zwei Sitzungstagen auswärts verbringen, erhalten sie einen Zustupf von 180 Franken. Einige Parlamentarier haben sich eine kleine Mansarde in Bern gemietet, andere haben WGs, und wieder andere leisten sich ein Hotel. Pech haben jene Politiker, die weniger als zehn Kilometer Luftlinie vom Bundeshaus wohnen oder ihr Zuhause in 30 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr erreichen. Sie bekommen nichts. Ausser sie fahren in Ausübung ihres Amtes ins Ausland – dann gibt es eine Mahlzeiten- und Übernachtungspauschale von insgesamt 395 Franken pro Tag. Pro Jahr läppert sich das auf 9839 Fr. (Nationalrat) beziehungsweise 10'625 Fr. (Ständerat) zusammen.
8 – Kinderzulagen: bis 384.70 Fr. pro Kind und Monat
Im Landesdurchschnitt beträgt die Kinderzulage 186 Franken pro Monat (je nach Kanton 160 bis 260 Franken). Für Parlamentarier «dörfs es bitzeli meh sii». Hier gibts 384.70 Fr. Franken für das erste zulagenberechtigte Kind, 248.40 Fr. für das zweite – und 270.60 Fr. für jedes weitere zulagenberechtigte Kind, welches das 16. Altersjahr vollendet hat und in Ausbildung ist.
9 – Jöbli: Betrag nach oben offen
Zudem bringt der Job als Parlamentarier oft lukrative Mandate mit sich – Verbände und Organisationen hoffen dadurch auf mehr Einfluss im Parlament. Und lassen sich das etwas kosten. Ein Job in einem Verwaltungsrat oder einem Verband bedeutet für einen Politiker zwar kaum Arbeit, dafür gute Bezahlung.
Daneben gibts noch den einen oder anderen Franken zusätzlich, dessen Erklärung den Rahmen dieser Auflistung sprengen würde (z.B. Einkommensausfall für die Dauer der Anreise). Die ganze Liste gibts hier. Schreibt Blick.
3.3.2023 - Tag der unsäglichen «Nebeneinkünfte» im Schweizer Parlament
So exorbitant, wie BLICK suggeriert, sind die Vergütungen für die Parlamentarier*innen nun auch wieder nicht. Da sollte sich das Boulevardblatt von der Zürcher Dufourstrasse schon einmal orientieren, welche Summen in der IT-Branche ab mittlerem Kader verdient werden. Oder was ein Luzerner Stadtpräsident*in abzügelt. Da kann es einem dann schon langsam schwindlig werden.
Kommt hinzu, dass Parlamentarier*innen für ihre Arbeit «für das Volk» auch gut entlöhnt werden sollen, damit sie gegenüber einträglichen korrupten Verlockungen immun bleiben.
Unerträglich sind hingegen die Mauscheleien mit all den unsäglichen «Pöstchenjägereien», die sich ja nicht wirklich kontrollieren lassen und häufig nichts anderes als pure Korruption darstellen. Es soll Parlamentarier*innen geben, die mit diesen «Nebeneinkünften» doppelt so viel verdienen wie mit den obligaten Vergütungen als «Volksvertreter*innen».
Der Luzerner Ständerat und von Blick als «Pöstchenjäger» bezeichnete Ständerat Damian Müller ist das beste Beispiel dafür. Um die einträglichen Pöstchen – da 20'000 Franken, dort 15 Franken – gegenüber Blick und sonstigen Neugierigen verschleiern zu können, betreibt der ehrenhafte FDP-Narziss mit den solariumgebräunten «Pfusibäggli» seit 2022 die MüPa.Beratung GmbH. Auch wenn die Unschuldsvermutung gilt: Ein Schelm, wer Böses denkt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Warnung eines russischen Oligarchen Oleg Deripaska: «Nächstes Jahr haben wir kein Geld mehr»
Seltener Moment der offenen Kritik: Der russische Magnat Oleg Deripaska – lange bekannt für seinen guten Draht zum Kreml – mahnt einen Kurswechsel in der russischen Wirtschaftspolitik an. Sonst sei das Land 2024 pleite.
Oleg Deripaska gehört seit vielen Jahren zu den reichsten Männern Russlands – und reich geblieben sind in dem Land in dieser Zeit nur jene Unternehmer, die weitgehend loyal zum Kreml standen. Die Kritik, wenn überhaupt, dann nur in wohldosierten Mengen äußerten. Am besten auch: nur hinter verschlossenen Türen.
Das ist der Hintergrund, vor dem sich Deripaskas Auftritt beim Krasnojarsker Wirtschaftsforum abhebt: Der Milliardär hat sich dort mit deutlicher Kritik am russischen Staatskapitalismus zu Wort gemeldet. Er sei »entsetzt über die Haushaltsmittel, die im vergangenen Jahr verschwendet wurden«, zitieren russische Medien den Magnaten, darunter die Agentur Interfax. Wenn Russland nicht bald neue Einnahmequellen erschließe und wirtschaftliche Reformen einleite, drohe dem Land womöglich bald schon die Pleite.
»Wir werden wählen müssen. Im nächsten Jahr schon werden wir kein Geld mehr haben«, warnte Deripaska mit Blick auf die russische Staatskasse. »Wir brauchen ausländische Investoren.« Das Land müsse deshalb zügig Fortschritte bei der Rechtssicherheit und Berechenbarkeit machen. Es könne nicht sein, dass »wir jedes Quartal die Spielregeln ändern«. Die »steinzeitliche« Praxis von Verhaftungen von Geschäftsleuten müsse endlich beendet werden.
Der Milliardär und sein Telegram-Kanal
Deripaska ist eng mit dem Aluminiumkonzern Rusal verbunden. In den USA galt er lange als ein Verdächtiger hinter den Manövern, die 2017 Donald Trump zur US-Präsidentschaft mitverholfen haben sollen. Noch vor wenigen Jahren sagte Deripaska voller Stolz, er können zwischen sich und dem russischen Staat keine Trennlinie ziehen.
Seit Kriegsbeginn liest sich der Telegram-Kanal des Milliardärs allerdings mitunter wie der eines Dissidenten. Deripaska hat dort ein »Manifest« verbreitet. Darin fordert er einen drastischen Bürokratieabbau: Die Hälfte aller russischen Beamtenstellen solle gekürzt werden, bei Polizei und Geheimdienst sogar vier von fünf Posten. Das ist ein kaum verhohlener Generalangriff auf den Geheimdienst- und Bürokratenstaat, den Wladimir Putin in den vergangenen 22 Jahren errichtet hat. Diese Forderung nach einer drastischen Reduzierung des Beamtenapparates wiederholte Deripaska nun auch in Krasnojarsk.
Über den Grund für die Schieflage des russischen Staatshalts – den Krieg in der Ukraine – sagte er nichts. Deripaska sagte nur allgemein, es sei »an der Zeit, dass wir aufhören, von einem besonderen Platz in der Welt zu träumen«. Besser sei es, sich »auf unsere eigenen Angelegenheiten zu konzentrieren«. Schreibt DER SPIEGEL.
2.3.2023 - Tag des Schweizerischen Verfassungsorgans «DIE WELTWOCHE»
Eine gefährliche Aussage vom russischen Oligarchen Oleg Deripaska: Wer sich gegen Putin zu weit aus dem Fenster lehnt, fällt in letzter Zeit sehr schnell aus einem Fenster. Sei es aus dem 12. Stock eines Hochhauses oder dem obersten Stockwerk eines Spitals. Einige mächtige Menschen aus der russischen Nomenkleptura haben seit dem Beginn des Ukraine-Krieges auf diese Weise bereits ihr irdisches Leben auf Mütterchen Russlands Boden verloren.
Was von Deripaskas Botschaft zu halten ist, kann seriös nicht beurteilt werden. Die westlichen Sanktionen scheinen aber doch je länger je mehr allen Unkenrufen zum Trotz grössere Früchte zu tragen, als die Putin-Versteher hierzulande im Tages-Rhythmus über ihren offiziellen Sprecher Roger Köppel verkünden. Vielleicht ist halt doch nicht alles Gold was in Putins Reich glänzt, auch wenn das neues Verfassungsorgan der Schweiz, DIE WELTWOCHE, das anders sieht.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Britische Regierung erwog zu Beginn der Corona-Pandemie offenbar Tötung von Hauskatzen
Die britische Regierung hat zu Beginn der Corona-Pandemie offenbar die Tötung aller Hauskatzen erwogen. "Tatsächlich gab es einen Moment lang die Idee, dass wir die Öffentlichkeit auffordern müssten, alle Katzen in Großbritannien auszurotten. Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn wir das gemacht hätten?", sagte der konservative Politiker James Bethell dem Sender Channel 4 News. Man sei damals unsicher gewesen, ob nicht auch Haustiere Corona übertragen können.
Es habe eine Zeit lang ein paar Belege gegeben, die hätten untersucht werden müssen, sagte der damalige Vize-Gesundheitsminister nach Angaben der Nachrichtenagentur PA weiter. Laut "Guardian" waren im Juli 2020 Katzenbesitzer davor gewarnt worden, ihre Tiere zu küssen. Zuvor war bekannt geworden, dass sich eine Siamkatze als erstes – bekannt gewordenes – Tier im Vereinigten Königreich mit der Krankheit infiziert hatte. Margaret Hosie, Professorin für vergleichende Virologie an der Universität Glasgow, habe den Katzenbesitzern damals geraten, "sehr auf Hygiene zu achten", berichtete der "Guardian".
Übertragung von Menschen auf Katzen häufiger
In England genießt vor allem ein Kater Kultstatus: Kater Larry residiert mittlerweile seit über zwölf Jahren als "oberster Mäusefänger des Vereinigten Königreichs" im Regierungssitz Downing Street. Auf seinem Satire-Account bei Twitter, der im Namen des Katers das politische Geschehen meist spöttisch kommentiert, folgte am Mittwochabend prompt eine Reaktion: "Schwer, das nicht persönlich zu nehmen", hieß es dort mit Blick auf Bethells Aussage, dass die Tötung der Katzen erwogen worden sei.
Tatsächlich kann das Coronavirus einer im Juni 2022 veröffentlichten Studie zufolge vermutlich von Katzen auf Menschen übertragen werden. Wissenschaftler beschrieben einen Fall in Thailand, bei dem eine Tierärztin sich im August 2021 mit dem Virus infiziert hatte. Sie hatte in der südthailändischen Stadt Songkhla eine positiv getestete Katze behandelt und war von dieser angeniest worden. Wissenschaftler betonen aber, dass sich das Virus deutlich häufiger vom Menschen auf Katzen überträgt als in umgekehrter Richtung. In Dänemark waren während der Pandemie aus Sorge vor Übertragung der Seuche Millionen Nerze getötet worden. Schreibt DER STANDARD.
1.3.2023 - Tag des Mäusefängers Larry von der Downing Street
Dass Katzen das Coronavirus tatsächlich auf Menschen übertragen können, soll ja inzwischen bestätigt sein. Ob man die Katzen deswegen gleich töten muss, sei dahingestellt. Dem erratischen Premier Boris Johnson wäre eine solche Aktion durchaus zuzutrauen gewesen. Ob es Kater Larry, dem Mäusefänger von der Downing Street, ebenfalls an den Kragen gegangen wäre, wird für immer ein Geheimnis bleiben.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Aargauer Gemeinde Windisch wehrt sich: 49 Mieter müssen raus – für Asylunterkunft
Gemeinden müssen Platz für Asylsuchende schaffen. Im Fall von Windisch bedeutet dies: 49 Mieter müssen raus, rund 100 Personen kommen rein. Gegen die Pläne des Kantons wehrt sich nun die Gemeinde.
Der Kanton Aargau will in Windisch AG eine Unterkunft für rund 100 Personen eröffnen. Der Eigentümer der Liegenschaft hat gemäss Angaben des Gemeinderats Windisch den bisherigen 49 Mietenden der drei Liegenschaften per Ende Juni gekündigt.
Eine davon ist Julia Adams (39). Die Naturwissenschaftlerin lebt mit Ehemann Michael (42) und den drei Kindern Finja (3), Johannes (6) und Norina (8) in einer der betroffenen Wohnungen. «Die Kündigung haben wir Mitte der letzten Woche bekommen. Wir waren geschockt. Unsere Kinder waren dabei, als der Brief kam. Alle haben geweint.»
In der Kündigung wurde keine Begründung angegeben. «Was mit dem Gebäude geplant ist, habe ich aus der Zeitung erfahren. Unsere Hoffnung ist, dass wir die Kündigung hinauszögern können. Die Frage ist aber, ob man überhaupt bleiben möchte, wenn so schlecht mit einem umgegangen wird», so Adams. Dabei spielt der neue Zweck der Liegenschaft keine grosse Rolle. Im Gegenteil. «Ich bin ein Mensch, der gerne teilt. Hier fühle ich mich aber verarscht. Die gesetzte Frist ist wahnsinnig kurz, speziell für eine Familie mit schulpflichtigen Kindern.»
Gemeinderat wehrt sich «vehement»
Weder der Gemeinderat noch die Gemeindeverwaltung seien vorher über den Vollzug dieser Kündigungen in Kenntnis gesetzt worden, heisst es in einer Mitteilung der Gemeindekanzlei.
Die Gemeinde habe den Kanton bereits bei einer Besprechung am 17. Februar darauf hingewiesen, dass man es nicht akzeptiere, «wenn für die Unterbringungen von Asylsuchenden Mieterinnen und Mieter auf die Strasse» gestellt würden.
Die Kündigung ausgesprochen hat laut SRF die private Firma «1drittel Aleph AG», mit Sitz in Wollerau im Kanton Schwyz.
Der Gemeinderat wehrt sich nach eigenen Angaben «vehement gegen den Rauswurf seiner Einwohnerinnen und Einwohner aus ihren Wohnungen». Gerade für Personen, die bereits in einer finanziell angespannten Situation seien, werde es schwierig bis unmöglich sein, Wohnraum im niedrigen Preissegment zu finden, hiess es in der Stellungnahme weiter.
«Ich befürchte, auf der Strasse zu landen.»
So geht es auch dem Bewohner und Sozialhilfeempfänger Björn Waltert (32): «Ich suche, seit wir die Kündigung erhalten haben, überall nach Wohnungen. Ich bin preislich eingeschränkt und durch meinen Hund wird die Suche noch schwieriger.»
«Es ist eine Frechheit. Man ist gleichzeitig wütend und traurig. Es ist ein Gefühlschaos. Alleine im letzten Jahr bin ich dreimal umgezogen. Ich dachte wirklich, ich hätte jetzt endlich ein Zuhause gefunden», zeigt sich Waltert konsterniert. «Traumhaft wäre, wenn wir alle bleiben könnten. Die Gemeinde setzt sich sehr für uns ein, wie ich gehört habe.» Wie es weitergeht, weiss Waltert nicht: «Ich befürchte sogar, dass ich auf der Strasse landen könnte.»
Ähnlich sorgenvoll äussert sich der Gemeinderat in seiner Stellungnahme: «Dass der Kanton nun so weit geht, dass sogar bewohnte Liegenschaften angemietet werden, im Wissen, dass dafür Mieterinnen und Mieter gekündigt werden muss, löst beim Gemeinderat grosses Befremden aus. Von Zurückhaltung und Verhältnismässigkeit ist in diesem Fall nichts zu spüren.» Der Gemeinderat erwarte vom Kanton, dass dieser auf die Miete der betroffenen Liegenschaften verzichte.
Kanton hält sich bedeckt
Das Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau teilte am Montagabend auf Anfrage mit, dass es um eine reguläre Anmietung zweier Altliegenschaften gehe, deren Sanierung in nächster Zeit bevorstehe und nicht um eine Beschlagnahmung.
Der Kantonale Sozialdienst (KSD) habe am Mittwoch einen Brief des Gemeinderats Windisch erhalten. Der KSD werde den Brief in den nächsten Tagen beantworten. Die bestehenden Differenzen wolle der KSD «nicht über die Medien austragen». Nach der Zustellung des Briefs an den Gemeinderat Windisch werde der KSD auch die Öffentlichkeit über den Inhalt des Briefs orientieren.
«Problem wird einfach verlagert»
Gegenüber Blick äussert sich Heidi Ammon (63), Gemeindepräsidentin von Windisch, konkreter: «Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man solche Kündigungen ausspricht.» Der Mietvertrag zwischen Eigentümer und Kanton wurde auf drei Jahre festgelegt. Bereits wird in der Gemeinde darüber spekuliert, ob es nach Ablauf des Mietvertrags einen Neubau an gleicher Stelle geben soll. «Wir gehen davon aus, dass die geplante Asylunterkunft eine Zwischenlösung ist», so Ammon. Die betroffenen Immobilien seien aktuell nicht in einem Zustand, in dem sie noch jahrelang bewohnt werden könnten. Auf diese Weise verschaffe man sich Zeit, ein Baugesuch vorzubereiten. «Ich wünsche mir, dass der Kanton alles nochmals überdenkt und die Mieter hier wohnen bleiben können», so SVP-Politikerin Ammon.
Auch bei Luzia Capanni (45), SP-Einwohnerrätin in Windisch, lösen die Kündigungen Empörung aus. «Die Mieterinnen und Mieter, denen gekündigt wurde, werden es nicht leicht haben, neuen kostengünstigen Wohnraum zu finden», sagt sie. Gelinge es ihnen nicht, so ist die Gemeinde für sie zuständig. «Dadurch wird das Problem einfach verlagert. Das geht nicht!» Sie übt zudem Kritik an der Kommunikation zwischen Kanton und Gemeinde.
Capanni betont aber: «Es ist nicht so, dass sich Windisch foutiert, Geflüchtete aufzunehmen. In unserer Gemeinde gibt es bereits zwei kantonale Asylunterkünfte», sagt sie. Eine mit aktuell 20 unbegleiteten Minderjährigen sowie eine mit jungen Erwachsenen, hinzu kämen viele Ukrainerinnen und Ukrainer. «Des Weiteren stellt das Bundesasylzentrum in Brugg auch für Windisch eine Belastung dar. Der Kanton unterstützt die Gemeinde nicht.». Schreibt Blick.
28.2.2023 - Tag der Ingredienzen mit denen man Stimmungen beeinflusst
Dass die private Immobilien-Firma «1drittel Aleph AG», mit Sitz in Wollerau im steuergünstigen Kanton Schwyz an die- oder denjenigen sein Haus vermietet, der am meisten bezahlt, ist irgendwie nachvollziehbar. Bevor Sie die Faust im Sack ballen: Hinterfragen Sie sich selbst, ob Sie es nicht auch tun würden, wären Sie der/die/das Besitzer der Liegenschaft. Die Mieter*innen aber kurzfristig aus den Wohnungen zu werfen dürfte ohne staatliche Intervention eher schwierig sein. Der Kanton Aargau wird ja wohl auch eine Schlichtungsstelle / Schlichtungsbehörde für das Mietwesen haben.
Zu denken geben sollte uns das Schweigen von SVP-Landammann Jean-Pierre Gallati, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales im Kanton Aargau. Ob das mit der offiziell angekündigten Wahlkampfstrategie für die National- und Ständeratswahlen im Herbst 2023 der SVP zusammenhängt, sei dahingestellt. Richtig ist, dass die SVP im Wahlkampf die Schweizer Asyl- und Flüchtlingspolitik als Hauptthema bewirtschaften wird. As usual.
Gefährlich ist die Geschichte um die gekündigten Wohnungen in Windisch aber auch für die Stimmung in der Schweiz bezüglich Flüchtlingen allgemein, aber speziell bezüglich der ukrainischen Schutzsuchenden in unserem Land. Die Zustimmungsrate der Schweizer Bevölkerung für die Aufnahme der kriegsgeschundenen Menschen aus der Ukraine sinkt jetzt schon dramatisch. Mit solchen Geschichten, wie sie derzeit aus Windisch – und auch aus anderen Schweizer Ortschaften – in den Medien die Runde machen, kann die Stimmung sehr schnell ins Bodenlose kippen.
Aber vielleicht ist ja genau dies von der SVP und ihrem Statthalter Gallati im Kanton Aargau beabsichtigt. Bei Gallati würde es einen eher erstaunen, hat doch der SVP-Regierungsrat während der Corona-Pandemie trotz heftigem Gegenwind aus der Partei und deren Unterabteilungen der Trychler und sonstigen Esoterikern*innen so ziemlich alles richtig gemacht. Dem Aargauer SVP-Präsident Andres Glarner jedoch, den man laut Gerichtsentscheid einen Dummschwätzer (und mehr) nennen darf, wäre es durchaus zuzutrauen. Denn dumme Männer – als dummen Mann darf man laut Gerichtsentscheid Glarner ebenfalls bezeichnen – machen dumme Sachen. Das wusste schon Forrest Gump.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Yi Fuxian: Das chinesische Jahrhundert ist vorbei
Die Alterung der Bevölkerung wird für Chinas Volkswirtschaft dauerhaft zur Belastung. Mit der derzeitigen Politik ist der Niedergang nicht zu stoppen. Die geopolitischen Folgen sind jetzt schon absehbar.
Die Kluft zwischen Chinas schwindender physischer Stärke und seinen Ambitionen führt zu strategischen Fehleinschätzungen, sagt Yi Fuxian, Wissenschafter an der University of Wisconsin-Madison. In seinem Gastkommentar sieht er Parallelen zu Russland.
Im Jänner hat China offiziell bestätigt, dass seine Bevölkerungszahl seit dem vergangenen Jahr zurückgeht – rund neun Jahre früher, als chinesische Demografen und die Vereinten Nationen prognostiziert haben. Die Folgen sind kaum zu überschätzen: Es bedeutet, dass Chinas gesamte Wirtschafts-, Außen- und Verteidigungspolitik auf fehlerhaften Bevölkerungsdaten beruht.
So hatten Ökonomen der chinesischen Regierung prognostiziert, dass Chinas Pro-Kopf-BIP 2049 die Hälfte oder sogar drei Viertel des Pro-Kopf-BIP der USA erreichen würde, während sein gesamtes Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis dahin auf das Doppelte oder sogar Dreifache des US-BIP steigen würde. Doch ging man davon aus, dass die Bevölkerung Chinas 2049 viermal so groß sein würde wie die der USA. Die wahren Zahlen erzählen eine deutlich andere Geschichte. Angenommen, es glückt China, seine Geburtenrate bei 1,1 Kindern pro Frau zu stabilisieren, wird seine Bevölkerung 2049 lediglich 2,9-mal so groß sein wie die der USA, und all seine Kennzahlen demografischer und wirtschaftlicher Vitalität werden deutlich schlechter ausfallen.
Diese fehlerhaften Prognosen betreffen nicht allein China. Sie legen einen geopolitischen Schmetterlingseffekt nahe, der letztlich die bestehende Weltordnung zerstören könnte. Chinas Behörden handeln bisher im Einklang mit ihrer langjährigen Annahme eines im Aufstieg begriffenen Ostens und eines im Abstieg begriffenen Westens.
Der russische Präsident Wladimir Putin glaubte in ähnlicher Weise, dass, solange Russland stabile Beziehungen zu einem aufsteigenden China unterhielte, der im Abstieg begriffene Westen unfähig sein würde, ihn für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Und mit ihrem hastigen Rückzug aus Afghanistan mit dem Ziel, ihre Ressourcen auf China zu konzentrieren, haben die USA Putin womöglich unbeabsichtigt hierin bestärkt.
China hinter Indien
Die Bevölkerungsalterung wird für die chinesische Volkswirtschaft eine dauerhafte Belastung darstellen. Schließlich weist, wie die Erfahrung Italiens zeigt, der Altersabhängigkeitsquotient (die Zahl der über 64-Jährigen, geteilt durch die Zahl derjenigen zwischen 15 und 64) eine starke negative Korrelation mit dem BIP-Wachstum auf, und Gleiches gilt für das Medianalter und den Anteil der über 64-Jährigen.
Im Jahr 1980 lag das Medianalter in China bei 21 Jahren; das waren acht Jahre weniger als in den USA. Und zwischen 1979 und 2011 wuchs Chinas BIP mit einer jährlichen Durchschnittsrate von zehn Prozent. Im Jahr 2012 jedoch begann Chinas Erwerbsbevölkerung im Alter zwischen 15 und 59 zu schrumpfen, und 2015 war das BIP-Wachstum auf sieben Prozent zurückgegangen. Seitdem ist es weiter auf drei (2022) gesunken.
Durchschnittlich 23,4 Millionen Geburten pro Jahr zwischen 1962 und 1990 hatten China zur "Fabrik der Welt" gemacht. Doch selbst laut Chinas eigenen, übertrieben hohen offiziellen Zahlen gab es in China im vergangenen Jahr lediglich 9,56 Millionen Geburten. Infolgedessen wird die chinesische Industrieproduktion weiter sinken, was zu verstärktem Inflationsdruck in den USA und anderswo führen wird.
Während Chinas Bevölkerung 1975 1,5-mal so groß war wie die Indiens, zeigen selbst die übertrieben hohen offiziellen Zahlen der chinesischen Regierung, dass sie im vergangenen Jahr kleiner war (1,41 Milliarden im Vergleich zu 1,42 Milliarden). In Wahrheit ist Indien bevölkerungsmäßig schon vor einem Jahrzehnt an China vorbeigezogen, und wenn sich die bisherige Entwicklung fortsetzt, wird Indiens Bevölkerung 2050 fast 1,5-mal so groß sein wie die Chinas. Das Medianalter wird in Indien dann bei 39 liegen; das ist eine volle Generation jünger als in China (57).
Natürlich investiert China stark in künstliche Intelligenz und Robotik, um den durch die Bevölkerungsalterung bedingten wirtschaftlichen Abschwung auszugleichen. Doch lässt sich mit derartigen Bemühungen nur bedingt viel erreichen, weil es zur Fortsetzung der Innovation junger Gehirne bedarf. Zudem konsumieren Arbeitsroboter nicht, und der Konsum ist die Hauptantriebskraft jeder Volkswirtschaft.
Langsamer Niedergang
Chinas Niedergang wird allmählich verlaufen. Es wird noch auf Jahrzehnte hinaus die zweit- oder drittgrößte Volkswirtschaft bleiben. Doch die enorme Kluft zwischen seiner schwindenden demografischen und wirtschaftlichen Stärke und seinen wachsenden politischen Ambitionen könnte es hochgradig anfällig für strategische Fehleinschätzungen machen. Erinnerungen an vergangene Ruhmeszeiten oder die Furcht vor Statusverlusten könnten es denselben gefährlichen Pfad hinab führen, den Russland in der Ukraine verfolgt.
Die chinesische Führung sollte daher die Lehren aus Russlands Invasion beherzigen und aus ihrem unrealistischen "Chinesischen Traum" nationaler Verjüngung erwachen. Der gegenwärtige politische Ansatz der Regierung ist ein Rezept für den demografischen und zivilisatorischen Zusammenbruch.
Auch die USA haben angesichts ihres erkennbaren Versagens im Umgang mit dem im Niedergang befindlichen Russland einiges zu lernen. Die USA und ihre Verbündeten – darunter Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, die Europäische Union, Japan und Südkorea – werden es ebenfalls mit einer gesellschaftlichen Alterung und daraus herrührenden Wirtschaftsabschwüngen zu tun bekommen. Ihr gemeinsamer Anteil an der Weltwirtschaft ist bereits von 77 Prozent (2002) auf 56 Prozent (2021) gesunken, und dieser Trend wird sich fortsetzen.
Die geopolitischen Folgen sollten offensichtlich sein. Wenn die bedeutenden Mächte klug sind, werden sie guten Glaubens zusammenarbeiten, um eine bleibende Weltordnung zu schmieden, bevor es ihnen dazu an Macht fehlt. Schreibt Yi Fuxian, Forscher für Geburtshilfe und Gynäkologie an der University of Wisconsin-Madison in DER STANDARD.
27.2.2023 - Tag der Gynäkologen die Weltpolitik schreiben
Das haben die «Ni Haos» nun davon, dass sie den Planet Erde mit ihren realistischen Liebespuppen aus Silikon in menschlicher Originalgrösse inklusive mittels Knopfdruck abrufbahrem Gestöhne fluten. Die Love Dolls sollen ja vor allem in Asien, speziell in China, der Verkaufsschlager schlechthin sein. Auch wenn die Silikon-Dolls noch so realistisch daher stöhnen, Kinder kriegen sie nun mal nicht.
Spass beiseite: Was der Gynäkologie-Forscher Yi Fuxian in seinem Bericht an die Wand malt, ist nichts als Unsinn. Wären seine Thesen ernst zu nehmen, müsste beispielsweise Japan mit seiner überalterten Gesellschaft längst kollabiert sein. Dass solch ein schwachsinniger Artikel sogar von der NZZ übernommen wird, sagt einiges über den «Qualitäts-Journalismus» des einstigen Flaggschiffs der Schweizer Medienlandschaft aus.
Kein Wort davon, dass China derzeit eine Jugendarbeitslosigkeit von beinahe 20 Prozent in der staatlichen Arbeitslosenstatistik aufführt. Das sollte Herr Fuxian mal auf die Gesamtbevölkerung der Jugendlichen Chinas hochrechnen. Da käme wohl selbst der Gynäkologe auf ein paar Millionen fehlende Jobs im Land des Lächelns. Die zaubert auch Xi Jinping nicht aus dem Ärmel. Nichts ist für die Machterhaltung von Diktaturen so gefährlich, wie Demonstrierende ohne Arbeit.
Kommt noch hinzu, dass eine Diktatur, die das Ein-Kind-Gesetzt problemlos durchsetzen konnte, auch ein Drei- oder Vier-Kinder-Gesetz mühelos der chinesischen Gesellschaft befehlen könnte. Womit das Problem langfristig, so es überhaupt eines darstellen würde, gelöst wäre.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Krieg um die Zukunft der Demokratie
Als Kampf um die Demokratie hat US-Präsident Joe Biden den Ukrainekrieg in seiner Rede in Warschau definiert und selbstbewusst erklärt, durch die russische Aggression seien "die Demokratien der Welt stärker, nicht schwächer geworden".
Das mag für den inneren Zusammenhalt des westlichen Bündnisses stimmen, aber leider nicht für die globale Bilanz. Im vergangenen Jahrzehnt hat das Prinzip der liberalen Demokratie mit politischem Pluralismus, Meinungsfreiheit und einem friedlichen Machtwechsel auf allen Kontinenten an Boden verloren. Liberale Demokratien sind illiberal geworden, und illiberale Demokratien haben sich in offene Autokratien verwandelt. Und das gilt nicht nur für Wladimir Putins Russland selbst.
Wo Demokratie an Boden verliert
Vom Arabischen Frühling ist seit dem Abgleiten Tunesiens in eine Präsidialdiktatur nichts übrig geblieben, in Mexiko zerstört ein linkspopulistischer Staatschef die demokratischen Kontrollinstitutionen, in Indien wird der traditionelle Pluralismus immer mehr von einem autoritären Hindu-Nationalismus verdrängt, und selbst in Israel sind demokratische Normen durch eine extrem rechte Regierung unter Beschuss.
Der einzige Lichtblick in jüngster Zeit war der hauchdünne Wahlsieg des Sozialdemokraten Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien; der vielleicht wichtigste Test in den kommenden Monaten, ob der Volkswille unpopuläre Autokraten von der Macht verdrängen kann, sind die Wahlen in der Türkei.
Wer Russland nicht verurteilt
Die Schwächung demokratischer Normen hat auch Einfluss auf die Positionierung der Staaten im russisch-ukrainischen Krieg. Zwar hat eine große Mehrheit in der UN-Vollversammlung den russischen Angriff verurteilt, aber zwei Drittel der Menschheit leben in Staaten, die dagegen gestimmt oder sich enthalten haben – und damit die russische Aggression billigen und in vielen Fällen davon profitieren. Das lässt sich zum Teil mit der postkolonialen Skepsis im Globalen Süden gegenüber allem erklären, was nach westlicher Moral und Scheinheiligkeit klingt, aber nicht nur.
Die Gleichgültigkeit, mit der der militärische Überfall eines paranoiden Diktators auf ein demokratisches Nachbarland aufgenommen wird, zeugt davon, wie fragil die Unterstützung für Werte wie Pressefreiheit, Trennung von Religion und Staat oder Respekt für Minderheitenrechte in so vielen Staaten ist; selbst der Bruch der territorialen Unversehrtheit von Staaten – ein Grundprinzip der UN-Charta – wird mit Achselzucken hingenommen. Dass Brasilien beim Wechsel von Jair Bolsonaro zu Lula auch die Position zum Krieg gewechselt und Russland nun verurteilt hat, ist kein Zufall.
Die Verbindung von Innen- und Außenpolitik lässt sich auch bei den Verbündeten der Ukraine im Westen beobachten: Die Putin-Versteher findet man vor allem in jenen Parteien und Bewegungen, die sich auch sonst um demokratische Normen nicht scheren.
Unterschied zwischen Kiew und Moskau
An der Politik der Ukraine gab es immer viel zu kritisieren, aber noch selten war der Unterschied zwischen Demokratie und Tyrannei so deutlich zu sehen wie heute zwischen Kiew und Moskau, zwischen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin. Dass das außerhalb der westlichen Welt so wenig wahrgenommen wird, ist ernüchternd.
Ob eine klare Niederlage Russlands in diesem furchtbaren Krieg der Demokratie außerhalb Europas einen frischen Aufwind geben wird, ist unsicher. Aber ein Sieg für Putin wäre jedenfalls eine Ernüchterung für demokratische Bewegungen in aller Welt und ein Signal an autoritäre Politiker, dass im 21. Jahrhundert Macht doch stärker ist als Recht. Und das darf nicht geschehen. Schreibt Eric Frey in DER STANDARD.
26.2.2023 - Tag der Krise westlicher Demokratien
Eine ebenso erschreckende wie auch ernüchternde Momentaufnahme und Analyse des österreichischen Publizisten und Politologen Eric Frey. Die Frage, ob Macht stärker ist als Recht wird durch die westlichen Demokratien selbst beantwortet. Nun rächt sich die Nonchalance im Umgang mit der industriellen Macht über Jahrzehnte hinweg.
In seiner TV-Abschiedsrede wandte sich Dwight D. Eisenhower 1961 an das US-amerikanische Volk und sprach eine eindringliche Warnung aus. Eisenhower hatte Angst vor einer alles durchdringenden Macht: dem militärisch-industriellen Komplex, dem sogenannten Deep State.
Doch Eisenhowers Warnung wurde vom Winde verweht und der Deep State der westlichen Führungsmacht und Vorzeigedemokratie wurde ins Unermessliche gesteigert. Inzwischen beherrschen industrielle Giganten die Politik nicht nur in den USA, sondern rund um den Erdball. Rohstoffgiganten sind inzwischen selbst in der Schweizer Stadt Zug – um nur ein Beispiel zu nennen – mächtiger als jedes Parlament. Ohne die führenden Tech-Riesen aus Amerika läuft in Europa kein einziger Computer mehr und ohne Chinas Billigproduktion wird es sogar schwierig, ein Elektrovelo zu kaufen. Und dies sogar in Amerika.
Kein Land kann heutzutage ohne Industrie existieren. Doch wenn die Macht der westlichen «Oligarchen» stärker ist als das Recht, werden die Demokratien und damit die Parlamente je länger je mehr zu Handlangern degradiert. Die Korruption in den Parlamenten nimmt schwindelerregende Züge an. Politikverdrossenheit ebenso. «Die da oben machen sowieso was sie wollen» ist inzwischen als geflügeltes Wort in aller Munde.
Vorbei die Zeiten, als 1911 Rockefellers «Standard Oil» von der Regierung unter Präsident Roosevelt zerschlagen wurde, weil Standard Oil wegen seiner Monopolstellung und dem politischen Einfluss zu mächtig geworden war. 112 Jahre später veröffentlichte das investigative Journalisten-Portal «ProPublica» anonym zugespielte Daten der staatlichen US-Finanzbehörde IRS. Bei Amazon-Gründer Jeff Bezos sieht das so aus: 4,2 Milliarden Dollar Einkommen, 973 Millionen Dollar Steuern gezahlt, zeitgleich wuchs der Vermögensstand des Amazon-Gründers in vier Jahren um rund 100 Milliarden Dollar – echte Steuerquote 0,98 Prozent.
Um Steuerquoten hinter dem Komma zu erreichen, braucht es Steuertricks, die ohne Billigung der Politik niemals und nirgendwo zu erreichen sind. Wenn selbst der Börsenmogul Warren Buffett gegenüber den Rechercheuren von ProPublica eine grundlegende Reform der Steuergesetze – und einer höheren Besteuerung von Menschen seinesgleichen – ernsthaft fordert, wird klar, weshalb die Demokratien rund um den Erdball um ihre Zukunft fürchten müssen.
Dass die autokratischen Regierungen um keinen Deut besser sind und sich die Lebensqualität unter ihren Bevölkerungen langfristig sogar verschlechtert, macht die Krise der westlichen Demokratien auch nicht besser.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
China will auch in Europa politisch mitspielen. Das ist besorgniserregend
Vor drei Jahren noch fühlte sich für die meisten von uns Geschichte an wie eben Geschichte: vergangen. Spätestens seit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine ist aber allen klar: Die Welt, wie wir sie kennen, verändert sich rasant. Auch weltpolitisch.
Wir sind Zeuginnen und Zeugen einer Zeit, in der die weltpolitischen Karten auch auf dem Schlachtfeld neu gemischt werden. Wie nach dem Fall der Berliner Mauer, nach den beiden Weltkriegen, nach der Revolution 1848. Die Liste lässt sich lange fortsetzen. Die Erkenntnis: Nichts währt ewig.
Wie umfangreich die Umwälzungen letztlich werden, ist aktuell noch nicht abzusehen. Ein Jahr nach der russischen Invasion in der gesamten Ukraine ist aber klar, dass auf diesem Territorium eine neue weltpolitische Machtverteilung ausgespielt wird. Und Europa muss aufpassen, dabei nicht zum Statisten zu verkommen.
Chinesischer Friedensplan
Der chinesische Friedensplan, den Peking nun auf den Tisch gelegt hat, ist nur ein Symptom dafür. Nicht nur die USA oder Europa haben den Anspruch, in internationalen Konflikten die Regeln festzulegen. Auch die Türkei und jetzt eben China versuchen sich als Player und kämpfen mittlerweile um ihren Platz in der ersten Reihe. Und das längst nicht nur mehr auf wirtschaftlichem Terrain.
Offiziell wollen sie eine "multipolare Weltordnung", eigentlich geht es ihnen aber darum, selbst vermehrt mitzumischen. Chinas Position gegenüber Russland ist von genau diesen Interessen geprägt. Deswegen hat die Staatsführung in Peking die russische Invasion in der Ukraine nie verurteilt. Auch bei der aktuellen Abstimmung in der Uno-Vollversammlung hat sich China strategisch enthalten. Gleichzeitig verlangt Peking in seinem am Freitag vorgelegten "Friedensplan" die Aufrechterhaltung der "Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität aller Länder". Eine Formulierung, die China als Vermittler empfehlen soll.
Dabei ist die aufstrebende Großmacht ein recht zweifelhafter Vermittler. Zwar beliefert Peking Moskau – noch – nicht direkt mit Kriegsgerät, aber es verhindert auch nicht, dass Nordkorea die Russen militärisch ausstattet. China als Nordkoreas Schutzmacht wird sogar unterstellt, selbst Absender der Lieferungen zu sein. Zugeben würde Peking das natürlich nie und nimmer.
Gleiches gilt für den Iran, der Russland mit Experten, Drohnen und ballistischen Raketen beliefert. Auch Teheran ist – geschwächt durch westliche Sanktionen – von China abhängig. Eine Neubelebung des Wiener Atomabkommens, mit der Sanktionslockerungen einhergehen könnten, liegt auf Eis. Dem Iran mit seinem wachsenden Atomprogramm bleibt nichts anderes als die Oststrategie.
Aufstieg zur Großmacht
Dass sich China auf dem Weg zu einer zentralen Großmacht des 21. Jahrhunderts befindet, ist keine neue Erkenntnis. Dass es durch eine zentrale Rolle im Ukrainekrieg aber auch erstmals politisch – nicht nur wirtschaftlich – in Europa mitbestimmen könnte, ist besorgniserregend. Europa bleibt nichts anderes übrig, als sich weiter nachhaltig aufzurüsten, um seinen Interessen auch machtpolitischen Nachdruck zu verleihen.
Napoleon soll gesagt haben: "China ist ein schlafender Löwe, lasst ihn schlafen! Wenn er aufwacht, verrückt er die Welt." China ist längst aufgewacht und sieht die Erfüllung seines Traums, an frühere ruhmreiche Zeiten anzuknüpfen, durch den Krieg in der Ukraine beschleunigt. Schreibt DER STANDARD.
25.2.2023 - Tag der asymetrischen Schere zwischen Reich und Arm
Im Jahr 2023 Napoleon mit einem (nicht verifizierbaren) Zitat zu erwähnen, zeugt nicht unbedingt von Qualitäts-Journalismus. Da wäre der ehemalige deutsche Bundeskanzler Adenauer die bessere Adresse gewesen, gehörte doch das Warnen vor der «Gelben Gefahr» zu seiner Lieblingsrhetorik.
Dass auch einer Weltmachtordnung chinesischer Prägung Grenzen gesetzt sind, wird nicht erwähnt. Doch die gibt es. Sogar in Asien: Man denke nur an die Atommacht Indien, die einer Weltherrschaft Chinas wohl kaum tatenlos zustimmen wird.
Auch Europa wird noch lernen mit dem oder den fernöstlichen Drachen umzugehen. Irgendwann werden die europäischen Staatenlenker begreifen, dass die in der Corona-Pandemie gemachten, vollmundigen Versprechen, (systemrelevante) Industrien aus China in die europäischen Gefilde zurückzuholen, umgesetzt werden müssen. Egal, was die superreichen Tycoons, die inzwischen auch die demokratische Politik rund um den Erdball steuern, dazu sagen. Kaiser, Könige und sonstige Fürsten wurden noch nie um ihre Erlaubnis gefragt, wenn sie von ihrem Thron gestossen wurden. Dazu liesse sich jetzt Napoleon zutreffend mit einem verifizierten Zitat erwähnen: «Ein Thron ist nur ein mit Samt garniertes Brett.»
Der Nährstoff für wirkliche Revolutionen entsteht immer aus der Asymmetrie der Schere zwischen Arm und Reich. Ist der Druck zu hoch, explodiert jeder Dampfkessel. Reissen erst mal die sozialen Auffangnetze, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Was danach kommt, steht allerdings bei jeder Revolution in den Sternen. Vom Regen in die Traufe ist nur ein kleiner Schritt. Treffend beschrieben in George Orwells Buch «Animal Farm».
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Bill Gates steigt mit 900 Millionen Euro bei Heineken-Brauerei ein
Er sagt zwar von sich selbst, er sei »kein großer Biertrinker« – aber dafür ist er nun Bierinvestor. Microsoft-Gründer Bill Gates steckt 900 Millionen Euro in die Heineken-Brauerei. Warum er das tut, bleibt unklar.
Eigentlich setzt sich der US-Milliardär Bill Gates unter anderem für ein gesünderes Leben ein, für Fortschritte in der Medizin. Insofern wirft sein neuestes Investment Fragen auf: Gates hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Anteil an der niederländischen Großbrauerei Heineken gekauft.
Gates steckt demnach rund 883 Millionen Euro in den Kauf von 10,8 Millionen Heineken-Aktien. Damit wird er zukünftig einen Anteil von 3,76 Prozent an dem Konzern halten. Der Microsoft-Gründer kaufte die Anteile der mexikanischen Brauerei Femsa ab, die sich als Heineken-Investorin zurückzog.
Kein großer Biertrinker
Welche Pläne Gates mit der Neuerwerbung hat, ist bislang unklar. Als Bierfan war der Milliardär bislang eher nicht aufgefallen. So zitiert das Portal »Business Insider« aus einer Onlinediskussion zwischen Gates und Nutzern der Plattform Reddit. Auf die Frage, was sein Lieblingsbier sei, antwortete Gates dort 2018: »Ich bin kein großer Biertrinker.« Er greife nur ab und an bei Baseballspielen zu einem Light-Bier, »um mit den anderen Biertrinkern mitzuhalten«.
Bemerkenswert auch: Im vergangenen Jahr hatte die Bill & Melinda Gates Stiftung eine Studie finanziert, in der es um die Gesundheitsrisiken von Alkoholkonsum ging. Die Stiftung wird von Gates und seiner Ex-Frau Melinda French Gates finanziert. Die Studie kam laut »Business Insider« zu dem Schluss, öffentliche Stellen müssten stärker eingreifen, um die erheblichen Gesundheitsschäden gerade bei jüngeren Menschen zu verringern, die durch Alkohol verursacht würden. Gates und seine Stiftung reagierten laut der Nachrichtenagentur Reuters und »Business Insider« zunächst nicht auf Anfragen zu dem Thema.
Gates gilt noch immer als einer der reichsten Menschen des Planeten. Die Nachrichtenagentur »Bloomberg« taxierte sein Vermögen zuletzt auf 116 Milliarden Dollar. Schreibt DER SPIEGEL.
24.2.2023 - Tag des Resettings der Menschheit durch Bill Gates und Heineken-Bier
Ein Hinweis vorweg: Lesen Sie diese Kolumne trotz ihrer Länge durch bis zum letzten Wort. Die Welt wird für Sie ab heute eine andere sein!
Unter Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches Denken und Verhalten. Als Motiv wird manchmal eine die gesamte Menschheit umfassende Liebe genannt, die «allgemeine Menschenliebe». Materiell äussert sich diese Einstellung in der Förderung Unterstützungsbedürftiger, die nicht zum engsten Kreis der Philanthropen zählen, oder von Einrichtungen, die dem Gemeinwohl dienen. Das Bild der Philanthropie prägen vor allem in grossem Stil durchgeführte Aktionen sehr reicher Personen. Schreibt Wikipedia.
Bill Gates, noch immer einer der reichsten Menschen auf diesem unserem Erdballon und Gründer von Microsoft, wird als einer dieser Philanthropen bezeichnet. Gates pendelt somit zwischen der Philosophie und den Tropen hin und her. So besitzt Bill Gates unter vielen anderen Liegenschaften auch ein 120-Millionen-Dollar Haus direkt am Strand in der Küstenstadt Del Mar nördlich von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Kalifornien wird zwar gemeinhin nicht den Tropen zugeordnet, die meteorologischen Verhältnisse Kaliforniens hingegen schon. Womit der Ritterschlag des Schulabbrechers Bill Gates zum Philanthrop auch ohne Villa auf einer Insel in der Karibik trotzdem und absolut gerechtfertigt ist.
Philanthropen sind dafür bekannt, im Sinne einer Reorganisation der Mutter Theresa-Saga mit ihren Stiftungen ausschliesslich Gutes für das Gemeinwohl der Mühseligen und Beladenen zu tun. Immer vorausgesetzt, es, das Gute, dient auch ihrem Ego, der totalen Steuerverhinderung und damit in erster Linie dem eigenen Bankkonto.
Dass der Philanthrop Bill Gates nun mit fast einer Milliarde Dollares beim zweitgrössten Bierbrauereikonzern der Welt einsteigt, lässt unsere ansonsten allwissenden Journalisten, Experten und sonstigen Medien-Trolle ratlos zurück. Niemand kann dieses Investment von Bill Gates erklären. Nicht einmal Mike Shivas Nachfolger Roger Köppel-Schlumpf.
Falsch! Einer kann es. Der Kolumnist, Philosoph, Resett-Experte und Hysteriker vom Artillerie-Verein Zofingen. Dies aber auch nur dank seinen exzellenten Beziehungen zur Nomenklatura der Innerschweizer Esoterik-Szene, die – wie könnte es anders sein? – von der Schweizer SVP, der Krienser SVP-Nationalrätin Yvette «die Nette» Estermann aus Bratislava, deren Doktortitel ihr schändlicherweise aberkannt wurde, und ihrem Ehemann und Buchautor Dr. Richard F. Estermann, dominiert wird. Sowie einigen ausgemusterten Schullehrerinnen und sonstigen Schrumpfhauben aus der Zentralschweiz.
Dr. Richard F. Estermann hat sein kürzlich erschienenes Buch «Glück ist kein Zufall – Der sichere Weg zu Glück und Erfolg!» per E-Mail auch bei meiner Wenigkeit mit einem Zitat von Dr. med. Alex Frei, Vizepräsident des Vereins «Ärzte gegen Organspenden» beworben: «Den Spendern werden die Organe bei lebendigem Leib aus dem Körper geschnitten!».
Unglaublich! Haben Sie das gewusst? Nein, Sie haben es nicht gewusst. Wie gut, dass es Dr. Estermann und die Esoterik gibt, die uns den sicheren Weg zu Glück und Erfolg weisen! Seien Sie also in Zukunft vorsichtig, wenn sie in der dunklen Nacht in einer Zofinger Altstadtgasse plötzlich einem Arzt mit Sackmesser begegnen. Das ist in etwa genau so lebensgefährlich wie einem Muslim mit Messer über den Weg zu laufen. Dass die SVP demnächst eine Volksabstimmung «Generelles Messerverbot für Muslime und Ärzte» lancieren wird, ist allerdings (noch) ein Gerücht.
Doch kommen wir endlich zum Nukleus des heutigen Themas. Dank diesen gut informierten Kreisen aus meinem Umfeld kann ich Ihnen als Einziger worldwide life den tatsächlichen Grund für das Milliardeninvestment (na ja, 900 Millionen Euro sind ja fast eine Milliarde; tönt einfach besser!) von Bill Gates bei Heineken verraten. Halten Sie sich fest:
Ab sofort ist jedem Heineken-Bier ein Mikro-Chip beigemixt, der das von Gates und dem WEF-Gründer Klaus Schwab betriebene «Great Resett» der Menschheit beschleunigt. Was lernen Sie aus meinem schockierenden Enthüllungsbericht? Ab sofort müssen Sie um Heineken-Bier einen ebenso grossen Bogen machen wie um die Corona-Impfung. Wollen Sie nicht resettet werden, trinken Sie auf gar keinen Fall ein Heineken-Bier!
Auch das feine Eichhof-Bier aus Luzern ist ab sofort ein absolutes No Go! Die Eichhof-Brauerei gehört nämlich auch Heineken. Wie so viele andere Brauereien. Bevor Sie überhaupt ein Bier trinken, sollten Sie sich ab sofort stets vergewissern, wem die Brauerei gehört.
Oder noch besser: Sie steigen auf den feinsten Schweizer (!) Whisky «Seven Seals Single Malt Whisky» um. Produziert im Emmental bei Langatun Distillery AG. Garantiert frei von Esoterik und Resett-Chips. Dafür Rock 'n Roll pur!
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Ausrüstung immer schlechter: Mit dieser Rost-Munition müssen Putins Soldaten kämpfen
Dass die Ausrüstung der Russen nicht gerade die Beste ist, wird schon länger vermutet. Nun sind Bilder aufgetaucht, die zeigen sollen, dass Putins Soldaten mit verrosteter Munition kämpfen müssen.
Sie schimmert braun-rötlich. Dass die rostige Masse, die sich in einem Behälter der russischen Armee befindet, mal Munition gewesen ist, ist schwer zu erkennen. Und damit sollen Putins Soldaten den Krieg gegen die Ukraine gewinnen?
Bilder, die am Mittwoch in den sozialen Medien aufgetaucht sind, zeigen, dass die russischen Kämpfer in der Ukraine offenbar nur noch rostige Munition geliefert bekommen.
More Information
Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange (47) meint, dass sich der Munitionsmangel schon seit längerer Zeit andeutete. «Zunächst war die Munition für die Ausbildung knapp. Russische Artilleristen mussten an die Front, ohne dass sie vorher einen Schuss abgefeuert hatten», schreibt er auf Twitter. Jetzt sei die Munitionsknappheit auf der russischen Seite auch an der Front zu spüren. Darum werde offenbar nun der letzte Rest zusammengekratzt.
Wagner-Chef wütend wegen Munition
Moskau hat sich bislang nicht zu dem Munitionsmangel geäussert. Dass die Aufnahmen tatsächlich russische Munition zeigen, ist nicht bestätigt. Was allerdings auffällig ist: In den letzten Tagen beklagte sich der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner seine Kämpfer würden keine Munition geliefert bekommen. «Die Kacke dampft, und Blut wird vergossen – aber sie liefern keine Munition», beschwerte sich Jewgeni Prigoschin (61). Und das habe üble Folgen für die Soldaten an der Front.
«Im Moment sterben doppelt so viele Menschen, wie sterben müssen», so Prigoschin weiter. Bei den Anschuldigungen kann es sich aber auch um einen Trick des Söldnerführers handeln. Seit Monaten kritisiert er die russische Militärführung. Er erhöht so den Druck auf Verteidigungsminister Sergei Schoigu (67). Prigoschins Ziel ist laut den US-Militärexperten vom Institute for the Study of War: Er möchte ein unabhängiges Waffensystem für seine Truppen.
In einem Punkt war Prigoschins Gemecker auf jeden Fall erfolgreich. Am Donnerstag er: «Heute um 6 Uhr morgens wurde bekannt gegeben, dass die Lieferung von Munition begonnen hat.» Wie es mit den konventionellen russischen Kämpfern aussieht, ist unklar.
Rekruten müssen Ausrüstung selbst kaufen
Berichte über die mangelhafte Ausrüstung von Putins Armee gibt es seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Im Oktober 2022 schimpften einige Soldaten bereits über mangelnde Verpflegung und die «absolut unmenschlichen Bedingungen».
Doch damit nicht genug: Die mobilisierten Rekruten erhalten offenbar uralte Ausrüstung – wenn überhaupt. «Das ist kein schönes Bild, wenn unsere mobilisierten Bürger Helme aus dem Jahr 1941 erhalten und einen Tornister aus der gleichen Ära. Das zeichnet ein unangemessenes Bild», kritisierte etwa der Militärexperte Michail Chodarjonok (68) in einer Talk-Show im russischen TV.
Putins Soldaten müssen sich ihre Ausrüstung teilweise selbst kaufen. Das Problem: Militärische Ausrüstung ist grösstenteils ausverkauft. Und die Preise sind wegen der hohen Nachfrage enorm angestiegen. Schreibt BLICK.
23.2.2023 - Tag der verrosteten Munition die trotzdem tötet
Häme ist hier falsch am Platz. Auch angeblich (die Bilder sind ja nicht verifiziert) verrostete Munition trifft ihre Ziele, tötet Menschen und macht unzählige zivile Bauten in der Ukraine dem Erdboden gleich.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Was die FPÖ immer wieder auferstehen lässt
Beim politischen Aschermittwoch am Mittwochabend darf sich FPÖ-Chef Kickl von wachsender Euphorie tragen lassen. Was hat die Blauen so rasch wieder so stark gemacht?
Weißwurst und Speck sind tabu, doch für Fischaufstriche und Salzstangerl ist gesorgt: Wenn sich am Mittwochabend 2.000 Menschen in der ortseigenen Jahnturnhalle drängen, halten sich die Zugeständnisse an die angebrochene Fastenzeit in Grenzen. Denn Bier zum Runterspülen darf natürlich nicht fehlen – und statt Buße zu tun, wie es die kirchlichen Gebote vorschreiben, werden die Stargäste auf der Bühne ordentlich austeilen.
Warum soll sich eine Partei mit deutschnationalen Wurzeln auch an katholische Bräuche halten? Die FPÖ ist stolz auf ihre eigene Tradition, die sie seit 1992 mit nur zwei der Corona-Pandemie geschuldeten Unterbrechungen in ihrer Hochburg im Westen Oberösterreichs auslebt: Nach Vorbild der bayerischen CSU im nahen Passau laden die blauen Vertreter aus Ried im Innkreis am Tag eins nach Faschingsende zum "politischen Aschermittwoch".
So manches, was die Wortführer vor johlender Menge abladen, sorgt für Aufsehen über die Bezirksgrenzen hinaus. Jörg Haider etwa setzte sich hier einmal mehr dem Vorwurf des Antisemitismus aus. "Ich verstehe überhaupt nicht", sprach der mittlerweile verstorbene Ex-FPÖ-Frontmann 2001 über Ariel Muzicant, den damaligen Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, "wie einer, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben kann."
Heute tritt einer vor die Anhänger, der den einstigen Chefs für derartige Auftritte Gags geschrieben hat. An Zugkraft stehe Herbert Kickl den Vorgängern kein bisschen nach, versichert Bezirksfunktionär Erhard Weinziger, Organisator seit der ersten Stunde. Das G'riss um die begrenzte Zahl der Tickets sei trotz Unkostenbeitrags von 15 Euro so groß gewesen "wie in den besten Zeiten von Haider und Strache".
Nicht lange zu Boden gelegen
Das liegt am aktuellen Höhenflug. Beeindruckend oder – je nach Leseart – erschreckend rasch hat sich die FPÖ von ihrem keine vier Jahre zurückliegenden Crash erholt. Am Boden war die Partei gelegen, nachdem sie im Zuge des Ibiza-Skandals aus der Regierung geflogen war. Bei der Wiener Landtagswahl im Oktober 2020 bekamen die Blauen mit einem Absturz von fast 24 auf sieben Prozent noch eine bittere Rechnung präsentiert – doch beim Urnengang in Niederösterreich Ende Jänner dieses Jahres landeten sie schon wieder beim Wiener Wert von einst. In den bundesweiten Umfragen rangiert die FPÖ mit 27 bis 29 Prozent in der Pole-Position.
Die Geschichte wiederholt sich. Schon in den 2000er-Jahren hatte sich die FPÖ, damals unter einem irrlichternden Haider, selbst ins Aus geschossen – um später unter Heinz-Christian Strache in alter Stärke wiederzukehren. Was lässt die Rechtspartei aus scheinbar aussichtsloser Lage immer wieder auferstehen?
Versprechen für Verlierer
Menschen, die sich von Mächtigen – oder jenen, die sie dafür halten – ungehört, ausgeschlossen, übergangen fühlen: Auf dieses Reservoir kann die FPÖ, solange sie in Opposition bleibt, bauen. Nicht zufällig fiel der Aufstieg unter Haider in den Achtziger- und Neunzigerjahren in eine Zeit des Umbruchs, der Verlierer produzierte. Der einstige Politstar profitierte zwar auch von austriakischen Besonderheiten wie der in Freunderlwirtschaft verstrickten großen Koalition und den hierzulande unterentwickelten Berührungsängsten den rechten Rand betreffend. Doch die Wurzeln des Erfolgs reichen über die heimischen Grenzen hinaus.
Ob man nun die Globalisierung oder – wie es Linke tun – mehr den Neoliberalismus für den entscheidenden Treiber hält: Auch in einem Land wie Österreich, das lange Zeit mit relativ stabiler Arbeitslosenrate beglückt war, wurde die Arbeitswelt für viele stetig ungemütlicher. Unsichere Beschäftigungsverhältnisse griffen um sich, stabile Vollzeitstellen gerieten gerade für immer mehr junge Menschen außer Reichweite. Die zunehmend unübersichtliche Realität befeuert Kräfte, die den Rückzug ins nationale Idyll propagieren – und mit den Fremden einen Außenfeind anbieten, auf dem sich Frust abladen lässt.
Wenn der blaue Erfolg mit den ökonomischen Umständen zusammenhängt: Ist ambitionierte Sozialpolitik also das Gegenmittel? Das ist leichter gefordert als getan. Natürlich könnte eine links orientierte Regierung versuchen, via Vermögenssteuer Geld zum Umverteilen zu lukrieren. Doch wie der in der SPÖ verankerte Politologe Nikolaus Kowall in einer STANDARD-Debatte feststellte, fehlen nationalen Politikern in der globalisierten Welt die Instrumentarien, wie sie zur sozialdemokratischen Blütezeit in den Siebzigern noch zur Verfügung standen. Postenverteilen in einer verstaatlichten Industrie spiele es nicht mehr: Die Versprechen der FPÖ suggerierten eine Machtfülle, die eine Illusion sei.
Pessimismus als Markenzeichen
Außerdem lässt sich der Zulauf zur Rechten nicht allein mit tatsächlichen materiellen Nöten erklären. Dafür ist die Sympathisantenschar schlicht zu groß – und von jener Gruppe, die man früher Proletariat genannt hätte, darf ein großer Teil mangels Staatsbürgerschaft ohnehin nicht wählen. Entscheidend ist laut Wahlforschern vielmehr der Ausblick: Wer pessimistisch in die Zukunft schaut, spricht viel eher auf die FPÖ an.
Anlass zum Schwarzsehen boten die vergangenen drei Jahre beileibe genug. Corona-Krise, Ukraine-Krieg und die Teuerungswelle als Folge hätten Menschen in eine von Nervosität, Erschöpfung und Depression geprägte "psychosoziale Sondersituation" geführt, glaubt der Meinungsforscher Günther Ogris vom Sora-Institut: Ein "Spiel mit Ängsten" falle da auf fruchtbaren Boden.
Insofern hatten die Freiheitlichen schlicht auch Glück: Weniger das Ibiza-Video selbst als das Spesenrittertum von Ex-Parteichef Strache hatten das Image der selbsternannten Antiprivilegienpartei schwer erschüttert – doch dann hat der Zorn über die Corona-Politik die Erinnerung an die blauen Affären rasch aus den Köpfen der auf Protest getrimmten Wähler verdrängt. Als Regierung und Landeshauptleute im Herbst 2021 eine Impfpflicht ausriefen, müssen in der FPÖ-Zentrale die Sektkorken geknallt haben.
Die Schwäche der anderen
Die heute von niemandem mehr verteidigte Idee zeigt: Die FPÖ schöpft ihre Stärke natürlich auch aus Schwächen der Gegner. Nicht nur im Corona-Management hat die Kanzlerpartei ÖVP Glaubwürdigkeit verspielt. Die Korruptionsdebatte treibt einstige Sebastian-Kurz-Wähler zurück ins blaue Lager, mit dem mutwillig losgetretenen Flüchtlingsthema legten die Türkisen im Niederösterreich-Wahlkampf eine weitere thematische Rutsche.
Das brachte auch eine andere Konkurrentin der FPÖ ins Schleudern. Der SPÖ fehlt nicht nur eine einheitliche Antwort auf die "Ausländerfrage", sondern auch eine unumstrittene Person an der Spitze. Mit dem Flüchtlingsthema kochte prompt wieder die Debatte um Obfrau Pamela Rendi-Wagner hoch. Aus der Teuerungskrise, an sich ein für die Sozialdemokratie maßgeschneidertes Thema, zog die größte Oppositionspartei zu wenig Profit. Die Folge: herbe Verluste in Niederösterreich.
Dass die Profiteure der Proteststimmung nicht ausschließlich blau sein müssen, zeigen Wahlen aber auch: Sobald ernstzunehmende Konkurrenz auf dem Feld der Populisten auftaucht, halten sich die Erfolge in Grenzen. Dies zeichnet sich auch bei der Kärntner Landtagswahl am 5. März ab, wo der FPÖ das Team Kärnten des Spittaler Bürgermeisters Gerhard Köfer zusetzt. Zwar liegen die Blauen laut Umfragen hier ebenfalls auf einem Niveau wie in Niederösterreich. Doch im einstigen Haider-Land sind sie Besseres gewöhnt. Schreibt DER STANDARD.
22.2.2023 - Tag der Eliten die keine Eliten sein wollen
Die tägliche Frage in den Medien nach der Ursache für die Erfolge populistischer Parteien und Politiker*innen entwickelt sich langsam zum Nerv Töter. Ein Trump oder ein Herbert Kickl, der mit seiner rechtsradikalen FPÖ derzeit die stärkste Partei Österreichs repräsentiert, sind nicht vom Himmel gefallen.
Das Rezept ist relativ einfach: Man wettere von frühmorgens bis spät in den Abend hinein gegen die herrschenden Politeliten «da oben» und greife Themen auf, die der Gesellschaft unter den Nägeln brennen. Fertig ist die siegreiche Strategie. Mehr Ingredienzen braucht es nicht. Die Mühseligen und Beladenen, die in Schlechtwetterzeiten so oder so die lautstarke Mehrheit der Gesellschaft stellen, folgen jedem noch so unappetitlichen Rattenfänger.
Paradox ist allerdings die Tatsache, dass auch die populistischen Posaunen ausser markigen Sprüchen, die öfters den Tatbestand der «Verbalinjurie» erfüllen, keine Lösungen anzubieten haben. Müssen sie auch nicht. Hauptsache es poltert und rappelt in der Kiste.
Absurd und geradezu lächerlich wird es aber, wenn eine Partei wie die Schweizer Rechtsaussenpartei SVP «die da oben» mit angriffiger Lust kritisiert oder durch Söldner aus dem Heer der Trychler*innen kritisieren lässt. Wer erinnert sich nicht an die abfälligen Äusserungen des SVP-Napoleons vom Herrliberg gegen die «Classe Politique»?
Ausgerechnet die SVP, die seit Jahrzehnten mit zwei Bundesräten (Ausnahme Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, die ab 2008 von der SVP zur BDP wechselte) in der Schweizer Regierung vertreten ist! Mehr noch: Meistens im Parlament sogar mit einer «bürgerlichen» Mehrheit aus SVP, FDP und Mitte (ehemals CVP) ausgestattet. Mehr Elite bzw. «Classe Politique» als bei den SVP-Granden geht ja kaum.
So einfach ist das. Populisten müssen nur zugreifen und die Themen bewirtschaften, die sie selbst (mit-) verursacht haben.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Geheimes Dokument: Kreml soll Übernahme von Belarus planen
Russland hat einem Medienbericht zufolge offenbar Pläne für eine schrittweise Übernahme seines Nachbarlandes Belarus bis zum Jahr 2030. Das legt ein Dokument aus der Moskauer Präsidialverwaltung nahe, über das die «Süddeutsche Zeitung» berichtet und das gemeinsam mit dem WDR, dem NDR und neun weiteren Medien ausgewertet worden sei. Demnach wollen die Strategen von Russlands Präsident Wladimir Putin Belarus offenbar politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandern.
Ziel der Pläne ist laut dem Bericht ein gemeinsamer Unionsstaat unter russischer Führung, wie die Zeitung unter Berufung auf das Dokument berichtet. Westliche Sicherheitskreise halten das Papier laut der «Süddeutschen Zeitung» für authentisch.
Einfluss soll sichergestellt werden
Das interne 17-seitige Kreml-Dokument mit dem Titel «Strategische Ziele der russischen Föderation in Belarus» stammt offenbar aus dem Sommer 2021.
Darin werden laut dem Bericht die strategischen Ziele Russlands in Belarus in den Bereichen Politik/Verteidigung, Handel und Ökonomie sowie Gesellschaft aufgelistet und in kurzfristig (bis 2022), mittelfristig (bis 2025) und langfristig (2030) unterteilt.
Das strategische Ziel Moskaus ist dem Papier zufolge unter anderem «die Sicherstellung des vorherrschenden Einflusses der Russischen Föderation in den Bereichen Gesellschaftspolitik, Handel, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur».
Die im Februar vergangenen Jahres in Belarus beschlossene Verfassungsreform solle nach russischen Bedingungen vollendet, Gesetze mit denen der russischen Föderation «harmonisiert» werden, berichtet die Zeitung. Gleichzeitig wolle der Kreml den westlichen Einfluss zurückdrängen und ein Bollwerk gegen die Nato schaffen.
Nachrichtendienstler: Inhalt plausibel
Fachleute halten das Kreml-Papier laut der Zeitung für authentisch. «In seiner äusseren Form ähnelt das Dokument einem Standarddokument der russischen Bürokratie oder politischen Verwaltung», sagte Martin Kragh, stellvertretender Direktor des Stockholm Centre for Eastern European Studies (SCEEUS). Der Inhalt stimme «weitgehend mit den politischen Zielen Russlands gegenüber Belarus seit den 1990er-Jahren überein».
Auch mehrere westliche Geheimdienste, denen das Papier gezeigt wurde, halten es laut der «Süddeutschen Zeitung» für glaubwürdig. «Der Inhalt des Dokuments ist absolut plausibel und entspricht dem, was wir auch wahrnehmen», sagte ein hochrangiger Nachrichtendienstler gegenüber der Zeitung. Das Strategiepapier sei als Teil eines grösseren Plans von Putin zu sehen: der Schaffung eines neuen grossrussischen Reichs.
«Schleichende Einverleibung von Belarus» – Einschätzung von Fredy Gsteiger, diplomatischer Korrespondent von SRF
«Der Bericht ist nicht wirklich überraschend und deckt sich mit dem, was man schon wusste: Seit zwei Jahrzehnten will die Kreml-Führung Russland und Belarus zu einer Art Unionsstaat machen, der klar von Moskau dominiert ist. Der Präsident von Belarus würde de facto zu einem Provinzgouverneur degradiert. Zunächst war das ein vages Ziel. Inzwischen ist es ein konkretes Vorhaben.
Schon vor Beginn des Ukraine-Krieges und erst recht seither erleben wir, dass die Umsetzung dieses Ziels bereits begonnen hat. Geplant ist kein Überfall wie bei der Ukraine, sondern eine schleichende Einverleibung. Es befinden sich inzwischen Tausende von russischen Soldaten in Belarus. Die belarussische Sprache wird allmählich aus dem Alltag verdrängt und die Handelsströme nach Belarus werden zunehmend über Russland gelenkt und weit weniger als früher über Polen und das Baltikum.
21.2.2023 - Tag der Geheimdokumte die alles andere als geheim sind
Die «geheimen Dokumente» sind auch nicht mehr was sie mal waren. De Facto hat Putin den Anschluss von Belarus an Russland längst vollzogen. Die von Russland seit 1994 auf den Präsidentenstuhl von Belrus gesetzte Marionette Alexander Lukaschenko ist nichts anderes als eine unappetitliche, mafiöse und boshafte Lachnummer. Als solche führt er die Befehle und Weisungen des russischen Zaren aus. Seit eh und je.
Auch wenn das der ehemalige SVP-Nationalrat und Eisenbahnkönig Peter Spuhler lange Zeit anders sah. Einträgliche Geschäfte mit Diktaturen vernebeln eben sehr oft den Blickwinkel. Nicht nur bei der SVP.
Das einzig Geheime an diesem mit einer Chuzpe sondergleichen als «Geheimpapier» verkauften Dokument ist lediglich das exakte Datum der offiziellen Verkündigung des Kremls, wenn Belarus auch de jure als Satellitenstaat dem Zarenreich einverleibt wird.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Sex-König Patrik Stöckli (65) geht in Rente: «Mit Telefonsex habe ich Millionen verdient»
Patrik Stöckli hat sein Lebenswerk Erotik Markt verkauft. Blick unterhält sich mit dem erfolgreichen Sex-Business-Unternehmer über seine Karriere. Und darüber, was als Nächstes kommt.
Erotikunternehmer Patrik Stöckli (65) geht in Rente. Seinen Ausstieg begründet der Schweizer «Sex-König» unter anderem mit einem schweren Velounfall. Bei diesem zog er sich vor zwei Jahren einen Beckenbruch zu.
Nun will er kürzertreten. Im Gespräch mit Blick macht Stöckli aber einen sehr lebhaften Eindruck. Redet mal leise und besonnen, mal laut und wild gestikulierend. So richtig in Fahrt kommt er, wenn er über «die Banken» spricht. Diese hätten ihm nie einen Franken Kredit gewährt. Sie trauen sich laut Stöckli keine Verbindung zum Sexgeschäft zu, was «verlogen» sei.
More Information
Diese Behauptung knüpft er an den verurteilten früheren Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz (66), der laut Stöckli ungerecht behandelt wird. «Eine Schweinerei ist das! Er hat doch das ganze Geschäft für die Banken in den Cabarets hereingeholt. Da darf er wohl auch Spesen dafür einfordern.»
Stöckli bleibt Inhaber von Cruising World
Ruhiger ist Stöckli, wenn es um Zahlen geht. «Wenn die Miete eines Ladens mehr als zehn Prozent seines Umsatzes beträgt, dann wird geschlossen», sagt er in seinem Büro in Wollerau SZ. 2017 schloss er deswegen schon sechs Erotik-Markt-Filialen.
Selbst in seinem eigenen Gebäude in Wollerau gibt es keinen Erotik-Markt mehr. Hier ist noch ein grosses Lager mit allerhand Sextoys sowie der Sitz der CNP Entertainment, die Stöckli weiterhin gehört. Verkauft hat er die zuletzt noch acht Filialen von Erotik Markt an den Mitbewerber Magic X. Im Portfolio von CNP verbleiben aber 6 Standorte von Cruising World. Das sind Swinger- und Saunaclubs ohne Prostitution. Stöckli ist operativ kaum mehr involviert.
Hat der Verkauf von Erotik Markt auch mit mangelnden Zukunftsperspektiven zu tun? Stöckli verneint: «Die zuletzt noch bestehenden Filialen von Erotik Markt waren allesamt profitabel.» Natürlich sei der Konkurrenzdruck höher als in früheren Zeiten. Hat er den Anschluss in den E-Commerce verpasst? Stöckli verneint erneut: «Wir haben da auch mitgemischt und gerade während Corona sehr viel Umsatz gemacht.» Es sei aber nicht sein Ding: «Ich verstehe nicht viel von E-Commerce.»
Bis zuletzt war der in den Läden erzielte Umsatz höher als jener aus dem E-Commerce. Stöcklis Erfolgskonzept basiert darauf, dass der Verkauf von Erotik-Artikeln kein «schmuddeliges» Geschäft ist. Seine Läden sind hell und sauber. Auch Paare zählen zu seinen Kunden. Mit einem Schmunzeln erzählt er vom Kaufdruck, der beim Mann entsteht, wenn der Frau etwas im Laden gefällt.
Die Anfänge in der Illegalität
Ursprünglich arbeitete Stöckli als Bildhauer in Hersiwil SO. 1983, mit 24 Jahren, sattelt er aufs Sexgeschäft um. Inspiriert wird er von einem Protzbild der deutschen Sexunternehmerin Beate Uhse (1919–2001) im «Stern», mit dem Titel «Das ist alles meins». Stöckli wittert das grosse Geschäft. Pornoartikel sind in der Schweiz zu jenem Zeitpunkt noch verboten. So besorgt er sich Hefte, Filme und Toys in Wiesbaden (D) und schmuggelt die Sachen über die Grenze. «Ich wurde mehrmals erwischt», gesteht er.
Ins Gefängnis kam er nicht. Er konnte durch die Gründung einer Niederlassung in Lörrach (D) sogar legal kleine Mengen in die Schweiz verschicken. Mit Inseraten im Blick bringt er die Ware an die Leute. Viel Geld macht er nicht, auch weil die Empfänger der Sexartikel aus Deutschland Mehrwertsteuer zahlen müssen. Stöckli kauft daraufhin die Vertriebsrechte für Sexfilme und legt in Wollerau eine «Kopierstrasse» an: Hunderte VHS-Recorder kopieren Sexfilme auf leere VHS-Kassetten, die Stöckli dann illegal innerhalb der Schweiz verschickt.
Dank sei der Abstimmung
Das Geschäft mit Sexartikeln explodiert aber erst mit der Liberalisierung. Am 17. Mai 1992 stimmt das Schweizer Volk dafür, dass pornografische Inhalte zulässig sind und nur «harte Pornografie» (etwa mit Tieren oder Kindern) verboten bleibt.
Stöckli ist mit dem Vertrieb von Sexheftli, -videos und -artikeln in der Schweiz bereits aktiv. Setzt alles auf eine Karte und organisiert am Abstimmungswochenende eine Sexmesse in Niedergösgen SO. Der Andrang sei riesig gewesen. «Wäre die Abstimmung anders verlaufen, wäre ich im Gefängnis gelandet», lacht Stöckli.
Die goldenen Zeiten
Es folgen goldene Zeiten. Zunächst im Versand, bald auch mit Läden. Der erste Erotik Markt in Wollerau ist gleich ein Erfolg. 1994 folgt ein 2000 Quadratmeter grosser Laden in Lyssach BE. Vor dessen Eröffnung stösst Stöckli auf erbitterten Widerstand der Gemeindebehörden. Er setzt sich durch und eröffnet munter weiter Läden. Zur Spitzenzeit um den Jahrtausendwechsel besitzt er 21 Erotik-Markt-Standorte.
«Auch mit Telefonsex-Nummern habe ich Millionen verdient», so Stöckli. Jetzt ist er auf dem Zenit angekommen. In den Erotik-Markt-Filialen steigen grosse Kundenpartys mit Hunderten Gästen. Zeitweilig steht Stöckli sogar kurz davor, das Seximperium von Beate Uhse zu kaufen. Letztlich kommt es nicht dazu. «Im Angebot waren zu viele Mietverträge und nicht genug Immobilien», so seine Begründung. Zudem findet er keine weiteren Investoren.
Der Fehlentscheid mit dem Womanizer
Als das Internet den Sexartikelvertrieb verändert, greift Stöckli zu besonderen Marketing-Aktionen. So verteilt er 2017 einmal persönlich 20-Franken-Scheine an alle Kunden, die den Erotik Markt betreten. «Das Geld holte ich zu 85 Prozent über die Verkäufe wieder herein», bilanziert Stöckli.
Nur einen Fehlentscheid bereut er bis heute: Er hätte sich beim «Womanizer»-Vibrator am Patent beteiligen können, pochte jedoch auf eine Mehrheit von 51 Prozent. Der Deal scheitert deswegen. An seinem späteren Verkaufsschlager hätte Stöckli als Miteigentümer deutlich mehr verdienen können.
Auf das Erreichte ist Stöckli dennoch stolz. Sein grösster Verdienst sei es, alles ohne Hilfe der Banken geschafft zu haben, sagt er nochmals stolz und angriffig.
Und jetzt?
Eine Zeit lang lief Stöckli Marathons, weil er deutlich an Gewicht zugelegt hatte. 80 waren es an der Zahl, heute könne er aber nicht mehr laufen. Seinen Lebensabend wird er oft auf dem Golfplatz verbringen. In der Schweiz, nahe seinem Wohnort Pfäffikon SZ, oder in seinem Zweitwohnsitz auf Ibiza (Spanien). Auch will er weitere Häuser bauen, «das ist für mich ein Hobby». Doch wolle er mit seinen Ressourcen haushalten.
Trotz des Erfolgs ist er bodenständig geblieben, hat sein schelmisches Lachen behalten. Den früheren Prunk, als er im Ferrari oder im Privathelikopter reiste, hat er abgelegt. Seine letzte Extravaganz: Eine Autonummer bestehend aus lauter «Sexen». Schreibt BLICK.
20.2.2023 - Tag der glücklichen Sexseller
Sex sells. Sagen die Amerikaner. Recht haben sie. Oder frei nach Hölderlin, leicht abgewandelt: Wo die Sucht am grössten ist der Markt nicht fern.
Allen Moralisten zum Trotz: Patrick Stöckli hat die Chance gepackt, genutzt und alles richtig und viele glücklich gemacht. Sich selbst am meisten. Man gönnt es ihm.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Regierung zwingt ORF zu Sparplänen bei Sport und Kultur
Am Montag, 14 Uhr, wird es ernst: ORF-Chef Roland Weißmann legt seinen Stiftungsräten in einer Sondersitzung sein Programm vor, wie er bis Ende 2026 320 Millionen Euro einspart. Das könnte das Ende der ORF-Finanzierung für das RSO, das Radio-Symphonieorchester, bedeuten, das Aus für den Sportspartenkanal ORF Sport Plus als Rundfunkprogramm, die Einstellung der Streamingportale Flimmit und Fidelio.
Sport-Interessenvertreter laufen sich schon mit ersten Protesten warm gegen eine Einstellung des Sportkanals. Unruhe über die Zukunft des RSO war bei einem Konzert am Samstag spürbar.
Ein massives Sparprogramm ist Bedingung der Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) für eine künftige ORF-Finanzierung. Freitag hat sie erstmals offiziell bestätigt, dass sie sich eine sogenannte Haushaltsabgabe statt der GIS vorstellen kann. Die Grünen sind ohnehin schon längst für eine solche Abgabe.
Eine neue Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt der Verfassungsgerichtshof vor. Er entschied Ende Juni 2022, dass GIS-freie Streamingnutzung verfassungswidrig sei. Bis Ende 2023 gab er der Politik Zeit für eine neue Finanzierung des ORF, die seine Unabhängigkeit gewährleistet.
Sparpotenzial bei GIS
Die Umstellung selbst erspart dem ORF einigen Aufwand für die GIS-Zasterfahndung: Viele Dutzend Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter klopfen bisher an Wohnungstüren und fragen, ob man nicht doch ein GIS-pflichtiges Rundfunkempfangsgerät zu Hause hat.
Eine künftige Haushaltsabgabe wird für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber unabhängig von Geräten und Empfangsmöglichkeiten eingehoben. Ausnahme: Befreiungen für Einkommensschwache wird es wie bisher bei der GIS geben.
Wer bisher mit alleiniger Streamingnutzung die GIS umging, muss künftig zahlen. Das bringt dem ORF mehrere 100.000 zahlende Haushalte mehr. Das dürfte die Einnahmen des ORF zumindest stabilisieren, auch wenn die Zahlungen pro Haushalt und Monat laut Medienministerin Raab etwas weniger werden müssen.
Derzeit nimmt der ORF 676 Millionen Euro im Jahr aus der GIS ein, also ohne Streaminghaushalte. Mit dieser heutigen Finanzierungsbasis prognostizierte der ORF Verluste von 70 bis 130 Millionen Euro pro Jahr ab 2024. Das Sparprogramm diktiert also nicht allein die Ministerin.
Noch viel Klärungsbedarf
Die Details der neuen ORF-Finanzierung wirken vorerst noch ziemlich unklar. Im Medienministerium verweist man bei allen Detailfragen zum Thema auf noch offene Verhandlungen mit den Grünen über die Neuregelung. Und die neue Finanzierungsform wirft viele Detailfragen auf. Die Haushaltsabgabe soll günstiger werden als die GIS bisher, lautet die Vorgabe der Ministerin. Sie erwartet Kürzungen an den bisher 18,59 Euro pro Monat.
Bundes- und Landesabgaben in Bewegung
Ob auch auf eine künftige Haushaltsabgabe wie auf die GIS Umsatzsteuer eingehoben wird, ist unklar, aber zweifelhaft. Derzeit läuft eine Sammelklage eines Prozessfinanzierers gegen die Mehrwertsteuer auf die GIS, die Frage liegt zur Klärung beim EU-Gerichtshof. Ende Mai soll der Generalstaatsanwalt einen – meist richtungsweisenden – Schlussantrag dazu vorlegen.
Mit der Steuer würde der ORF voraussichtlich die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug verlieren – der wesentliche zweistellige Millionenbeträge pro Jahr ausmacht.
Neben der Steuer hebt der Bund noch zwei Euro pro Haushalt und Monat an TV-Gebühr, Radiogebühr und Kunstförderungsbeitrag ein. Die Bundesabgaben fließen unter anderem in die Privatrundfunkförderung. Der Kunstförderungsbeitrag könnte künftig aus dem Bundesbudget kommen, sagen Menschen mit Einblick in die Verhandlungen.
Bei Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wird derzeit an rund 100 Millionen Euro Volumen im Zusammenhang mit der künftigen GIS-Lösung gerechnet, heißt es in Verhandlungskreisen.
Wesentlich günstiger könnte die ORF-Abgabe künftig ausfallen, wenn die Bundesländer auf ihre Abgaben verzichten. Oder wenn für die Mittel aus den bisherigen Abgaben doch noch mit Bund-Länder-Vereinbarungen von der ORF-Abgabe entkoppelt würden. Dann stellt sich allerdings die Frage: Wie verfahren mit Oberösterreich und Vorarlberg, die bisher auf Abgaben auf die GIS verzichten.
Gut möglich allerdings, dass am Ende der Verhandlungen weiterhin Bundesländer eigene Abgaben auf oder mit der Haushaltsabgabe einheben.
Wen das 320-Millionen-Sparpaket im ORF bis 2026 treffen könnte
Wo könnte das Sparpaket durchschlagen, das ORF-Chef Weißmann am Montag seinen Stiftungsräten präsentiert?
ORF Sport Plus: Sport-Spartenkanal auch laut Umfrage Sparkandidat
Wenn der ORF schon am Programm sparen soll, dann am ehesten an ORF Sport Plus. Das sagen 51 Prozent der 1043 online Befragten laut OGM-Erhebung für den Kurier. ORF Sport Plus zählt zu den wahrscheinlichsten Opfern des großen ORF-Sparpakets, das am Montag den ORF-Stiftungsräten präsentiert wird.
ORF Sport Plus könnte als Rundfunkkanal eingestellt werden. Die Übertragungen einer Vielzahl von Sportarten abseits von Premiumbewerben aus Fußball, Formel 1 und Ski soll offenbar im ORF-Angebot bleiben: Einerseits braucht ORF 1 österreichische Inhalte, wenn es sich deutlicher von US-Serienware verabschieden will. Andererseits plante der ORF schon länger eine Streamingplattform dafür – wenn es das Gesetz erlaubt.
RSO: ORF-Orchester soll wieder einmal eingespart werden
Das ORF-RSO Wien ist Debatten um seine Auflösung gewöhnt. Mehrfach drohte der ORF damit, den Klangkörper einzusparen. Das aktuelle Vorhaben trifft ein Orchester, bei dem fast 50 Prozent Frauen spielen und das – als einziges etabliertes Orchester Österreichs – eine Frau, Marin Alsop, als Chefdirigentin hat. Das RSO ist zudem ein zentraler Faktor im musikalischen Ökosystem. An die 300 Uraufführungen hat es umgesetzt und damit Musikgeschichte mitgeschrieben. Durch das RSO ist der ORF somit ein wesentlicher Kulturförderer des Landes, wozu ihn das ORF-Gesetz auch verpflichtet. Spannend wird, welche Kosten bei einer Auflösung des Orchesters anfallen und ob die Bundesregierung, Auslöser der Sparaktivität, ein Konzept zur RSO-Rettung hat.
GIS: Haushaltsabgabe statt Hausbesuche
Eine Umstellung von der bisher geräteabhängigen GIS-Gebühr auf eine Haushaltsabgabe eröffnet Sparpotenzial bei der Gebührentochter des ORF mit derzeit an die 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Aufwand von rund 40 Millionen Euro pro Jahr. Wenn die Gebühr künftig nicht mehr von Empfangsgeräten abhängt, sondern alle Haushalte zahlen müssen (bis auf besonderes einkommensschwache), dann braucht es keinen Außendienst mehr, der an der Wohnungstür nach TV oder Radiogerät fragt. Ob eine kleinere GIS künftig die Haushaltsabgabe einhebt (sie hat schon jetzt hoheitliche Aufgaben für Bund und Länder) oder eine neue Stelle, ist noch unklar. Der Aufwand für die Einhebung dürfte jedenfalls mit der Haushaltsabgabe gegenüber der bisherigen GIS deutlich sinken.
Flimmit und Fidelio: Bezahlportale für Film und Klassik auf dem Prüfstand
Der ORF will mit der ORF-Novelle über seine künftige Finanzierung auch mehr Möglichkeiten im Streaming bekommen. Zwei bestehende Bezahlportale allerdings könnten dem großen Sparpaket zum Opfer fallen.
Flimmit ist ein Film- und Serienportal, das der ORF als kommerzielles Angebot gegen Netflix und Co 2015 startete. Es blieb unter seinen Erwartungen und darf inzwischen auch mit GIS-Gebühren querfinanziert werden. Flimmit konzentriert sich auf österreichische und europäische Filme und Serien. Dafür dürfte auch im künftigen ORF-Streaming Platz sein.
Fidelio ist ein Klassikportal, das der ORF 2015 mit der deutschen Unitel aus Jan Mojtos Beta-Gruppe startete. Auch dieser Streamingdienst blieb unter den Erwartungen. Die Medienbehörde lehnte eine GIS-Finanzierung dieses Portals ab. Schreibt DER STANDARD.
19.2.2023 - Tag der nicht refinanzierbaren Sportsendungen
320 Millionen Euro beim Milliardenbudget von ORF einzusparen ist jetzt nicht wirklich die ganz grosse Hausnummer. Gespart werden soll vor allem beim Rundfunkprogramm, das sich vorwiegend kulturellen und regionalen sportlichen Themen widmet.
An die wirklich teuren Sportveranstaltungen wie internationale Fussballveranstaltungen und Formel 1 wagt man sich nicht heran, obschon diese – wie in der Schweiz – durch Werbung nicht refinanzierbar sind. Immerhin wurde die Formel 1-Liveübertragung seit zwei Jahren beim ORF um die Hälfte der Renndaten gekürzt, weil der Free-TV-Privatsender Servus (zum Red-Bull-Konzern gehörend) die andere Hälfte übernimmt. Warum nicht gleich 100 Prozent der Live-Übertragungsrechte dem Privatsender überlassen, der ja einen eigenen Formel-1-Rennstall betreibt?
Tja, wer will sich schon mit der FIFA oder der Formula One anlegen? Dann doch lieber die regionale Kultur und die regionalen Fussballveranstaltungen vom Programm streichen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Öko-Energie zu teuer: Grünes Schrumpfen ist angesagt
Eine neue Studie weist nach, dass „grünes Wachstum“ eine Illusion ist. Denn Öko-Energie, die unsere Technik antreibt, hat schlicht zu hohe Kosten.
Klimaschutz scheint einfach: Man muss nur auf Ökoenergie setzen. Doch leider ist es nicht trivial, genug Ökoenergie zu mobilisieren. Energieexperten schätzen, dass Deutschland etwa 2.000 Terawattstunden (TWh) an Ökostrom benötigen würde, wenn „grünes Wachstum“ möglich sein soll. Das wäre rund 4-mal so viel Strom, wie Deutschland heute verwendet.
Diese Mengen kann die Bundesrepublik nicht komplett erzeugen. Selbst wenn so viele Solarpaneele und Windräder wie möglich installiert würden, kämen wohl nur 1.200 heimische Terawattstunden heraus. Die restlichen 800 TWh müssten importiert werden.
Wirtschaftsminister Robert Habeck ist daher kürzlich nach Namibia gereist, um dort ein Projekt anzustoßen, das 10 Milliarden Dollar kosten soll. Mit Sonne und Wind soll grüner Wasserstoff produziert und dann in Ammoniak umgewandelt werden. 2027 soll die erste Fuhre nach Deutschland gehen, um hier Dünger und andere Chemikalien klimaneutral herzustellen.
Die Idee hat Charme: Namibia ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 2,6 Millionen Einwohner – und damit viel Platz für Windräder und Solarpaneele. Zugleich würde auch Namibia Ökostrom erhalten, denn „eine Art von grünem Energie-Imperialismus“ schließt Habeck aus.
Bleibt die Frage: Wie teuer wird die gesamte Produktion? Es sagt wenig, dass ein Projekt 10 Milliarden Dollar kosten soll. Um die Energiewende zu kalkulieren, ist wichtig, wie teuer die einzelnen grünen Energie-Einheiten im Vergleich zu den fossilen Varianten werden.
Lange gab es nur vage Schätzungen – bis im Dezember eine Studie erschien, die das Bundeswirtschaftsministerium gefördert hat. Gerechnet wurden Modelle für das nördliche Afrika und den Nahen Osten, wo die Bedingungen ähnlich günstig wie in Namibia sind: Die Sonne scheint fast immer, und in den Wüsten leben kaum Menschen, die sich an den Solarpaneelen oder Windrädern stören könnten.
Immerhin: Theoretisch ließe sich genug Strom erzeugen, um ganz Europa zu versorgen. Doch der Rest ist schwierig. Denn der Wüstenstrom lässt sich nicht einfach nach Norden transportieren, weil Stromleitungen zu teuer wären. Um aber per Schiff oder Pipeline nach Europa zu gelangen, muss der Strom umgewandelt werden – erst in grünen Wasserstoff und dann in synthetische Kraftstoffe oder andere Basisprodukte. Schon dabei geht eine Menge Energie verloren. Zudem lässt sich Wasserstoff nur erzeugen, wenn Süßwasser vorhanden ist, das aber in Wüsten bekanntlich fehlt.
Hohe Energiekosten
Also muss Meerwasser entsalzt werden, was erneut Energie kostet. Ein weiteres Problem: Um grünes Kerosin oder andere Energieträger zu erzeugen, wird Kohlenstoff benötigt. Klimaneutral ist dies jedoch nur, wenn dafür CO2 aus der Luft gefiltert wird, weil auch wieder CO2 entsteht, wenn grünes Kerosin verfeuert wird. Leider kostet es erneut viel Energie, CO2 aus der Luft zu holen.
Die neue Studie hat daher errechnet, dass ein Liter grünes Kerosin 2030 zwischen 1,92 und 2,65 Euro kosten dürfte. Bis 2050 sollen die Herstellungskosten auf 1,22 bis 1,65 Euro fallen. Diese Preise wirken zunächst nicht besonders teuer – schließlich müssen Fluggesellschaften momentan etwa 2,81 Dollar pro Gallone Kerosin zahlen, wobei eine Gallone 4,4 Litern entspricht. Das grüne Kerosin scheint also „nur“ 4-mal so teuer zu sein wie die fossile Variante.
Marktpreise und Herstellungskosten verwechselt
Doch dieser Vergleich führt in die Irre, weil Marktpreise mit Herstellungskosten verwechselt werden. Die Fluggesellschaften zahlen nicht nur für die Produktion des Kerosin, sondern finanzieren auch die enormen Gewinne der Ölstaaten – und die Spekulation an den Finanzmärkten. Das Öl selbst lässt sich relativ billig aus dem Boden holen. Im Nahen Osten liegen die Förderkosten bei etwa 10 Dollar pro Barrel (159 Liter), in den USA sind es rund 30 Dollar.
Natürlich ist auch ein bisschen Aufwand nötig, um das Rohöl zu Kerosin zu raffinieren – aber insgesamt dürfte die Herstellung von grünem Kerosin etwa 10- bis 40-mal so viel kosten wie die fossile Variante. Damit wird „grünes Wachstum“ zur Illusion.
Stattdessen ist „grünes Schrumpfen“ angesagt. Denn die Energie treibt die ganze Technik an, die unseren Wohlstand produziert. Wird Energie knapp und teuer, muss die Wirtschaftsleistung sinken. Viele Klimaretter wollen nicht wahrhaben, dass es auf „grünes Schrumpfen“ hinausläuft. Sie führen gern zwei Argumente an, die aber beide falsch sind. Erstens: Nur die Marktpreise würden zählen, nicht die Herstellungskosten. Denn das hiesige Geld sei futsch, sobald wir unsere Ölimporte zahlen. Deswegen sei grünes Kerosin „nur“ 4-mal so teurer.
Firmen müssten aufgeben
Dieses Argument krankt daran, dass so getan wird, als würde das Geld auf ewig in Saudi-Arabien verschwinden. Das Geld kehrt jedoch nach Europa zurück, weil die Saudis hier Urlaub machen, Immobilien erwerben oder Luxuskarossen kaufen. Es behindert die weltweite Wirtschaftsleistung kaum, wenn die Saudis ihr billiges Öl überteuert verkaufen. Beim grünen Kerosin hingegen fallen echte Kosten an: Es werden weitaus mehr Rohstoffe, mehr Arbeit und mehr Energie benötigt, um eine Energie-Einheit zu gewinnen.
Das zweite Argument lautet: Die fossilen Energien sind irgendwann genauso teuer wie die grünen Varianten, weil die CO2-Preise steigen. Doch damit wird kaschiert, dass die Unternehmen zusammenbrechen würden, wenn sie die echten Schäden des CO2 zahlen sollten – es sei denn, sie können zu billiger Ökoenergie wechseln. Wenn aber auch die Ökoenergie extrem teuer ist, müssen viele Firmen aufgeben. Es kommt zum „grünen Schrumpfen“.
Das Wirtschaftsministerium dürfte es noch nicht bemerkt haben: Es hat eine Studie finanziert, die zwischen den Zeilen nachweist, dass „grünes Wachstum“ eine Illusion ist. Schreibt TAZ.
18.2.2023 - Tag der Partei-Ideologien
Dass es sich nicht lohnt, den politischen Wendehals thematisch einseitig einzig und allein immer wieder ausschliesslich auf die anstehenden Wahlen auszurichten, musste bei den Schweizer National- und Ständeratswahlen 2019 bereits die FDP schmerzlich mit gravierenden Verlusten bezahlen. Bei den kommunalen Wahlen in Zürich im Februar 2023 traf es nun die Grünen himself. Was zu erwarten war. Der Klimawandel wird derzeit von anderen Themen überlagert.
Und es wird im Herbst 2023 bei den diesjährigen National- und Ständeratswahlen für einige Partei-Ideologien noch viel schlimmer kommen. Um dies vorauszusagen, muss man kein Prophet sein. Nur die SVP kann sich mit ihren Kernthemen Migration und EU genüsslich zurücklehnen. Ihre Partei-Ideologie zahlt sich – mit einem vernachlässigbaren Ausrutscher 2019 – seit Jahrzehnten aus.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Niemand weiss, wo der abgeschobene Kinderschänder aus Afghanistan ist
Deutschland hat einen entlassenen Häftling afghanischer Herkunft in die Schweiz abgeschoben. Trotz illegalen Aufenthalts liessen ihn die hiesigen Behörden laufen.
Bauarbeiter Emran K.* (35) missbrauchte einen Buben (6) und ein Mädchen (8) schwer. Deshalb verurteilte ihn ein deutsches Gericht 2018 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Am Freitag schoben die deutschen Behörden den Mann in die Schweiz ab. Wie Blick-Recherchen zeigen, tauchte der Kinderschänder danach unter.
K. hat keine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Deutschland konnte den Mann nur abschieben, weil er einst illegal über die Schweiz nach Deutschland eingereist war. So will es das Rückübernahmeabkommen. Wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Anfrage erklärt, wurde K. wegen rechtswidrigen Aufenthalts an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt und aus der Schweiz weggewiesen. Zudem wurde eine Einreisesperre verhängt.
Er sollte selbständig ausreisen
Trotz Wegweisung liessen ihn die Schweizer Beamten laufen. SEM-Sprecher Reto Kormann zu Blick: «Gegen die betroffene Person liegt in der Schweiz nichts vor. Darum konnte sie von den Schweizer Grenzschutzbehörden auch nicht festgehalten werden.» Sollte die Person erneut in der Schweiz aufgegriffen werden, sei der Sachverhalt anders, betont Kormann. Der aktuelle Aufenthaltsort von K. sei den Behörden nicht bekannt.
Blick wollte vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) wissen, wie das genaue Vorgehen in einem solchen Fall ist. «Einer sich rechtswidrig in der Schweiz aufhaltenden Person wird mündlich und schriftlich mitgeteilt, dass sie die Schweiz zu verlassen hat», sagt Sprecher Simon Erny. Anschliessend müsse die Person selbständig ausreisen.
Ob der Mann sich nach wie vor in der Schweiz aufhält, wieder nach Deutschland zurückkehrte oder in ein anderes Land weiterreiste, ist somit unklar. Die Spur des Kinderschänders verliert sich in Basel, wo deutsche Polizisten ihn am Zoll den Schweizer Grenzschutzbehörden übergaben. Das SEM ist in dieser Sache mit Deutschland in Kontakt, wie Sprecher Kormann erklärt. «Die Beziehungen mit Deutschland sind gut, und es bestehen gute Gesprächskanäle auf allen Ebenen.»
Rückführung nach Afghanistan nicht mehr möglich
Die deutschen Behörden setzten Kinderschänder K. im Februar 2021 bereits einmal ins Flugzeug und schoben ihn in sein Heimatland Afghanistan ab. Das war noch vor der Machtübernahme der Taliban. Heute führen weder Deutschland noch die Schweiz Rückführungen nach Afghanistan durch.
Im Dezember 2022 tauchte K. schliesslich plötzlich wieder in Deutschland auf. Der Afghane war über die Schweiz eingereist. Wie «Bild» im Januar berichtete, war er in Basel in ein Tram der Linie 8 gestiegen. Später wurde er bei einer Kontrolle im deutschen Weil am Rhein aufgegriffen und kam erneut ins Gefängnis. Die Strafe hat er inzwischen vollständig abgesessen.
Unmut in Deutschland wegen illegaler Einreisen
Illegale Einreisen über die Schweizer Grenze sorgen in Deutschland in letzter Zeit vermehrt für Misstöne. Während 2020 noch 1574 illegale Einreisen aus der Schweiz nach Baden-Württemberg festgestellt wurden, stieg die Zahl im Folgejahr auf 2512. Im vergangenen Jahr wurde mit 10'500 Fällen mehr als das Vierfache verzeichnet.
Viele dieser Migrantinnen und Migranten reisen über die Balkanroute nach Westeuropa. Sind sie einmal im Schengenraum, können sie sich aufgrund der Reisefreiheit auch über Landesgrenzen hinweg weitgehend ungehindert bewegen. Die Flüchtlinge reisen häufig via Österreich nach Buchs SG, um von dort nach Deutschland weiterzuziehen. Viele wollen lieber in Deutschland einen Asylantrag stellen als in der Schweiz, weil es für sie dort einfacher ist, zu arbeiten. Die Schweiz sieht keine Rechtsgrundlage, die Migranten zu stoppen. Schreibt Blick.
* Name geändert
17.2.2023 - Tag der Kinderschänder vom Hindukusch
Der Fatalist sagt «Auf ein Arschloch mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an» und der Hysteriker vom Dienst sieht seine Befürchtungen über das «totale Staatsversagen» bestätigt. Trifft man sich in der Mitte der beiden Aussagen haben sowohl der Fatalist wie auch der Hysteriker irgendwie recht.
Würden 20'000 Personen aus der Schweiz innerhalb von zehn Jahren nach Afghanistan auswandern, wären wohl auch ein paar abartige Kriminelle darunter.
Eines sei hier allerdings bei diesem boulevardschen Leckerbissen von «Bild» und «Blick» festgehalten, ohne die Taten des Afghanen zu relativieren: Dreieinhalb Jahre Gefängnis für den Missbrauch eines 6-jährigen Buben und eines 8-jährigen Mädchens lassen aufhorchen. Entweder waren die Taten des Afghanen nicht dermassen gravierend wie vom Boulevard dargestellt oder irgendwas bei der deutschen Justiz läuft falsch.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Abzug auch aus Burkina Faso: Französische Truppen werden aus der Sahelzone verdrängt
Nach Mali und der Zentralafrikanischen Republik will auch Burkina Faso keine französischen Truppen mehr im Land. Dafür kommt Russland ins Spiel.
«Frankreich verachtet uns seit der Sklaverei und hat bis heute seine Haltung nie geändert», ärgert sich der Demonstrant Alouna Traoré. Seit mehreren Monaten wird in Burkina Faso an Demonstrationen der Rauswurf der französischen Truppen gefordert.
Ende Januar hat der Übergangspräsident Ibrahim Traoré, der seit einem Putsch im September an der Macht ist, dann offiziell den militärischen Vertrag mit Frankreich aufgekündigt.
Mehr Dschihadisten trotz Frankreichs Truppen
400 Elitesoldaten waren zuletzt im Land, mit einer Spezialmission: Bekämpfung des Dschihadismus in der Region. Nun wird diese Mission abgebrochen, obwohl der Dschihadismus weiter ein grosses Problem ist in Burkina Faso.
«Die Bevölkerung versteht nicht, warum die Dschihadisten so viel Einfluss gewonnen haben in Burkina Faso trotz der sehr langen Präsenz der Franzosen», sagt Ulf Laessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Dass es Burkina Faso versäumt habe, in die Gebiete zurückzukehren, die von Dschihadisten zurückerobert wurden, werde in den staatlichen Medien bewusst verschwiegen. Das verstärkte die Anti-Frankreich-Stimmung.
Demonstrationen auch in Niger
Frankreich ist nicht nur in Burkina Faso auf dem Rückzug. Erst im letzten Sommer wurde auf Druck die Antiterror-Operation «Barkhane» in Mali beendet. Und auch aus der Zentralafrikanischen Republik ist das französische Militär abgezogen.
Um die 3000 Soldaten sind weiterhin in Mauretanien, Niger und Tschad stationiert. Aber auch in Niger sind die französischen Truppen umstritten. Gegen die Verlegung von Soldaten der Operation «Barkhane» nach Niger wurde im Herbst protestiert. «In Niger ist die Regierung sehr stark mit Frankreich verbündet, aber auch dort gibt es in der Bevölkerung eine ähnliche Stimmung wie in Mali und Burkina Faso.» Dies sei für Frankreich heikel, so Laessing.
Frankreich will nun seine Strategie in der Sahelzone anpassen und sich stärker zurücknehmen, wie Präsident Emmanuel Macron im November auf der Militärbasis in Toulon erläuterte: «Unser Engagement an der Seite unserer Partner in Afrika muss sich nun auf die Zusammenarbeit und Unterstützung ihrer Armeen konzentrieren.»
Russland will Kooperation in Sahelzone verstärken
Während Frankreich gezwungen ist, sich aus der Region zurückzuziehen, wird Russland in verschiedenen Ländern der Sahelzone mit offenen Armen empfangen.
Auf seiner Afrika-Tour hat der russische Aussenminister Sergei Lawrow Anfang Februar unter anderem Mali besucht und betont, dass man Mali und den anderen Ländern in der Sahelzone bei der Bekämpfung des Terrorismus zur Seite stehen werde.
Russland werde als Retter gefeiert, in den sozialen Medien werde diese Position durch Kampagnen gezielt gefördert, so Laessing: «Der Westen wird als schlecht empfunden, obwohl er eigentlich der Partner für die Entwicklungszusammenarbeit ist.» Russland hingegen werde dargestellt als Bekämpfer des neuen Kolonialismus des Westens und somit bejubelt.
Bisher ist die Offensive Russlands in Afrika vor allem diplomatischer Art. Wie eine allfällige militärische Unterstützung aussehen könnte und ob Russland im Kampf gegen den Dschihadismus erfolgreicher wäre als Frankreich, bleibt offen. Schreibt SRF.
16.2.2023 - Tag der Neokolonialisten in Afrika
Die hehre westliche Wertegemeinschaft, deren Werte ausschliesslich auf wirtschaftlichen Interessen und Schuldgefühlen aus der Kolonialzeit basieren, macht aber auch wirklich alles falsch, was man falsch machen kann.
Putin führt die Kriege und der Westen übernimmt die Flüchtlinge, die finanzielle Unterstützung der örtlichen Bevölkerung und den Wiederaufbau der zerstörten Infrastrukturen.
Die Neokolonialisten Russland und China wissen wie der hehre Westen und Afrikas korrupte Politik tickt. Und die afrikanischen failed states mit ihren mafiösen Politstrukturen akzeptieren die neuen Plünderer, solange der Rubel aus dem Westen rollt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Immer mehr Telefonbetrug: Mit einer neuen Masche erbeuten Telefonbetrüger Millionen
Alleine im Kanton Zürich stieg die Deliktsumme auf 6.7 Millionen Franken. Die Täter sitzen grösstenteils im Ausland. Alleine im Kanton Zürich haben kriminelle Telefonbetrüger letztes Jahr 6.7 Millionen Franken erbeutet. Diese Deliktsumme ist fast dreimal so hoch wie noch ein Jahr zuvor. Die erfundenen Geschichten seitens der Betrüger spielen dabei immer mehr mit der Angst der Opfer. Telefonbetrüger versuchen in der Region Zürich «hunderte Male pro Tag» meist zufällig ausgewählte Opfer ausfindig zu machen, um ihnen Geld abzuknöpfen. Hierbei setzten sie vermehrt auf sogenannte Schockanrufe, wie die Polizei mitteilt.
Eine neue, dreiste Masche
Diese Masche ist relativ neu – funktioniert aber eigentlich immer genau gleich: Die kriminellen Telefonbetrüger suchen gezielt nach Seniorinnen und Senioren – etwa über einen älter klingenden Namen – und rufen diese an.
Dann gaukeln sie ihrem potenziellen Opfer beispielsweise vor, dass ein nahestehender Verwandter einen Unfall gemacht habe. Und dass die Person nun in Haft sei und für sie deswegen eine Kaution bezahlt werden müsse, sagt Florian Frei von der Kantonspolizei Zürich.
Eine andere, oft angewandte Lügengeschichte ist, dass eine verwandte Person im Spital sei und deshalb dringend Geld bezahlt werden müsse, damit diese Person die benötigte Operation erhalten würde, so Florian Frei weiter.
Und diese Masche ist für die Kriminellen offenbar lukrativ. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Zürich trugen diese Schockanrufe erheblich dazu bei, dass die Schadenssumme derart massiv angesteigen ist: von knapp 2.4 Millionen Franken im Jahr 2021 (bei rund 60 vollendeten Betrugsfällen) auf 6.7 Millionen Franken im 2022 (bei 111 vollendeten Betrugsfällen).
Noch vor nicht allzu langer Zeit haben sich Telefonbetrüger eher als «falsche Polizisten» ausgegeben: Ihren vermeintlichen Opfern gaben sie an, dass das zu Hause aufbewahrte Geld und Schmuck nicht sicher sei – und die Polizei deswegen die Wertsachen abholen müsse.
Anders als bei dieser Masche stehen die Opfer bei Schockanrufen deutlich stärker unter Druck. So geht die Kantonspolizei Zürich denn auch davon aus, dass die persönliche Betroffenheit, die bei Schockanrufen mitspiele, die Opfer veranlasse, grössere Beträge zu bezahlen. Im Schnitt flossen pro Opfer letztes Jahr rund 60'000 Franken an die Betrüger.
Der Polizei gelang ein grosser Schlag
Obwohl die Täter meist im Ausland sitzen und die Ermittlungsarbeit für die Schweizer Behörden dementsprechend schwierig ist, gelingt es den Polizeien dann und wann, Täter festzunehmen oder Betrugsversuche zu vereiteln.
So gelang der türkischen Polizei – auf Ersuchen der Zürcher Staatsanwaltschaft und in Zusammenarbeit mit Zürcher Behörden – im Oktober 2022 ein grosser Schlag gegen eine Betrügerbande. Dabei wurden mehr als zwei Dutzend Hinterleute verhaftet und Wohnungen von mutmasslichen Telefonbetrügern durchsucht.
In anderen Kantonen sieht es wie folgt aus:
Kantonspolizei Bern:
«Auch wir stellen im Vergleich mit dem Vorjahr 2021 sowohl bei den Versuchen als auch bei den erfolgreichen Telefonbetrugen eine Zunahme fest. Auch die Schadenssumme fällt höher aus.»
Für das Jahr 2022 habe die Kantonspolizei Bern rund 850 Telefonbetrugsversuche registriert. 21 Mal seien die Täter an Geld gelangt, dabei seien fast 1.1 Mio. Franken an Schadenssumme entstanden. Dies beinhalte jedoch nicht alle Telefonbetruge.
Kantonspolizei Thurgau:
«Derzeit verzeichnet die Kantonspolizei Thurgau einen deutlichen Anstieg von Meldungen über Betrugsversuche durch Schockanrufe. Die Bevölkerung wird um Vorsicht und Thematisierung mit ihren Angehörigen gebeten.»
Schaffhauser Polizei:
Auch im Kanton Schaffhausen haben Fälle von Telefonbetrug zugenommen, heisst es auf Anfrage. Genaue Zahlen lägen zwar noch keine vor, aber es seien mehr Meldungen eingegangen.
Kantonspolizei St. Gallen:
«Es ist eine Verlagerung der Betrugsmasche feststellbar. Die klassischen Anrufe [...] kommen derzeit weniger oft vor. Stattdessen sind es häufiger sogenannte Schockanrufe. Im Gesamtrahmen sind die Anzahl Fälle aber aktuell nicht auffällig hoch. Eine Zunahme ist somit nicht festzustellen.»
15.2.2023 - Tag der geprellten Seniorinnen und Senioren
Auch die Kantonspolizei des Kantons Aargau kann ein Lied von diesen elenden, aber funktionierenden Betrugsmaschen singen. Obschon sie – wie alle anderen Polizeikorps der Schweiz - Warnungen vor diesen Betrügern en Masse veröffentlicht. Auch die Medien leisten gewaltige Anstrengungen, ältere Menschen zu sensibilisieren und aufzuklären. Doch irgendwie gehen alle Warnungen und Empfehlungen einfach nicht in die Köpfe rein, in die sie rein gehen sollten.
Deshalb kann man nur immer und immer wieder an die jüngere Bevölkerung appellieren, ihre älteren Verwandten und Bekannten auf die Telefonbetrugsmaschen aufmerksam zu machen. Eine lohnende Angelegenheit, denn was Grosi Betrügern gibt, kann nicht mehr geerbt werden. Man nennt das Win-Win-Situation.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Baby-Rückgang nach Corona: Das sind mögliche Gründe
Knapp zehn Prozent weniger Geburten gab es letztes Jahr. Denn viele Paare zogen während Corona ihren Kinderwunsch vor. In den Geburtssälen der Schweiz war es letztes Jahr stiller als auch schon: Gegen zehn Prozent weniger Babys kamen 2022 im Vergleich zum Vorjahr zur Welt.
Dies zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik für die Monate Januar bis November. Sie sind zwar erst provisorisch, erfahrungsgemäss werden noch einige Geburten nachgemeldet. Der Trend ist aber deutlich.
Dass es weniger Geburten gab, spürten die Geburtseinrichtungen. Und zwar massiv. Etwa im Kanton Bern. Hier haben Kliniken teilweise gegen 18 Prozent weniger Geburten durchgeführt.
Das sind Gründe für die Baby-Baisse
Was sind mögliche Gründe für den Baby-Rückgang? Paare, die sich Kinder wünschten, hätten die Corona-Zeit 2021 fürs Kinderkriegen genützt.
«Der Kinderwunsch wurde so vorgezogen, diese Kinder kamen folglich 2022 nicht zur Welt», sagt Daniel Surbek, Chefarzt der Frauenklinik des Berner Inselspitals, zu SRF.
Die Pandemie und die dagegen getroffenen Massnahmen wie Homeoffice, Bewegungseinschränkungen und Änderungen des Freizeitverhaltens hätten offensichtlich dazu geführt, dass sich ab Herbst 2020 viele Paare dem Thema Kinderwunsch «intensiver gewidmet haben und die Reproduktion Fahrt aufgenommen habe». Dies hat zum Geburten-Peak im Jahr 2021 geführt.
Unfruchtbarkeit steigt nicht
Anlass zur Sorge, dass sich Unfruchtbarkeit bei Frauen und Männern häufen könnte, gebe es nicht. Die Fachleute stellen keine Zunahme an Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch fest.
«Wir sehen, dass Anfang 2023 die Geburtenrate wieder angezogen hat.» Er gehe davon aus, dass sich die pandemiebedingten Ausreisser im Laufe des Jahres wieder einpendle.
Coronavirus selbst hat keinen Einfluss auf Geburtenrate
Ausschliessen kann Chefarzt Surbek, dass die tiefe Geburtenrate mit der Covid-Impfung oder einer Corona-Infektion in einem Zusammenhang steht. Das sei genügend untersucht worden.
Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt ein ähnliches Bild in Deutschland: Dort ging die Anzahl der Geburten 2022 um acht Prozent zurück. Die Schweiz ist punkto Baby-Baisse also kein Sonderfall. Schreibt SRF.
14.2.2023 - Tag der Corona-Fruchtbarkeit
Das war eigentlich zu erwarten. Was sollten denn die Leute während Corona sonst tun? Während die einen mit oder an Corona starben, sorgten die andern für entsprechenden Nachwuchs und erzielten damit ein Gleichgewicht des Schreckens: Die einen gehen, die andern kommen. So geht Bevölkerungs-Balance dank einem Naturgesetz.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Nahe kanadischer Grenze: US-Militär schiesst weiteres Flugobjekt ab
Im US-Bundesstaat Michigan ist ein weiteres, nicht identifiziertes Flugobjekt abgeschossen worden. Das bestätigte das Pentagon. Es ist der dritte solche Abschuss im nördlichen Amerika innert drei Tagen.
Drei Abschüsse in drei Tagen: Das US-Militär hat am Sonntag ein weiteres Flugobjekt abgeschossen. Der Vorfall habe sich über dem Huronsee ereignet, der im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada liegt, meldeten am Sonntag zuerst US-Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise.
Auch der republikanische Senator Jack Bergman teilte mit, er sei am Sonntag vom Verteidigungsministerium darüber informiert worden, dass das Militär ein weiteres «Objekt» über dem US-Bundesstaat Michigan «ausser Dienst gestellt» habe. Daraufhin bestätigte auch das US-Verteidigungsministerium den Abschuss eines weiteren, nicht identifizierten Flugobjektes.
«Das amerikanische Volk verdient Antworten»
In einem Tweet fügte Senator Bergman hinzu: «Ich begrüsse das entschlossene Handeln unserer Kampfpiloten. Das amerikanische Volk verdient weit mehr Antworten, als wir haben.» Die Kongressabgeordnete Elissa Slotkin fügte hinzu: «Wir sind alle daran interessiert, was genau dieses Objekt war und welchen Zweck es erfüllte.»
US-Kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen: eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas. Bislang ist unklar, um was für Objekte genau es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Überresten der Flugobjekte soll Aufschluss geben.
Die Vorfälle erinnerten an einen mutmasslich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon, den die US-Luftwaffe eine Woche zuvor vor der Küste des Bundesstaates South Carolina vom Himmel geholt hatte. Es bleibt zunächst offen, ob die Vorfälle zusammenhängen. Schreibt Blick.
13.2.2023 - Tag der neuen Sportart «Ballonschiessen»
So entstehen neue Sportarten: Aus dem etwas aus der Zeit gefallenen «Tontaubenschiessen» entwickelt sich in rasender Geschwindigkeit «Ballonschiessen».
Netflix soll bereits Liveübertragungen vorbereiten und eine US-amerikanische Landesmeisterschaft, die sogar den «Super Bowl» in den Schatten stellt, ist ebenfalls in Planung. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu vernehmen ist, plant Gianni Infantilo zusammen mit seinen arabischen Freunden bereits Weltmeisterschaften in den nahöstlichen Wüsten. Regenbogenfarbige Ballonhüllen sind selbstverständlich verboten.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Die Viertagewoche darf nicht zu längeren Arbeitstagen führen
Die Viertagewoche ist für viele Beschäftigte zum Synonym der idealen Arbeitswelt geworden – ein Tag mehr Zeit für Erholung, Familie und Freunde. Um diesem Wunsch zu entsprechen, testen nun immer mehr Unternehmen das neue Arbeitsmodell. Zuletzt berichtete der Motorradhersteller KTM von seinem Pilotversuch: Vier Monate lange wurde im oberösterreichischen Mattighofen einen Tag pro Woche weniger gearbeitet.
Der Preis des verlängerten Wochenendes waren allerdings verlängerte Arbeitstage. Statt wie gewohnt von 6 bis 14 Uhr und 14 bis 22 Uhr an fünf Tagen die Woche wurde in einem Vier-Tage-Rad mit Schichten zwischen 4 bis 24 Uhr gearbeitet. Auf Dauer habe das zu einer Mehrbelastung der Beschäftigten geführt. Weniger Wochenstunden bei gleichem Gehalt – diese Formel wird in der Praxis selten ausprobiert.
Vielfach belegt
Dabei konnten schon einige Pilotprojekte rund um den Globus – von Neuseeland bis Großbritannien – die Vorteile einer tatsächlich verkürzten Arbeitswoche aufzeigen. Die Viertagewoche hatte dabei nicht nur positive Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten, sondern konnte auch dazu beigetragen, die Arbeitsleistung anzukurbeln. Der öffentliche Diskurs rund um den KTM-Pilotversuch macht zudem deutlich, dass für viele Beschäftigte ohnehin nur eine Arbeitszeitreduktion auch eine "echte" Viertagewoche bedeutet.
Weniger Wochenarbeitsstunden könne man sich angesichts des Fachkräftemangels nicht leisten, hieß es bei KTM. Das ist zu kurz gedacht. Denn eine Viertagewoche, die tatsächlich mehr Freizeit lässt, hilft geplagten Unternehmen, mehr qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen. Wenn sich das Management das nicht traut, bleibt von dem revolutionären Gedanken einer Viertagewoche nur ein leeres Versprechen übrig. Schreibt DER STANDARD.
12.2.2023 - Tag von Lukrez und König Lear
Finden Sie raus, wo der berühmte Haken liegt. Gendersternchen und Wokeness sind es definitiv nicht. Auch wenn uns die Rechtspopulisten und sonstigen Dumpfbacken auf ihren YouTube-Kanälen dies immer wieder weis machen.
Eine mehrheitlich saturierte Konsumgesellschaft, die schon jetzt Mühe hat, die Freizeit sinnvoll ohne Psychiatrie zu gestalten, kommt dafür schon eher in Frage. Damit wir es nicht unter den Tisch wischen: Laut BAG mussten im Jahr 2022 mehr als 50'000 (fünfzigtausend in Worten!) junge Schweizerinnen und Schweizer psychiatrische Hilfe bis hin zur Einlieferung in die Psychiatrie in Anspruch nehmen. Nicht weil es ihnen so gut geht, sondern weil sie schlicht und einfach die Kurve nicht mehr kriegen.
Es rächt sich nun, beinahe alle regulierenden und erzieherischen Werte für die Stabilisierung einer funktionierenden Gesellschaft über Bord zu werfen, ohne neue zu entwickeln. Der alles und nichts regulierende Markt und eine entfesselte Entertainment-Industrie freuen sich.
Wir bauen mit der Viertage-Woche einen Popanz auf, den es mit der Teilzeit-Beschäftigung ja eigentlich längst gibt. Nur den Fünfer und das Weggli gibt es noch nicht und wird es – mit einigen Ausnahmebranchen wie beispielsweise die IT, die es sich leisten können – auch nie geben: Wer sich für Teilzeit-Arbeit entscheidet, hat Ende Monat schlicht und einfach weniger Einkommen.
Eine gesetzlich verankerte Viertagewoche bei gleichem Lohn gegenüber der Fünftagewoche würde vermutlich die Teuerung querbeet dermassen in die Höhe treiben, dass selbst den glühendsten Anhängern dieses Modells die Lust darauf schnell vergehen würde. Denn wer mehr Freizeit hat, konsumiert auch mehr. Das berühmte sinnbildliche Hamsterrad.
Könnten die enormen Kosten, die aus einer gesetzlichen Viertagewoche bei gleichem Lohn entstehen würden, kurzfristig durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen werden, hätten ja so ziemlich alle Schweizer Unternehmen bisher prinzipiell etwas falsch gemacht.
Der Fetisch «Work Life Balance» in Ehren, aber dass von nichts nichts kommt, war nicht nur dem römischen Philosophen Lukrez bekannt, sondern auch König Lear in William Shakespeares Schauspiel: «Nothing can come of nothing».
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Auf Befehl von Biden: US-Militär schiesst erneut Flugobjekt ab
Das US-Militär hat ein weiteres Flugobjekt über amerikanischem Territorium abgeschossen. Das teilte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in Washington mit. Zur Herkunft des Flugobjekts könne er noch nichts sagen, so Kirby weiter.
Das Flugobjekt habe sich in Höhe von etwa zwölf Kilometern über dem Bundesstaat Alaska befunden und eine Gefahr für die Sicherheit des zivilen Flugverkehrs dargestellt, so Kirby. Daher habe das Militär es auf Anordnung von Präsident Joe Biden abgeschossen. Zur Herkunft des Flugobjekts könne er nichts sagen, betonte Kirby. «Wir wissen nicht, wem dieses Objekt gehört.»
Objekt in der Grösse eines Kleinwagens
Teile des Objekts seien nach dem Abschuss wohl auf gefrorenes Wasser gefallen. «Wir hoffen, dass die Bergung erfolgreich sein wird und wir dann etwas mehr darüber erfahren können.»
Nach vorläufigen Erkenntnissen sei das Flugobjekt deutlich kleiner als der am vergangenen Samstag abgeschossene chinesische Ballon. «Es wurde mir so beschrieben, dass er ungefähr die Grösse eines Kleinwagens hatte», sagte Kirby. Der chinesische Ballon habe eher die Grösse von zwei bis drei Bussen gehabt. Er betonte: «Wir werden unseren Luftraum weiterhin wachsam im Auge behalten.»
USA: China überwachte 40 Länder
Am vergangenen Samstag hatte das US-Militär einen mutmasslichen Spionageballon Chinas über amerikanischem Territorium vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Die US-Regierung wirft China vor, es habe Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei, und von einer «Überreaktion».
Das US-Aussenministerium warf China vor, ein umfangreiches internationales Überwachungsprogramm zu betreiben: China habe mit einer Flotte von Spionageballons mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten ins Visier genommen. Schreibt SRF.
11.2.2023 - Tag der gefährlichen Ballonfahrten über den Vierwaldstättersee
Ballonfliegen, pardon, Ballonfahren wird langsam gefährlich. Ich habe jedenfalls die für heute geplante Ballonfahrt, ausgehend von der MIGROS Würzenbach über den Vierwaldstättersee bis zur Landung auf der Marihuana-Wiese der Luzerner Aufschütti, abgesagt.
Die geplanten Ballonferien in Nebraska sind ebenfalls gecancelt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Kundschaft und Konkurrenz verärgert: Musk sorgt mit Preissenkungen bei Tesla für Aufruhr
Die Teuerung treibt die Preise momentan überall in die Höhe. Nicht so bei Tesla: Elon Musk hat die Preise im Januar gesenkt. Je nach Modell um bis zu 10'000 Franken! Das kommt aber nicht überall gut an.
Das neuere Model Y von Tesla kostet aktuell noch 46'990 Franken. Das sind 8000 Franken weniger als letztes Jahr. Bei der Version mit grösserer Reichweite sinkt der Preis gar um 10'000 Franken, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.
Tesla-Chef Elon Musk (51) hat die Preise für seine E-Autos im Januar von den USA über Europa bis nach China gesenkt. Und das bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten. Inzwischen liegen die Preise zwischen 13 und 24 Prozent unter denjenigen von September 2022, wie das Online-Magazin «E-Fahrer» schreibt. Dabei wird doch momentan wegen der Inflation eigentlich alles teurer?
More Information
Tesla kann sich die Preisreduktion leisten. Letztes Jahr schrieb der Elektroautobauer einen Gewinn von 12,6 Milliarden Dollar. Und hat dabei 1,3 Millionen Autos verkauft. Bis 2030 will Tesla jährlich 20 Millionen Autos produzieren. Deshalb sucht Musk nach neuen Käuferinnen und Käufern.
Proteste in China
Aber Achtung: Die bisherigen Tesla-Kunden freuen sich gar nicht über die drastischen Preissenkungen. In China protestierten aufgebrachte Menschen zu Hunderten vor Tesla-Filialen. Kurz zuvor hatten sie noch deutlich mehr für ihren neuen Tesla bezahlt. Auch die Occasionspreise sind durch die günstigeren Neukaufpreisen ins Bodenlose gestürzt.
Wer in der Schweiz einen Tesla bestellt und noch nicht erhalten hat, könne von den neuen, tieferen Preisen profitieren, sagt ein Tesla-Sprecher gegenüber dem «Tages-Anzeiger». All jene, die ihren Tesla schon erhalten haben, ziehen den Kürzeren.
Was macht die Konkurrenz?
Auch bei der Konkurrenz sorgen die Preissenkungen für Kopfzerbrechen. Bisher ist der US-Autobauer Ford der einzige Anbieter, der in den Preiskampf eingestiegen ist. Ford verkauft sein Elektromodell Mustang Mach-E als Reaktion auf die Preissenkungen bei Tesla nun ebenfalls deutlich günstiger – wenn auch nur in Nordamerika.
VW-Chef Oliver Blume (54) hingegen hat gemäss «Tages-Anzeiger» kürzlich angekündigt, auf einen Preiskampf mit Tesla verzichten zu wollen. Auch Amag, der grösste Autohändler der Schweiz, meint, der Konkurrenzdruck sei nichts Neues. Mercedes-Benz Schweiz gibt sich ebenfalls zurückhaltend.
Dabei ist es wohl eine Frage der Zeit, bis die Konkurrenz nachzieht. «Musk will die anderen vom Markt drängen», so der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer (71) gegenüber der Zeitung. «Wer nicht mitmacht und seine Preise gleich lässt, der verliert Marktanteile.»
Im Gegensatz zu Tesla verdienten die übrigen Autokonzerne, die erst seit kurzem E-Autos herstellen, mit diesen kaum Geld oder machten gar Verluste, wie Dudenhöffer erläutert. «Alle anderen sind in einer sehr unglücklichen Situation. Sie haben schlechte Margen. Tesla kann das Preisspiel also unendlich lange betreiben.» Schreibt Blick.
10.2.2023 - Tag der freien Marktwirtschaft bei Tesla
Der gute Elon Musk kann aber auch wirklich tun und/oder lassen was er will: Allen kann er es nie recht machen. Vielleicht hat er ja gute Gründe dafür, dass er momentan seine Elektroautos verscherbelt.
So funktioniert nun mal Marktwirtschaft. Das müssen selbst die chinesischen Tesla-Kunden*innen langsam begreifen. The winner takes it all. Immer vorausgesetzt, hinter den Preissenkungen bei den Tesla-Elektroautos steckt eine Strategie.
Im Oktober 2021 kaufte ich bei Brack die Jahreslizenz für MS Office 2022 für CHF 79.25. Exakt zwei Tage später wurde die gleiche Lizenz als Aktion für 49.25 – also 30 Franken günstiger – angeboten. Und? Was kann Brack dafür, wenn ich zwei Tage zu früh einkaufe? Dumm gelaufen für mich. Sich darüber zu ärgern lohnt sich nicht.
Deshalb hier mein Tipp (besonders für den Onlinehandel): Kaufen, bezahlen und Preis gleich wieder vergessen. So erspart man sich Magenkoliken. Irgendwann landen sowieso die meisten Artikel bei den Sonderangeboten im Aktionskörbchen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Er will mehrere Millionen: Mann verklagt Frau in Singapur, weil sie nicht seine Freundin wurde
Ein Mann aus Singapur verklagt seine langjährige beste Freundin, weil sie ihm einen Korb gegeben und jegliche Kommunikation abgebrochen hat. Umgerechnet beläuft sich die Klage auf fast 3 Millionen Euro. Der kuriose Fall landet nun vor Gericht.
Es ist ein kurioser Fall, der diese Woche vor dem Obersten Gerichtshof in Singapur verhandelt wird. Der Drohnen-Experte K.* verklagt eine Frau auf mehr als 3 Millionen Singapur-Dollar, umgerechnet etwa 2 Millionen Franken, nachdem sie seine romantischen Annäherungsversuche zurückgewiesen und gesagt hatte, sie sehe ihn nur als Freund. Das berichtet die Zeitung «Straits Times».
Er spricht in der Anklage von grosser seelischer Belastung, die er nach der Zurückweisung durch seine ehemals beste Freundin erlitten habe. Und er behauptet, dass die Ablehnung der Frau ein «nachhaltiges Trauma» und eine «Minderung seiner Einkommensmöglichkeiten» verursacht habe.
More Information
Weiter hat er bei einer früheren Klage geäussert, dass seine ehemalige Freundin gegen das Versprechen verstossen habe, «ihm einen Raum der Inspiration und der gegenseitigen Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen zu bieten und immer füreinander da zu sein, jenseits von Kaffeetreffen».
Er drohte ihr nach der Zurückweisung
K. lernte die Frau 2016 in einem «sozialen Umfeld» kennen, heisst es in einem amtlichen Dokument. Zuerst habe sich eine Freundschaft entwickelt, doch dann kam es immer mehr zu Missverständnissen und die beiden waren sich nicht mehr einig, wie ihre Beziehung in Zukunft aussehen würde. Sie sah ihn nur als platonischen Freund, während er sich laut Gerichtsdokumenten als ihr «engster Freund» betrachtete und eine feste Beziehung wollte.
Als die Frau ihm 2020 sagte, dass sie sich nicht mehr so oft mit ihm treffen will, zeigte er sich sehr bestürzt und drohte ihr damit, dass ihr «persönliches und berufliches Ansehen» darunter leiden würde, wenn sie nicht auf seine Forderungen eingeht. Bevor es vor Gericht ging, wurde versucht, die Situation mit Beratungen zu klären. Ohne Erfolg. Nun muss ein Richter über den Fall entscheiden.
Trotz Fortschritt immer noch Probleme
In der Zwischenzeit hat die Frau eine Gegenklage gegen K. eingereicht und behauptet, sie habe einen digitalen Türspion, einen Alarmsensor und eine intelligente Videotürklingel installieren müssen, um sich vor seinen Belästigungen zu schützen. Sie sagte, er sei ständig bei ihr zu Hause aufgetaucht.
Der Fall beschreibt ein Problem, mit dem viele Frauen weltweit konfrontiert sind: Ein Nein wird oftmals nicht akzeptiert. Diesen Punkt nimmt auch die Organisation «Aware Singapore» auf. «Frauen schulden Männern weder ihre Zeit noch ihre Aufmerksamkeit, geschweige denn ihre Freundschaft, Liebe, sexuelle Aktivität oder emotionale Unterstützung. Der Versuch, diese Dinge über den rechtlichen Weg zu erzwingen, kann auch schon als Belästigung gewertet werden.»
Singapur belegt im Global Gender Gap Report 2022 des Weltwirtschaftsforums den 49. Platz und ist damit nach den Philippinen das Land mit dem zweithöchsten Grad an Gleichstellung in Asien. Doch wie viele andere Industrienationen hat auch Singapur mit Sexismus und Frauenfeindlichkeit zu kämpfen. Schreibt Blick.
* Name bekannt
9.2.2023 - Tag der konfuzianischen Weisheiten
Das mediale Sommerloch beginnt aber in diesem Jahr schon etwas früh beim Boulevardblättli von der Zürcher Dufourstrasse. Der Artikel scheint immerhin ein paar Wenige von der Blick-Community zu interessieren. In der Kommentarspalte sind einige Wortmeldungen zu sichten. So schreibt Blick-Leser Andreas Schärer um 06:48 Uhr:
«Frauen schulden Männern nichts, korrekt. Umgekehrt auch nicht...»
Das sind ja schon beinahe konfuzianische Weisheiten. Jetzt mal unter uns Intellektuellen und sonstigen SVP-Wälern*innen: Hätten Sie eine solch eloquente Wortschöpfung einem Blick-Leser zugetraut?
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Wohnungsnot in Luzern: Das sind die Rezepte der Regierungsrat-Kandidaten
Der Kanton Luzern steckt tief in der Wohnungsnot. Wie will die neue Regierung sie lösen? Das fragte zentralplus fünf Regierungsrat-Kandidatinnen am wohnpolitischen Podium des Mieterverbands Luzern.
Wohnen ist für die 240'000 Mieterinnen im Kanton Luzern zur Herausforderung geworden. Nicht nur wegen des knappen Wohnraums. Auch die steigenden Mieten und Heiz- und Nebenkosten belasten. Gleichzeitig steigen die Inflation und Teuerung. Der Mieterverband Luzern sieht grossen Handlungsbedarf.
Daher hat er am Dienstagabend zu einem wohnpolitischen Podium eingeladen. Mit dabei die fünf neuen Kandidatinnen für die kommenden Regierungsratswahlen: Ylfete Fanaj (SP), Armin Hartmann (SVP), Claudia Huser (GLP), Michaela Tschuor (Mitte) und Christa Wenger (Grüne). Sie alle streben ihren erstmaligen Einzug in der Luzerner Regierung an.
Doch zuerst müssen sie sich den Fragen von zentralplus-Redaktor Elio Wildisen stellen. Das Thema: Wie lässt sich die Wohnungsnot lösen? Und wie kann den steigenden Mieten Einhalt geboten werden? Das Podium fand bei Caritas Wohnen in der Neustadt Luzern statt.
Armutsbetroffene leiden unter Wohnungsnot
Und so sitzen an diesem Abend 50 Zuhörerinnen im hinteren Teil des Ladens, auf Stühlen, an denen Preisschilder hängen. Schnell wird klar, der Ort ist Programm. Denn armutsbetroffene Menschen leiden überproportional unter der Wohnungsnot, erklärt Caritas-Geschäftsleiter Daniel Furrer zu Beginn. Bis zu 35 Prozent ihrer Mittel geben sie für Miete und Energiekosten aus. Etwa 33'000 Menschen im Kanton Luzern sind armutsbetroffen.
Der Kanton Luzern hat Wohnungsnot, erklärt der Moderator Elio Wildisen zum Anfang. Wie wollen die Kandidaten dafür sorgen, dass Wohnen nicht zum Luxus wird?
Die Problemlage
Ylfete Fanaj (SP) klagt über ein Strukturproblem. Die Mieten hätten in den letzten 15 Jahren eigentlich sinken müssen. Stattdessen habe es seit 2006 eine Umverteilung von Mieter- zu Vermieterseite von insgesamt 78 Milliarden Franken gegeben (gemäss Studie des Mieterverbands Schweiz). «Die Regierung ist total inaktiv», kritisiert Fanaj.
Christa Wenger (Grüne) wiederum bemängelt die kantonale Immobilienstrategie. Es gehe dem Kanton hauptsächlich um den Verkauf seiner Liegenschaften. Sie wünscht sich, dass die Strategie überarbeitet wird und der Kanton seine Grundstücke selber vermietet oder aber im Baurecht abtritt – vergleichbar zu dem, was bereits für städtische Liegenschaften in Luzern gilt. «Der Kanton muss verhindern, dass kantonale Liegenschaften zu Rendite-Objekten werden.»
Die Frage der Rendite
Die Frage der Rendite ist an diesem Abend stark umstritten. Schlagen die Vermieter unverhältnismässig Rendite auf den Mietzins? Der SVP-Kandidat Armin Hartmann winkt ab. Das Gesetz kenne eine zulässige Maximalrendite, betont der Präsident des Hauseigentümerverbands Luzern. Das heisst: Höhere Mieten seien das Resultat von höheren Baukosten, und nicht der willkürlichen Mieterhöhung der Vermieter geschuldet. Ziel müsse es also sein, die Baukosten zu senken.
Die Kandidatinnen von SP und Grünen widersprechen resolut. «Die steigenden Mieten der letzten 15 Jahre sind nicht erklärbar, wenn alle die Rendite eingehalten hätten», sagt Christa Wenger (Grüne). Ausserdem müssten Genossenschaften mit denselben steigenden Baukosten umgehen, doch dort steigen die Mieten nicht, ergänzt Ylfete Fanaj (SP).
Privat oder Kanton?
Armin Hartmann (SVP) ist überzeugt: «Die Privaten müssen Teil der Lösung sein, der Staat kann es nicht alleine machen.» Ziel sei es, schnell mehr Wohnraum zu bauen. Dafür brauche es Verdichtung und schnellere Verfahren für Private. «Wir wollen den Kanton möglichst raushalten», so Hartmann.
Claudia Huser (GLP) sieht die Gemeinden in der Verantwortung, für geeignete politische Rahmenbedingungen zu sorgen. Wie die SVP fordert auch sie, dass vorwiegend Private die Wohnungsnot lösen. «Der Kanton soll ein koordinative Rolle übernehmen», erklärt sie.
Die Wikoner Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor (Mitte) will den Kanton in die Verantwortung nehmen. Sie schlägt einen «Blumenstrauss an Massnahmen» vor. Mit dem Raumplanungsgesetz, der Förderung von Wohnbaugenossenschaften und der spezifischen Unterstützung von Personen mit tiefen Einkommen. «Wir wollen Personen, die armutsgefährdet sind, speziell unterstützen.»
Kantonale Formularpflicht
Im Zusammenhang mit steigenden Mietzinsen gibt es im Kanton Luzern seit rund einem Jahr eine Unterstützung für die Mieter. Wegen der Volksinitiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!» müssen Vermieterinnen beim Mieterwechsel den Mietzins der Vormieterin angeben. Steigt die Miete zu stark, kann sich die neue Mieterin vor der Schlichtungsbehörde beschweren.
Die Kandidaten sind darüber gespalten. Armin Hartmann sieht den Schritt zur Formularpflicht immer noch kritisch. Steige der Referenzzinssatz, müsse dieser direkt an die Mieterin weitergegeben werden, weil das beim Mieterwechsel nicht eingeholt werden kann. Heisst konkret: Mieten steigen künftig während eines Mietverhältnisses, prognostiziert Hartmann. Und er betont, dass es kaum Fälle vor der Schlichtungsbehörde gibt, weil es unter den Vermieterinnen nur wenig «schwarze Schafe» gibt, die den Mietzins ungerechtfertigt anheben.
Ganz anders sieht es Christa Wenger von den Grünen: «Das Verhältnis von Mieterin und Vermieterin ist nicht auf Augenhöhe. Die Formularpflicht ist eine Möglichkeit für ein wenig mehr Augenhöhe.»
Einigkeit bei Einsprachen
Relativ einig ist sich das Podium dagegen, dass die Einsprachen aus der Bevölkerung ein Bremsklotz sind. «Die ewigen Einsprachen verhindern Innovation und drücken die Investoren vom Markt», sagt Michaela Tschuor. Sie alle wünschen sich schnell mehr Wohnraum – dieser Konsens wird deutlich.
Die Konfliktlinien aber auch: Wer ist für Wohnraum verantwortlich? Kanton oder Gemeinde? Schlagen die Vermieter ungerechtfertigte Renditen auf den Zins? Ja oder Nein? Und was soll eigentlich gefördert werden? Genossenschaften, gemeinnütziger Wohnraum oder lediglich schnellere Verfahren für Private? Schreibt ZentralPlus.
8.2.2023 - Tag des zusammengestanzten Wortmülls
«Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd.» Das fälschlicherweise immer wieder Otto von Bismarck zugeschriebene Zitat, vermutlich geprägt vom liberalen Abgeordneten des Deutschen Reichtstags Louis Constantin Berger Witten, trifft trotz umstrittener Herkunft den Nagel auf den Kopf.
So ziemlich alle Statements der Kandidaten*innen, die den akuten Wohnungsmangel in Luzern beheben sollen, basieren entweder auf bedenklichem Unwissen oder gar bewusster Täuschung. Dass Wohnbaugenossenschaften höhere Baukosten nicht weitergeben, fällt unter eine dieser beiden Kategorien.
Die Baukosten zu senken ist ja ein hehres Ziel. Aber leider in der Praxis nicht durchführbar. Steigende Löhne für die Bauarbeiter*innen beispielsweise sind unantastbar. Auch Grundstückpreise und die Preise für sämtliche Baumaterialien werden einzig und allein vom vielgeschmähten Markt geregelt. Da führt kein Weg vorbei.
Dass der Staat gewisse Kernaufgaben ausüben muss, ist unbestritten. Bezahlbarer Wohnraum ist nur eine dieser Kernaufgaben. Dass der Staat aber auch nicht immer alles richtig macht, dokumentiert ein (beweisbares!) Beispiel aus der Stadt Luzern.
Eine externe Liegenschaftsverwaltung aus dem Kanton Zürich inserierte in den Luzerner Medien vor knapp zwei Jahren eine seit Monaten leerstehende 3-Zimmer-Wohnung zum Preis von 1'800 Franken pro Monat an zentraler Lage in der Stadt Luzern. Als sich eine Flüchtlingsfamilie mit ein paar Kindern für eine Besichtigung der Wohnung anmeldete, wurde die Hauswartung der entsprechenden Liegenschaft von der Verwaltung angewiesen, dem Ehepaar bei der Wohnungsbesichtigung den Preis von etwas über 2'000 Franken zu nennen. Auf die Frage der Hauswartung an die Verwaltung, warum die Wohnung nun plötzlich über Nacht mehr als zehn Prozent teurer sei, erhielt sie die lapidare Antwort: «Weil die Stadt Luzern (bzw. das Sozialamt) für diese Flüchtlingsfamilie mit ihren Kindern genau diesen Preis zulässt.»
Natürlich muss der Staat bezüglich Mieten im Sozialhilfebereich Maximalpreise vorgeben, die sich nach der Anzahl Kinder einer Familie richten. Das ist alles andere als ein Staatsversagen sondern gesetzlich vorgeschriebene Pflicht. Dass hingegen niemand der zuständigen Behörde den marktkonformen und auf dem Wohnungsmarkt inserierten Wohnungspreis beim Abschluss eines Mietvertrages nachprüft und sich über den Tisch ziehen lässt, ist schlicht und einfach eine Schlamperei.
Auch wenn die Kandidatenrunde vom Mieterverband moderiert wurde, sind sämtliche Aussagen der Politkandidaten vernachlässigbar. Zu Sätzen zusammengestanzter Wortmüll. Die ganze Diskussion wird beherrscht von ideologischen Denkansätzen und parteipolitischem Klientel-Gesülze. Mann/Frau will ja schliesslich gewählt werden.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Teilzeitarbeit und Geschlecht – Studie zeigt: Noch immer soll der Mann die Familie ernähren
Väter sollen mehr arbeiten als Mütter: Dieser Meinung sind laut Studie zu Teilzeitarbeit die Mehrheit der Befragten – unabhängig des Geschlechts.
Die Realität der Befragten sieht so aus: In der Praxis arbeiten die Mütter von betreuungspflichtigen Kindern im Durchschnitt 55 Prozent, die Väter 91 Prozent. Doch eigentlich finden sie, dass das ideale Arbeitspensum für Väter von schulpflichtigen Kindern 80 Prozent beträgt. Darin sind sich beide Geschlechter einig.
Wie die Studie des Forschungsinstituts Sotomo weiter zeigt, sind sich beide Geschlechter auch einig, dass Mütter weniger arbeiten sollten als Väter – das Familienmodell mit dem Mann als Haupternährer findet also noch immer Anklang.
Kleine Unterschiede gibt es aber bei der Frage nach dem perfekten Erwerbspensum für Mütter. So halten Frauen bei Müttern von schulpflichtigen Kindern ein 60-Prozent-Pensum für ideal, Männer ein 50-Prozent-Pensum. Mütter von Kleinkindern sollen nach den Vorstellungen der Teilnehmerinnen 50 Prozent arbeiten, die männlichen Befragten halten 45 Prozent für ausreichend.
Wie die Studie-Macher schrieben, bevorzugten Personen mit Hochschulabschluss, jüngere Menschen sowie solche, die linken Parteien näher stehen, egalitäre Aufteilungen der Erwerbsarbeit.
Linke arbeiten nicht weniger als Rechte
Entgegen den gängigen Vorurteilen arbeiteten Paare und Eltern, die linken Parteien nahestehen, insgesamt nicht weniger als solche, die der SVP nahestehen. Auch gaben Personen, die der SVP nahestehen, mit 56 Prozent das tiefste Wunschpensum für den Fall an, dass sie finanziell ausgesorgt hätten.
Allerdings sind in dieser Frage die Unterschiede zwischen den politischen Lagern relativ klein – im Durchschnitt wollten die Befragten drei Tage pro Woche arbeiten, wenn das Geld keine Rolle spielen würde.
Kinderlose sollen Pensum erhöhen
Schwer hat es laut der Studie die Forderung, wegen des zuspitzenden Fachkräftemangels die Erwerbsbeteiligung von Müttern zu erhöhen. Es sei sogar die Gruppe, welche die Befragten zuletzt in die Pflicht nehmen würden.
Hingegen begegnen kinderlose Teilzeitarbeitende gewissen Vorbehalten. So sind knapp 50 Prozent der Befragten der Meinung, dass kinderlose Teilzeitarbeitende ihr Pensum aufstocken sollten, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zudem sprach sich eine deutliche Mehrheit dafür aus, dass eigentlich gutverdienende Teilzeitarbeitende keinen Anspruch auf Vergünstigungen bei den Kita-Kosten oder Krankenkassenprämien haben sollten.
Deutliche Mehrheit für Viertagewoche
Insgesamt attestieren die Studienmacher bei den Befragten «ein beträchtliches Spannungsfeld» betreffend ihrer Einstellung zur Teilzeitarbeit. So sei eine Mehrheit der Meinung, dass angesichts des Fachkräftemangels eigentlich mehr gearbeitet werden müsste. Aber: Mehr als Zweidrittel der Befragten, finden «dass wir in der Schweiz eigentlich zu viel arbeiten».
Dieses Spannungsfeld führe zu scheinbar widersprüchlichen politischen Forderungen. So befürworten die Befragten mehrheitlich einen garantierten Kita-Platz für alle und eine finanzielle Unterstützung von Eltern, die ihre Kinder selber betreuen. «Die Bevölkerung spricht sich für die Unterstützung von Familien aus, unabhängig von der Wirkung auf die Erwerbsbeteiligung», schrieben die Studienmacher.
Als familienfreundlich interpretieren die Urheber der Studie auch das deutliche Ja zur Viertagewoche: Rund Zweidrittel der Befragten unterstützten eine solche Verkürzung der regulären Arbeitswoche. Schreibt SRF.
7.2.2023 - Tag der Evolution
Ein Hauch von Taliban weht halt immer noch durch die menschlichen Gesellschaften dieser unserer Erde: Die Frauen gehören an den Herd. Aber wir Mannsbilder sollten trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft blicken: Die Evolution wird's richten. Dauert halt ein paar Hunderttausend Jahre. Um von den Bäumen herunterstiegen, dauerte es noch viel länger. Vom Klopapier ganz zu schweigen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Pilatusplatz ruft Luzerner Hochhaus-Gegner auf den Plan
Der Verein Stadtbild Luzern hat eine Einsprache gegen das geplante Hochhaus auf dem Pilatusplatz eingereicht. Ein Blick auf den Bundesplatz zeigt, dass nun ein jahrelanger Rechtsstreit droht.
Das Gestänge verrät es: Mit dem Bauprojekt auf dem Pilatusplatz in Luzern soll es nun endlich vorwärts gehen. Denn es ist zwar schon seit vielen Jahren klar, dass auf diesem Platz einst ein Hochhaus stehen wird. Doch seit dem Abriss der «Schmitte» im Jahr 2011 liegt das Areal brach. Eine Überbauung hat sich wieder und wieder verzögert.
Und die Chancen, dass das Hochhaus-Projekt reibungslos vorankommt, stehen schlecht. Bis Ende 2022 lag der Gestaltungsplan von «Lu Two», das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs, öffentlich auf.
Und wie Stefan Mathys, Sprecher der für das Projekt verantwortlichen Senda Immobilien AG, auf Anfrage bestätigt, gibt es Gegenwind: «Es gab ein paar wenige Einsprachen. Mit den Einsprechern ist Senda Immobilien derzeit im Austausch.»
Verein Stadtbild wehrt sich gegen Hochhaus
Wie sich das auf den Zeitplan auswirkt, hänge vom Ausgang der Gespräche ab. Das Immobilienunternehmen will bereits im kommenden Frühling mit dem Bau des neues Gebäudes beginnen. 2027 soll es bezugsbereit sein – rund zwei Jahre später, als bei der erstmaligen Präsentation des Bauprojekts verkündet.
Doch der Baustart in rund einem Jahr ist mehr als fraglich. Denn wie eine Anfrage zeigt, stehen die Bauherren bei den Einspracheverhandlungen einem hartnäckigen Gegner gegenüber: dem Verein Stadtbild Luzern. Dieser bestätigt gegenüber zentralplus, sich gegen das geplante Hochhaus zu wehren. Der Verein hat gemeinsam mit Anwohnern eine Einsprache gegen das Projekt gemacht.
Die Einsprache kommt nicht ganz überraschend, weil der Verein schon 2020 nach Bekanntgabe des Siegerprojekts verkündete, sich dagegen zur Wehr zu setzen und in der Nachbarschaft mit Flyern für seine Anliegen warb. Und der Verein ist in Luzern kein Unbekannter. Zwar gibt die Webseite keinen Aufschluss darüber, wer hinter dem Verein steckt. Bekannt ist aber, dass der Verein auf die Unterstützung des Anwalts Viktor Rüegg zählen kann, seines Zeichens bekennender Gegner des Pilatus-Towers im Krienser Mattenhof.
Wiederholt sich die Bundesplatz-Geschichte?
Die Kritik des Vereins an Hochhäusern hat eine mehrjährige Vergangenheit. 2014 lancierte der Verein die Hochhaus-Initiative, um den Bau von Hochhäusern im Stadtzentrum zu verbieten. Doch die Initiative wurde 2015 in einem Gutachten der Universität Bern für ungültig erklärt. Das hinderte den Verein aber nicht daran, sich gegen Hochhäuser im Zentrum zu wehren.
So hat «Stadtbild Luzern» 2018 eine Einsprache gegen das geplante Hochhaus am Bundesplatz gemacht. Der Stadtrat wies die Einsprache jedoch zurück, worauf der Verein beim Kantonsgericht eine Beschwerde gegen diesen Entscheid einreichte.
Dort kassierte die Stadt Luzern eine Klatsche. Denn das Kantonsgericht hiess die Beschwerde des Vereins gut. Das Gericht monierte, dass die Stadt nicht ausreichend geprüft hat, in welcher Art und Weise der Neubau die benachbarten Bauten und das Ortsbild beeinflussen. Die HRS Real Estate AG, Eigentümerin des Grundstücks, zog wiederum den Entscheid des Luzerner Kantonsgerichts weiter vors Bundesgericht. Dessen Entscheid ist noch hängig.
Verein befürchtet Verschwinden der Spitalmühle
Wird nun also auch das Projekt auf dem Pilatusplatz zum Zankapfel? Zumindest die Ausgangslage präsentiert sich ähnlich. Der Verein kritisiert hier wie am Bundesplatz, dass sich das Hochhaus nicht ins Ortsbild integriert. Wie eine Sprecherin des Vereins auf Anfrage schreibt, tangiere das Hochhaus mehrere schützens- und erhaltenswerte Gebäude, die Teil des kantonalen Bauinventars und des Bundesinventars schützenswerter Ortsbilder (Isos) sind.
Insbesondere die beiden rot-weissen Fachwerkhäuser am Pilatusplatz seien durch das Projekt betroffen. Die Spitalmühle und dessen Nebengebäude stammen aus dem 17. Jahrhundert. Das kantonale Bauinventar würdigt die Spitalmühle wie folgt: «Durch seine Konstruktionsart und seinen architektonischen Reichtum ist der Bau eine Seltenheit im innerstädtischen Raum.»
Eine Seltenheit, die aus Sicht des Vereins Stadtbild Luzern, verdrängt würde: «Ein Gebäude mit dem geplanten Volumen würde die beiden Baudenkmäler komplett zum Verschwinden bringen», kritisiert der Verein. «Der Ortsbildcharakter am Pilatusplatz würde zudem zukünftig klar durch das Hochhaus dominiert, statt von den bundesrechtlich geschützten Isos-Bauten.»
Gutachten der Denkmalpflege soll Klarheit schaffen
Dabei ist das Nebengebäude der Spitalmühle am Mühlebachweg 8 fester Bestandteil des Projekts «Lu Two». So soll das Haus zu einem Café umgenutzt werden und den Innenhof des neuen Gebäudes beleben. Diesem kommt in den Plänen der Investoren die Rolle als neuer Quartier-Treffpunkt zu.
Doch bis es so weit ist, fliesst noch viel Wasser den unterirdischen Krienbach am Pilatusplatz hinunter. Konkret fordert der Verein Stadtbild Luzern ein Gutachten der eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege. Sie soll unabhängig beurteilen, wie sich der geplante Neubau auf das Ortsbild am Pilatusplatz auswirkt.
Gleichzeitig bemüht sich der Verein um ein weiteres Gutachten des ehemaligen städtischen Denkmalpflegers André Meyer. Dieser war zuletzt im Dezember des vergangenen Jahres in der Öffentlichkeit, als er das Siegerprojekt für das neue Luzerner Theater kritisierte. Seiner Meinung nach gliedert sich das Projekt ungenügend ins Stadtbild ein. Es ist darum kaum ein Zufall, dass sich der Verein Stadtbild Luzern ausgerechnet bei ihm um ein denkmalpflegerisches Gutachten zum Pilatusplatz bemüht. Schreibt ZentralPlus.
6.2.2023 - Tag der ganz normalen Angelegenheiten
Es ist in einer Demokratie eine ganz normale Angelegenheit, dass gegen den Bau von Hochhäusern in einer Stadt wie Luzern Einsprachen erhoben werden. Der Baubeginn verzögert sich damit in der Regel um Jahre. Im gleichen Mass erhöhen sich aber auch die Baukosten. Und damit die Mieten oder, falls Eigentumswohnungen geplant sind, die Preise für das Wohneigentum.
Die teilweise exorbitanten Preissprünge könnten durch rasche Entscheidungen vermieden werden. Was wiederum auch nichts anderes als gelebte Demokratie ist, solange die Beschlüsse nicht in Hinterzimmern gefasst werden.
Die wunderbaren – manchmal auch etwas sonderbaren – Experten und Denkmalschützer müssen schlicht und einfach zusammen mit den Behörden der Stadt entscheiden, ob der eklatante Wohnungsmangel in der Stadt Luzern zukunftsgerecht bekämpft werden soll oder ob der Blick auf historische Gebäude aus jedem erdenklichen Blickwinkel wichtiger ist. Was übrigens früher, als die Traditionsbeiz «Schmitte» noch stand, auch nicht zu Hundert Prozent der Fall war. Zumal der Pilatusplatz ein Verkehrsknotenpunkt par excellence ist. Ob man aus fahrenden Autos wirklich historisch bauliche Schönheiten betrachtet, darf bezweifelt werden. So viel Ehrlichkeit sollte schon sein.
Einen für alle beteiligten Parteien verträglichen Kompromiss zu schmieden, dürfte in vorliegendem Fall relativ einfach sein. Damit könnte sehr viel Geld gespart werden. Man muss es nur tun. Kommende Mieter*innen oder Wohnungsinhaber*innen wären jedenfalls dafür dankbar.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Wir fordern Raumschiffe mit Warp-Antrieb

Wir fordern Raumschiffe mit Warp-Antrieb
Cartoon: Oliver Schopf. Bild DER STANDARD
5.2.2023 - Tag der tausend Worte
Bilder sagen oft mehr als tausend Worte. Cartoons erst recht.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Olympische Keule gegen die Ukraine
Es gibt Themen, da geht sich kein Für und Wider, kein Pro und Kontra aus. Da ist Haltung gefragt. Der Krieg, den Russland gegen die und in der Ukraine angezettelt hat, ist ein solches Thema. All jene, die da immer noch und nicht selten zur Gewinnmaximierung ihre Geschäfte mit Russland treiben, möchte man fragen, ob sie schon völlig abgestumpft sind oder einfach nur die Augen verschließen. Ob sie die russischen Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung wirklich ausblenden können.
Zu den großen Geschäftetreibern zählen große Sportverbände, auch sie wollen sich ihr Business vom Krieg ganz sicher nicht ruinieren oder auch nur eindämmen lassen. Russland diente dem Fußballweltverband Fifa, dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und anderen Institutionen jahrelang als verlässlicher Veranstalter, mit dem sich Geld scheffeln ließ. Das war so bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi, die praktisch unmittelbar in die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim mündeten. Das war so mehr als vier Jahre später, bei der Endrunde der Fußball-WM.
Schnelles Ende des olympischen Friedens
Auch im Februar 2022 hatte Wladimir Putin das Ende der Winterspiele in Peking abgewartet, ehe er wieder und noch brutaler über die Ukraine herfiel. Um den olympischen Frieden ging es ihm nicht, er wollte bloß den Chinesen nicht in die Suppe spucken.
Die Bosse von IOC und Fifa, Thomas Bach und Gianni Infantino, und die Bosse etlicher anderer Sportinstitutionen haben sich Putin und seinen Vasallen angebiedert. Man erinnere sich an den ehemaligen Präsidenten des Eishockeyweltverbands (IIHF), den Schweizer René Fasel, der den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko umarmte, als dieser die Aufstände gegen seine geschobene Wiederwahl brutal niederschlagen ließ. Minsk, die belarussische Hauptstadt, sollte gemeinsam mit Riga, der lettischen, die Eishockey-WM 2021 veranstalten. Erst als der internationale Druck zu groß wurde, rückte Fasel von Lukaschenko ab, und Riga trugt die WM allein aus.
Jetzt singen Bach und Konsorten das Lied von den russischen Sportlerinnen und Sportlern, die nichts können für ihre Herkunft. Sie singen, dass nicht der Reisepass darüber entscheiden sollte, wer an Olympischen Spielen teilnimmt und wer nicht. Sie singen, dass ein kategorischer Ausschluss Russlands dem einen oder der anderen die einmalige Chance auf eine Olympiateilnahme oder gar eine Medaille verbauen und deshalb eine Menschenrechtsverletzung bedeuten würde. Blanker Zynismus. "Die Athletinnen und Athleten sollen nicht leiden", sagte Peter Mennel, der Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC), im STANDARD-Interview.
Verurteilte ukrainische Boykottdrohung
Vor wenigen Tagen wurde in der Ukraine der 22-jährige Leichtathlet Wolodymyr Androschtschuk, ein herausragendes Talent im Zehnkampf, zu Grabe getragen. Er hatte sich freiwillig gemeldet, um seine Heimat gegen den russischen Aggressor zu verteidigen. Wer singt sein Lied, wer singt das Lied von Wolodymyr Androschtschuk?
Die von Russland in der Ukraine verletzten Menschenrechte fallen bei den Olympiern, scheint's, unter den Tisch. Das IOC verurteilt nun sogar eine ukrainische Boykottdrohung für den Fall, dass russische Aktive in Paris 2024 teilnehmen dürfen. Ein Boykott wäre für das IOC ein "Verstoß gegen die olympische Charta". Man glaubt es nicht, das IOC schwingt die Keule gegen die Ukraine. Allerdings wird mittlerweile in immer mehr anderen Ländern, etwa in Polen, Deutschland, Finnland und im Baltikum, Kritik an den IOC-Plänen laut.
Das alles war so vorhersehbar und wurde doch in Kauf genommen. Sollte Paris 2024 tatsächlich von einem Boykott – sei es durch die Ukraine, sei es in größerem Rahmen – überschattet werden, so wäre dieser ganz sicher nur auf einem Mist gewachsen. Auf dem Mist des IOC. Schreibt DER STANDARD.
4.2.2023 - Tag der gigantischen Geldmaschine IOC
Das IOC, gegründet am 23. Juni 1894 mit (von Steuern befreiten Sitz) in Lausanne, hat seine Unschuld spätestens 1936 bei den Olypmpischen Winter- und Sommer-Spielen von Adolf Hitler verloren, sofern es überhaupt je eine hatte.
Inzwischen hat sich die nichtstaatliche Organisation ähnlich der Fifa zu einer gigantischen Geldmaschine entwickelt, deren Dimension, Macht und Widerwärtigkeit alle Vorstellungen sprengt und mit den im olympischen Wertekanon gepredigten Werten nichts mehr zu tun hat.
Wer einem Diktator wie Hitler in den Arsch kriecht, hat logischerweise auch keine Hemmungen, Zungenküsse mit Xi Jinping oder Putin auszuteilen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Pentagon sichtet chinesischen Spionageballon über den USA
Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Der Ballon sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA entdeckt worden, teilte das Pentagon mit. Es soll nicht der erste Vorfall dieser Art im Luftraum über den USA gewesen sein.
Die Flugbahn des Ballons werde genau verfolgt, erklärt das Pentagon. Er befinde sich noch immer über den Vereinigten Staaten. Man habe erwogen, ihn abzuschiessen, sich dann aber dagegen entschieden, wegen der Gefahr durch herabfallende Trümmer.
«Sicher, dass Ballon aus China stammt»
Nach der Entdeckung des Ballons habe die Regierung umgehend Massnahmen ergriffen, um die Preisgabe von sensiblen Informationen zu verhindern, sagte Pentagonsprecher Pat Ryder. Man sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme.
Schon in der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Der Unterschied sei diesmal, dass sich der Ballon länger als sonst über den USA aufhalte. Der Ballon stelle keine militärische Bedrohung oder Gefahr für Menschen am Boden dar, sagte Ryder.
Für Flugzeuge ist der Ballon laut dem Pentagon aufgrund seiner grossen Flughöhe ungefährlich. Die USA stünden mit China bezüglich des Vorfalls in Kontakt.
Wie im Spionagefilm
«Die Absicht dieses Ballons ist eindeutig, Informationen zu sammeln», sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der nicht genannt werden wollte, über die Aktion.
Washington habe den Ballon seit seinem Auftauchen im amerikanischen Luftraum auch mit bemannten US-Militärflugzeugen beobachtet. Schreibt SRF.
3.2.2023 - Tag der Panoramasicht mit Schlitzaugen
Wozu eigentlich einen Ballon, wenn man angeblich mit Schlitzaugen eine Panoramasicht haben soll?
Nur so nebenbei: Die These der «Panoramasicht» wird von einem Asiaten in Luzern verbreitet. Nicht wenige glauben ihm.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
«Staatsgefährder» – Kickl beschimpft Van der Bellen, weil der den Ukraine-Krieg verurteilt
Alexander Van der Bellen macht Schluss mit der Putin-Versteherei, die so lange die österreichische Außenpolitik dominiert hat. Bei seinem Solidaritätsbesuch in Kiew sagte das österreichische Staatsoberhaupt: Russland führe einen "Kolonialkrieg", vergleichbar mit jenen des 19. Jahrhunderts.
Dazu muss man wissen, dass keineswegs nur die westlichen Mächte Kolonialkriege führten, sondern dass die Sowjetunion und Russland das Ergebnis von brutalen Eroberungen in Zentralasien, dem Kaukasus und Osteuropa waren und sind. Der Angriff auf die Ukraine ist russischer Spätimperialismus. Van der Bellen sagte, die Bevölkerung sei vor die Wahl gestellt worden: "Entweder akzeptiert ihr, eine Provinz Russlands zu sein, die von Moskau aus regiert wird, oder es ist alles kaputt."
Van der Bellen macht sich über die Natur des russischen Regimes und die Auswirkungen auf das freie Europa keine Illusionen (mehr). Deswegen nennt ihn der radikalisierte Herbert Kickl einen "Staatsgefährder", der die Entscheidung für den Kiew-Besuch offenbar "einsam im Machtzirkel der EU- und Nato-hörigen Eliten" getroffen habe. Eine Formulierung, die nur den Schluss zulässt, dass die Kickl-FPÖ geistig bereits aus der EU ausgetreten ist und sich mit anderen ultrarechten europäischen Parteien an Putin kuschelt. Da gab’s ja einmal einen Freundschaftsvertrag.
Kickl will Österreich in die Isolation treiben. Wer ist da "Staatsgefährder"? Fragt Hans Rauscher im STANDARD.
2.2.2023 - Tag der politischen Verkommenheit
Der unsägliche Kickl will österreichischer Kanzler werden. Seine Chancen auf diesen Job stehen nicht schlecht. Er führt nämlich mit seiner Partei FPÖ derzeit alle Umfragen bei der «Sonnntagsfrage» in Österreich an. Einen Koalitionspartner hat die FPÖ bis jetzt noch immer gefunden, auch wenn alle bisherigen Regierungen mit Beteilung der FPÖ krachend gescheitert sind.
Krisen, Zeitenwenden, gesellschaftliche Veränderungen und Unzufriedenheit mit den herrschenden Eliten in weiten Teilen der Bevölkerung sind und bleiben das Elixier der Populisten. Das war schon immer so und wird heutzutage noch durch die Tatsache verschärft, dass sich die Frustrierten, Mühseligen und Beladenen ihre Informationen mehrheitlich nur noch über die Echokammern der Sozial Media-Portale beschaffen. Die klassischen Medien mit ihrem Einheitsbrei aus Agenturmüll und schwarz/weiss-gefärbtem Gefälligkeits- und Klienteljournalismus sind an dieser Entwicklung nicht unschuldig.
Doch bevor wir jetzt zähnefletschend über den stramm rechtspopulistischen Herrn Kickl herfallen, sollten wir in uns fragen, wie viele «Putin-, Russland- und Nazi-Versteher» hierzulande ihr Unwesen treiben? Es sind nicht wenige.
Herr Köppel von der SVP, der nebst Putin auch den Nazi-Führer Hermann Göring anhimmelt und verharmlost, ist nur einer davon. Die Verkommenheit des SVP-Nationalrats wird das Schweizer Wahlvolk allerdings im kommenden Herbst bei den National- und Ständeratswahlen nicht daran hindern, die SVP wieder zur stärksten Partei im Parlament zu wählen.
Sie sehen: Wir sind gar nicht so weit von Österreich entfernt. Weder räumlich noch geistig.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Lässt sich mit Cancel Culture und Wokeness Politik machen?
Die SVP kämpft nun offiziell gegen Wokeness. Das Thema birgt politischen Zunder und hat laut einem Experten Potenzial.
Im Wahljahr 2023 wird ein Thema, das sich bislang vornehmlich in den Seiten des Feuilletons abgespielt hat, auch die Stammtische im Land bewegen. Davon ist zumindest die Basis der grössten Partei des Landes überzeugt. Die Delegierten der SVP haben sich im neuen Parteiprogramm dem Kampf gegen Wokeness und Cancel Culture verschrieben. Doch was hat es mit diesen Phänomenen auf sich, und wie stark eignen sie sich als Wahlkampfthemen?
Entstanden sind die Begriffe vor rund zehn Jahren in den USA. An Universitäten mehrten sich damals die Rufe, Werke problematischer Herkunft wegen der Vergehen ihrer Autoren zu boykottieren. Es kam zu teils spektakulären Protesten mit zerstörten Denkmälern. Von Social-Media-Influencern über die Bestseller-Autorin J.K. Rowling hin zu gleich mehreren bekannten Komikern: Die Liste «Betroffener» ist lang.
Von den Universitäten schwappte das Thema in die nationale Politik über. Eine der bekanntesten Stimmen der amerikanischen Linken, Alexandria Ocasio-Cortez, spricht im Interview mit dem «New Yorker» von rechten Kampfbegriffen. Ähnlich sieht dies der deutsch-amerikanische Sprachwissenschaftler Adrian Daub, der ein viel beachtetes Buch zum Thema geschrieben hat. Es handle sich bei der Cancel Culture um einen politischen Diskurs, der seit Jahrzehnten von einer gut finanzierten Rechten vorangetrieben werde.
Wird sich das Thema also auch in der Schweiz durchsetzen? Gemäss Politanalyst Mark Balsiger sieht es – zurzeit zumindest – nicht so aus. Das Sorgenbarometer der CS zeige, dass das Thema die Schweizerinnen und Schweizer derzeit nicht gross beschäftige. Themen wie der Klimawandel, die Altersvorsorge oder die Beziehung zu Europa seien wichtiger. «Die SVP geht also ein Wagnis ein, mit Gender und Woke in den Wahlkampf zu ziehen», so Balsiger.
Interessant ist für den Kampagnenexperten, dass in rot-grün dominierten Städten zwar eine Affinität für die Anliegen des Wokeismus vorhanden sei, das Thema aber nicht aktiv bewirtschaftet werde.
Ein eher einseitig geführter Diskurs
Während aus der politischen Linken also wenig zu hören ist von Cancel Culture und Wokeness, fürchten sich ihre Kritiker auf bürgerlicher Seite umso mehr vor Denkverboten oder einer negativen Schweigespirale.
Für Aufsehen sorgte diesbezüglich vor zwei Jahren der deutsche Politikwissenschaftler Richard Traunmüller mit den Ergebnissen einer Befragung von Studentinnen und Studenten. Darin zeigte er auf, dass eine Mehrheit der Befragten Verboten im Sinne der Cancel Culture positiv gegenüber stehen. Für Traunmüller ist deshalb klar, dass es sich um ein politisch fassbares Phänomen handle.
Bei der Kritik, die auf die Veröffentlichung der Studie folgte, zeigte sich ein deutliches Rechts-links-Schema. Ebendieses findet sich auch in der Forschung Traunmüllers. Wie die Menschen auf den Begriff der Cancel Culture reagieren, verlaufe entlang eines Gradienten. «Auf bürgerlicher Seite ist die Empörung grösser. Wer weiter links steht, tendiert dazu, in der Cancel Culture kein Problem zu sehen», so der Politikwissenschaftler gegenüber SRF.
Genau diese Leidenschaft, die das Thema bei einigen auslöse, könnte ihm längerfristig denn auch zum Erfolg verhelfen, glaubt Mark Balsiger. «Themen wie Gender, Woke und kulturelle Aneignung sind hochemotional und werden uns eine lange Zeit beschäftigen. Eine Lösung in diesem Konflikt ist nämlich noch nicht in Sicht.» Schreibt SRF.
Wer sich mit der Thematik befasst, kann schnell den Überblick verlieren. Eine Auswahl an relevanten Begrifflichkeiten.
• Wokeness: Ein (grammatikalisch nicht ganz korrekt formuliertes) Adjektiv, basierend auf der Formulierung «wake up» (dt. «aufwachen»). Aufruf zum Aktivismus in Gesellschaftsfragen, wie etwa gegen Sexismus oder Rassismus.
• Cancel Culture: Aus dem Englischen «to cancel» (dt. «etwas abbrechen»). Die Redewendung begann vor rund zehn Jahren auf Twitter als Form des Protests zu zirkulieren. Ziel ist es, die Sendefähigkeit einer Person aufgrund derer als gefährlich erachteten Überzeugungen zu reduzieren.
• Political Correctness: Bevor von Cancel Culture oder Wokeness die Rede war, wurde das Phänomen in den 1990er-Jahren zum Zentrum politischer Kämpfe zwischen Rechts und Links in den USA. Verstanden wird darunter die Bemühung, potenziell verletzende Bemerkungen über Identitätsmerkmale anderer Menschen zu auf ein Minimum zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.
• Culture Wars: Ebendiese Kämpfe sind Ausdruck einer bis heute anhaltenden politischen Polarisierung im Land. Sachfragen rücken in den Hintergrund, während kulturelle oder gesellschaftspolitische Themen dominieren.
• Schweigespirale: In den 1980er-Jahren von der deutschen Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann entworfenes Konzept, wonach Medien das Meinungsklima in der Gesellschaft durch eine verstärkte Wiedergabe gewisser Meinungen verzerrt wiedergeben können. Wer diese Meinungen nicht vertritt, fühlt sich in der Minderheit und schweigt. Das Konzept wird seither kontrovers diskutiert.
Quellen: Merriam Webster Dictionary; Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
1.2.2023 - Tag der Partei des Oligarschen vom Herrliberg
Die Schweiz: Ein einig Land von glücklichen Brüdern und Schwestern, in dem Milch, Honig und Happyness im Überfluss fliesst. Das Glück der Bevölkerung könnte umfassender nicht sein. Wären da nicht ein paar Gendersternchen und die Ablehnung von Sexismus und Rassismus in einigen Teilen der Bevölkerung.
Erstmals* seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs tobt in Europa seit einem Jahr ein mörderischer Angriffskrieg. Mit verheerenden Folgen, Auswirkungen und Verwerfungen für alle europäischen Staaten. Angefangen von Fluchtbewegungen in einer Grössenordnung, wie wir sie in Europa seit Dekaden nie mehr erlebt haben. Weil halt wirklich alles mit allem zusammenhängt, herrscht inzwischen beinahe weltweit eine Inflation, die sich bei einigen europäischen Ländern längst in zweistelliger Höhe präsentiert. Die Preise für Energie und Lebensmittel sowie Wohnungsmieten explodieren.
Und bei all diesen gesellschaftlichen Verwerfungen hat die stimmenmässig grösste und erfolgreichste Partei der Schweiz, die SVP, nichts Besseres in Bezug auf ihre Wahlkampfthemen anzubieten als seit Jahren ausgelutschte Themen wie Migration und ihre Obsession auf ein paar harmlose Gendersternchen. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen.
Das Verheerende für die Parlamentswahlen vom kommenden Herbst ist die Vermutung, dass die SVP einmal mehr die Themen setzt und damit sogar durchkommt. Die Konkurrenz hat diesem ebenso radikalen wie vor Dummheit strotzendem Dumpfbackengeschwätz aus teilweise elitären SVP-Kreisen nichts entgegenzusetzen. Im Gegenteil: Einige, wie beispielsweise die «Wendehalspartei»-FDP, okkupieren die SVP-Thesen und gehen sogar Listenverbindungen mit der Partei aller mühseligen und beladenen Esoterikern*innen ein.
Wäre mehr oder weniger alles vernachlässigbar. Gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens an. Doch leider ist davon auszugehen, dass die von der Allmacht träumende Partei des Oligarchen vom Herrliberg damit beim Wahlvolk durchkommt und erneut Platz eins im Hohen Haus von und zu Bern belegen wird.
*Die Jugoslawienkriege (1991 bis 2001) für einmal beiseite geschoben, weil sie nicht mit dem Zweiten Weltkrieg auf eine Stufe zu setzen sind.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Ehemaliger Kreml-Vertrauter ist sicher: «Ein Militärputsch gegen Putin ist durchaus möglich»
Immer mehr enge Vertraute wenden sich von Wladimir Putin ab. Auch ehemalige Weggefährten des russischen Präsidenten halten einen Putsch nicht für unmöglich.
Seit fast einem Jahr führt Russlands Präsident Wladimir Putin (70) Krieg in der Ukraine. Die vom Kreml geplante Kurz-Invasion des Nachbarlandes wird immer mehr zu einem Stellungskrieg – mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Zehntausende russische Soldaten haben in dem Krieg bereits ihr Leben verloren.
Für Putin wird es im Kreml immer ungemütlicher. Immer mehr seiner Vertrauten wenden sich von ihm ab. Selbst zwischen Putin und seinen engsten Kreml-Gefolgsleuten wie etwa Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin (61) soll es richtig brodeln.
Tatsächlich halten auch ehemalige Vertraute des russischen Präsidenten einen Putsch für immer wahrscheinlicher. «Der Krieg ist verloren. Die russische Wirtschaft ist am Boden», sagt etwa Putins ehemaliger Redenschreiber Abbas Galljamow in einem CNN-Interview. «Momentan denke ich, dass ein Militärputsch durchaus möglich ist.»
Putsch schon bald?
Im Interview mit dem amerikanischen TV-Sender erklärt Galljamow die Hintergründe seiner Gedanken. So würden mehr und mehr Tote nach Russland zurückkehren. «Die russische Bevölkerung wird eine Erklärung dafür fordern. Sie werden sich umschauen und denken: ‹Das kommt davon, wenn unser Land von einem alten Tyrannen, einem alten Diktator regiert wird.›»
Laut Galljamow könnte es bereits in den nächsten zwölf Monaten zu einem solchen Putsch kommen. «In einem Jahr ändert sich die politische Situation. Wenn dann ein wirklich verhasster, unpopulärer Präsident an der Spitze des Landes steht und einen unpopulären Krieg führt, wird ein Staatsstreich zu einer realen Möglichkeit. Irgendwann müssen Köpfe rollen.»
Putin könnte Wahlen absagen
In rund einem Jahr stehen in Russland ausserdem Präsidentschaftswahlen an. In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Stimmen von Experten laut, die an einer erneuten Amtszeit Putins zweifelten. Russland-Experte Ulrich Schmid etwa sagte im Gespräch mit Blick: «Putin wird bei Wahlen 2024 wohl nicht mehr antreten».
Ex-Redensprecher Galljamow könnte sich indes vorstellen, dass Putin aus Angst vor seiner Macht die Präsidentschaftswahlen einfach absagt. «Ohne Sieg gegen die Ukraine wird er beim russischen Volk in Schwierigkeiten geraten», sagt er. «Die Russen brauchen keinen schwachen Anführer. Darum könnte er die Wahlen absagen – aus Angst, als Versager dazustehen.» Schreibt Blick.
31.1.2023 - Tag des Konjunktivs
Hier dürfte wieder einmal der Wunsch Vater der Gedanken sein, die Putins Ex-Redenschreiber Abbas Galljamow im Konjunktiv zum Besten gibt. Zitieren wir Karl Valentin: «Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.»
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Kickl ist ein Feind unseres freien Lebensmodells
Liebe Leser und Leserinnen, geben Sie sich in der ORF-TVthek die ZiB 1 vom Donnerstag. In dem Beitrag über Alexander Van der Bellens Angelobungsrede im Parlament beginnt es bei Minute 2:18:
"Die Grund- und Freiheitsrechte, die Menschenrechte, die Minderheitenrechte sind unantastbar. Dieser Grundkonsens unserer Republik steht außer Frage", sagt der Bundespräsident. Starker Applaus brandet auf. Doch die Kamera erfasst zuerst die prominente FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowich in der ersten Reihe. Sie zeigt bei genau diesen Worten einen verächtlichen Gesichtsausdruck. Der FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker etwas weiter hinten schüttelt den Kopf und legt die Stirn in die Hand. FPÖ-Chef Herbert Kickl gelingt es gerade noch, seinen höhnischen Gesichtsausdruck in Zaum zu halten.
Herbert Kickl ist mit seiner FPÖ ein Feind des "Grundkonsenses dieser Republik".
Was braucht man mehr als diese blanke Verachtung von "Grund-und Freiheitsrechten" etc., dargelegt in einer gemeinsamen Sitzung beider Häuser des Parlaments? Man kann es natürlich schon lange wissen, aber der Bundespräsident hat es jetzt ganz unmissverständlich ausgesprochen: Kickl ist mit seiner FPÖ ein Feind des "Grundkonsenses dieser Republik". Man könnte es auch mit einem anderen Van-der-Bellen-Zitat aus dieser ungewöhnlichen Rede beschreiben: Kickl ist ein Feind "unseres freien, europäischen Lebensmodells".
Es wird jetzt diskutiert, ob Van der Bellen so klar hätte sein sollen. Aber seit mehr als 30 Jahren reden sich weite Teile der Politik und der Öffentlichkeit die FPÖ schön. Und sie wird gewählt: 1999 unter Jörg Haider, 26,91 Prozent. 2017 unter Heinz-Christian Strache, 25,97 Prozent. Unter Kickl liegt sie in Umfragen mit 28 Prozent an erster Stelle.
Kickl wird wahrscheinlich nicht Kanzler. Aber es gibt Konstellationen, Situationen, im Englischen "freak accidents", wo das doch passieren kann. Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdoğan und andere haben es vorgezeigt. Das passiert meist als schleichende Machtergreifung.
Autoritäres System
Die FPÖ hat ihre Wurzeln aus dem Deutschnationalismus und Nationalsozialismus nie ganz abgelegt. Sie wollte immer eine andere Republik. Der Grundkonsens der Republik nach 1945 war eine Ablehnung des Nationalsozialismus, eine Hinwendung zur Konsensdemokratie, zum Rechtsstaat, zur Toleranz, eine (langsame) Abwendung vom Rassismus und der friedliche Interessenausgleich. Und letztlich der Glaube an Europa.
Seit jeher, besonders aber seit Jörg Haider, will die FPÖ aber was anderes: ein autoritäres System, mit dem Ausschluss aller lästigen Bestände an gesellschaftlicher, kultureller, politischer Liberalität und mit der Errichtung der Herrschaft der Intoleranten, Feindseligen, von ihrer Aggressivität Lebenden. Außenpolitisch angelehnt an den Neozarismus eines Wladimir Putin und Orbán. Die FPÖ betreibt den bewussten Regelbruch, um zu zeigen, dass sie keine "Systempartei" (ein Nazi-ausdruck) ist.
Kickl wurde nach Ibiza von Sebastian Kurz als Innenminister dem Bundespräsidenten zur Entlassung vorgeschlagen. Nicht weil er zu radikal war, sondern weil Kurz ihn der schleichenden Machtergreifung verdächtigte.
Aber es heißt ja immer: Die FPÖ spricht ja echte Probleme an (Chiffre: "Ausländer"). Ja, sie spricht sie an – mit Lügen, wie die populistische Ultrarechte in Österreich und anderswo generell. Wenn man aber der Lüge nicht widerspricht, wird sie irgendwann Wahrheit. Die Demokraten müssen Lösungen für Migration etc. bieten. Aber sie dürfen genauso der Lüge nicht die Herrschaft überlassen.
Deshalb ist es notwendig, klar zu sagen, was Kickl und Co sind: Feinde des Grundkonsenses der Republik, Feinde unseres freien, erfolgreichen europäischen Lebensmodells. Schreibt Hans Rauscher in DER STANDARD.
30.1.2023 - Tag der Machtergreifungen
Heute vor exakt 90 Jahren wurde am 30. Januar 1933 Adolf Hitler als «Führer» der stimmenstärksten (!) Partei NSDAP (Nationalsozialistische Arbeiter Partei) vom greisen Staatspräsidenten Paul von Hindenburg zum Kanzler des Deutschen Reichs ernannt. Millionen von Deutschen jubelten, klatschten und erhoben ihre Hand zum Hitlergruss an diesem für die Weltgeschichte verhängnisvollen Tag. 12 Jahre später, als das «Dritte Reich» in Schutt und Asche lag, jubelte ausser den Siegermächten niemand mehr in Deutschland.
Dass Österreich ausgerechnet am Jahrestag von Hitlers Machtübernahme das Rekordergebnis der radikalen österreichischen Rechtspartei FPÖ nach der gestrigen Landtagswahl in Niederösterreich beklagen muss, ist fast schon ein Treppenwitz der Geschichte. Der «Austrofaschismus» (1933/34 bis 1938, anschliessend Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich inklusive Herrschaft der Nationalsozialisten) scheint in Österreich lebendiger denn je. Dafür sorgt die am 7. April 1956 gegründete «Freiheitliche Partei Österreichs» – kurz «FPÖ». Erster Parteiobmann und Mitbegründer der neuen Partei war der ehemalige SS-Brigadeführer Anton Reinthaller, von 1950 bis 1953 wegen nationalsozialistischer Betätigung als Schwerstbelasteter inhaftiert.
Derzeit steht die rechtsextremistische «FPÖ» in sämtlichen aktuellen Umfragen als stärkste Partei in Österreich an erster Stelle. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. War doch die Partei nach der sogenannten Ibiza-Affäre (2019) und dem darauf folgenden Rauschschmiss aus der Kurz-Regierung am Boden zerstört. Die Umfragen näherten sich einstelligen Zahlen. Doch Totgesagte leben öfters länger als man denkt. Vor allem dann, wenn das Momentum und unfähige Politiker*innen mithelfen.
Die wundersame Auferstehung der FPÖ kam schneller als man denken konnte. Coronavirus, Lockdowns, Corona-Impfung, der Zerfall des korrupten Systems von Bundeskanzler Kurz und überbordende Flüchtlingszahlen liessen die Unzufriedenen erst lautstark in Massen demonstrieren, um sie später wie reife Äpfel der «FPÖ» in den Schoss fallen zu lassen. Auch wenn alles mit allem zusammenhängt, sind das Rekordergebnis in Niederösterreich und die Umfragezahlen bei der «Sonntagsfrage» letztlich dem Ansturm von Flüchtlingen im Jahr 2022 geschuldet, der zusammen mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sogar die Zahlen aus dem Jahr 2015 um ein Mehrfaches toppte.
Wie die Schweizer SVP bewirtschaftet die «FPÖ» ausschliesslich zwei Haupt-Themen: Flüchtlinge und EU. Dazu gibt's noch ein paar Zückerchen für die mühselige und beladene Bevölkerung. Doch ist die «FPÖ» erst einmal als Juniorpartner an der Macht, gehen die gefüllten Zuckersäcke in Millionenhöhe erst einmal in den eigenen Sack. Stets am Rande oder gar jenseits der Legalität, wie unzählige Anzeigen und Gerichtsverfahren gegen FPÖ-Granden beweisen. Die Koalitionen mit der Austro-faschistoiden Raubritterpartei als Juniorpartner sind ja nicht umsonst bisher allesamt geplatzt.
Dass die FPÖ derzeit nicht als Juniorpartner gehandelt wird sondern als Headliner, verdankt sie vor allem der herrschenden Regierung Österreichs und deren Unfähigkeit in Sachen Migration. Statt seriöse Lösungsansätze für das Problem mit der Migration zu präsentieren, wird täglich eine neue Massnahmensau durchs Dorf getrieben, die sich aber in Hyperschallgeschwindigkeit als Rohrkrepierer entpuppt.
Auch das eine Analogie zur Schweiz. Man erinnere sich an die vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2022 für die Schweizer Migration zuständige FDP-Bundesrätin und «Ankündigungsministerin» Keller-Sutter und deren Abkommen mit Algerien, Österreich, den Balkanstaaten und weiss Gott mit wem noch, die alle wie Luftblasen in der Luft platzten.
Quintessenz am Jahrestag von Hitlers Machtergreifung: Die westlichen Demokratien sind mehr oder weniger fast alle unter heftigem Beschuss der radikalen systemverachtenden Parteien, sofern sie von denen nicht schon längst vereinnahmt sind. Siehe Ungarn. Es wird den Evangelisten und Spaltpilzen des Populismus aber auch leicht gemacht durch die herrschenden Polit-Eliten. Wehret den Anfängen war einmal. Es rächt sich nun, dass wir nicht von den fähigsten Politikern und Politikerinnen regiert werden, sondern von zweitklassigen Selbstdarstellern*innen mit erschreckend grossen Hosentaschen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
SVP setzt auf Provokation und die FDP als Partnerin
Ueli Maurer wurde als SVP-Bundesrat verabschiedet. Deshalb werde ihn die Partei jetzt aber nicht los, witzelte Maurer an der SVP-Delegiertenversammlung.Die Delegierten der SVP haben am Samstag an ihrer Versammlung in Bülach ZH das neue Parteiprogramm und mit Standing Ovations ihren alt Bundesrat Ueli Maurer (72) verabschiedet.
Die grösste Schweizer Partei setzt im neusten Programm nebst bewährten Themen auch auf Provokatives. So stellt sich die SVP gegen «das integrative Schulsystem» und fordert, dass Behörden die Daten von sogenannten Sans-Papiers automatisch an die Migrationsbehörden weiterleiten. So sollen illegal Anwesende konsequent ausgeschafft werden können.
Weiter will die Partei dafür kämpfen, dass innerorts mindestens Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen gilt. Und ein Kapitel widmet sich der Strategie, mit der die Partei den «Gender-Terror und Woke-Wahnsinn» bekämpfen will.
«Werde Partei verbunden bleiben»
Zudem will sich die Partei dafür einsetzen, dass die Rassismusstrafnorm aufgehoben wird. Diese verhindere die freie Meinungsäusserung, glaubt die Mehrheit der anwesenden Parteimitglieder.
Die freie Meinungsäusserung war auch das zentrale Thema in Mauers Abschiedsrede. In dieser sagte der alt Bundesrat, dass er es als seine künftige Aufgabe sehe, jenen Menschen zuhören, die resigniert hätten und sich gewisse Dinge nicht mehr zu sagen trauten. «Viele Leute sagten mir, man dürfe gewisse Sachen nicht mehr laut sagen.» Aber das sei eine gefährliche Entwicklung und schlecht für die Demokratie. Er sehe auch, dass ständig «moralisiert» werde. Dadurch werde die Diskussion abgeklemmt.
Maurer wurde von seinen Parteifreunden für seine Worte freudig beklatscht. Er habe inzwischen fast jeden Posten besetzt, den die Partei zu bieten habe, bedankte sich Maurer. Deshalb werde ihn die SVP aber jetzt aber nicht los, meinte er schmunzelnd. «Ich werde selbstverständlich der Partei verbunden bleiben – und bin jetzt wieder als Mitglied voll dabei.» Er sei fast täglich an SVP-Anlässen und wolle das beibehalten, so Maurer.
Mehr Migranten für die Städte?
Dass in der SVP noch kontrovers diskutiert wird, zeige der Anlass exemplarisch auf. So forderte ein Antrag aus der Basis, dass sich die SVP dafür einsetzen soll, dass Asylsuchende konsequent nach links-grünen Wähleranteilen zu verteilen seien. Der Vorschlag stiess auf recht grosse Sympathien bei den SVP-Mitgliedern im Saal. Es sei nicht an den bürgerlichen Gemeinden der Schweiz, Migranten aufzunehmen, so Stimmen im Saal. «Sollen doch die linken Städter für diese Menschen aufkommen», hiess es.
Der SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel (57) sprach sich deutlich gegen den Vorschlag aus. Dieser sei nicht seriös. Ein anderer Anwesende wies darauf hin, dass es keine Option sei, Migranten in der Schweiz «einander zuzuschieben». Man müsse stattdessen sorgen, dass weniger Migranten in die Schweiz kämen. Der Antrag wurde schliesslich von der Mehrheit abgelehnt und fand damit keinen Eingang in das Parteiprogramm.
Zusammenarbeit mit Freisinn gefordert
Neben dem neuen Parteiprogramm war auch das anstehende Wahljahr Thema. So forderte SVP-Präsident Marco Chiesa (48) flächendeckende Listenverbindungen mit der FDP. Bei den letzten Nationalratswahlen habe die SP wegen der fehlenden Verbindung von FDP und SVP etwa in Graubünden einen Sitz gewonnen, sagte Chiesa. Das dürfe sich nicht wiederholen. «Wir müssen alles tun, damit es keinen erneuten Links-Rutsch gibt.» Rund 500 Delegierte und Gäste nahmen am Anlass teil. Schreibt Blick.
29.1.2023 - Tag der allerdümmsten Kälber
Da kommt für die National- und Ständeratswahlen im Herbst 2023 zusammen, was ideologisch zusammen gehört: Die SVP als Vertreterin aller Mühseligen und Beladenen und die ehemals stolze FDP, die als Wertekanon inzwischen nur noch die abartigsten Varianten des Neoliberalismus pflegt. Verbunden mit kleptokratischer Pöstchenjägerei und unappetitlicher Klientelpolitik.
Die groteske Ansage von SVP-Präsident Marco Chiesa bezüglich Listenverbindungen mit der FDP könnte absurder nicht sein: Ausgerechnet die Herrliberger Partei, die nebst den neu hinzugekommenen Gendersternchen in ihren Wahlkämpfen ausschliesslich die Themen «Flüchtlingspolitik» und «EU» bewirtschaftet, schliesst sich mit der Partei zusammen, die in den letzten vier Jahren federführend für die katastrophale Schweizer Migrationspolitik verantwortlich war: Die FDP mit Bundesrätin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD).
Haben der Stratege vom Herrliberg und sein Vasall aus dem Tessin vergessen, welch unsägliche Versäumnisse die wandelnde Kosmetik- und Schmucktante Keller-Sutter in ihrem Departement (EJPD) hinterlassen hat, das für die Migration zuständig ist? Grossspurige Pressekonferenzen mit hehren Ankündigungen vor laufenden Kameras wie beispielsweise das Abkommen mit Algerien betreffend Rücknahme abgelehnter algerischer Migranten entpuppten sich im Nachhinein als Rohrkrepierer. Wie auch die unzähligen Konferenzen mit Österreich und den Balkan-Staaten.
Nur eine von vielen vollmundigen Ansagen der unsäglichen FDP-Ankündigungsministerin. Dass bis zum heutigen Tag algerische «Flüchtlinge» noch immer die Schweiz fluten ist in den monatlichen Flüchtlingsstatistiken vom SEM nachzusehen. Oder bei der Aargauer Polizei, die sich wöchentlich mehrmals bei Einbruch- und Diebstahldelikten mit algerischen Asylbewerbern auseinandersetzen darf.
Ist die Schweizer Wählerschaft wirklich von allen guten Geistern verlassen, dass sie verlogene Wahlkampagnen mit beinahe Trumpscher Idioten-Prägung nicht durchschaut? Denn Hand aufs Herz: Wäre es den bürgerlichen Parteien, die im Schweizer Parlament eine komfortable Mehrheit haben, mit der Beseitigung der Migrationsprobleme tatsächlich ernst gewesen, hätten sie es in den vergangenen vier Jahren längst durchführen oder zumindest anpacken können. Selbst auf die Gefahr hin, dass die SVP damit ihr Wahlkampfthema verliert, das ihr seit mehr als einem Jahrzehnt gewaltigen Zulauf bei den Wahlen beschert. Von diesem Kuchen will sich nun auch die FDP ein Stück abschneiden.
Aber scheinbar ist auf die Vergesslichkeit des Wahlvolks Verlass. Kommt noch hinzu, dass sich die von der Politik Frustrierten längst zurückgezogen haben und den Wahlen fernbleiben. Darauf kann sich die «bürgerliche Mehrheit» verlassen. Die für einen Grossteil der Bevölkerung wirklich wichtigen Themen kommen nicht auf den Tisch und können somit auch weiterhin vernachlässigt werden. Der vom Bund gehätschelte «Qualitätsjournalismus» lässt dies durchgehen.
Hauptsache, die Politk kümmert sich um Gendersternchen und macht diese auch noch zum Wahlkampfthema. Das muss man sich in Zeiten eines in Europa tobenden Angriffskrieges mit all seinen Verwerfungen für unser tägliches Leben auf der Zunge zergehen lassen.
«Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlächter selber».Dieses Sprichwort taucht erstmals 1874 auf einem Schweizer Stimmzettel zur Wahl der Züricher Steuerkommission auf, was damals von vielen deutschen und österreichischen Zeitungen amüsiert berichtet wurde. Der Witz des unbekannten Autors wurde in den Jahren darauf weit verbreitet und von Sozialdemokraten schon vor dem 1. Weltkrieg bei Wahlen oft als Slogan verwendet.
Dieses Sprichwort von einem Schweizer Stimmzettel wird fälschlicherweise oft Bertolt Brecht und - seltener - auch Wilhelm Busch oder Heinrich Heine zugeschrieben. Bertolt Brecht schreibt in seiner Parodie «Kälbermarsch» auf das «Horst Wessel-Lied der Nazis:
Hinter der Trommel her
Trotten die Kälber
Das Fell für die Trommel
Liefern sie selber.
Der Schlächter ruft:
Die Augen fest geschlossen
Das Kalb marschiert.
In ruhig festem Tritt.
Die Kälber, deren Blut im Schlachthaus schon geflossen
Marschiern im Geist in seinen Reihen mit.
Die ersten vier Zeilen der Brecht'schen Parodie treffen leider auf viele Schweizer Wähler und Wählerinnen zu. Die «Trychel» (Treichel) ist letztlich auch nur eine Trommel. So wie Mohn nur eine Blume ist. Mit guten und weniger guten Inhaltsstoffen. Alles klar?
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Rentner Otto Limacher (75) soll 500 Franken für einen Sex-Klick zahlen: «Hilfe, ich sitze in der Porno-Falle!»
Otto Limacher wehrt sich gegen die Schwyzer Firma Obligo. Er hat im Internet einen vermeintlichen Gratis-Erotik-Link angeklickt, jetzt soll er dafür zahlen. Er ist nicht der Einzige. Auch das Seco und die Konsumentenorganisation FRC kämpfen seit 2014 gegen die Firma.
Rentner Otto Limacher (75) ist sauer. Er sagt zu Blick: «Ich zeigte einem Kollegen, wie man mit dem Handy ins Internet kommt. Dann wollte er auch noch wissen, wie man gratis Sexfilmli sehen kann. Ich zeigte es ihm auf meinem Handy, das war wohl ein Fehler. Jetzt sitze ich in der Porno-Falle von Obligo!» Limacher ist nicht allein: Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und die welsche Konsumentenschutz-Organisation FRC versuchen seit 2014, der Masche von Obligo einen Riegel zu schieben – ohne Erfolg.
Was der Krienser Pensionär am Handy alles angeklickt hat, weiss er nicht mehr genau. Sicher ist er sich, dass er im November 2021 vermeintlich ein Gratis-Probeabo für 72 Stunden bei der aus Rumänien betriebenen Seite Swissxtube.com angewählt hatte. Und: Er hat die lange Liste der AGB nicht genau gelesen.
Der Telefon-Trick
Nach drei Tagen bekam er von der Obligo AG einen Anruf. Das Abo sei jetzt aktiviert. «Ich bestritt das unverzüglich», sagt Otto Limacher. Einen Monat später kommt die erste Forderung über 149 Franken. Von da an folgten Mahnungen und Zusatzgebühren.
Otto Limacher schreibt viermal einen Brief an Obligo und erklärt, dass er keine kostenpflichtigen Dienstleistungen bezogen habe. Resultat: Die Rechnungen kommen plötzlich von einem Inkassodienst und es wird mit rechtlichen Schritten gedroht. Mittlerweile ist die Schuld auf 544 Franken angewachsen. Otto Limacher hat nicht vor zu zahlen. «Ich lasse es darauf ankommen», sagt er kämpferisch.
Limacher ist einer von vielen
Es gibt Dutzende Männer in der gleichen Situation. Beim Gerichtsverfahren im September 2022 klagen insgesamt 40 Privatkläger gegen die beiden Inhaber der Firma Obligo. Mit im Boot als Kläger: das Seco und die welsche FRC. Aber: In einer ersten Instanz verloren sie den Prozess vor dem Bezirksgericht March.
Der Besitzer und Verwaltungsrat Fritz-Emil Müller* (75) wurde vom Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs freigesprochen. Sein Kompagnon (†48) starb zwei Monate vor dem Gerichtsverfahren. Sowohl das Seco als auch die FRC ziehen das Verfahren vor das Schwyzer Kantonsgericht weiter.
Wie in dem 88-seitigen Urteil zu lesen ist, wirft die Anklage Obligo vor, «dass der Bestellvorgang irreführend ist, da für den Konsumenten nicht klar ist, dass er mit den entsprechenden Klicks automatisch ein kostenpflichtiges Abonnement abschliesst, wenn er nicht innert drei Tagen kündigt». Obligo übernimmt die Aufgabe als Rechnungssteller für verschiedene Porno-Portale.
Verhandlung wegen «Komplexität» ausgesetzt
Bereits im Juni 2014 stellten Seco und FRC Strafantrag gegen die Verantwortlichen von Paypay, der Vorgängerin von Obligo. Dazu kamen laufend Anzeigen von Privatpersonen. Es folgte ein jahrelanges juristisches Hickhack. Eine Verhandlung wurde im Februar 2021 «wegen der Vielzahl und Komplexität der Vorfragen» ausgesetzt.
Im September 2022 kam es vor dem Bezirksgericht March endlich zum Prozess. Das Dreiergericht liess aber die Ankläger abblitzen. Ein Grund für den Freispruch ist für die Richterin und die zwei Richter, dass die Verantwortlichen mehrmals beim Seco angefragt hätten, was man bei dem Bestellverfahren besser machen könnte, aber keine Antwort erhalten haben. Zudem sei bereits im Vorfeld von mehreren Strafverfolgungsbehörden durch Einstellungsverfügungen die strafrechtliche Relevanz verneint worden.
Blick sprach mit Fritz-Emil Müller, dem Chef von Obligo. Der Berner, ein erfahrener Anwalt, der nicht erkannt werden will, sieht sich im Freispruch bestätigt: «Es ist ein jahrelanges Kesseltreiben gegen mich und meinen verstorbenen Geschäftspartner. Ich leide sehr darunter, wir werden beschimpft und öffentlich im Internet angeprangert.»
Noch einmal 15 Jahre?
Müller sagt bestimmt: «Es kann doch niemand behaupten, er glaubte, der Dienst sei gratis. Wir haben bei Privatklägern überprüft, wie sie konsumiert haben, das kann man alles nachvollziehen. Die haben alle massiv konsumiert. Nichts von: ‹Ich habe nur einmal geklickt, dann hatte ich plötzlich ein Abo.›»
Er ist sicher: «Das Seco wird seinen Standpunkt wohl bis vor Bundesgericht weiterziehen und vertreten – notabene auf Kosten der Steuerzahler. Das kann gut und gerne weitere 15 Jahre dauern.» Bis dahin dürfte wohl noch so mancher Nutzer in die Porno-Falle tappen. Schreibt Blick.
28.1.2023 - Tag der Senioren-«Fastfinger»
Senioren und Seniorinnen sollten sich ab einem gewissen Alter damit abfinden oder zumindest auseinandersetzen, dass gewisse Funktionen im Hirn und Körper nicht mehr so zuverlässig funktionieren wie in früheren Zeiten. Oder gar vollständig fehlen. Der Umgang mit dem Internet ist nur eine davon.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Chilbi-Horror in China: Karussell-Fahrgäste knallen gegen Lastwagen
Das erschreckende Video wurde am 22. Januar in einem Freizeitpark in der chinesischen Stadt Zhoukou aufgenommen. Das Kettenkarussell gerät plötzlich ausser Kontrolle und die Fahrgäste kollidieren mit einem in der Nähe geparkten LKW. Schreibt BLICK und liefert ein «erschreckendes» Video mit.
27.1.2023 - Tag der chinesischen Reis-Säcke
News-Portale inklusive Liveticker und Social Media müssen im Stunden- wenn nicht gar Minutentakt mit Inhalten gefüllt werden.
Nachdem der Blockbuster «Harry & Megan» bei Blick nach der atemlosen Berichterstattung über Wochen hinweg selbst an der Dufourstrasse in Zürich ausgelutscht und bis aufs letzte fehlerhafte Komma veröffentlicht ist, braucht es Nachschub.
Kein Problem. Wozu hat man denn ein Reuters- oder Bloomberg-Abo? Genau! Sie ahnen es. Die mehrheitlich US-kontrollierten News-Agenturen liefern, was die Schweizer Leserherzen* begehren. Inklusive einem auf dem chinesischen Videoportal «TikTok» längst veröffentlichten «erschreckenden» Video – all shit in one. (*Von «Leseratten» zu schreiben, wäre in diesem Zusammenhang eine Beleidigung für die intelligenten Nager.)
Auf China ist Verlass. Im Reich der Mitte – ein Begriff, der nur in Bezug auf den abartigen Neoliberalismus etwas mit der gleichnamigen Schweizer Partei (ehemals als gottesfürchtige CVP bekannt) zu tun hat, fällt jede Minute ein Sack Reis um. Das wissen auch die US-amerikanischen News-Agenturen. Und so landet denn dramatisch aufgepeppter Schwachsinn aus einer fernöstlichen Stadt, deren Namen hierzulande wohl kaum jemand je gehört hat, auf der Frontseite (!) des Blick-Portals.
Aldous Huxley war seiner Zeit tatsächlich weit voraus.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Menschen mit starker Meinung halten sich für klug, auch wenn das nicht stimmt
Wissenschaft regt neuerdings auf. Seit der Corona-Pandemie hat die Diskussion über Wissenschaft auch viele Kreise erobert, in denen das Thema bislang wenig präsent war. Welche Mechanismen dabei wirksam sind, hat sich nun ein Forschungsteam anhand des Beispiels Großbritannien angesehen, mit teils mehr und teils weniger überraschenden Ergebnissen.
So zeigte sich, dass wissenschaftliche Erkenntnisse tendenziell vor allem von Menschen mit eher wenig Fachwissen infrage gestellt würden, bestätigt eine in der Zeitschrift "PLOS Biology" vorgestellte Studie vorherige Analysen. Zudem schätzen demnach eher Menschen mit einer starken Haltung pro oder kontra Wissenschaft ihr eigenes Wissen als sehr hoch ein.
Konkret befragten die Forschenden 2.000 britische Erwachsene anhand verschiedener Forschungsthemen im Bereich Genetik über ihre Einstellung zur Wissenschaft und dazu, wie sie ihr eigenes Verständnis beurteilten. Dabei beobachteten sie, dass Befragte mit den ausgeprägtesten Einstellungen – sowohl Befürworter als auch Gegner der Wissenschaft – stärker von ihrem eigenen Wissen überzeugt waren.
Fragen zu Gentechnik und Radioaktivität
Zu den gestellten Richtig/Falsch-Fragen gehörte: "Durch den Verzehr einer gentechnisch veränderten Frucht könnten auch die Gene einer Person verändert werden", "Alle Radioaktivität ist von Menschen gemacht" und "Tomaten enthalten von Natur aus keine Gene, Gene sind nur in gentechnisch veränderten Tomaten zu finden".
"Wir haben festgestellt, dass starke Einstellungen sowohl für als auch gegen die Wissenschaft durch ein starkes Selbstvertrauen in das Wissen über die Wissenschaft untermauert werden", sagt Mitautor Laurence Hurst. Das ergebe psychologisch gesehen durchaus Sinn, so das Team: Um eine starke Meinung zu haben, müsse man fest an sein Wissen bezüglich der grundlegenden Fakten glauben.
Tatsächlich vorhanden ist dieses Basiswissen allerdings nicht zwingend: Wie die Analyse bestätigt, verfügen gerade jene, die sich am negativsten zu einem Forschungsbereich äußern, tendenziell über wenig Wissen zum Thema. Den britischen Forschern zufolge ist es zumindest bei gentechnisch veränderten Organismen nur eine sehr kleine Gruppe von etwa fünf Prozent, die extrem ablehnend eingestellt ist. Grundsätzlich verallgemeinern ließen sich die Ergebnisse nicht, betont das Forscherteam auch. Bei der Evolution zum Beispiel spielten religiöse Einstellungen eine große Rolle, bei der Klimakrise politische Positionen. Einen wie starken Anteil das subjektive Verständnis habe, sei bei solchen Themen noch zu klären.
Laut Eva Thomm von der Universität Erfurt bestätigen die aktuellen Befunde die Ergebnisse früherer Studien. "Die Konsequenz einer Überschätzung des eigenen Wissens im Zusammenhang mit einer kritischen Einstellung gegenüber Wissenschaft kann sein, dass man fragwürdigen Informationen aus fragwürdigen Quellen aufliegt", erläuterte die Psychologin in einer unabhängigen Einordnung.
Die von den britischen Forschern gefundenen Zusammenhänge ließen sich zumindest zum Teil auch auf den deutschen Sprachraum übertragen, so Thomm. So habe eine 2019 in "Nature Human Behaviour" veröffentlichte Studie, die sich ebenfalls mit Einstellungen, subjektivem und tatsächlichem Wissen über gentechnisch veränderte Organismen beschäftigte, auch eine deutsche Stichprobe enthalten und sei zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.
Wissenschaftskommunikation sollte sich an die Mehrheit richten
In einer Analyse, an der Thomm beteiligt war, kamen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass sich Kampagnen im Rahmen von Wissenschaftskommunikation eher darauf konzentrieren sollten, die stille, unsichere Mehrheit zu erreichen anstatt die laute Minderheit zu überzeugen. Eine reine Weitergabe von Informationen könne kontraproduktiv sein, hieß es nun auch. "Um die negative Einstellung mancher Menschen gegenüber der Wissenschaft zu überwinden, muss man wahrscheinlich das dekonstruieren, was sie über die Wissenschaft zu wissen glauben, und es durch ein genaueres Verständnis ersetzen", erklärt Anne Ferguson-Smith, Mitautorin der Studie in "PLOS Biology".
Wie Thomm betont, gelte es auch, das Wissenschaftsverständnis von Menschen zu berücksichtigen: "Welche Vorstellungen haben sie darüber, wie wissenschaftliches Wissen generiert wird, wie Wissenschaftler miteinander diskutieren oder wie wissenschaftliche Standards aussehen?" Zu einer angemessenen Vorstellung von Wissenschaft gehöre das Wissen über die Unsicherheit wissenschaftlicher Erkenntnisse und über wissenschaftliche Kontroversen.
Das Fehlen von Wissen sei auch ein Risiko, sagt Thomm. Es könne sich zu einer ablehnenden Haltung entwickeln: "In der Wissenschaftskommunikation muss es gelingen, derartige Unsicherheiten als Teil wissenschaftlicher Prozesse zu vermitteln, ohne Vertrauenswürdigkeit oder Akzeptanz zu unterlaufen." Widersprüche und Veränderungen könnten vielleicht zunächst Unbehagen auslösen. "Sie sind aber auch Ausdruck davon, dass Wissenschaft funktioniert", betont Thomm. Schreibt DER STANDARD.
26.1.2023 - Tag der Orakel von Delphi und Zofingen
Wer den «Dunning-Kruger-Effekt» kennt, kann sich den STANDARD-Artikel sparen. Auch die vielen Leser-Postings, die fälschlicherweise Sokrates mit «Ich weiss, dass ich nichts weiss» zitieren, ohne die Details dieser Aussage des griechischen Philosophen zu kennen. Denn bei richtiger Übersetzung der Aussage (im Zusammenhang mit dem Orakel von Delphi) behauptet Sokrates nicht, dass er nichts wisse, sondern hinterfragt (als Nichtwissender) das, was man zu wissen meint. Oder anders ausgedrückt: «Ich weiss, dass ich NICHT weiss...».
Mit der Überschätzung des eigenen Wissens sind nicht nur Politker*innen, Akademiker*innen und Forschende gesegnet, sondern mehr oder weniger die ganze Menschheit. Mich eingeschlossen. Als ehemaliger endlos-Klassenprimus glaubte ich auch ab und zu die «Weisheit mit Löffeln gefressen» zu haben. Doch dann lernte ich irgendwann das «wandelnde Lexikon» vom Artillerie-Verein Zofingen, Res Kaderli, kennen und stellte fest, dass ich zum Beispiel von Schweizer Geschichte im Detail gar nicht so viel weiss, wie ich immer dachte.
Doch ich hadere nicht mit meiner Erkenntnis, sondern betrachte es als Glücksfall. Stellt sich mir eine Frage beispielsweise über historische Details aus der Schweizer Geschichte, habe ich eine kompetente Ansprechperson und rufe an. Unangenehm empfinde ich lediglich die Tatsache, dass mir der haarlose Herr der Geschichtsbücher aus Zofingen stets die Dauer des Telefonats auf die Sekunde genau vor die Nase hält. Who cares? Selbst das Orakel von Delphi hatte so seine Macken.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Einschätzung: Das lange Zögern von Olaf Scholz
Deutsche Kampfpanzer werden russischen im Krieg gegenüberstehen. Dieses historisch aufgeladene Bild war bis vor einigen Monaten unvorstellbar. Zur Recht fällte Kanzler Olaf Scholz einen solchen Entscheid nicht leichtfertig.
Nach langem Zögern sollen die Leoparden die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf nun unterstützen. Und wie es aussieht gemeinsam mit den USA, die ihren Abrams-Kampfpanzer vermutlich widerwillig liefern.
Das Resultat sorgt erst einmal für grosse Erleichterung bei all jenen, die schon lange massiv Druck auf den SPD-Kanzler gemacht haben. Zuvorderst die eigenen Koalitionspartnerinnen von FDP und Grünen.
Aber auch die Opposition im Bundestag aus CDU/CSU mit Fraktionschef Friedrich Merz fragte sich, warum Scholz für seinen Entscheid nicht den letzten Sonntag gewählt hat, als er zum historischen Tag deutsch-französischer Freundschaft in Paris war. Eine weitere Gelegenheit hätte ihm bereits an der Nato-Zusammenkunft vom Freitag in Ramstein geboten.
Stattdessen umschiffte sein Verteidigungsminister Boris Pistorius tagelang Fragen. Jetzt lässt sich der Grund dafür erahnen: Es brauchte doch noch Verhandlungsgeschick, um die Zweifler in der Nato zu überzeugen, nicht nur Berlin tat sich schwer.
Kanzler Olaf Scholz hat hinter den Kulissen diese Allianz für Kampfpanzer geschmiedet, ungeachtet jeglicher Polemik in der Öffentlichkeit. Dass er dabei die USA stark unter Druck gesetzt hat, ist anzunehmen.
Wenn es nun so kommt, ist das der grosse Schulterschluss, den Scholz stets verlangt hat. Berlin tat und tut in diesem Krieg keinen Schritt, ohne dass Washington genau denselben tut. Scholz möchte wohl um jeden Preis vermeiden, dass sich Deutschland zu sehr exponiert. Dazu hat er auch das Vertrauen der internationalen Partner strapaziert.
Einschätzung von SRF-Deutschland-Korrespondentin Simone Fatzer.
25.1.2023 - Tag der Leoparden-Kanzlers
Vielleicht ist der deutsche Bundeskanzler cleverer und smarter als viele seiner Kritiker aus Presse und Politik. Da die grosse mediale Leoparden-Schlacht nun zu Ende ist, können sich die Medien wieder dem zuwenden, was sie wirklich können: Nonsens von Prinz Harry veröffentlichen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Erdoğan will nach Koran-Verbrennung schwedischen Nato-Beitritt nicht unterstützen
Schweden kann nach einer Koranverbrennung in Stockholm nach Aussage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nicht mit einer Unterstützung der Türkei für einen Nato-Beitritt rechnen. "Wenn ihr der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen Nato auch keine Unterstützung bekommen", sagte Erdoğan am Montag in Ankara. Schwedens Außenminister Tobias Billström kommentierte die Aussagen vorerst nicht.
Zunächst wolle er genau verstehen, was gesagt worden sei, teilte er der schwedischen Nachrichtenagentur TT mit. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wies am Montag darauf hin, dass Meinungsfreiheit ein hohes Gut sei. Er sei natürlich gegen diese Art von Beleidigungen. "Und ich bin absolut gegen das Verhalten, was wir auf den Straßen von Stockholm erlebt haben", sagte Stoltenberg im TV-Sender der Welt. Es sei aber nicht illegal gewesen. "Denn die Meinungsfreiheit ist nun mal stark verankert, ist ein großes, hohes Recht."
Alle 30 Nato-Mitglieder müssen zustimmen
Ankara blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Verteidigungsbündnis. Die Türkei wirft aber vor allem Schweden unter anderem Unterstützung von "Terrororganisationen" wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor und fordert die Auslieferung etlicher Personen, die Ankara als Terroristen betrachtet. Alle 30 Nato-Mitglieder müssen die Anträge auf Nato-Mitgliedschaft ratifizieren, 28 haben das bereits getan – nur die Türkei sowie Ungarn fehlen noch. Das US-Verteidigungsministerium erklärte am Montag, Schweden und Finnland seien reif für einen Nato-Beitritt. Gleichzeitig wurde aber festgehalten, dass das "Verbrennen von Büchern, die vielen heilig sind, ein zutiefst respektloser Akt" sei.
Protestaktionen in Schweden hatten zuletzt erneuten Ärger mit der Türkei nach sich gezogen. Unter anderem hatten Aktivisten im Zentrum von Stockholm eine Erdoğan ähnelnde Puppe an den Füßen aufgehängt, was eine wütende Reaktion aus Ankara zur Folge hatte. Am Samstag hatte dann der aus Dänemark stammende, islamfeindliche Politiker und Provokateur Rasmus Paludan neues Öl ins Feuer gegossen, indem er bei einer von der Polizei genehmigten Kundgebung nahe der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannte. Die Aktion sei eine "Schande", sagte Erdoğan. Die Demonstration bei der türkischen Botschaft hatte am Samstag unter großem Polizeischutz und hinter Metallbarrieren stattgefunden. Paludan hielt eine Tirade gegen den Islam und Migranten und zündete dann eine Ausgabe des Koran an.
Die schwedische Regierung hatte sich von dieser Aktion ebenso distanziert wie von dem Vorfall mit der Erdoğan-Puppe, aber auf die in Schweden geltende Meinungsfreiheit verwiesen. "Meinungsfreiheit ist ein grundlegender Bestandteil der Demokratie", hatte Ministerpräsident Ulf Kristersson als Reaktion auf die Koran-Verbrennung auf Twitter mitgeteilt. "Aber was legal ist, ist nicht unbedingt angemessen. Das Verbrennen von Büchern, die vielen heilig sind, ist eine zutiefst respektlose Handlung."
Damit verschärfen sich die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern. Schweden hatte sich 2022 nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine um eine Aufnahme in die Nato beworben. Damit es dazu kommt, müssten alle 30 Mitgliedstaaten zustimmen.
Proteste in Bagdad
In Bagdad ist es am Montag bei einer Protestversammlung vor der schwedischen Botschaft gegen die Koranverbrennung zu einer gewalttätigen Konfrontation zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Dabei wurden am Montag sieben Protestierende und ein Polizist verletzt, wie aus dem irakischen Innenministerium verlautete.
Laut der Quelle aus dem Innenministerium hatten sich etwa 400 Menschen an dem Protest vor der Botschaft beteiligt. Sie riefen Sprechchöre wie "Nein zu Schweden, ja zum Koran!". Als die Polizei die Demonstranten zurückdrängte, brach Gewalt aus.
Die Demonstranten hätten mit Steinen geworfen, die Polizei Schlagstöcke eingesetzt, sagte der Ministeriumsmitarbeiter. Später verlief sich der Protest, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Schreibt DER STANDARD.
24.1.2023 - Tag der Chicken Games
Erinnert an das berühmte «Chicken Game»: Zwei Fahrzeuge rasen mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu. Weicht einer der Fahrer aus Angst aus, hat er das Spiel durch seine Feigheit verloren. Weicht jedoch keiner der zwei Spieler aus, haben beide die Mutprobe bestanden. Nutzen zieht aber keiner daraus, weil beide durch den Zusammenprall ihr Leben verlieren.
Im «Chicken Game» um Schwedens Nato-Beitritt steht der Sieger jetzt schon fest. Es ist Erdogan. Die unsinnige Koranverbrennung durch ein paar schwedische Neo-Nazis vor der türkischen Botschaft in Stockholm liefert ihm den willkommenen Anlass, die Muslime für die kommende Präsidentschaftswahl in der Türkei zu mobilisieren. Mit dieser religiösen «Aufrüstung» ist sein Sieg im Mai 2023 so sicher wie das Allahu akbar in der Moschee.
«Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.» 1997 zitierte Erdogan, damals noch Bürgermeister von Istanbul, diese Zeilen eines islamischen Gedichts. Damals wurde er wegen «religiöser Volksverhetzung» noch zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Inzwischen gewinnt er mit religiösem Humbug Wahlen.
Über die Verwerflichkeit von Bücherverbrennungen, egal ob es sich nun um Koran, Bibel oder Erich Kästners «Fabian» handelt, muss in einer zivilisierten Gesellschaft nicht diskutiert werden. Über die Instrumentalisierung von Religionen in der Politik allerdings auch nicht.
Nach der gewonnen Präsidentschaftswahl wird sich der Sultan vom Bosporus den Beitritt Schwedens zur NATO mit einem fürstlichen Bakschisch – in welcher Form auch immer – der hehren westlichen Wertegemeinschaft vergolden lassen. Wetten, dass Schweden spätestens im Sommer 2023 Mitglied der Nato ist?
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Pistorius: Entscheidung zu Leopard-Lieferung wird bald getroffen
Die Entscheidung über eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine ist nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weiter offen. «Der Entscheidungsprozess läuft und den werden wir jetzt abwarten müssen», sagte Pistorius am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Anne Will».
Pistorius sagte, die Entscheidung hänge «von vielen Faktoren ab» und werde "im Kanzleramt getroffen". Jeder verstehe, in welcher Not die Ukraine aktuell sei. Deswegen werde es «auch bald eine Entscheidung geben, wie immer sie aussieht».
«Dass es Panzer braucht, dass es Offensivbewegung braucht im Hinblick auf Donbass und Luhansk, ist völlig klar», sagte der Minister. Für Deutschland gehe es einerseits um die Abstimmung mit den Partnerländern. Dies sei «vor allem» die Abstimmung mit den USA.
«Schuldzuweisungen helfen niemandem»
Gleichzeitig handle es sich um eine «schwere Panzerwaffe, die eben auch für Offensivzwecke genutzt werden kann». Deshalb müsse die Bundesregierung hier «sehr sorgfältig abwägen» und könne «nicht übereilt und leichtfertig» entscheiden. Pistorius verwies darauf, dass es auch in der deutschen Bevölkerung «keinesfalls ein einheitliches Meinungsbild» zu der Frage der Panzerlieferungen gebe.
Zu der Kritik des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, Deutschlands Zögern sei «inakzeptabel», sagte Pistorius: «Schuldzuweisungen helfen niemanden.» Deutschland stehe «an der Spitze derjenigen Länder in der Welt, die die Ukraine unterstützen». Die Bundesregierung habe inzwischen insgesamt Systeme und Ausstattung im Wert von 3,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Deutschland müsse sich hier «nicht verstecken». Schreibt Blick im Ukraine-Liveticker.
23.1.2023 - Tag der neuen Kanzlerin Olaf Scholz in Männlich
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird als «die neue Kanzlerin in Männlich» verspottet. Nicht erst seit jetzt. Schon im Wahlkampf um das Kanzleramt inszenierte sich Scholz erfolgreich als Merkel-Nachfolger. Er schreckte nicht einmal davor zurück, die Merkelsche Raute zu kopieren.
Doch jetzt darüber zu lamentieren nützt nichts. You get what you vote for. Das war schon immer so. Selbst bei Adolf Hitler.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
In Dörfern und in Städten, im Knast – und sogar im Spital: zur Bewachung von Gefährdern: Die Schweiz ersetzt Polizisten durch Securitys
Verträge mit diversen Sicherheitsfirmen zeigen: Eskaliert die Situation, treffen im Justizvollzug auch Privatpersonen heikle Entscheidungen.
Schaffhausen sei zwar «blos e chliini Stadt», in der es «statt High Society blos Dameriige» gebe. Dennoch pries der Liedermacher Dieter Wiesmann (1939–2015) das «munzig chliinii Stuck Welt» als Ort, «wo sich’s guet lääbe loot».
Das war einmal. Mittlerweile scheint sich Schaffhausen in einen Sündenpfuhl verwandelt zu haben: Vor einem Jahr machten Teile der 37 000-Einwohner-schaft gegen Lärm, Müll und Drogen am Rheinufer mobil. In einer Petition forderten sie die «Durchsetzung der Polizeiverordnung» sowie «genügend Personal» für regelmässige Patrouillen.
Der Stadtrat äusserte zwar Verständnis für den Unmut, hielt aber fest, dass dauernde Polizeipräsenz «wegen der personellen Situation» nicht möglich sei. Um dennoch «Prävention wie Repression» zu gewährleisten, präsentierte man als Alternative eine private Sicherheitsfirma.
Gewaltmonopol: Sache des Staates
So kam es, dass von Mai bis September 2022 die Delta Security AG für Recht und Ordnung sorgte. Und weil deren Mitarbeitende auf «hohe Akzeptanz» gestossen seien, beschloss der Stadtrat Ende Dezember, auch in Zukunft auf deren Dienste zu setzen.
Schaffhausen liegt zwar «äänen am Rhii», ist in diesem Punkt aber typisch für die ganze Schweiz: Ob Arlesheim im Baselbiet, Brugg im Aargau, Landquart im Bündnerland, Oetwil am Zürichsee oder Thun, das Tor zum Berner Oberland – überall wurden in den letzten Jahren Polizeiaufgaben an Securitys ausgelagert.
Johanna Bundi Ryser, Präsidentin des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter, sieht das mit Sorge: «Es ist nicht die Aufgabe von Privatfirmen, auf öffentlichem Grund Pflichten der Polizei zu übernehmen.» Das Gewaltmonopol sei Sache des Staates und müsse es bleiben – zumal es auch von polizeilichen Sicherheitsassistenten ausgeübt werden könne.
Welche Aufgaben private Sicherheitsleute übernehmen, variiert von Ort zu Ort. Neben Patrouillengängen werden sie auch bei Littering oder Hundemarkenverstössen eingesetzt oder nehmen Personalien auf. In einigen Gemeinden können Verzeigungen oder Bussen auf Grundlage ihrer Rapporte ausgesprochen werden. Häufig werden Securitys auch in der Nacht losgeschickt, etwa bei Anrufen wegen Lärmbelästigung.Eine Gefährdung des Gewaltmonopols sehen die verantwortlichen Gemeinden und Kantone dennoch nicht. Gebetsmühlenhaft betonen sie, die Befugnisse der Privaten seien klar definiert und stark eingeschränkt.
Jürg Marcel Tiefenthal (50), Jurist und Kenner des schweizerischen Polizeirechts, sieht das anders. In einer Abhandlung über die «Herausforderungen des schweizerischen Föderalismus» kommt er zum Schluss, kantonale Lösungen zum Einsatz privater Sicherheitskräfte hätten sich als «wirkungsschwache Regulierungsversuche» entpuppt, die in der Praxis einfach zu unterlaufen seien.
Dass es solche Auslagerungen zunehmend und in immer stärkerem Ausmass gibt, erklärt Tiefenthal mit fehlenden Ressourcen der Polizeikorps. Das zeige sich nur schon daran, dass es in der Schweiz mittlerweile mehr private Sicherheitsleute als Polizisten gibt.
Securitys entscheiden wie Häftlinge angepackt werden
Mittlerweile fungieren die Securitys längst nicht mehr nur auf der Strasse als verlängerter Arm der Polizei, sondern auch im Justizvollzug der Kantone. Diese haben in den vergangenen Monaten mehrere Grossaufträge vergeben, bei denen sich die Frage stellt, ob das Gewaltmonopol des Staates gewahrt bleibt.
In Bern zum Beispiel werden Inhaftierte, die der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht vorgeführt werden müssen, seit August 2022 von Mitarbeitern der Securitas AG begleitet. Sie bekamen von der Kantonspolizei den Auftrag, eingewiesene Personen in ihre Zellen zu führen, sie zu bewachen, zu betreuen und für die jeweiligen Übergaben bereitzustellen.
Die Behörde schreibt dazu: «Die Kompetenzen und Tätigkeiten des Sicherheitsdienstes gehen nicht über das hinaus, was eine private Person machen darf.» Das «Pflichtenheft» der Securitas-Mitarbeitenden, das SonntagsBlick gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz einsehen konnte, offenbart jedoch, dass die Aufgaben der «privaten Personen» nicht ganz ohne sind. Securitas musste dem Staat nämlich garantieren, dass ihre Angestellten mit «Personen in psychischen und emotionalen Ausnahmesituationen» umzugehen wissen und «Strategien zur Deeskalation» beherrschten.
Der Kanton Basel-Landschaft wiederum setzt Securitas seit Sommer in den Gefängnissen Arlesheim, Liestal und Muttenz für den Nacht- und Wochenenddienst ein. Bei diesem Auftrag war in der Ausschreibung ebenfalls vermerkt, dass der Dienstleister in der Lage sein müsse, «im Eskalationsfall» Unterstützung zu leisten. Teilweise stehen den Privatpersonen für ihre Aufgaben in Gefängnissen auch «Reizstoffsprays» sowie «Hand- und Fussfesseln» zur Verfügung. So geht es aus Verträgen zwischen dem Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich und Delta Security hervor.
Die Sicherheitsfirma wird ab März 2023 für Aufsichts- und Sicherheitsdienste, Nachtdienste sowie die Begleitung von Klientengesprächen im Justizvollzug verantwortlich sein. Den Kanton kostet das 4,1 Millionen Franken pro Jahr. Dafür verlangt er von den Auftragnehmern, dass sie sich «bei besonderen Vorkommnissen» richtig zu verhalten wissen und über Kenntnisse zum «Eigenschutz» und zur «Selbstverteidigung» verfügen.
Dieses Anforderungsprofil offenbart: Wenn eine Situation eskaliert, entscheiden auch Securitys darüber, wie Häftlinge angepackt werden – und nicht nur vereidigte Staatsdiener.
Auslagerung staatlicher Aufgaben
Bei Patienten in Spitälern, die polizeilich überwacht werden müssen, setzt Zürich ebenfalls auf private Sicherheitsdienste. Dies wird etwa nötig bei Gefangenen mit gesundheitlichen Problemen, die in einer Justizvollzugsanstalt nicht korrekt behandelt werden können. Seit etwas über einem Jahr stehen bei solchen Personen nicht mehr zwingend Polizisten vor dem Krankenzimmer, sondern auch Mitarbeitende der Sicherheitsfirma Vüch AG.
SonntagsBlick wollte auch diesen Vertrag einsehen. Das Gesuch wurde jedoch von der Kantonspolizei Zürich abgelehnt. Begründung: Dies würde die öffentliche Sicherheit «schwerwiegend gefährden». Laut Kantonspolizei seien teilweise Straftäter im Spital, die «schwere Delikte» begangen hätten und wegen «Flucht- oder Kollusionsgefahr» daran gehindert werden müssten, mit der Aussenwelt in Kontakt zu kommen. Zudem könnten auch Personen betroffen sein, von denen eine «Selbst- oder Fremdgefährdung» ausgehe. «Deren Bewachung in Spitälern und Kliniken, wo Betrieb und Infrastruktur nicht auf einen Freiheitsentzug ausgerichtet sind, stellt eine besondere Herausforderung dar», schreibt die Kantonspolizei.
Dem Personal der Vüch AG traut man diese Aufgaben offensichtlich zu – das Amt für Justizvollzug beurteilt die Auslagerungen als unproblematisch. Die Behörden beteuern, dass für die Anordnung hoheitlicher Entscheide stets die Vollzugseinrichtung zuständig bleibe.
Bundi Ryser vom Verband der PolizeiBeamten hält die geschilderten Fälle dennoch für «sehr fraglich». Für sie steht fest, dass der Umgang mit Festgenommenen nicht an private Firmen ausgelagert werden sollte.
Florian Düblin, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren, möchte einzelne Aufträge nicht kommentieren, hält aber fest, dass stets eine ausreichende Rechtsgrundlage bestehen müsse, sofern es nicht bloss um Unterstützungsaufgaben unter Aufsicht und Verantwortung von staatlichem Personal gehe: «Je tiefer der mit dem Auftrag verbundene Eingriff in die Freiheitsrechte der betroffenen Personen, desto detaillierter müssen die Aufgaben, Kompetenzen und Pflichten der ausführenden Mitarbeitenden geregelt sein.»
Die Zürcher Nationalrätin Priska Seiler Graf (54, SP) versuchte vor einigen Jahren, schweizweit einheitliche Regeln für solche Eingriffe zu schaffen. Ihre Motion scheiterte jedoch 2019 im Ständerat. Seiler Graf hält das Anliegen aber nach wie vor für berechtigt. «Ich überlege mir ernsthaft, nochmals einen Vorstoss zu diesem Thema zu machen.»
Auch Polizeirechtsexperte Tiefenthal hält einheitliche Regeln für dringend notwendig. Er kommt in seiner Analyse zum Schluss, dass sich der Wildwuchs bei der Auslagerung staatlicher Aufgaben nur durch eine nationale Gesetzgebung bändigen lasse. Schreibt Blick.
22.1.2023 - Tag des Parkbussen-Huhns, das goldene Eier legt
Der SonntagsBlick-Artikel und das beinahe unvermeidliche Editorial von SonntagsBlick-Chefredaktor Gieri Cavelty entwickeln eine Hysterie, die dem Thema nicht gerecht wird. Denn Hand aufs Herz: Parkbussen verteilen und auch einkassieren sind nun wirklich nicht Kernaufgaben der Polizei. Kontrolldienste dieser Art sollten sogar ausgelagert werden. Was in der Stadt Zofingen übrigens längst der Fall ist. Im Thut-Städtchen werden Parkbussen seit Jahren von der SECURITAS ausgestellt.
Ob mit solch banalen Kontrolldiensten unbedingt Sicherheitsfirmen beauftragt werden müssen sei dahingestellt. Es könnten möglicherweise auch ortsansässige Personen für diese Jobs verpflichtet werden. Senioren / Seniorinnen, die sich ein Zubrot verdienen möchten oder ausgesteuerte Arbeitslose. Der Möglichkeiten gibt es viele. Eventuell würden damit sogar die Sozialhilfen entlastet. Einfach mal andenken.
Letztendlich wollen Gemeinden und Städte mit den Einnahmen aus Parkbussen nichts anderes als Geld verdienen. Die hehren Sprüche seitens der Politik über «prophylaktische Massnahmen» hinsichtlich Parkbussen dürfen wir für einmal ruhig vergessen. Parkbussen sind nichts anderes als ein Huhn, das goldene Eier legt. Und das ist gut so. Denn diese Einnahmen brauchen Städte und Gemeinden zwingend. FDP, SVP, Mitte und GLP sehen das aufgrund ihrer Ideologien logischerweise etwas anders.
Dass bei der Ausführung und Durchsetzung von Kernaufgaben der Polizei strikte Trennlinien zu den Sicherheitsdiensten gezogen werden müssen, versteht sich von selbst. Das braucht man gar nicht zu diskutieren. Verirrt sich trotzdem zwischendurch mal ein*e Stadt- oder Gemeinderat*in in den pervers abartigen Neoliberalismus US-amerikanischer Prägung, lässt sich das in einer funktionierenden Demokratie relativ einfach korrigieren. Man muss es nur tun. Stadt- und Gemeinderäte*innen können nämlich abgewählt werden.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Deutsche Rechtspopulistin Alice Weidel an Albisgüetli-Tagung: Hemdsärmliger Blocher, konzilianter Rösti
Der neue Bundesrat Albert Rösti und SVP-Übervater Christoph Blocher schwören am Freitagabend an der Albisgüetli-Tagung ihre Partei auf den Wahlkampf ein. Den Weg ins Albisgüetli gefunden hatte auch Alice Weidel.
Wahlkampf ist Volksnähe. Die Parteien müssen in diesem Wahljahr ihre Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Dafür müssen sie ran an die Leute, ganz dicht. Müssen mit kernigen Parolen Herzen und Hirne erreichen. Ja, Wahlkampf ist wichtig. Auch für die SVP.
Domenik Ledergerber (35), Präsident der Zürcher SVP, gab in seiner Begrüssungsrede zur 35. Albisgüetli-Tagung darum den über 1000 Gästen gleich die Direktive durch: «Sie alle, die ganze SVP muss im Wahlkampf sein. Denn das vergangene Jahr bleibt nicht nur wegen der drohenden Strommangellage in Erinnerung, sondern auch wegen neuer Rekordzahlen bei der Zuwanderung.» Ledergerber setzte also gleich zu Beginn der Veranstaltung den Ton und malte das düstere Bild der 10-Millionen-Schweiz.
Das Bevölkerungswachstum zerstöre die Umwelt, gefährde die Versorgungssicherheit mit Strom und Lebensmittel und führe auch sonst zu massiven Problemen. Es sei darum höchste Zeit, befand Ledergerber, die Parlamentarier auszuwechseln, die diese Zuwanderung zuliessen. Denn, soviel wurde an diesem Abend im Schützenhaus Albisgüetli in Zürich einmal mehr klar: Die Zuwanderungspolitik der Schweiz ist für die SVP auch Seismograf für Entwicklungen in Energie-, Bildungs- oder Wirtschaftsfragen.
«Alles im freien Fall»
Mit gewohnt kernigen Worten arbeitete auch alt Bundesrat und SVP-Übervater Christoph Blocher (82) wieder einmal die bekannten Schlagworte ab. Der «Dichtestress», die «10-Millionen-Schweiz» und die «unzumutbare Zuwanderung» waren darum zentrale Themen in seiner rund einstündigen Rede. Und wie bereits alt Bundesrat Ueli Maurer (72) vor zwei Wochen an der SVP-Kadertagung im Hotel Bad Horn bediente sich auch Blocher der Sackgasse-Metapher. Die Schweiz und mit ihr auch die SVP seien in einer Sackgasse gelandet, hineingetrieben von Linken und Grünen. Souveränität, Rechtsstaat, die Demokratie – alles befinde sich im freien Fall.
Dagegen, so Blochers Fazit, gebe es eigentlich nur eine Lösung: die SVP. Die Partei müsse das Ruder jetzt herumreissen und die Wahlen gegen die Roten und Grünen gewinnen. «Nur so kommt die Schweiz aus der Sackgasse», redete Blocher seinen Parteikolleginnen und -kollegen ins Gewissen. Und so weiter und so fort. Nach jeder dieser Parolen lachten und klatschten viele Anwesenden im Saal. Weil Blocher ihnen sagte, was sich gut auf SVP-Wahlplakate drucken lässt. Und womit sie aus der Sackgasse finden und auf krachende Offensive umschalten können.
Zum Schluss seiner Rede gab der SVP-Doyen im Namen der Zürcher SVP noch Empfehlungen für die Wahlen im Kanton Zürich vom 12. Februar ab: Die beiden bewährten SVP-Regierungsräte Natalie Rickli (46) und Ernst Stocker (67) hätten aufgrund ihrer guten Arbeit die Wiederwahl verdient.
Unterstützung auch für die anderen Bürgerlichen
Auch den parteifremden bürgerlichen Zürcher Regierungsrätinnen Carmen Walker-Späh (64, FDP) und Silvia Steiner (65, Mitte) sowie dem Direktor der Denkfabrik Avenir Suisse und FDP-Regierungsratskandidaten Peter Grünenfelder sprach Blocher seine Unterstützung aus. Sie alle waren anwesend am Freitagabend.
Sowieso liess sich viel Polit-Prominenz blicken am Fusse des Uetlibergs: Von alt Bundesrat Ueli Maurer (72) über Parteipräsident Marco Chiesa (48) bis hin zu alt Nationalrat Christoph Mörgeli (51) und den Nationalräten Magdalena Martullo-Blocher (53), Mauro Tuena (50) und Fraktionschef Thomas Aeschi (44) war alles da, was in der SVP Rang und Namen hat.
Weidel und Rösti
Und auch darüner hinaus: Die deutsche AfD-Politiker Alice Weidel (43) und ihre Schweizer Lebenspartnerin wurde ebenfalls im Albisgüetli gesichtet. Wie der Stadtzürcher SVP-Präsident Ledergeber gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte, sei sie von der Partei aber nicht eingeladen worden, sondern mit einem anderen Gast gekommen.
Der prominenteste Gast allerdings war der neue SVP-Bundesrat Albert Rösti (55). Der neue Energieminister bemerkte gleich am Anfang seiner Rede, dass sich neue Bundesräte eigentlich erst nach 100 Tagen im Amt äussern. «Vielleicht habe ich es verwechselt mit 100 Stunden – so lange bin ich nämlich sicher schon im Amt», sagte Rösti. Nach einigem Geplänkel und Freundlichkeiten sprach er davon, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nie selbstverständlich seien. «Demokratie kann nur dann gelebt werden, wenn man miteinander diskutieren kann und das Volk bei Wahlen das letzte Wort hat.»
«Grossen Respekt vor den Erwartungen der Leute»
Schliesslich kam Rösti auf die Versorgungssicherheit in der Schweiz zu reden. «Ich habe grossen Respekt vor der Erwartung, dass die Leute in der Schweiz genügend Strom und Energie haben», beteuerte der neue Bundesrat. Er könne zwar nichts versprechen, aber er werde sich Tag und Nacht dafür einsetzten. Und dann wiederholte er in etwa, was er bereits vor zwei Tagen am Stromkongress in Bern gesagt hatte: Man müsse sehr schnell eine grosse Stromproduktion sicherstellen und schauen, dass Energiequellen nicht «unnötig früh» abgestellt würden.
«Nach gerade einmal 20 Tagen im Amt kann ich noch nicht vieles auf den Punkt bringen», sagte Rösti. Aber er versprach, die Argumente und Sichtweisen der SVP mit Vehemenz im Bundesrat zu vertreten.
Am Schluss seiner Rede versprach Rösti, dass er weiterhin Rückmeldungen aus der Basis abholen werde. Die Delegierten klatschten frenetisch Beifall. Standing Ovations für den Mann, der es nun in Bundesbern richten soll. Und dann stiessen die Anwesenden an: auf den Wahlkampf, die Geselligkeit – und die Schweiz. Schreibt Blick.
21.1.2023 - Tag des netten und talentierten Mr. Röstli
Albisgüetli-Tagung as usual oder frei nach Erich Maria Remarque «im Trychlerland nichts Neues». Der Gesalbte vom Herrliberg poltert wie immer als Primus inter Pares seine «Christophorus uakbar Suren» herunter und der neue SVP-Bundesrat Rösti – vom deutschen Vizekanzler Robert Habeck in der PK am WEF als «Bundesrat Röstli» benannt – spielt gekonnt seine Rolle im Albisgüetli-Western «The good, the bad and the ugly» als kreidefressender Wolf: Der nette und talentierte Mr. Ripley.
Die AfD-Rechtspopulistin und Putin-Versteherin Alice Weidel samt ihrer/ihrem tamilischen Ehefrau*mannwaren nicht explizit von der SVP eingeladen, beteuert die SVP. Aber sehr wohl herzlichst willkommen. Gleich und gleich gesellt sich nun mal gern. Das Ehepaar Alice Weidel und Sarah Bossard dürfte vermutlich von einem der unzähligen AfD-Versteher der SVP mittgeschleppt worden sein. Der Vermutungen gibt es ebenso viele wie der Putin-Versteher*innen bei der SVP.
Dem Weltwochen-Clown Köppel, der u.a. am Gendersternchen-Syndrom leidet, dem brachial gescheiterten SVP-Bundesratskandidaten Thomas Aeschi oder dem unsäglichen Herrn Mörgeli wären geheimnisvolle Schlepperdienste unter Gleichgesinnten sehr wohl zuzutrauen. Es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung für die Genannten. Equal rights for all. Selbst für Widerwärtige mit neofaschistischer Rhetorik.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Kosovos Premier Albin Kurti am WEF: «Serbien ist kein demokratisches Land»
Zwischen Kosovo und Serbien ist es Ende Jahr erneut zu Spannungen gekommen. Diese wurden zwar inzwischen entschärft, von einer Normalisierung der Beziehungen sind Kosovo und Serbien aber noch weit entfernt. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und auch Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti sind ans WEF gereist. Beide weibeln für ihre Sache. Im Interview gibt sich Kurti wenig kompromissbereit.
SRF News: Die Spannungen haben im Kosovo in den letzten Monaten wieder zugenommen. Wer trägt dafür die Hauptverantwortung?
Serbien unterhält 48 vorgelagerte Operationsbasen des Militärs und der Polizei um die Grenze zu Kosovo im Umkreis von weniger als fünf Kilometern. Serbien hat letztes Jahr Vereinbarungen mit dem Kreml getroffen, um billiges Gas aus Russland zu bekommen. Die Aussenminister Serbiens und Russlands trafen sich in New York, um die Aussenpolitik abzustimmen. Gleichzeitig wurde der prorussische, serbische Politiker zum Leiter des Geheimdienstes ernannt. Um unsere Beziehungen steht es also nicht gut, weil Serbien uns ständig provoziert, und Kosovo in einen dysfunktionalen Zustand versetzen will.
Es gibt aber auch Kritik von Diplomatinnen und Diplomaten der EU und den USA an Ihnen, nämlich dass Sie nicht zu Kompromissen bereit seien. Giessen Sie nicht auch Öl ins Feuer?
Ich war prinzipientreu und habe die territoriale Integrität, Souveränität und Demokratie unseres Landes verteidigt. Wir sind ein junger Staat, aber ein altes Volk. Wir können die Funktionalität unseres Staates und die territoriale Integrität, die Integrität der Grenzen nicht aufgeben. Serbien ist kein demokratisches Land.
Deshalb müssen wir sehr wachsam und vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass wir Kompromisse eingehen können, wenn es um unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit, geht. Serbien sollte sich vom Regime Milosevics distanzieren, das vor 24 Jahren Völkermord beging. Und Serbiens Regierung muss sich vom Putin-Regime distanzieren, womit es eng zusammenarbeitet.
Sie senden Spezialeinheiten in den von der serbischen Bevölkerung bewohnten Norden Kosovos, weshalb?
Wir unterscheiden Menschen nicht nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit, sondern nach ihrem Verhalten. Unsere Polizisten sind sehr professionell. Sie wurden sowohl von der EU als auch von uns ausgerüstet und geschult. Wir arbeiten eng mit der KFOR und Organisationen der EU zusammen. Deshalb werden wir das Recht unserer Polizisten, Kriminelle zu verhaften, nicht aufgeben. Wir haben im Norden zum Beispiel fünf Drogenlabors zerstört.
Wie hoch schätzen Sie die Risiken ein, dass die Lage – wie bereits in der Vergangenheit – eskalieren könnte?
Das hängt von Belgrad ab, muss ich sagen, denn sie provozieren uns ständig. Es wurde dokumentiert, dass Söldner der Wagner-Gruppe und andere Paramilitärs, die vom Kreml finanziert und gesteuert werden, bei den vorgelagerten Operationsbasen waren. Es besteht die Gefahr, dass Serbien etwas unternimmt.
Kosovo möchte sowohl der EU als auch der Nato beitreten. Wie realistisch ist das, bevor die Beziehungen mit Serbien normalisiert werden?
Der EU- und der Nato-Beitritt haben eigentlich nichts mit Serbien zu tun. Denn Serbien will der Nato nicht beitreten und hat zudem ein Problem mit der EU. Und die EU hat wegen Serbiens Verbindungen zu Russland ein Problem. Unser Hindernis für den EU-Beitritt ist nicht Serbien, sondern die fünf Staaten, die uns nicht anerkennen: Spanien, die Slowakei, Rumänien, Griechenland und Zypern. Vier von ihnen sind auch Nato-Mitglieder. Aber wir geben trotzdem nicht auf.
Sie haben sich hier am WEF auch mit Schweizer Bundesratsmitgliedern getroffen. Was erwarten Sie von der Schweiz?
In der Schweiz leben über 200'000 Bürgerinnen und Bürger aus Kosovo. Sie senden Geld nach Hause und helfen unserer Wirtschaft und ihren eigenen Familien. Die Schweiz ist für uns auch wegen ihres Know-hows wichtig. Viele kehren zurück aus der Schweiz und gründen in Kosovo Unternehmen. Wir haben vom dualen Bildungssystem der Schweiz gelernt. Derzeit sind wir in Verhandlungen mit der Schweiz für ein Freihandelsabkommen. Das Gespräch führten Sebastian Ramspeck und Martin Aldrovandi. Schreibt SRF.
20.1.2023 - Tag der potemkinschen Demokratien aus der Zeit der UdSSR
Man kann dem kosovarischen Premier Albin Kurti nur beipflichten: Serbien ist in der Tat kein demokratisches Land, sondern eher eine mafiöse Kleptokratie. Das trifft allerdings auch auf den Kosovo zu. Sowie einige andere Staaten aus dem ehemaligen Einflussbereich der UdSSR wie beispielsweise Ungarn, Albanien, Rumänien und Bulgarien.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Mülltaucher suchen Essen: «Einer der pervertiertesten Auswüchse des Kapitalismus»
Es ist 22.42 Uhr, als Aron über ein niedriges Gitter in einem inneren Wiener Gemeindebezirk klettert. Es ist kalt, erste Regentropfen künden sich schon an, und die Straßen leeren sich. Ideale Umstände für ihn, Lara und Alex – sie alle möchten ihre echten Namen nicht im STANDARD lesen. Kaum in dem Hof gelandet, huscht der junge Student über den Gehweg.
Er späht in alle Richtungen, sieht aufgrund der Finsternis aber wohl nicht viel. Andererseits sieht ihn aber auch niemand. Für das, was er heute vorhat, ist das vorteilhaft. Beim Eingangstor angelangt, öffnet er das Schloss für seine beiden Freunde, die noch außerhalb der Wohnsiedlung stehen. Die Gruppe verstummt, denn nun ist Achtsamkeit angesagt.
"Man möchte nicht gesehen oder gehört werden", sagt Aron. "Nicht von Anrainern, nicht von Mitarbeitern. Sonst fällt der Standort weg." Nur wenige Schritte in die Wohnsiedlung hineinmarschiert, steht die Gruppe vor einer Tür mit eindeutiger Beschriftung. Hier ist der Müllraum für den Supermarkt.
Tonnen durchsuchen
Aron und seine Freunde sind gekommen, um die Tonnen nach Lebensmitteln zu durchsuchen. Das Phänomen ist nicht neu, allerdings ist es dieser Tage wieder im Gespräch, seitdem in Deutschland eine Debatte um die Legalisierung ausgebrochen ist.
So leicht ist es nicht immer, den richtigen Ort zu finden, erzählt Lara, oft seien gewerbliche Müllräume gut versteckt. Aron kramt einen Schlüssel aus seiner Tasche. Es ist der gleiche, den etwa auch die Müllabfuhr nutzt. Und er ist der Angelpunkt für Mülltaucher. Denn mit nur so einem Schlüssel ist es möglich, diesen Müllraum – und viele andere in Wien – zu betreten.
Müllsackerln öffnen
Wie er selbst an ihn gelangt ist, will Aron nicht erzählen. Grundsätzlich ist das Werkzeug aber mit den richtigen Kontakten nicht schwierig zu beschaffen. Allerdings dürfte der Student ihn eigentlich nicht besitzen (siehe Wissen). Tür auf, alle rein, Tür zu. Kaum haben die Studenten den Raum betreten, erhellt das automatisierte Licht den Raum – und parallel dazu die Stimmung. Ein leicht abgestandener Geruch dringt in die Nase.
"Hast du auch einen für mich?", fragt Lara, schon deutlich lauter als zuvor, ihren Freund Alex, der sich einen Gummihandschuh über die Hand stülpt. Er nickt und zieht einen Einweghandschuh aus der Jackentasche.
Die Gruppe reißt die schwarzen Müllsäcke in den Restmülltonnen auf, die eine Vielzahl an Schätzen offenbaren: Wurstsemmerln, Bowls, Kuchen und Salate etwa.
Aron und seine Freunde sind nicht arm. Wenn sie wollten, könnten sie sich ihr Essen einfach kaufen. Dass sie hier sind, habe eher mit Moral zu tun. Schließlich werden Lebensmittel, die noch komplett genießbar sind, verschwendet. Das könne man verhindern.
Gleichzeitig spare er sich viel Geld, sagt Aron. Ein Doppelsieg also, findet er. Vor allem im Winter beschafft er sich so einen großen Teil seiner Nahrung. Auch wenn er sich damit möglicherweise strafbar macht. Im Sommer würden die Lebensmittel in den heißen Tonnen hingegen rasch schlecht werden.
Keine schimmligen Himbeeren
Der junge Student ist überhaupt von Kopf bis Fuß mit einem eigenen Outfit zum Dumpstern ausgerüstet. Er trägt eine dunkle Jacke, Hose und alte, abgewetzte Schuhe. Seit Jahren taucht er regelmäßig im Müll.
Aron, Lara und Alex prüfen die Lebensmittel nach eindeutigen Merkmalen, die suggerieren würden, dass sie verdorben sind. Schimmlige Himbeeren will die Gruppe etwa lieber nicht aussortieren, auch bei einer zerdepschten Erdbeere entscheiden die drei sich nach einem kurzen Austausch dagegen, sie mitzunehmen. Das meiste können sie aber in die mitgebrachten Sackerln packen – und später in den Rucksack. Ob die Beute tatsächlich genießbar ist, verraten später die eigenen Sinne: Vor dem Essen sollte man sie genauer ansehen, riechen und eventuell ein kleines Stück probieren.
Als in den obersten Sackerln nichts mehr zu finden ist, muss Lara näher ran. Also klettert sie kurzerhand in die rund zwei Meter breite Tonne. "Berühr am besten nicht die Ränder", sagt Aron zu ihr. "Die sind meistens am dreckigsten." Eher mache es Sinn, auf den Hebellaschen der Tonne zu stehen oder sich mitten in die Tonne zu stellen. Lara entscheidet sich für Letzteres.
Convenience-Abteilung
Auch die Sackerln, in denen Lara am Boden der Tonne wühlt, erinnern immer wieder an die Convenience-Abteilung des Supermarktes. Einige Salate verderben bereits in ihrer Plastikverpackung. "Aufgeschnittene Ware wird am schnellsten schlecht", sagt Aron. Deswegen finde man sie täglich im Müll.
"Oh geil! Glücksschweinchen!", ruft Alex auf, der in der Zwischenzeit in der anderen Tonne gräbt. Schokolade gibt es selten zu retten. Genauso wie andere Süßigkeiten, rohes Fleisch, Bier und überhaupt abgepackte, trockene Ware. "Das nehmen wohl die Mitarbeiter mit", vermutet Aron. Oder es wird gespendet. Dafür entdeckt die Truppe umso mehr süße Mehlspeisen.
Reiche Beute
Als die Gruppe auch das letzte Sackerl durchsucht hat, präsentiert sie ihre Ausbeute: mehrere gefüllte Weckerln, packungsweise Krapfen, Salate, einen Eiaufstrich und Schwedenbomben. Lara freut sich zudem über einen Stahlschwamm – und ein Käsemesser. Alles werden sie nicht rechtzeitig aufessen können, dafür ist es zu viel. Daher wollen sie die Nahrung mit Freunden und Bekannten teilen.
Bevor die Truppe wieder abrauscht, bleibt ein wichtiger Schritt: Der Müllraum soll so aussehen wie zuvor. Nichts soll lose herumliegen. Einerseits, um der Belegschaft des Supermarktes keine Umstände zu machen. Andererseits auch, um unauffällig zu bleiben.
Warum all die Geheimniskrämerei? Aus rechtlicher Perspektive könnte man argumentieren, dass der Student und seine Freunde und Freundinnen Diebe sind. Nur dass ihr Diebesgut etwas ist, das die ursprünglichen Besitzer gar nicht mehr haben wollten. Hinzu kommt, dass sich Müllräume oft auf privaten Grundstücken befinden. Und dann wäre da noch diese Sache mit dem Schlüssel.
Schlösser ausgetauscht
Abgesehen von rechtlichen Aspekten sei es sinnvoll, nicht aufzufallen, weil Supermärkte teils empfindlich reagieren würden, erzählt Aron. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass die Schlösser ausgetauscht werden – oder dass Wachpersonal engagiert wird. "Das ist einer der pervertiertesten Auswüchse des Kapitalismus", sagt Aron.
Doch das sind Gefahren, um die sich die Truppe zumindest diesmal keine Sorgen machen muss. Weitaus entspannter als zuvor spazieren sie hinaus, ihre Rucksäcke voller Lebensmittel. Die nächsten Tage werden sie vermeintlichen Müll schlemmen. Schreibt DER STANDARD.
19.1.2023 - Tag der falschen Fährte
Eigentlich ist an diesem Artikel nichts auszusetzen. Eine aufwühlend geschriebene Echtzeit-Erzählung, die wohl einige von uns betroffen macht. Obschon diese Zustände in der Schweiz glücklicherweise (noch) nicht in diesem fassungslosen Ausmass herrschen wie beispielsweise in Österreich und Deutschland.
Vermutlich verdanken wir diese zunehmende Sensibilisierung bezüglich «Food Waste» unserer grossen Detailhandelsketten wie Migros, Denner, Coop, Aldi, Lidl & Co. dem öffentlichen Diskurs in der Gesellschaft. Da bewegt sich inzwischen sehr viel zum Positiven. Zum Umdenken. Zur Selbstreflektion.
So bieten beispielsweise Aldi, Denner und Migros gegen Abend oder am Samstag schon gegen Mittag etliche Artikel mit kurzer Haltbarkeit wie Gemüse, Früchte, Backwaren, Fleisch usw. zu stark reduzierten Preisen (bis zu 50 %) an. So kann es einem schon mal passieren, dass die Gemüseabteilung bei Denner an der Sälistrasse Luzern eine Stunde vor Ladenschluss beinahe ausverkauft ist. «Food Waste» ist damit – vor allem im privaten Haushaltsbereich – allerdings noch lange nicht aus der Welt geräumt.
Die dämliche Headline «Einer der pervertiertesten Auswüchse des Kapitalismus» jedoch wird dem Thema nicht gerecht und legt eine komplett falsche Fährte. Clickbaiting in Ehren, aber Kapitalismus wird leider und fälschlicherweise immer wieder als Ursache für alle möglichen Probleme dieser Welt bezeichnet, für die er nicht verantwortlich ist.
Ohne Kapitalismus und damit ohne Investitionen und Gründergeist wäre die Schweiz im globalen Staatenranking wohl irgendwo hinter Nordkorea zu finden. Um «Food Waste» bräuchten wir uns nicht zu kümmern, dafür aber um Kinder und alte Menschen, die an Hunger sterben.
Mit dem globalisierten Neoliberalismus abartiger Prägung der Neuzeit hat der Kapitalismus ebenfalls nichts und mit «Food Waste» nur sehr wenig zu tun. Der Kapitalismus ist auch nicht schuld daran, dass wir viele bewährte Werte im Laufe der Zeit über Bord geworfen haben, ohne neue zu schaffen. Der Umgang mit Lebensmitteln war einer dieser Werte der kriegsgeplagten Generation.
In erster Linie sind wir es selbst, die mit unserem Verhalten querbeet durch die Gesellschaft «Food Waste» am Laufmeter produzieren. Selbst in Haushalten, die es sich rein vom Budget her betrachtet gar nicht leisten könnten und somit alles andere als «Kapitalisten» sind, werden um zwei Tage abgelaufene Joghurts und Orangen mit einem klitzekleinen Fleckchen in die Mülltonne entsorgt. Warum eigentlich? Weil ihnen die Eltern der letzten Generation nicht beigebracht haben, wie man mit Lebensmitteln umgeht.
Die Detailhändler können wir dank «kapitalistischer» Demokratie mit Gesetzen bezüglich «Food Waste» langfristig regulieren. Die unverbesserlichen Food Waster*innen leider nicht. Da helfen nicht einmal Polizeibussen, wenn junge Leute unterwegs die halbe Pizza inklusive Verpackung wegwerfen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Physikalische Objekte sind zu Schwarmintelligenz fähig
Die Frage nach der Natur des Denkens und der Intelligenz beschäftigt die Menschen seit jeher und bekommt durch die zunehmende Verbreitung von verblüffenden Anwendungen auf künstlicher Intelligenz basierender Tools neuen Aufwind.
Noch ist die Intelligenz des Menschen in ihrer Gesamtheit sowohl in der Biologie als auch in der Technik unerreicht. Allerdings scheint die Beantwortung der Frage, was Intelligenz eigentlich ausmacht und ob echte Intelligenz auch außerhalb menschlicher Hirne möglich ist, immer schwieriger zu werden.
Intelligent im Kollektiv
Ein Phänomen der Natur stellt unsere Vorstellung von Intelligenz seit jeher auf die Probe: Schwärme von vielen kleinen Tieren können im Kollektiv erstaunlich geordnetes Verhalten zeigen. So sind etwa Ameisen in der Lage, komplexe Bauten zu errichten und einen perfekt funktionierenden Staat mit genauer Aufgabenteilung zu errichten, obwohl keines der Individuen das große Ganze überblickt. Ähnliches gilt für Vogel- oder Fischschwärme, die zu verblüffend geordnetem Verhalten fähig sind. Für die Science-Fiction ist das Phänomen eine mächtige Inspirationsquelle, sei es in dem herrlich minimalistischen Science-Fiction-Film "Phase IV" oder in Adrian Tchaikovskys Evolutionsroman "Die Kinder der Zeit". Aktuell ist das Phänomen auch Thema in der Netflix-Serie "Cabinet of Curiosities" des Oscarpreisträgers Guillermo del Toro.
Diese Phänomene sind deshalb so verwirrend, weil sie nicht zu der Idee passen, dass hinter Intelligenz irgendeine Art von konkretem Geheimnis steht, das über das Stoffliche hinausgeht. Die Idee hat Rene Descartes einst dazu animiert, sich den Ort des Denkens innerhalb des Körpers als Punkt ohne Ausdehnung vorzustellen, und zwar konkret in der Zirbeldrüse. Die Intelligenz von Schwärmen ist aber unbestritten ein Phänomen eines Kollektivs, dessen Grenzen nicht klar umrissen sind und dessen Entstehung sich mit dem schönen Wort "Emergenz" beschreiben lässt. Eines aber galt für Schwarmintelligenz bisher wie für andere Formen der Intelligenz: Es brauchte dafür lebende Wesen mit einer gewissen Fähigkeit zur Wahrnehmung und der Fähigkeit zu komplexen Reaktionen auf äußere Reize.
Physikalische Selbstordnung
Eine kürzlich im Fachjournal "Nature Communications" veröffentlichte Arbeit stellt diese Ansicht nun aber infrage. Ein Team um die beiden Physiker Frank Cichos und Klaus Kroy hat im Labor physikalische Effekte erzeugt, die man als Zeichen für Schwarmintelligenz interpretierte.
Konkret arbeiteten sie mit winzigen schwimmenden Tröpfchen aus Melaminharz auf einer Wasseroberfläche, Kolloide genannt, die mit Nanopartikeln aus Gold versehen waren. Diese Teilchen waren klein genug, um der Brownschen Molekularbewegung zu folgen, die durch die Wärmebewegung der Wassermoleküle verursacht wird. Ihre Bewegungsmuster sind also eigentlich chaotisch. Doch den Forschern gelang es mithilfe von Lasern, ihnen eine Art Raketenantrieb zu verleihen, der es ihnen erlaubte, aus der chaotischen Bewegung auszubrechen und gezielt die Richtung zu ändern.
"Der experimentelle Aufbau bietet abgesehen von der in der Mikrophysik allgegenwärtigen Brownschen Zufallsbewegung eine vollständige Kontrolle über die physikalischen Parameter und Navigationsregeln der einzelnen Kolloide", erklärt Studienautor Cichos.
Kreisende Teilchen
Bei den Beobachtungen des Teams zeigte sich Verblüffendes: Das Verhalten der Teilchen erwies sich als komplexer als anfangs angenommen. Schon das Einführen einer einfachen Regel erzeugte Muster. Die Teilchen begannen teilweise spontan, einander zu umkreisen. Nötig war dazu nur die Regel, dass die Teilchen auf die Vorgabe, sich auf einen bestimmten Punkt zuzubewegen, mit einer gewissen Verzögerung reagieren sollen.
"Physikalisch gesprochen, kann jeder einzelne Schwimmer spontan die radiale Symmetrie des Aufbaus brechen und in Kreisbewegung übergehen", erklärt Studienautor Kroy. Entscheidend sei nur das Verhältnis von Strömungsgeschwindigkeit und Verzögerungszeit.
Die dafür verantwortliche Regel, die von den Forschern als "Schrecksekunden-Effekt" bezeichnet wird, ist deshalb so interessant, weil sie in Schwärmen biologischen Ursprungs auf natürliche Weise realisiert ist. Jedes Tier reagiert auf äußere Reize erst nach einer bestimmten Reaktionszeit. Der Effekt wurde bisher eher vernachlässigt, könnte aber von größerer Bedeutung sein als bislang angenommen. Das macht die Beobachtung auch für die Biologie interessant. Die Forschenden erhoffen sich, ihre experimentelle Anordnung künftig als Versuchslabor für Schwarmphänomene benutzen zu können.
"Alles in allem ist es somit gelungen, ein Labor für Schwärme von Brownschen Mikroschwimmern zu schaffen. Es kann als Baukasten für zukünftige systematische Untersuchungen von zunehmend komplexerem und möglicherweise noch unbekanntem Schwarmverhalten dienen", zeigt sich Cichos zufrieden. Schreibt DER STANDARD.
18.1.2023 - Tag der Schwarmdummheit
Die «Schwarmintelligenz» ist ein spannendes Thema für Wissenschaft und Forschung und fasziniert immer wieder auch Otto und Claudette Normalbürger*in. Man denke nur an die unglaubliche Flugakrobatik der vier Millionen Stare, die laut Schätzungen jedes Jahr in Rom überwintern und den staunenden Zuschauern und Zuschauerinnen ihre Intelligenz in der Luft live und wahrhaftig vorführen.
Was in diesem Artikel allerdings nicht erwähnt wird ist die Schwarmdummheit. Denn auch diese ist ein Bestandteil der «Schwarmforschung». Nehmen Sie zum Beispiel unsere ebenso wunderbare wie auch sonderbare SVP-Unterabteilung der «Trychler» samt Anhang, die während der Coronapandemie die Schweizer Städte in Schwärmen heimgesucht hat. Die Aufmärsche dieser Horden von physikalischen Subjekten bedeuten in der Wissenschaft nichts anderes als gelebte Schwarmdummheit, der allerdings die Anmut, Schönheit und Intelligenz der Römer Stare fehlt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
China schrumpft
Chinas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Im Land tickt eine demografische Zeitbombe.
Chinas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr erstmals seit sechs Jahrzehnten geschrumpft. Ende 2022 habe das bevölkerungsreichste Land der Welt 1,411 Milliarden Einwohner gehabt und damit rund 850'000 weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt in Peking am Dienstag mit.
Damit ist Chinas Bevölkerungszahl zum ersten Mal seit 1961 gesunken – eine historische Wende, die den Beginn einer längeren Periode des Bevölkerungsrückgangs markieren dürfte.
Die Geburtenrate wurde nur noch mit 6,77 Neugeborenen auf 1000 Menschen angegeben – das ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die stetig abnehmende Zahl war vor zwei Jahren erstmals in den einstelligen Bereich gefallen. Zuletzt war die Bevölkerung 1960 und 1961 geschrumpft – als Folge der schweren Hungersnöte nach der verheerenden Industrialisierungskampagne des «Grossen Sprungs nach vorn».
Demografische Zeitbombe
Mit 9,56 Millionen Geburten und 10,41 Millionen Sterbefällen sei die Bevölkerung im vergangenen Jahr erstmals rückläufig gewesen, berichtete das Statistikamt. 2021 war die Einwohnerzahl demnach noch um 450'000 Menschen gestiegen.
China leidet schon länger unter einem starken Geburtenrückgang und einer Überalterung der Bevölkerung. Die Auswirkungen der über Jahrzehnte verfolgten «Ein-Kind-Politik» werden immer spürbarer. Die Aufhebung der umstrittenen Geburtenkontrolle, die von 1980 bis 2016 in Kraft war, führte nur kurzzeitig zu einem leichten Anstieg der Geburten.
Experten sehen die hohen Kosten für Wohnraum, Bildung und Gesundheitsversorgung in China sowie die schwindende Bereitschaft zur Heirat als eigentliche Gründe für die beunruhigende Entwicklung einer demografischen Zeitbombe. Die seit drei Jahren andauernde Corona-Pandemie sorgte für weitere Unsicherheiten, die den Trend noch beschleunigt haben dürften.
Keine Trendwende abzusehen
Als Reaktion auf den Geburtenrückgang und die rapide Überalterung wurden 2021 auch drei Kinder erlaubt. Ausserdem bemüht sich die Regierung seither, es jungen Paaren leichter zu machen, für Kinder zu sorgen. Die Kosten für Bildung wurden gesenkt. Finanzhilfen wurden gewährt, Mutterschafts- und Elternurlaub erleichtert, da viele Frauen befürchten, dass sich eine Mutterschaft negativ auf ihre berufliche Karriere auswirkt.
Durch die Überalterung müssen zunehmend weniger Werktätige in der zweitgrössten Volkswirtschaft immer mehr alte Leute versorgen. Jeder fünfte Chinese ist heute schon älter als 60 Jahre. Zugleich geht die Bevölkerungsgruppe im statistisch betrachtet arbeitsfähigen Alter zwischen 15 und 59 Jahren weiter zurück.
China: Tiefstes Wirtschaftswachstum seit Kulturrevolution
Vor dem Hintergrund der chaotischen Corona-Lage in China ist die Wirtschaft des Landes nach offiziellen Angaben im vierten Quartal noch um 2,9 Prozent gewachsen. Das teilte das Statistikamt in Peking am Dienstag mit. Das entspricht dem geringsten Wirtschaftswachstum Chinas seit der Kulturrevolution von 1966 bis 1976.
Im Gesamtjahr 2022 legte die zweitgrösste Volkswirtschaft demnach um 3 Prozent zu, womit das von der Regierung vorgegebene Wachstumsziel von rund 5,5 Prozent verfehlt wurde. Ökonomen der Weltbank hatte zuletzt noch mit einem Wachstum vom 2,7 Prozent für das Gesamtjahr gerechnet.
Die chinesische Wirtschaft wurde im abgelaufenen Jahr stark durch die strikte Null-Corona-Politik und die damit einhergehenden Lockdowns belastet. Am 7. Dezember vollzog die Führung in Peking eine abrupte Kehrtwende und schaffte nach gut drei Jahren die meisten Corona-Massnahmen ab. Doch seitdem breitet sich das Virus rasant im Land aus, was sich nun ebenfalls negativ auf die Wirtschaftstätigkeit auswirkt. Schreibt BLICK.
17.1.2023 - Tag des Sacks Reis, der in China umgefallen ist
Um allfälligen Verdächtigungen und Fake-News vorzubeugen: Der Blick-Artikel stammt nicht wirklich von Blick und wurde diesmal auch nicht von Alain Berset dem Boulevardblatt an der Zürcher Dufourstrasse zugesteckt, sondern von der US-Schweizerischen Depeschenagentur/Keystone (SDA/kes).
Ansonsten: Ein ziemlich fader Artikel. In China ist ein Sack Reis umgefallen. Die Bevölkerung schrumpft. Na und? Statt 1,411 Milliarden Einwohner*innen sind es nun offiziell «nur» noch 1,410 Milliarden Ni Hao's. Was in China an dritter Stelle hinter dem Komma bezüglich Bevölkerung passiert, ist eigentlich vernachlässigbar.
Die wunderbaren Experten sollten sich weniger Sorgen um Chinas Schrumpfprozess machen, dafür etwas mehr um den Westen, genauer gesagt um die Schweiz, deren Bevölkerung inzwischen auf 9 Millionen angewachsen ist.
Der Unterschied zwischen China und der Schweiz liegt darin, dass die Machthaber in Peking ihren Staat mit langfristigen Plänen lenken, während die Schweizer Politik ihre Pläne nur von Parlamentswahl (National- und Ständeratswahlen) zu Parlamentswahl denkt. Phantasmagorien wie Schweizer Klimaziele fürs Jahr 2050 inbegriffen. Das sind halt die Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Washington DC (6. Januar 2021) und Brasilia (8. Januar 2023): Die siamesischen Zwillinge
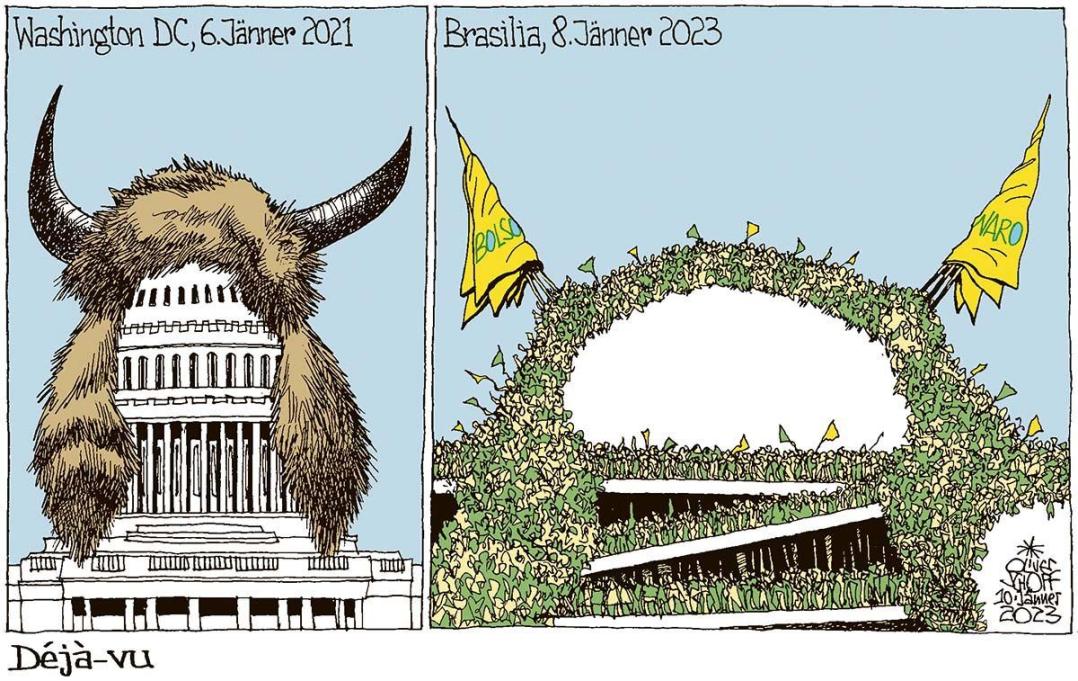
Déjà-vu
Cartoon von Oliver Schopf in DER STANDARD
16.1.2023 - Tag der gleichgesinnten Rechtspopulisten
Heute erlaube ich mir statt meinem Senf die Südwest Presse zu zitieren. Verbunden mit der Frage, ob diejenigen, die jetzt Böses denken tatsächlich Schelme sind, wie der Volksmund zu sagen pflegt. Die Analogien zwischen den beiden (erfolgreichen) Rechtspopulisten Trump und Bolsonaro mit ihrer grossen Anhängerschaft lassen jedenfalls nichts Gutes für die Zukunft erahnen.
In der brasilianischen Hauptstadt Brasilia haben am 8. Januar 2023 mehrere hundert Anhänger von Jair Bolsonaro den Kongress gestürmt. Am Abend (Ortszeit) war die Lage wieder unter Kontrolle, mindestens 200 Personen wurden festgenommen. Verantwortlich waren radikale Anhänger des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, der Anfang des Jahres vom linksgerichteten Politiker Lula da Silva abgelöst wurde. Die rechtsradikalen Anhänger erkennen Lula aber nicht als Präsidenten an und wollen, dass er abgesetzt wird.
In all den Ereignissen ist eine Person auffällig abwesend gewesen: Jair Bolsonaro selbst. Wo ist der ehemalige Präsident also?
Wo ist Bolsonaro? Rechtspopulist mit seiner Familie im Ausland
Schon wenige Tage vor dem Ende seiner Amtszeit ist Jair Bolsonaro mit seiner Familie ausgereist. Er ist Medienberichten zufolge aktuell in Florida, USA. Er ist wohl auf Anraten seiner Anwälte in die USA gereist, um sich vor strafrechtlichen Ermittlungen zu schützen. Er befindet sich nur wenige Kilometer von Mar-a-Lago entfernt, wo sein Verbündeter Donald Trump wohnt und arbeitet. Vor seiner Ausreise plante er, mindestens einen Monat in Orlando, Florida zu bleiben. Möglicherweise ändern sich seine Pläne jetzt aber. Schreibt SÜDWEST PRESSE.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Gute Freunde, strenge Rechnung? Wie die Ukraine für ihre Waffen zahlen soll
Wer an die Ukraine denkt, denkt derzeit wohl meist an das Leid, das ein knappes Jahr Krieg mitten in Europa angerichtet hat; vielleicht auch an die beeindruckende Widerstandskraft der Menschen dort oder an die Schrecken des Krieges, die Bewohner und Soldaten derzeit in Orten wie Soledar oder Bachmut erleben müssen. Wohl die wenigsten denken an Schläuche und alte Kaugummis. Und doch sind diese Gegenstände wichtige Metaphern in einer der hitzigsten Debatten, die derzeit um den Umgang mit dem russischen Angriffskrieg toben – jener um die Bewaffnung Kiews und um die Frage, wer eigentlich finanziell dafür aufkommt.
Lend-Lease Act oder Leih- und Pachtgesetz heißt das US-Papier, auf das sich Gegner der Waffenlieferungen, und oft auch Freunde Russlands, im Diskurs gerade einschießen. Der Tenor ihrer Vorwürfe: Die USA würden nur scheinbar großzügig Hilfen für die Ukraine versprechen, in Wahrheit ihre teuren Waffensysteme aber verkaufen – und dies auch noch auf Kosten der europäischen Partner. Von diesen wiederum würde erwartet, Kiew gratis aus der Patsche zu helfen.
All das ist, so wie es verbreitet wird, großteils nicht wahr – und im Rest grob verzerrt. Richtig ist aber, dass die Geschichte der ukrainischen Rüstung komplizierter ist, als sie oft scheint. Um sie zu verstehen, hilft ein Blick in die Geschichte.
Kampf dem Faschismus
Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 heißt das Gesetz, über das die US-Regierung die meisten Mittel fließen lässt. Der Name ist nicht zufällig gewählt. Er ist ein Rückgriff auf eines der wichtigsten Programme des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen den Faschismus. Mit dem damaligen Leih- und Pachtgesetz rüsteten die USA bereits ab Februar 1941, also vor dem Kriegseintritt Washingtons, jene Staaten mit Material aus, die gegen die Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan kämpften. Dazu zählten neben Großbritannien auch die Sowjetunion und China. Dass Washington nun den gleichen Namen wählte, zeigt auch, in welchem Kontext man den Angriffskrieg Russlands sieht. Signiert hat US-Präsident Joe Biden das Gesetz ausgerechnet am 9. Mai – dem Datum, an dem Moskau den Tag des Sieges gegen den Nazi-Faschismus feiert.
Womit wir, über Umwege, wieder bei Schlauch und Kaugummi sind: Von Ersterem sprach 1941 der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt, als er Hilfen für Europa ankündigte. Kurz zuvor hatte ihn der britische Premier Winston Churchill um Waffen, aber auch um Lebensmittel für die bedrängten Briten gebeten. Damals stand es Spitz auf Knopf. Die Wehrmacht überrollte Europa, Roosevelt wollte helfen, am besten schnell und unkompliziert. Wenn das Haus des Nachbars brenne, sagte er bei einer Pressekonferenz, borge man ihm einen Schlauch – auch dann, wenn dieser 15 Dollar koste und der Nachbar diese im Moment nicht besitze. Er solle den Betrag eben irgendwann später zurückzahlen. Nicht alle US-Politiker waren überzeugt. Isolationisten beider Parteien wollten die militärisch neutrale Position der USA beibehalten.
Der Republikaner Robert Taft sagte, die Idee, Kriegsgerät zu verborgen, sei ein ebenso guter Deal wie ein Kaugummiverleih: Man werde das Geliehene nicht mehr zurückhaben wollen. Tatsächlich ging das Gesetz damals sogar weiter und erlaubte dem Präsidenten auch das Verschenken von Material.
Mit einer baldigen Rückzahlung durch die Ukraine – einen Staat, der ohne Hilfen wohl schon pleite wäre – rechnet auch nun niemand. Dagegen spricht allein schon das Ausmaß der Unterstützung: Auf deutlich mehr als hundert Milliarden US-Dollar beliefen sich die gesammelten Hilfen schon zum Stichtag 20. November – dem letzten Datum, für das das renommierte Kieler Institut für Weltwirtschaft (IFW) vergleichbare Daten zusammengetragen hat. Rund 52 Milliarden Euro entfielen damals auf die EU, auf ihre Institutionen und Mitgliedsstaaten, und rund 48 Milliarden auf die USA. Etwa 14 Milliarden steuerten weitere Akteure bei.
Seither dürften sich die Beträge noch vergrößert haben: Erst Mitte Dezember etwa beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU weitere 18 Milliarden an Hilfen für das Jahr 2023, die USA sagten jüngst wieder fünf Milliarden zu. Außerdem hat Washington die Lieferung eines Patriot-Raketenabwehrsystems zugesagt, auch Deutschland will Kiew mit einer Batterie versorgen. Dazu kommen rund 40 Kampfpanzer vom Typ Marder, die Berlin bereitstellt, sowie französische AMX-10-RC-Spähpanzer. Die Briten wollen rund ein Dutzend Challenger-2-Kampfpanzer liefern. Womöglich erhält Kiew bald auch 14 Stück der neueren deutschen Leopard-Kampfpanzer aus Polen. Das freilich ist auch eine politische Frage: Deutschland muss für den Weiterverkauf der Panzer sein Okay geben, zierte sich vorerst aber noch.
Gratis gibt es für Kiew Informationen. Ihr finanzieller Wert ist schwer zu beziffern, der Vorteil aber unbezahlbar: Ohne die Kooperation westlicher Geheimdienste wären wohl einige ukrainische Erfolge nicht möglich gewesen. Von den Kriegswarnungen 2022 ganz zu schweigen. Zu alldem kommt Hilfe, die nicht direkt in Waffen fließt – etwa die bisherigen humanitären Spenden Österreichs.
Nicht nur Nächstenliebe
Das alles ist nicht nur uneigennützig. Russlands Streben nach Ausdehnung bedroht die EU schließlich auch direkt. Dass man diese Gefahr am besten gleich in der Ukraine stoppen sollte, bevor sie auch am Baltikum oder in Polen virulent wird, sagen nicht nur die betroffenen Länder.
Dafür sind viele nun auch bereit, relativ moderne Systeme wie Himars, Patriot oder Leopard zu liefern – was ein recht neues Phänomen ist. Denn zuerst sortierten viele EU-Staaten einmal ihre alten, teils eingestaubten Systeme aus und stellten sie der Ukraine zur Verfügung. "Ringtausch" heißt das Zauberwort: Um den Verlust der eigenen Verteidigungsfähigkeit zu kompensieren, bestellte man modernes, frisches Gerät nach. Die gesteigerten Militärhaushalte machen es möglich. Stichwort: Zeitenwende.
In die Ukraine ging also "der alte Schrott", wie es ein Diplomat einmal bezeichnete. So geringschätzend wie das klingt, war das Prinzip aber nicht. Denn die Methode hatte für Kiew praktische Vorteile. Die Systeme stammten häufig aus Beständen der Ex-Sowjet- und Ex-Warschauer-Pakt-Staaten. Sie waren daher mit jenen der Ukraine kompatibel. Eine Einschulung, wie sie bei westlichen Systemen oft fällig ist, dauert damit nicht lange oder entfällt vollkommen. Und auch die Munition passt.
Rohstoffe als Kredittilgung
Mit der Lieferung hochmoderner Waffen, Luftabwehrraketen oder Kampfflieger und -panzer waren westliche Staaten bisher vorsichtig. Nicht nur aus Angst vor Eskalation – sondern auch aus pragmatischen Überlegungen. Immerhin droht stets die Gefahr, dass moderne Nato-Technologie in den Kriegswirren in russische Hände fällt. Und auch Korruption und illegaler Waffenhandel sind nie auszuschließen, wenngleich Washington extra Beobachter schickt, um dieses Risiko zu senken. Dass neue Waffen für die Ukraine aber viel effektiver wären, das steht fest.
Geschenkt ist aber auch die EU-Hilfe an die Ukraine nicht. Jene 18 Milliarden Euro etwa, die die EU Kiew Ende 2022 zusagte, sind ein Darlehen. Freilich eines mit sehr günstigen Konditionen: Tilgungsfrei über zehn Jahre, die Union übernimmt dabei außerdem einen Großteil der Zinskosten. Zurückzuzahlen wird das Geld am Ende aber sein.
Wahrscheinlich zumindest. Wie so etwas ablaufen kann, zeigt auch die Geschichte des ersten Leih- und Pachtgesetzes. London und Moskau mussten ihre Schulden damals tatsächlich über Jahrzehnte zurückzahlen. Das tat allerdings nicht immer besonders weh. Denn die Kredite waren über viele Jahrzehnte gestreckt und nicht an die Inflation gebunden – der zu zahlende Wert sank also mit der Zeit. Beim Kalten-Krieg-Partner London drückten die USA zudem beide Augen zu, indem sie sich auf besonders günstige Konditionen einigten: Das Material wurde an seinem einstigen Einsatzort belassen und an die Briten verkauft – zum "Schrottwert" von rund zehn Prozent des einstigen Preises.
83 Millionen US-Dollar machte in der Silvesternacht auf 2007 die letzte Tranche der Bank of England an die Federal Reserve in New York aus. 61 Jahre nach Kriegsbeginn war man in London fast ein bisschen stolz, den "Verpflichtungen zur Gänze nachgekommen zu sein". Immerhin hatten einst auch die USA "ihre Verpflichtungen erfüllt", wie es Ed Balls, damals Labour-Staatssekretär im Londoner Schatzkanzleramt, formulierte. Strenge Rechnung, gute Freunde.
Für nicht ganz so gute Freunde war die Rechnung aber strenger. Die Sowjetunion stellte den USA für Lieferungen in Höhe von 9,8 Milliarden Dollar letztlich Rohstoffe im Wert von 7,3 Milliarden Dollar zur Verfügung. Die Differenz wurde großteils in Gold erlegt.
Im Fall der Ukraine ist davon auszugehen, dass sich eines Tages großzügige Modalitäten finden werden. Der erneuerte Lend-Lease Act für das Land spricht formal zwar ebenfalls von einer Rückzahlung der Kosten. Allerdings ist und bleibt es wohl im strategischen Interesse der EU und der USA, dass demokratische Länder wie die Ukraine nicht von expansionistischen überrollt werden. Zugleich liegt Washington eine längerfristige Schwächung des Antagonisten Russland am Herzen. Und die gibt es aktuell zum Schnäppchenpreis.
Alle Ukraine-Hilfen eingerechnet zahlt Washington nur rund fünf Prozent des Pentagon-Budgets. Eine Schwächung der Ukraine durch jahrelangen Schuldendienst würde diesen Erfolg wieder verringern.
Lukrative Aufträge
Die Finanzmittel werden so schnell also nicht zurückfließen. Und aus diesem Grund sucht man bereits andere Möglichkeiten, sich bei Washington und Brüssel zu revanchieren. In den Fokus gerät dabei der Wiederaufbau. So steht etwa im Raum, dass US- und EU-Firmen eines Tages bei den dafür nötigen Arbeiten lukrative Aufträge zugesprochen bekommen könnten. Das würde, sollten auch ukrainische Firmen noch ausreichend zum Zug kommen, allen Seiten helfen. Freilich bräuchte es auch dafür Finanzmittel. Und wieder gibt es ein Vorbild. Von einem Marshallplan für die Ukraine ist derzeit aber noch selten die Rede. Schreibt DER STANDARD.
15.1.2023 - Tag des AFD-Doktors Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb from Dr. Espendiller-Espenkiller
Vielleicht ergeht es Ihnen wie mir. Sie kennen einen Freund oder Verwandten, den Sie eigentlich schätzen und mögen. Dieser Freund oder Verwandte ist weder ungebildet noch dumm. Dass er Mitglied der SVP ist... Egal. Geschenkt. Seine Entscheidung. Doch seit der Pandemie und den damit aufkommenden Trychlern ist er anfällig geworden für Verschwörungstheorien jenseits von Gut und Böse.
Ab und zu schickt er mir über WhatsApp hanebüchene Videos mit Inhalten, die weit über querdenken hinaus gehen. Also reine Verschwörungstheorien oder Fake News. Ich habe es inzwischen längst aufgegeben, ihn jeweils auf entsprechende Tatsachen hinzuweisen. WhatsApp hat ja glücklicherweise eine Löschtaste, mit der man Mitteilungen auch löschen kann.
Letzte Woche erreichte mich wieder einmal eines dieser kruden Videos von ihm. Der forschungspolitische Sprecher der deutschen Rechtspartei AfD, Dr. Michael Espendiller (Jahrgang 1989), resümierte exakt über diesen «Lend-Lease Act» der USA im Zusammenhang mit den Ukraine Hilfsgeldern und Waffenlieferungen und bezog sich auf den in obigem Artikel ebenfalls erwähnten «Ukraine Support Tracker» vom IFW. Eigentlich Kaffeesatz von gestern, ist doch der «Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022» seit 9. Mai 2022 allen Interessierten längst bekannt. Vorausgesetzt, man orientiert sich nicht ausschliesslich auf «sozialen Deppenmedien» oder den einschlägigen Weltverschwörungs-Portalen auf YouTube.
Dr. Espendiller, Mitglied des Deutschen Bundestags und ehemaliger Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, backt seinen Verschwörungskuchen nach dem gleichen Rezept wie alle anderen Köche aus dieser Szene. Der Teig besteht aus einem oder mehreren nachweisbaren Fakt*en, den oder die niemand bestreiten kann. In diesem Fall sind dies der «Lend-Lease Act» und der «Ukraine Support Tracker» vom seriösen IFW-Institut. Die Ingredienzen für die Hefe werden dann allerdings nach eigenem Belieben, politischer Ausrichtung oder reinen Mutmassungen fern jeglicher Wirklichkeit zusammengemixt. Fertig ist der Verschwörungskuchen.
Den fertigen Kuchen trägt der etwas mehr als nur eigenartige Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb from Dr. Espendiller-Espenkiller von der AfD auf seinem Video unter stetigen Lachanfällen vor. Ob er über seinen eigenen Bullshit lacht, den er verzapft, oder über die Deppen*innen, die sich diesen Unsinn anhören und auch noch glauben, weiss nur Dr. Strangelove.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
So dramatisch waren die letzten Stunden der Elvis-Tochter
Die einzige Tochter von Elvis Presley, Lisa Marie Presley, verstarb am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einem Herzstillstand. Nun geben Berichte Aufschluss darüber, wie dramatisch ihre letzten Stunden waren.
Der Tod von Lisa Marie Presley (†54) bewegt die Welt. Die einzige Tochter vom King of Rock'n'Roll, Elvis Presley (1935–1977), starb am Donnerstagabend (Ortszeit) in Kalifornien, nachdem sie nach einem Herzstillstand ins Spital gebracht wurde. Nun kommen Details über ihr Ableben ans Licht.
So soll die Sängerin nicht nur einen, sondern zwei Herzstillstände erlitten haben. Den ersten hatte sie Zuhause in ihrem Privathaus in Calabasas (Kalifornien), ihr Ex-Mann Danny Kough (58) und später auch Sanitäter haben vor Ort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt. Gemäss dem US-Portal «TMZ» soll im Spital ihr Herz dann ein zweites Mal aufgehört haben zu schlagen.
Patientenverfügung gegen Wiederbelebung
Aufgrund ihres schlechten Zustands habe ihre Familie eine Patientenverfügung unterschrieben, die besagt, dass Presley nicht wiederbelebt wird, falls sie noch einmal einen Herzstillstand erleidet. Als sie im Spital ankam, wurde sie in ein künstliches Koma versetzt und lebenserhaltende Massnahmen seien ergriffen worden. Später wurde sie für hirntot erklärt. Unklar ist, wie lange sie in ihrem Zuhause ohne Sauerstoff war, bevor eine Haushaltshilfe sie in ihrem Schlafzimmer fand.
Obwohl ihr Interview an den Golden Globes am vergangenen Dienstag für viele bizarr wirkte, kam der Tod von Lisa Marie Presley für die Öffentlichkeit überraschend. Nicht der Fall sei dies aber für nahestehende Personen der Sängerin. «Leider ist das die Nachricht, die wir alle befürchtet haben», sagt eine befreundete Person gegenüber der britischen «Sun». Sie hat schon mehrere Entzüge durchgemacht, sei nun aber süchtig nach verschreibungspflichtigen Medikamenten gewesen – darunter Gabapentin, ein starkes Schmerzmittel, und Seroquel, das Patienten mit Gemütskrankheiten verabreicht wird.
Beerdigung in Graceland
Es gibt auch Vermutungen, dass sich Presley für die Inhalation von chirurgischem Gas interessierte, das in der Schönheitschirurgie und von Zahnärzten zur Schmerzlinderung eingesetzt wird. Trotzdem: Gemäss ersten Berichten wurden in ihrem Zuhause keine Drogen gefunden.
«Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass unsere wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat», schrieb Lisa Marie Presleys Mutter Priscilla (77) am Donnerstagabend in einem Statement. Ihre Tochter soll einem Statement zufolge, das dem «Hollywood Reporter» vorliegt, in Graceland, dem ehemaligen Anwesen von ihrem Vater Elvis Presley, neben ihrem Vater und ihrem Sohn Benjamin (1992–2020) beigesetzt werden. Auch Elvis' Eltern Gladys (1912–1958) und Vernon Presley (1916–1979) sind dort beerdigt. Schreibt Blick.
14.1.2023 - Tag des amerikanischen Hardcore-Drogenmarkts
Man soll Toten nichts Schlechtes nachsagen. Das ist eine seit vermutlich Jahrtausenden fest etablierte Konvention. Und das ist gut so.
Doch wenn eine derart prominente Person wie die Tochter von Elvis Presley, Lisa Marie, seit Jahrzehnten so ziemlich alles geschluckt hat was der Hardcore-Drogenmarkt hergibt, lässt sich das nicht verheimlichen. Auch das ist gut so.
Könnte möglicherweise Anlass für einige Drogenkonsumenten*innen sein, über ihre lebensgefährliche Sucht nachzudenken.
Für Lisa Marie Presley ist es dafür nun zu spät. R.I.P.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Klimaforschung torpediert: Was der Ölkonzern Exxon schon vor Jahrzehnten über den Klimawandel wusste
Wie massiv große Öl-, Gas- und Kohlekonzerne jahrzehntelang gezielt Zweifel am menschengemachten Klimawandel schürten, ist gut dokumentiert. Während Firmen aus der Fossilindustrie in internen Studien schon seit den 1970er-Jahren klare Hinweise auf das enorme Emissionsproblem für das Klima vorlagen, säten sie in der Öffentlichkeit Zweifel an den Ergebnissen der Klimaforschung und finanzierten Klimawandelleugner, um die öffentliche Meinung im Sinne ihrer Geschäftsinteressen zu beeinflussen.
Wie sie dabei vorgingen, hat die US-Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes mit ihrem Kollegen Erik Conway 2010 im vielbeachteten Buch "Merchants of Doubt" rekonstruiert: Die Förderer fossiler Energieträger nutzten dieselbe Strategie, die zuvor schon der Tabaklobby großen Erfolg beschert hatte. Sie zogen den Konsens der Wissenschaft in Zweifel, den ihre eigenen Forschungsergebnisse eigentlich stützten. Eine interne Studie der heutigen Exxon Mobil Corporation kam etwa 1979 zum klaren Resultat, dass der Emissionsanstieg zu einer Erderwärmung und dramatischen Umweltschäden führen werde.
Zutreffende Modelle
2017 wies ein Team um Oreskes (Harvard University) nach, dass in internen Exxon-Memos schon damals "dramatische Folgen vor dem Jahr 2050" durch den menschengemachten Klimawandel prognostiziert wurden. Wie präzise die internen Klimamodelle des Konzerns waren, hat Oreskes nun gemeinsam mit dem Historiker Geoffrey Supran (ebenfalls Harvard University) und dem deutschen Klimaforscher Stefan Rahmstorf (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Uni Potsdam) untersucht. Wie das Team im Fachblatt "Science" berichtet, waren die Modelle qualitativ hochwertig und entpuppten sich als weitgehend zutreffend.
Für ihre Untersuchung analysierten Oreskes, Supran und Rahmstorf Exxon-Studien zum Klimawandel aus den Jahren 1977 bis 2003. Darin entwarfen Forschende des Unternehmens ein qualitativ hochwertiges und realistisches Bild der Entwicklungen: Durchschnittlich wurde eine Erwärmung um rund 0,20 Grad Celsius pro Jahrzehnt prognostiziert – ein ziemlich treffsicheres Ergebnis. "Die meisten ihrer Projektionen stimmen genau mit späteren Beobachtungen überein", schreiben Oreskes und Kollegen in "Science". "Ihre Vorhersagen entsprechen auch denen unabhängiger akademischer Modelle und waren mindestens so gut wie diese."
Verschleierte Ergebnisse
Die Analyse zeigt auch, dass Exxon schon früh akkurate Schätzungen vorlagen, wie viel CO2 noch emittiert werden dürfe, um die Erderwärmung in welchem Ausmaß zu begrenzen. Für die Öffentlichkeit waren diese Informationen freilich zu keinem Zeitpunkt gedacht: Um die geschäftsschädigenden Befunde zu verschleiern und klimapolitische Entscheidungen hinauszuzögern, wurden grundsätzliche Zweifel am Klimawandel gesät, emotionale Werbekampagnen gestartet und "Forschungsinstitute" finanziert, die in der Öffentlichkeit ein Gegengewicht zu den Erkenntnissen der Klimaforschung bilden sollten.
"Die Ergebnisse bestätigen, dass Exxon Mobil die Bedrohung durch die menschengemachte Erderwärmung genau vorhergesehen hat", und zwar sowohl vor als auch während umfangreiche Lobbying- und Propagandakampagnen betrieben wurden, schreiben Oreskes und Kollegen. Die vorliegenden Daten würden öffentlichen Aussagen des Konzerns widersprechen – bis heute: Das Unternehmen ließ zu Enthüllungen rund um seine interne Forschung erst kürzlich wissen, Aktivistinnen und Aktivisten würden "den falschen Anschein erwecken, dass Exxon Mobil seine Unternehmensforschung falsch dargestellt hat". Schreibt DER STANDARD.
13.1.2023 - Tag der Gier von Suchtkranken
Wirklich neue Erkenntnisse über das unheilvolle Treiben der mächtigen Erdöl-Konzerne bezüglich öffentlicher Debatte über den Klimawandel sind in diesem Artikel nicht zu finden. Wer sich in den letzten 20 Jahren auch nur minimalst mit dem Klimawandel beschäftigt hat, ist längst informiert, dass die wichtigsten und grössten Player der Erdöl-Giganten wie Exxon Mobil & Co. Studien von willfährigen Forschern und Institutionen manipulieren liessen. Das haben aber Studien generell an sich: «Sag mir wer die Studie bezahlt hat und ich sage Dir wie ernst sie zu nehmen ist.» So einfach ist das.
Die Gier von Suchtkranken schreckt vor rein gar nichts zurück. Weder vor dem eigenen Tod noch vor dem Weltuntergang. Bei den Öl-Multis ist es die gierige Sucht nach noch mehr Milliarden (bzw. Billionen) und bei den Zigarettenkonsumenten*innen Nikotin. Whatever it takes. Oder auf Deutsch: Koste es was es wolle. So einfach ist das.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
«Reinheitsgrad ist gestiegen»: Schweizer schnupfen jedes Jahr 5 Tonnen Kokain
Die Zahlen und Fakten zum internationalen Drogenhandel und Schweizer Konsum zeigen auf: Hierzulande wird im europäischen Vergleich viel Koks konsumiert. Dabei verbrauchen 20 Prozent der Konsumenten rund 80 Prozent der importierten Droge.
Beim Koks haben die Schweizer die Nase vorn. In den Top Ten von Europas Städten mit dem höchsten Konsum pro Kopf finden sich 2021 gleich vier Schweizer Städte wieder: St. Gallen liegt auf Platz 3, Zürich auf Platz 4, Basel auf Platz 6 und Genf auf Platz 9. Abwasserstudien zeigen: Hier wird am meisten gekokst.
«Die Abwasserwerte sind zwar relativ hoch – aber stabil», sagt Frank Zobel, Co-Leiter der Forschungsabteilung von Sucht Schweiz, zu Blick. Das bedeute aber nicht, dass sich die Szene nicht geändert habe. Im Gegenteil. «Der Reinheitsgrad ist in den letzten sechs bis sieben Jahren gestiegen. In vielen europäischen Ländern liegt er nun bei etwa 70 bis 80 Prozent», erklärt Zobel. Immer weniger Händler strecken das Kokain mit verschiedenen Mitteln, was heisst, dass sie genügend Koks zur Verfügung haben.
Kein Wunder: In den klassischen Produktionsländern Kolumbien, Peru und Bolivien steigen die Koka-Produktionsflächen seit einigen Jahren massiv an. «Auch die Sicherstellungen der Drogenfahnder in Europa werden immer grösser», sagt Zobel. «Es kommen riesige Mengen nach Europa.»
Jährlich kommen bis zu 3000 Tonnen Kokain nach Europa
Allein 2021 wurden 240 Tonnen Kokain in Europa sichergestellt. Experten wie der deutsche Forscher Günther Maihold, der zum Themenkomplex Lateinamerika und organisierte Kriminalität forscht, geht davon aus, dass das von den Behörden sichergestellte Kokain nur circa acht bis neun Prozent des Gesamtvolumens ausmacht. Also könnten jährlich 2600 bis 3000 Tonnen Kokain nach Europa kommen.
Davon finden etwa fünf Tonnen Koks den Weg in die Schweiz, so die Schätzung. Dies zeigt eine methodisch gut belegte Studie von Sucht Schweiz aus dem Jahr 2018 auf. «Da es sich um einen Schwarzmarkt handelt, sind dies natürlich nur geschätzte Zahlen. Aber wir gehen aufgrund von Hochrechnungen davon aus, dass diese in etwa stimmen», sagt Zobel dazu.
«Es gibt steigende Anfragen für eine Suchtbehandlung»
Rund 20 Prozent der Konsumenten schnupfen rund 80 Prozent des importierten Kokains. Zobel zu Blick: «Das sind die Intensivkonsumenten. Sie bestehen etwa zur Hälfte aus Drogenabhängigen, die neben Heroin und anderen Substanzen auch noch Kokain nehmen, und zur anderen Hälfte aus mehr bürgerlichen Personen aus der Arbeitswelt, die sogenanntes Kokain-Doping betreiben.»
Die restlichen Konsumenten würden Kokain hauptsächlich in ihrer Freizeit ziehen, jedoch unregelmässig. «Es gibt heute steigende Anfragen für eine Suchtbehandlung im Zusammenhang mit Kokain», sagt Zobel. «Das widerspiegelt die Zunahme des Kokainkonsums in der Schweiz während der letzten zehn Jahre.» Schreibt Blick.
12.1.2023 - Tag der psychiatrischen Kliniken und des reinen Kokains
Tja, der Kokainkonsum nimmt in der Schweiz laufend zu. Die psychiatrischen Behandlungen allerdings auch.
So schrieb das BAG in seiner Newsletter-Botschaft vom Dezember 2022 über einen Allzeit-Jahres-Rekord: 55'825 junge Männer und Frauen (von minderjährig bis 24 Jahre; alle Altersklassen über 24 sind in dieser Statistik noch nicht einmal mitgerechnet) landeten im Jahr 2022 beim Psychiater oder gleich in einer psychiatrischen Klinik. Das ist der Preis den man für eine zugedröhnte Gesellschaft bezahlt. Auch über die Krankenkassenprämien. Schon mal darüber nachgedacht?
Es gibt aber auch positive Aspekte: Das gesniffte Kokain hat einen höheren Reinheitsgrad. Es «fährt» also noch besser und nachhaltiger ein. Die Psychiater*innen freuts.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Hickhack um die Schuldigen nach Erdrutsch in Rothrist AG: Jetzt zoffen sich Gemeinde und Hausbesitzer
Es war bekannt, dass der Hang in Rothrist AG schnell ins Rutschen kommt. Trotzdem donnerten diese Woche Erdmassen bis auf die Hauptstrasse, zum Glück gab es keine Verletzten. Wie konnte es dazu kommen?
Es waren deutliche Vorwürfe, die Gemeinderat Hans Rudolf Sägesser (57) am Tag des Erdrutsches in Rothrist AG fand. «Dieser Erdrutsch kam mit Ansage», sagte er am Dienstag zu Blick. Denn bereits 2022 war der Hang schon einmal Richtung Strasse gedonnert.
Damals habe man Forderungen an die betroffenen Grundeigentümer gestellt, so der FDP-Politiker weiter. Der Problem-Hang sollte gesichert werden. Konkret: «Wir haben empfohlen, eine Plastikmatte zu verlegen, damit das Wasser nicht im Boden versickert.» Passiert sei seither jedoch nichts. Und der Gemeinde seien die Hände gebunden gewesen. Immerhin sei jetzt niemand verletzt worden.
Eigentümer widersprechen dem Gemeinderat
Bei den Grundeigentümern reagiert man nicht erfreut ob der Vorwürfe aus dem Gemeindehaus. Betroffen sind die Wohnungseigentümer von zwei Mehrfamilienhäusern oberhalb des Hangs, aber auch die Besitzer der unbebauten Hang-Parzellen selber.
Ein Immobilienunternehmer, der einige der Wohnungsbesitzer vertritt, sagt zu Blick: «Weder die Wohnungseigentümer noch die Besitzer des Hangs wurden von der Gemeinde aufgefordert, aktiv zu werden. Das stimmt einfach nicht!»
Man habe jedoch nach dem ersten Erdrutsch ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Und das Resultat sei eindeutig gewesen: «Die Häuser waren weder Auslöser der Erdrutsche, noch ist deren Stabilität bedroht. Sie haben sich keinen Millimeter bewegt.» Schon beim Bau der Gebäude seien Massnahmen zur Stabilisierung getroffen worden. Schreibt Blick.
11.1.2023 - Tag der Waisenkinder
Erfolg hat viele Väter. Nur der Misserfolgt ist und bleibt stets ein Waisenkind.
Bei Politikern und Immobilienunternehmern ist dieses absolut verständliche Verhaltensmuster der Menschheit besonders ausgeprägt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Baran T. (53) brach seiner Tochter (4) mehrfach den Schädel: Auf Whatsapp schrieb er, er wolle sie «kaputtschlagen»
Ein Vater packte seine Tochter und schleuderte sie zu Boden. Die Horror-Tat spielte sich im August 2019 in Brugg AG ab. Ab Dienstag muss sich Baran T. vor Gericht verantworten.
Schreibt Blick im Live-Ticker-Format.
Auf den Rest sei hier verzichtet.
10.1.2023 - Tag der pervertierten Voyeure
Eine dieser üblen Geschichten, die bei Blick auf der Frontseite landen. Aber damit nicht genug: Atemlos berichtet das «Revolverblatt»sogar im Viertelstundentackt via Live-Ticker-Format über den Prozess.
Gibt es wirklich so viele kaputte Voyeure*innen, die sich detailliert am Leid anderer Menschen derart ergötzen können, dass solch ein pervertiertes Format aufgeschaltet wird? Die Frage ist einfach zu beantworten: Unter den Blick-Lesern*innen scheinbar schon.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Hartes Urteil von Ueli Maurer: Die SVP steckt «in der Sackgasse»
Die SVP steht oft in der Kritik. Vor den Bundesratswahlen wurde ihr Führungslosigkeit vorgeworfen. Doch jetzt kommen scharfe Worte aus den eigenen Reihen. Alt Bundesrat Ueli Maurer sieht die Partei in der Sackgasse.
Alle Jahre wieder trifft sich das Parteikader der SVP im Spa-Hotel Bad Horn. Auch diesen Januar versammelten sich die Vertreter der Volkspartei im Hotel des ehemaligen Vizepräsidenten Walter Frey (79). Das Ziel: Standortbestimmung. Quo vadis SVP? Wohin soll die Reise weiter gehen?
Überraschend klar äusserte sich alt Bundesrat Ueli Maurer (72) zu seiner Partei. Sie befinde sich in einer Sackgasse, urteilte er unverblümt, wie verschiedene Medien berichten. Die SVP habe nicht mehr das gleiche Sieger-Image wie früher. Schuld sind laut Maurer die Grünen und die Linken, die die Schweiz und eben mit ihr die SVP in die Sackgasse getrieben hätten.
Kritik an der SVP
Aber auch die eigene Arbeit der «Sünneli»-Partei gerät ins Kreuzfeuer. Man habe zu wenig programmatische Arbeit gemacht. «Wir dürfen nicht nur darauf hinweisen, dass die Schweiz in einer Sackgasse ist, wir müssen sagen: ‹Die SVP führt euch hinaus, kommt mit!›»
Die Kritik an der Parteiführung ist nicht neu. Sowohl der ehemalige Parteipräsident und jetzige Bundesrat Albert Rösti (55) als auch Parteichef Marco Chiesa (48) standen häufiger in der Kritik. Von Führungslosigkeit war im Vorfeld der Bundesratswahlen immer wieder die Rede.
Die SVP neu erzählt
Maurer setzt jedoch grösser an. Er will die SVP neu erfinden, neu erzählen. «Wir brauchen eine neue, positive Erzählung», sagte er kürzlich im letzten Interview als Bundesrat gegenüber der «NZZ». Er sieht die Zukunft der SVP nicht als reine Oppositionspartei.
Die SVP müsse lernen, dass sie als stärkste Partei Verantwortung übernehmen und mitgestalten müsse, so seine Forderung. Damit meinte er nicht Kompromisse in den Kernthemen, etwa beim EU-Beitritt, den die Partei strikt ablehnt. Doch die Partei solle, statt das Meiste zu fordern, zusammen mit anderen das Beste erreichen.
Dass gerade Maurer seine Partei zu Konkordanz und Kompromiss aufruft, überrascht, wenn man bedenkt, dass er in seiner Zeit als Parteipräsident eine treibende Kraft des harten, provokativen Kurses der SVP war. Schreibt Blick.
9.1.2023 - Tag des Konkordanz-Gifts
Dass Maurer als Bundesrat die treibende Kraft für einen provokativen Kurs der SVP gewesen sein soll ist schlicht unwahr. Selbst Nicht-SVP-Wähler*innen oder gar SVP-Hater zollen ihm grossen Respekt für die kompetente Führung der beiden Departemente (Armee und Finanzen) während seiner Amtszeit.
Dass ein paar Mal der «ehemalige SVP-Parteichef» mit ihm durchging, sei ihm verziehen, weil diese parteipolitisch bedingten Scharmützel nichts mit seiner Amtsführung zu tun hatten. Welcher Bundesrat / Bundesrätin äussert sich nicht vor wichtigen Wahlen wie beispielsweise National- und Ständeratswahlen im Sinne seiner Partei zu wichtigen Wahlthemen? Keiner und keine.
Die im Bundesrat gelebte Konkordanz hinterlässt selbstverständlich auch und vor allem bei der SVP ihre Spuren. Die SP kann ein Lied davon singen. Die Konkordanz ist Gift für die Hardcore-Ideologen der SP wie auch für die Hardcore-Rechten der SVP wie Trychler, Anthroposophen*innen, Esotheriker*innen, Querdenker und sonstige Weltverschwörungs-Apologeten. Allen recht(s) getan ist eine Kunst, die selbst die SVP nicht kann. Mit den Eiertänzen der abgehängten Randgruppen hat aber jede Partei so ihre Problemchen. Egal ob Rechts, Mitte oder Links.
Eine neue «Erzählung» der SVP liesse sich vermutlich nur in der Opposition glaubwürdig erzählen. Auch davon kann die SP ein Liedlein singen, die als Regierungspartei ihre (nationale) Kampagnenfähigkeit beinahe vollständig verloren hat. Das blüht nicht nur sondern passiert in letzter Zeit ab und zu selbst der sieggewohnten SVP.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Hinter der Show-Kulisse: TV-Bschiss bei Sendung «Höhle der Löwen» des TV-Privatsenders 3+
Die Idee wäre gut: Ein TV-Sender lässt Start-ups um Investoren werben. Doch nach dem Deal vor der Kamera fühlen sich manche jungen Gründer geprellt.
Im Studio von «Die Höhle der Löwen», dem Erfolgsformat des TV-Privatsenders 3+, flammen die Scheinwerfer auf. Khawar Awan (22) betritt den Saal, in dem fünf bekannte Investoren vor ihm sitzen, die sogenannten Löwen. Der junge Unternehmer hat drei Minuten. Er muss sie vor laufenden Kameras davon überzeugen, 80'000 Franken in sein Start-up zu stecken. Awan schwitzt und zittert vor Nervosität. Aber er präsentiert seine Geschäftsidee – und hat Erfolg: Alle fünf sind interessiert.
Awan wählt seinen Favoriten – Lukas Speiser, CEO des Online-Erotikhandels Amorana: «Er kann uns bestimmt viel auf den Weg geben.» Auch die Unternehmer Tobias Reichmuth und Bettina Hein holt er ins Boot. Die drei Löwen sind begeistert. Auch Awan strahlt, denn er verlässt die Sendung als Sieger.
Was die Zuschauer zu Hause am Bildschirm nicht ahnen: Awan wird keinen einzigen Rappen erhalten. Nicht selten platzen die vereinbarten Deals im Nachhinein. Das Publikum erfährt davon nichts. In der Start-up-Szene heisst es, die Hälfte aller in der Sendung zugesagten Investments blieben leere Versprechen. «Die Höhle der Löwen Schweiz» gehört zum Medienreich von CH Media TV. Joël Steiger, Leiter PR Entertainment, widerspricht: «Es sind weniger Deals, die final nicht zustande kommen.» Genaue Zahlen will er nicht nennen.
Die «Löwen» sitzen am längeren Hebel
Für die «Löwen» ist die Sendung trotzdem ein Gewinn. Vor der Kamera dürfen sie sich als grosszügige und hilfsbereite Geldgeber inszenieren – ohne jede Verpflichtung. Jenseits des Rampenlichts geht es härter zu: Tanzen die Start-ups nicht nach der Nase der Investoren, ziehen sie das Angebot zurück.
Mit dieser Darstellung konfrontiert, weicht Steiger von CH Media aus: «Alle unsere Investorinnen und Investoren hegten bereits vor ihrer Tätigkeit für 3+ grosses Interesse für die Start-up-Szene, einige Löwen investierten zudem auch schon zuvor eifrig in Start-ups.»
Für junge Unternehmer wie Khawar Awan ist das kein Trost. Er ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war Busfahrer, seine Mutter Pflegerin. Schon als kleiner Junge begeisterte ihn Mode. Er hatte zwar kaum Geld, aber schon während der Schulzeit kam ihm die Idee, qualitativ hochwertige Kleider im niedrigen Preissegment anzubieten. Also gründete er Finelli und setzte sich zum Ziel, das grösste Streetwear-Label der Schweiz aufzubauen. Seine erste selbst gestaltete Kollektion verkauft sich gut. Doch um weiterzuwachsen, braucht seine Marke dringend Investitionen. Da kommt ihm der Gedanke: «Ich gehe in ‹Die Höhle der Löwen›.»
Hürden über Hürden
Bei mehreren Interessenten übernimmt einer der Investoren die Verhandlungen. Im Fall von Finelli leitete Lukas Speiser die Gespräche. Als sich auf Awans Konto eineinhalb Monate nach den TV-Aufnahmen immer noch nichts bewegte, schrieb er den Amorana-Chef via Instagram an.
Statt des CEOs meldete sich dessen Anwalt. Der beschwichtigte ihn per Telefon, die 80'000 Franken seien ein kleines Investment und ein klarer Deal. Das bedürfe keiner umfangreichen Prüfung. Awans Hoffnungen waren gross. Er hatte die Summe bereits für die nächste Kleiderproduktion eingeplant.
Dann aber wollte Speisers Anwalt plötzlich sämtliche Unterlagen einsehen. Statt in der «Höhle der Löwen» landete Awan in der Hölle des Papiertigers: Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Mietverträge. In der Due-Diligence-Phase muss alles offengelegt werden. Bis zum ersten Treffen mit Speiser vergingen zwei weitere Monate. Der Start-up-Gründer stand unter zunehmendem Druck. Es dauerte noch einen Monat, bis alle drei Investoren zusammenkamen. Zu diesem Zeitpunkt hing das Schicksal von Awans Unternehmen komplett von neuen Finanzspritzen ab.
Doch die Löwen errichteten weitere Hürden. Nun sollte Awan einen Co-Gründer präsentieren. Der Jungunternehmer: «In so einer kurzen Zeit einen Co-Founder zu finden, ist unmöglich. Das weiss jeder Unternehmer.» Damals zahlte sich Awan nicht mal Lohn aus: «Es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der im Textilbereich Erfahrung besitzt und bereit ist, den Job zu kündigen oder das Studium zu beenden.» Sechs Monate nach Aufzeichnung der Show folgte die Hiobsbotschaft: «Am Schluss haben sie mir per Mail abgesagt.»
Lukas Speiser bestätigt auf Anfrage, im Falle von Finelli im Lead gewesen zu sein. Seine Version über den Verlauf der Verhandlungen ist jedoch wesentlich kürzer: «Ich hatte zu dem Deal Treffen und Telefonate mit Khawar, um die Bedingungen zu besprechen.» Laut Speiser platzte das Investment, weil man sich nicht über die Verteilung der Aktien einig wurde.
Vertrag sei unverbindlich
Die Zusammenarbeit mit der TV-Produktion wollte Awan nicht kommentieren. Denn: Öffentliche Kritik ist riskant. CH Media kann gegen anstössige oder verleumderische Äusserungen von Beteiligten rechtlich vorgehen. So regelt es ein Engagementvertrag, der SonntagsBlick vorliegt. Um bei der «Höhle der Löwen» aufzutreten, müssen Start-ups zahlreiche Zugeständnisse machen. Unter anderem: «Der Produzent [erwirbt] das ausschliessliche sowie zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht am gesamten Ergebnis der Leistung der Mitwirkenden.» Die Start-ups erhalten keine Abgeltung, weder Vergütung noch Spesenersatz. Und der Produzent der Sendung entscheidet frei, ob das Aufnahmematerial verwendet wird. Weiter heissts: «Der Produzent ist berechtigt, den Mitwirkenden ohne Angabe von Gründen aus dem Projekt auszuschliessen.» CH Media TV wollte sich zu Vertragsdetails nicht äussern.
Auch Raphaell Schär trat in der Sendung auf: mit seinem Start-up MyFeld. Er versteht die Position der Produzenten, meint aber: «Dieser Vertrag ist hart und schreckt ab.» Eine Rechtsprüfung, von der Schär die Vereinbarung prüfen liess, sei zum Schluss gekommen, die Start-ups hätten wenig Rechte. «Zudem vergehen zwischen Aufnahme und Ausstrahlung Monate.» Bei einem Start-up könne in dieser Zeit viel passieren. Hinzu komme die Due-Diligence-Phase: «Es dauerte drei Monate, bis wir Geld überwiesen bekamen.»
Laut Schär müsse einem Start-up bewusst sein, wie die Show aufgebaut ist. Die Löwen haben vorab keine Info über die Start-ups. «Wenn man sich bei einem Business Angel Club bewirbt, reicht man alle Dokumente im Vornherein ein», so Schär. Das mache den Prozess kürzer. Der Jungunternehmer schlussfolgert: «‹Höhle der Löwen› ist gut, wenn man sein Start-up bekannter machen möchte und Investoren sucht.» Aber man müsse genug Zeit einplanen, da die Investments nicht schnell über die Bühne gehen.
«Heute ist Finelli das grösste Streetwear-Label der Schweiz»
CH Media erzählt eine andere Geschichte. In einer Stellungnahme heisst es: «Genauso wie bei Pitches ausserhalb unserer TV-Gründershow ist es normal, dass in Folgegesprächen (...) Gründe auftauchen können, die gegen eine Zusammenarbeit zwischen den Löwen und den Start-ups sprechen.» Zudem betont das Medienunternehmen, es biete Start-ups «eine prominente Plattform».
Start-up-Gründer Awan meint, ihm habe die Reichweite von 3+ wenig gebracht. Mit einem Post auf Tiktok erreiche er bis zu 1,2 Millionen Menschen. Nach der definitiven Absage gab er nicht auf und präsentierte seine Modevision 45 Investoren, bis er zwei Geldgeber fand.
«Heute ist Finelli das grösste Streetwear-Label der Schweiz», sagt er stolz. Anderen Start-ups rät er, sich gut über die Löwen zu informieren. Und falls der Deal scheitert: nicht aufgeben! Awan ist das beste Beispiel. Heute besitzt er einen Pop-up-Store in Luzern und einen am Zürcher Bahnhofplatz.
Sein Traum wurde Realität; trotz aller Widrigkeiten. Schreibt SonntagsBlick.
8.1.2023 - Tag der Erotikhändler aus dem Löwenkäfig
TV-Schwachsinn hat einen Namen: 3+. Ich wundere mich, dass sich überhaupt jemand diesen Knallchargen-Sender antut. Geschweige denn an einer der vom Privatsender 3+ produzierten Dumpfbacken-Sendungen wie «Bauer ledig und schwul sucht...», «Bäuerin dick und fett geht mit jedem ins Bett» oder «Die Höhle des Fegefeuers der ausgeprägten Eitelkeiten» auch noch live und wahrhaftig teilnimmt.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Asiatische Abhängigkeit: Wo kommen in Zukunft unsere Pillen her? Politik will die Produktion zurückholen
Kaum ein Schmerzmittel ist so erfolgreich wie Paracetamol. Das weiße, kristalline Pulver steckt in Pillen und Brausetabletten, die in der Erkältungszeit millionenfach über die Apothekentische gehen. Mehr als 150.000 Tonnen werden von der Arznei jedes Jahr produziert – nur nicht in Europa. 2008 sperrte die letzte europäische Produktionsstätte von Paracetamol zu. Dem französischen Chemiekonzern Rhodia war die Produktion in Europa zu teuer geworden. Seitdem dämpft Paracetamol aus China und Indien die Erkältungssymptome der Europäerinnen und Europäer.
Paracetamol ist kein Einzelfall. Mehr als 80 Prozent aller medizinischen Wirkstoffe werden inzwischen in China und Indien hergestellt. So abhängig, wie Europa von russischem Gas war, so abhängig sind wir von in Asien produzierten Arzneien. "Die Chinesen brauchen gar keine Atombombe", drückte es die deutsche Pharmazieprofessorin Ulrike Holzgrabe zu Beginn der Corona-Pandemie im ZDF aus. Denn China könnte einfach keine Arzneien mehr liefern, womit sich Europa "von selbst" erledigen würde. Wie drastisch ist die Lage?
Versorgung derzeit gesichert
Derzeit sind nur leichte Vibrationen der Versorgungslage in Österreich zu spüren. Über 500 Medikamente sind laut einer offiziellen Liste des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen nicht lieferbar. Das klingt nach erschreckend viel – entspricht aber nur rund einem Prozent aller Arzneien. Zudem zählen unterschiedliche Wirkstoffkonzentrationen und Packungsgrößen in der Liste doppelt. Für Fachleute ist die Situation deshalb noch nicht besorgniserregend.
Es seien vor allem chemisch einfache Substanzen, deren Produktion ins Ausland verlegt wurde, erklärt Thierry Langer, Leiter des Departments für Pharmazeutische Wissenschaften an der Universität Wien. Die Produktion dieser Arzneien lasse sich einfacher hochfahren, weshalb es selbst während der Pandemie keinen Mangel gab. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik in China habe das Land die Produktion von Paracetamol und Ibuprofen im letzten Monat etwa vervierfacht, meldete etwa die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua kürzlich.
Es seien vor allem chemisch einfache Substanzen, deren Produktion ins Ausland verlegt wurde, erklärt Thierry Langer, Leiter des Departments für Pharmazeutische Wissenschaften an der Universität Wien. Die Produktion dieser Arzneien lasse sich einfacher hochfahren, weshalb es selbst während der Pandemie keinen Mangel gab. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik in China habe das Land die Produktion von Paracetamol und Ibuprofen im letzten Monat etwa vervierfacht, meldete etwa die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua kürzlich.
Schwindender Vorsprung
Auch Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs, betont, dass Europa bei technologisch anspruchsvollen Medikamenten gut dasteht. Die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 seien etwa zu großen Teilen direkt in Europa entwickelt und produziert worden – und zwar für die ganze Welt. "Die ist die Haute Cuisine der Medikamentenproduktion", sagt Herzog. In China, das nur selbstentwickelte Vakzine nutzen will, ist hingegen bis heute kein mRNA-Impfstoff gegen Corona zugelassen.
Dazu könnten die Medikamente der Zukunft ganz anders aussehen als heute: Statt Massenware könnten Menschen auf ihre DNA zugeschnittene Medikamente einnehmen, viele Krankheiten könnten gleich im Vorhinein verhindert werden. Europa ist bei solchen medizinischen Innovationen gut aufgestellt – doch dieser Vorsprung könnte schwinden, warnt Herzog. In Europa seien die Patentanmeldungen für hochinnovative Arzneimittel am Sinken, während sie in den USA und China steigen. Damit Europa den Anschluss nicht verliert, fordert er mehr Geld für klinische Forschung.
Die Fabrik, die niemand will
Wo auch immer die Hightech-Medikamente der Zukunft herkommen werden – eine Grundversorgung mit altbewährten Arzneien gegen Grippe, Erkältungen und Infektionen wird es wohl auch künftig brauchen. Für die Versorgungssicherheit sei es "wünschenswert", wenn sie in Europa produziert werden, sagt Pharmazeut Langer. Doch die Produktion zurückzuholen sei nicht immer einfach. "In Indien stellt man eine solche neue Anlage innerhalb von zwölf Monaten hin, bei uns dauert es Jahre – niemand will eine Chemiefabrik in der Nähe haben", sagt Langer. Und es mache durchaus Sinn, wenn sich Europa auf anspruchsvolle Arzneien fokussiert und die Produktion von einfachen Wirkstoffen Staaten wie Indien oder China überlässt.
Preislich könnten die heimisch produzierten Medikamente ohnehin nicht mit der Konkurrenz aus Fernost mithalten. "Wenn man darauf besteht, dass eine Packung Schmerzmittel vergleichsweise so viel kostet wie ein Wurstsemmerl, wird die Produktion nicht zurückkommen", sagt Pharmavertreter Herzog. Der staatlich auferlegte Preisdruck habe den Produzenten jeglichen Spielraum genommen.
Schwierige Rückholung
Spätestens seit dem Beginn der Pandemie überlegt die Politik, wie sie die Pharmaindustrie in Europa halten kann. "Es ist nicht normal, dass Europa kein einziges Gramm Paracetamol herstellt", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Mitte 2020. Noch im selben Jahr kündigte die EU-Kommission eine Arzneimittelstrategie an, um die Abhängigkeit von Drittländern zu verringern. Passiert ist seitdem wenig. Der Plan soll nun im März 2023 vorgestellt werden, wie die "Presse" am Montag berichtete.
Unabhängig von der EU versuchen Staaten selbst, die Produktion wichtiger Wirkstoffe auf ihrem Staatsgebiet zu halten. In Kundl in Tirol steht eine der weltweit größten Produktionsstätten für Penicilline – und die letzte in ganz Europa. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis überlegte bereits, das Antibiotika-Werk wegen des Preisdrucks aus Asien zu schließen, entschied dann aber doch, die Produktion auszubauen. Wohl auch, weil Bund und Land 50 Millionen Euro zuschossen.
In Frankreich wiederum entsteht ein neues Werk für Paracetamol. Auch dort förderte der Staat die Wiederansiedlung mit viel Geld. 75 Prozent weniger CO2 sollen durch einen neuen Herstellungsprozess entstehen, verspricht der Betreiber Seqens. Ab 2024 soll das wichtige Schmerzmittel dann zum ersten Mal seit 16 Jahren auch wieder aus Europa kommen. Schreibt DER STANDARD.
7.1.2023 - Tag der pharmazeutischen Abhängigkeit von China und Indien
Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet die Pharmaindustrie gewisse Medikamente in Billiglohnländern wie China und Indien produzieren lässt. Gibt es doch nur wenige Branchen, die derart exorbitante Gewinnspannen wie die Pharmabranche vorweisen können. Exorbitant ist aber scheinbar noch lange nicht genug. Jedenfalls auf den ersten Blick.
Doch bei den Überlegungen der Pharma-Multis dürften andere Erwägungen als nur die Tiefstlöhne in den asiatischen Ländern im Vordergrund stehen. China und Indien sind nun einmal als bevölkerungsreichste Staaten Asiens die Zukunftsmärkte. Je früher man sich positioniert, umso effizienter lässt sich der Pharmabereich in Zukunft in Fernost gestalten. Aus unternehmerischer Sicht eine absolut verständliche Strategie.
Hinzu kommt, dass die auf gewisse Medikamente in der Grundversorgung angewiesenen Staaten Europas erpressbar werden. «Novartis will nicht mehr von China abhängig sein und investiert 150 Millionen Euro in die Produktion von Penizillin im Tirol – aber nur, wenn sich Österreich beteiligt.» Schrieb SRF bereits am 15.8.2020.
Diese Strategie zeigt längst Wirkung. Jedenfalls in der Schweiz, wo die Politik entsprechende Rahmenbedingungen für die Pharmaindustrie geschaffen hat. Im aargauischen Eiken sollen durch die Ansiedlung der Basler Biochemie-Firma BACHEM bis zu 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Um nur ein Beispiel zu nennen. Auch im Kanton Graubünden sind Neuankömmlinge aus der Pharmabranche zu sichten.
Nicht verzweifeln: Es tut sich was. Dauert halt ein bisschen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erschaffen. Es brannte allerdings in einer einzigen Nacht nieder.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Mutter und Tochter aus Afghanistan sollen ausgewiesen werden: Das ganze Verzascatal kämpft für die kleine Sara (8)
Über vier Jahre sind Anna B. und ihre Tochter aus Afghanistan auf der Flucht. Im Tessiner Tal haben die Frauen endlich eine neue Heimat gefunden. Doch nun droht den beiden die Ausschaffung. Die Bevölkerung protestiert und sammelt an Weihnachten über 2700 Unterschriften.
Der 22. Dezember ist ein wichtiger Tag für die Kinder im Verzascatal. Wochenlang wurde das traditionelle Krippenspiel vorbereitet, die Kostüme genäht, an der Kulisse gebastelt. Auch Sara B.* (8) darf mitmachen. Die kleine Afghanin tritt als Engel auf. Ihre Augen leuchten wie der glitzernde Weihnachtsschmuck in der Kirche.
«Sie ist so ein aufgewecktes Kind, lernt schnell Italienisch und kommt gut im Unterricht mit», sagt ihre Lehrerin Bianca Soldati (34) zu Blick. «Auch Saras Mutter nimmt teil an unserem Alltag, bietet ihre Hilfe an, geht mit dem Hund einer Rentnerin Gassi oder macht Handarbeiten. Sie ist glücklich, wenn sie etwas zurückgeben kann», stellt Cousine Veronika Soldati fest. Sozialarbeiterin Valentina Matasci (38) ist beeindruckt von Anna B.* (32), Saras Mutter: «Sie will unbedingt unsere Sprache lernen. Sie will sich rasch integrieren und hat schon viele Freunde».
Über vier Jahre auf der Flucht
Doch die Idylle wird durch ein Einschreiben überschattet, das nur einen Tag vor dem Krippenspiel bei Anna B. eingeht. Absender: das Staatssekretariat für Migration (SEM). Ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Anna B. und ihr Töchterchen sollen gleich nach Weihnachten die Schweiz verlassen, heisst es im Brief aus Bern. Fünf Tage Zeit hat die Afghanin, um gegen die Entscheidung zu rekurrieren.
Für die beiden Asylbewerberinnen ist der Brief ein Schock. Seit über vier Jahren ist Anna B. mit ihrem Kind auf der Flucht. In Afghanistan wurde sie von ihrem gewalttätigen Ehemann bedroht. Über die Türkei kam sie nach Griechenland. Dann kämpfte sie sich über die Balkanroute bis nach Slowenien. Dort nahm man ihre Fingerabdrücke. Über die Wälder gelangte sie nach Italien. In Chiasso TI fragte sie nach Asyl. Das war im November 2021. Im März 2022 kamen die beiden zum ersten Mal ins Verzascatal.
«Es sind sehr liebenswürdige Menschen», sagt Barbara Mutti (53) vom Ristorante Froda. In den Fremdenzimmern werden Asylbewerber untergebracht. Auch Anna B. und ihre Tochter ziehen ein. Die Wirtin, von allen «Beba» genannt, erinnert sich: «Die Augen der Mutter waren voller Trauer. Aber die Kleine versprühte Hoffnung».
Anna und Sara wurden schon einmal abgeschoben
In der Nacht auf den 19. Mai 2022, gegen zwei Uhr, holen fünf Polizeibeamte Mutter und Kind aus dem Schlaf. Sie werden nach Slowenien geschafft. Da sie dort als das erste Mal auf EU-Boden registriert wurden, sollen sie, wie im Dublin-Abkommen festgelegt, auch dort um Asyl bitten. Doch Slowenien ist von Flüchtlingen überflutet. Die Menschen werden nicht versorgt. Anna B. und Sara B. leben als einzige Frauen im Männertrakt. «Sara wurde krank. Sie ass nichts mehr. Wir konnten nicht bleiben», sagt Anna B. zu Blick.
Die Afghanin nimmt erneut die riskante Reise durch die Wälder auf sich, durchquert Norditalien und beantragt im Oktober 2022 an der Tessiner Grenze erneut Asyl. Wieder landet sie im Verzascatal. Die Bewohner nehmen sie mit offenen Armen auf. Fortan gehören die beiden dazu. Die herzlose Entscheidung des SEM sorgt für eine Welle der Empörung – und für unerwartet heftigen Widerstand gegen den Asylentscheid.
Über 2700 Unterschriften in nur fünf Tagen
Über Weihnachten gelingt es, über 2700 Unterschriften zu sammeln. Dreimal mehr als das Tal Einwohner hat. Erst werden Listen im Dorfladen in Brione TI ausgelegt. «Wir sind ein Treffpunkt im Tal. Die Leute konnten ihre Unterschrift in die Liste eintragen», sagt Franzisca Werthmüller (53) und erinnert sich, «manche nahmen stapelweise Kopien mit, um weitere Unterschriften zu sammeln». Sie selbst finde die Entscheidung des SEM einfach nur absurd.
Saro di Martino (57) und Giorgio Matasci (70) aus Brione TI sind erschüttert. «Solche Dinge dürften heute nicht mehr passieren», sagt der Besitzer des B&B am Platz. Und der Pensionär fügt hinzu: «Das Problem liegt allein in Bern.» Im Verzascatral sei genug Platz für zwei Afghaninnen. Auch Pfarrer Don Marco (63) ist empört. Man müsse den Menschen über die Vorschrift stellen, «sogar Jesus hat gegen die Regeln verstossen und den Menschen in den Mittelpunkt gestellt». Schreibt Blick.
6.1.2023 - Tag der «Dubliner»-Lachnummer und der Schminktante von der FDP
Ich will das SEM hier nicht kritisieren. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) befolgt pflichtgemäss nur die Vorschriften.
Das «Dublin-Verfahren» darf man hingegen ohne Skrupel als Lachnummer bezeichnen. Würde dieses Abkommen wirklich konsequent umgesetzt, müsste sich die Aargauer Kantonspolizei beispielsweise nicht beinahe täglich mit kriminellen Asylanten aus Algerien und Marokko beschäftigen, die Einbrüche und Diebstähle am Laufmeter produzieren. Hinweis für Geografie-Unkundige: Es ist unmöglich, die Schweiz aus Algerien oder Marokko auf dem Landweg zu erreichen, ohne einen Staat des «Dublin»-Abkommens zu durchqueren. Punkt.
Die im Asylbereich vollkommen unfähige und gescheiterte Schminktante von der FDP, Bundesrätin Keller Sutter, hat das Justiz- und Polizeidepartement ja nicht ohne Grund per Ende Dezember 2022 grosszügig an die SP weitergereicht. Im Hinblick auf die kommenden National- und Ständeratswahlen 2023 ein geschickter Schachzug von Keller-Sutter. Man fragt sich allerdings, warum die wahlstrategisch von allen guten Geistern verlassene SP dieses Danaergeschenk angenommen hat.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Österreichischer Wirt Stefan Lercher tobt - und will «Hippies und Araber» ausschliessen
Ein österreichischer Wirt polarisiert derzeit im Netz mit einem Post auf Instagram. Weil er keine Nerven mehr für anstrengende Gäste habe, möchte er bestimmte Menschengruppen künftig pauschal nicht mehr bedienen - darunter „Araber, Veganer und Hippies“.
„Veganer, Hippies, Ökos und Araber ausgeschlossen“: Mit dieser Aussage polarisiert derzeit ein Wirt aus dem österreichischen Kärnten. Stefan Lercher, Betreiber des Lokals „Peppino“, bringt damit seinen Frust zum Ausdruck. Frust über das Leben als Gastronom, anstrengende Gäste, zu viel Arbeit bei zu wenig Personal. Seit zehn Jahren bereichert er laut eigener Aussage das gastronomische Leben in Millstatt, unzählige Touristen habe er in dieser Zeit bewirtet. Und zu oft hätten diese ihm und seinem Team zugesetzt.
Wirt möchte Betrieb verkleinern
„Das Leben für die Gastronomie macht mürbe. Ich werde mich auf die vielen Stammgäste und Einheimischen konzentrieren“, äußert sich Peppino-Chef Lercher im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ (Österreich). In der Hochsaison habe er täglich mehr als 1000 Mahlzeiten serviert. Nach einer dreitägigen Pause Mitte Januar will er ab 19.1. nur mehr maximal sechs Tische in seinem Restaurant zur Verfügung stellen, wie er im selben Instagram-Post mitteilt. Maximal 250 Essen pro Tag seien dann noch möglich.
„Im Sommer wird das für Millstatt ein Riesenproblem werden“, sagt Lercher dazu der „Kleinen Zeitung“. Denn die übrige Gastronomie in der österreichischen Gemeinde habe nicht ausreichend Kapazitäten. Doch Lercher bleibt bei seinem Entschluss. Neben anstrengenden Gästen begründet er ihn auch mit Personalmangel – und mangelnder Unterstützung seitens der Gemeinde.
Lercher hat „keine Nerven mehr für Diskussionen mit Gästen“
Die Entscheidung, Veganer, Hippies, Ökos und Araber auszuschließen, sei vor einigen Tagen gefallen, berichtet der „ Kurier “ (Österreich). Spontan, bei einem Glas Wein und aus der Wut heraus, erklärt Lercher dazu.
Er führt aus: „Ja, mir reicht es. Wer je mit diesen Gästen zu tun hatte, weiß wovon ich rede. Wir hatten zuletzt Gäste aus dem arabischen Raum, die ihr Kind samt dreckigen Schuhen mitten im Lokal auf den Tisch gestellt haben und meine Kellnerin dann beleidigen, weil sie sagt, sie sollen das unterlassen.“ Letzten Endes habe er „keine Nerven mehr für Diskussionen mit Gästen“.
Wer sich genauer mit den Posts auseinandersetzt, sieht, dass Lercher nicht nur „Araber und Ökos“, sondern Touristen generell aus seinen Räumlichkeiten ausschließen möchte. Ab 19. Januar stünden seine Türen nur mehr „Stammgästen und Einheimischen“ offen, erklärt Lercher, dessen Küche vor allem für Pizza und Sushi bekannt ist.
Diskriminierung oder Hausrecht? Das sagen Experten zum Wut-Wirt-Post
Die polarisierende Aussage könnte für den Gastronom nichtsdestotrotz Folgen haben, denn auch, wenn er generell das Hausrecht besitzt und entscheiden darf, wen er in seine Räumlichkeiten lassen möchte, fallen seine Aussagen unter „Diskriminierung“. Stefan Sternad, Wirtesprecher in Kärnten, sagte etwa dem „Kurier“: „Eine Einschränkung des Angebots aufgrund von Ethnien ist nicht machbar, das ist eine klare Diskriminierung.“
Auch Guntram Jilka, Fachgruppengeschäftsführer für Gastronomie in der Wirtschaftskammer Kärnten, sagte der „Kleinen Zeitung“: „Gäste dürfen nicht aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion zurückgewiesen werden.“ Ein Verstoß müsste vor einer Gleichbehandlungskommission behandelt werden. Schreibt Focus.
5.1.2023 - Tag der arabischen Familie, die noch keinen Sommer macht
Mit seinem Social Media-Gesülze hat sich Stefan Lercher, Betreiber des Lokals «Peppino» in der herrlichen Touristenstadt Millstatt am Millstättersee (Kernten), zumindest eine zweifelhafte Publizität verschafft. Welche Beweggründe ihn wirklich geritten haben, geht aus dem Artikel nicht hervor.
Erinnert stark an die Zeiten, als die Stadt Luzern dank einer indischen Dependance in Engelberg von indischen Touristen geflutet wurde. Das kulturell bedingte Verhalten der indischen Gäste bereitete einigen Luzerner Hotels mit Übernachtungsangeboten und Schiffsbetreibern mit Rundfahrt-Angeboten etliche Unannehmlichkeiten, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Andere Länder. Andere Sitten. Besonders was Hygiene betrifft.
Es kam wie es nicht hätte kommen müssen: Einige Hardcore-Hoteliers und der Touristenschiff-Anbieter Charles «Charlie» Bucher weigerten sich verbal oder mit schriftlichen Hinweisen an der Rezeption und an der Schifflände, indische Touristen aufzunehmen.
So ziemlich das Dümmste für eine Touristenstadt wie Luzern, sprach sich doch dieser Touristen-«Rassismus» mit rasender Geschwindigkeit herum bis nach Indien und auch andere asiatische Länder bekamen Kenntnis davon. Dass dies keine besonders attraktive Werbung für den angepeilten Tourismus aus dem asiatischen Raum war, merkten dann with a little help from «Lucerne Tourismus» auch die betreffenden Hoteliers inklusive «Charlie» Bucher. So schnell wie sie gekommen waren verschwanden die denunzierenden Hinweise wieder.
Ob die fragwürdigen Argumente von Stefan Lercher für die Touristenstadt am Millstättersee dienlich sind, darf bezweifelt werden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Millstätter Wirt mit dem schwachen Nervenkostüm, der eigenen Aussagen zufolge «von der Gemeinde zu wenig unterstützt wird», mit seinem Wutgerede einen Käufer für sein Lokal sucht. Nirgendwo lässt sich dafür günstiger Werbung betreiben als auf den Social Medien. Wenn dann noch die lokalen Zeitungen auf den Zug aufspringen, ist der Jackpot gefüllt.
Wer pro Tag mehr als 1000 Essen verkauft, schraubt die sprudelnde Einnahmequelle nicht wegen einer einzigen arabischen Familie auf 250 Portionen hinunter. Vorausgesetzt, er hat an diesen kolportierten 1000 Essen auch was verdient. Selbst die Personalprobleme dürften eher auf den cholerischen Charakter von Lercher zurückzuführen sein als auf die Gäste. Choleriker waren noch nie gute Chefs als Wirte, Hoteliers oder Schifffahrtbetreiber.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Konkurs von Bio-Geschäft: Schweizer Reformhaus-Kette Müller ist pleite
Die Reformhaus-Kette Müller muss Insolvenz anmelden, da die Firma überschuldet ist. Vom Konkurs betroffen sind 37 Standorte und 298 Mitarbeitende. Der letzte Verkaufstag findet schweizweit am heutigen 3. Januar 2023 statt.
Wie das Unternehmen mitteilt, sei die Zahl der Kunden in der Reformhausbranche seit 2016 gesunken. «Nach einem vergleichsweise erfolgreichen ersten Pandemiejahr 2020 ist der Umsatz im Frühling 2021 erneut stark eingebrochen», so die Mitteilung. Dieser Einbruch habe sich im zweiten Halbjahr 2022 noch weiter verschärft und halte bis zum heutigen Tag an.
Pandemie verstärkte sinkende Kundenzahlen
Die Pandemie und darauffolgende Krisen hätten die Tendenz der sinkenden Kundenzahlen im Fachhandel zusätzlich akzentuiert. «Dabei etablierten sich keine völlig neuen Phänomene, vielmehr wurden bestehende Trends wie Homeoffice und digitale Einkäufe beschleunigt und innert kürzester Zeit zum Standard in unserer Gesellschaft», schreibt die Müller Reformhaus Vital Shop AG weiter.
Zu hohe Preise
Als weiteren Grund für den Konkurs nennt das Reformhaus die Preise. Sie seien als Kaufkriterium in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Dabei agierte die Müller Reformhaus Vital Shop AG eigentlich auf einem «intrinsisch motivierten Markt» – gemäss Firmenwebsite aus Überzeugung und einem starken Bewusstsein für Produktqualität.
«Täglich wurden unsere Mitarbeitenden mit der Aussage konfrontiert, dass unser Angebot zu teuer sei», heisst es weiter. «Andererseits waren wir aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage, die Anstellungsbedingungen unserer Belegschaft nachhaltig zu verbessern.»
Fast 100-jähriges Bestehen endet
Damit endet nach fast 100 Jahren die Geschichte der Reformhaus-Kette Müller in der Schweiz. Gemäss der Firmenwebsite soll sich Roland Müller nach jahrelanger Krankheit durch «neuzeitliche Ernährung geheilt» haben und wurde zum Vegetarier. Seine Erkenntnisse und Lebensweise wollte der Bildhauer und Maler möglichst vielen Menschen bekannt machen und eröffnete 1929 sein erstes Reformhaus am Rennweg 15 in Zürich. Dies sei es noch immer das grösste Reformhaus der Schweiz.
Insgesamt hat die Kette 37 Filialen in der Deutschschweiz und im Tessin. Die Reformhäuser agierten als Fachhandel für gesunde Ernährung mit Fokus auf Bio- oder Demeterqualität, Naturkosmetik und Naturheilmittel. Schreibt SRF.
4.1.2023 - Tag des Managementversagens und Konkursverschleppung
Bitte, bitte nicht schon wieder die Corona-Pandemie für den Konkurs der Reformhaus-Kette Müller verantwortlich machen. Denn der Geschäftszweig, den das Reformhaus Müller bediente, war vom Lockdown gar nicht betroffen.
Der Konkurs ist dem Versagen des Managements zuzuschreiben. Das 100-jährige Geschäftsmodell wurde nicht den Anforderungen der heutigen Zeit angepasst. Die Digitalisierung, die speziell im Angebots-Segment der Naturheilprodukte extrem wichtig ist, wurde sträflich vernachlässigt; die Müller-Website als Online-Shop ein Joke. Tradition allein ist längst kein Selbstläufer mehr im 21. Jahrhundert. Geschweige denn ein Alleinstellungsmerkmal in einem hart umkämpften Markt.
Wenn der Umsatz und damit auch die Kundschaft seit 2016 rückläufig waren, wie das Reformhaus auf seiner Website in weinerlichem Ton selber schreibt, und die Kundinnen und Kunden täglich beim Personal über die hohen Preise in den Müller-Filialen jammerten, hätte jeder vernünftige Unternehmer sein Geschäftsmodell bis ins kleinste Detail analytisch hinterfragt und die notwendigen Schlüsse daraus gezogen. Ist man als CEO einer Unternehmenskette dazu selber nicht in der Lage, gibt es ja genügend fähige Unternehmensberater*innen.
Ich besuchte vor vielen Jahren einmal die Müller-Filiale am Weinmarkt 1 in Luzern. Beste, aber auch sehr teure Lage in der Altstadt mit einer hohen Publikumsfrequenz. Entsprechend der vermutlich hohen Ladenmiete extrem hochpreisige Artikel, von denen die meisten bei den grossen Detailhändlern wie Migros, Coop und sogar Aldi gleich «um die Ecke» ohne Qualitätsverlust zum halben Preis angeboten werden, verhinderten auch bei mir einen Einkauf. Ich habe zwar nicht beim Personal über die hohen Preise gestänkert, dafür aber die Müller-Filiale nie mehr betreten. Ein Einzelbeispiel, dem wohl viele gefolgt sind.
Tatenlos über Jahre hinweg bis zum unvermeidlichen Konkurs abzuwarten, wirft ein schlechtes Licht auf das verantwortliche Management der 100-jährigen Traditions-Reformhaus-Kette. Grenzt ja beinahe schon an Konkursverschleppung.
Wenigstens um die Arbeitnehmer*innen braucht man sich für einmal keine Sorgen zu machen. Der Lohn während der gesamten Kündigungsfrist (ab Konkurs) wird von der ALV bezahlt und der Detailhandel sucht händeringend Mitarbeiter*innen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
Russischer Erfolgsautor Michail Schischkin lebt in der Eidgenossenschaft – und kritisiert sie scharf: Schweizer Fehler führten zum Krieg in der Ukraine
Der in der Schweiz lebende russische Autor Michail Schischkin hat der Schweiz eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine gegeben. Laut ihm geht diese auf Fehler in den 90er-Jahren zurück. 2014 startete seiner Ansicht nach der dritte Weltkrieg.
Michail Schischkin (61) lebt in der Schweiz, in Russland ist er Erfolgsautor. Der Kreml führt ihn auf der schwarzen Liste. Im Februar sprach er mit Blick über den Einmarsch in die Ukraine, war schockiert. Nun äussert er scharfe Kritik an der Schweiz – und gibt ihr eine indirekte Teilschuld am Krieg.
Bei den Olympischen Spielen 2014 im russischen Sotschi hätten die Schweizer «dort ihr Hüsli gebaut, und als Resultat hatten wir die Annexion der Krim», sagte Schischkin im Interview mit Tamedia-Zeitungen vom Dienstag. Der preisgekrönte Autor lebt seit 1994 in der Schweiz.
Schischkin forderte zu Ukraine-Solidarität auf
An der Fussball-Weltmeisterschaft 2018 habe er die Schweiz dazu aufgerufen, Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. «Aber die Schweizer wollten wie alle anderen lieber Fussball spielen.» Der russische Kremlchef Wladimir Putin (70) habe die Botschaft verstanden: Der Westen unterstützt den Krieg stillschweigend. «Damit war der Weg offen für den Überfall auf die Ukraine am 24. Februar.»
Die Schweiz hatte laut Schischkin schon in den 90er Jahren Fehler begangen. «Sie hätte zusammen mit anderen westlichen Staaten der jungen russischen Demokratie der 90er-Jahre auf die Beine helfen sollen», sagt der kremlkritische Autor. Stattdessen habe sie der «neuen kriminellen Diktatur» geholfen.
Schweiz habe «schmutziges Geld» angenommen
Als in der Schweiz tätiger Dolmetscher hat Schischkin seinen Angaben zufolge gesehen, wie die Schweiz «das schmutzige Geld mit grosser Freude» angenommen habe. Ohne die Unterstützung der Schweiz, aber auch von Grossbritannien und den USA, wäre ihm zufolge keine «Banditendiktatur» entstanden.
Schon im Februar letzten Jahres deutete Schischkin die dunkle Rolle der Schweiz an. Auf die Frage, was die Eidgenossenschaft denn tun sollte, sagte er: «Der Schweizer Staat hat als Geldwäsche-Maschine funktioniert. Die Regierung sollte sich dafür entschuldigen, so lange geduldet zu haben, dass ihre eigenen Gesetze nicht angewendet wurden.» Schreibt Blick in einer SDA-Meldung.
3.1.2023 - Tag der russischen Geschichtsklitterung und der Sündenböcke im Ukraine-Krieg
Der «heilige» Zorn des russischen Autors Michail Schischkin ist verständlich und deshalb auch nachvollziehbar. Doch leider schiesst seine Empörung über das Ziel hinaus und hält den Fakten nicht stand.
Es war sicher und definitiv nicht das «Schweizer Hüsli» von Sotschi, das 2014 zur Annexion der Krim durch Russland führte. Dass die Schweiz der «jungen russischen Demokratie» in den 90er Jahren auf die Beine hätte helfen sollen, ist ein wirklichkeitsfremdes Hirngespinst des russischen Schriftstellers. Diesen Einfluss konnte die Schweiz gar nicht ausüben. Zumal zu diesem Zeitpunkt die grossen und wirklich einflussreichen Player wie die USA, Deutschland, England und Frankreich längst vor Ort waren, um die Claims abzustecken.
Die «junge russische Demokratie» in den 90er Jahren gab es nicht mal im Ansatz. Ein machtloses Parlament als potemkinsche Staffage mit der überwältigenden Mehrheit einer kommunistischen Partei, die das russische Volk kurz zuvor noch zum Teufel jagte, sind alles andere als die Grundpfeiler einer Demokratie. Das war und ist reines Wunschdenken und Schönfärberei der damaligen politischen Verhältnisse in Russland. Hätten die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg die NSDAP der Nazis nicht für alle Zeit verboten, wäre auch in Deutschland niemals eine Demokratie entstanden. So viel Wahrheit muss schon sein.
Der nach dem Zerfall der UdSSR an die Macht «gewählte» Präsident und notorische Alkoholiker Boris Jelzin war nichts anderes als ein durch und durch korrupter Kleptokrat. Statt den russischen Geheimdienst (KGB) mit seinen diversen Ablegern als Hemmschuh jeder demokratischen Entwicklung zu zerschlagen, begnügte sich Jelzin letztendlich mit einer Umbenennung der mächtigen Geheimdienst-Institutionen aus der Zeit der Sowjet-Union. So entstand beispielsweise der Inlandsgeheimdienst FSB als Nachfolger des KGB mit Vladimir Putin als Direktor.
Jelzin bemühte sich zwar, die russische Wirtschaft zu liberalisieren. Doch das Konzept Jelzins war falsch und produzierte statt einer liberalen Wirtschaft eine illiberale Vetternwirtschaft von Oligarchen, die sich die einträchtigen Industriekonglomerate samt Rohstoffen unter die Nägel rissen.
Es war nicht die Schweiz, die Putin als russischen Ministerpräsident ermöglichte, sondern einzig und allein Jelzin, der ihn in dieses Am beförderte. Jelzin wiederum profitierte später davon, dass Putin, inzwischen Präsident Russlands und damit Jelzins Nachfolger, die gesamte Familie Jelzin mit einem Erlass vor jeglicher Strafverfolgung bewahrte. Dieser Deal zwischen Putin und Jelzin war dringend notwendig, hatte doch die Jelzin-Sippe mittels Korruption ein riesiges Vermögen auf die Seite gescheffelt. Auch das gehört zur Wahrheit.
Richtig hingegen ist der Vorwurf Schischkins, dass die Schweiz als bedeutende globale Finanzmacht «schmutziges» Geld aus Russland in Milliardenhöhe angenommen und möglicherweise auch einen Teil davon gewaschen hat. Dass die USA, England und Deutschland dies in noch viel grösserem Ausmass betrieben haben, macht die Sache nicht besser. Auch nicht der Hinweis, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine selbst dann stattgefunden hätte, wenn die Schweiz keinen einzigen Rubel aus Russland angenommen hätte.
Dass die Schweiz im Gleichschritt mit der gesamten westlichen Wertegemeinschaft aus 2014 die falschen Schlüsse gezogen hat, wird heute von niemandem mehr bestritten. Auch nicht von Schweizer Politikerinnen und Politikern. Abgesehen von ein paar Putin-Verstehern und Köppel-Fans. Aber, und das gehört auch zu den vielen Wahrheiten, die Michail Schischkin entweder nicht kennt oder unterschlägt: Die Schweiz hat die Ukraine finanziell seit der Maidan-Revolution massiv unterstützt. Dies gegen alle Vorbehalte im Schweizer Parlament. Denn, eine weitere Wahrheit, die Ukraine war bis Ende 2021 als korruptester Staat Europas gelistet.
Man kann und darf die Schweiz für Vieles kritisieren. Was der russische Buchautor Michail Schischkin jedoch mit seinen Aussagen betreibt, ist ein Nachtreten auf faktenlosem Niveau, das seinem Intellekt nicht gerecht wird. Von der Geschichtsklitterung ganz zu schweigen. Sich die Welt so zu machen, wie sie einem gefällt, sollte man immer noch Pippi Langstrumpf überlassen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube

Bundesratsfoto 2023
Bild ZVG BK
Bundesratsfoto 2023: Gute Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Standpunkten
Die Bundeskanzlei hat das offizielle Bundesratsfoto 2023 veröffentlicht. Mit dem Bild des Waadtländer Fotografen Matthieu Gafsou will Bundesrat Alain Berset zeigen, dass die Mitglieder des Bundesrats trotz unterschiedlicher Standpunkte gut zusammenarbeiten und sich gemeinsam für die Schweiz einsetzen.
Das Foto zeigt die sieben Mitglieder des Bundesrats und den Bundeskanzler an einem grossen Tisch: Sie bilden ein Kollegium, interagieren aber auch in kleinen Gruppen. Die Landschaft im Hintergrund symbolisiert die Aussenwelt und verbindet das Handeln des Bundesrates mit dem des Volkes. Für das Bild liess sich Fotograf Matthieu Gafsou von der Genremalerei des 17. Jahrhunderts und der Düsseldorfer Fotoschule inspirieren. Er versammelte alle Mitglieder des Bundesrats und den Bundeskanzler im Bernerhof, wo das Foto aufgenommen wurde.
Auf dem Tisch liegen ein Kompass, eine Schweizerkarte und eine gebundene Ausgabe der Bundesverfassung. 2023 kann die Bundesverfassung, auf die sich der Bundesrat bei seinem Handeln stützt, ihr 175-jähriges Bestehen feiern. Die Blätter, die durch den Raum fliegen, tragen ein Gedicht von Charles-Ferdinand Ramuz und symbolisieren diskret das Chaos und die Spannungen auf der Welt, die heute viel stärker präsent scheinen als früher.
«In einer Zeit der Unsicherheiten und Krisen soll das offizielle Bundesratsfoto Sicherheit vermitteln und zugleich nüchtern wirken. Es soll zeigen, dass der Bundesrat eine Einheit bildet und gut zusammenarbeitet, obwohl seine Mitglieder unterschiedliche Standpunkte haben», so Bundesrat Alain Berset. Als Bundespräsident für das Jahr 2023 ist er den andern Bundesratsmitgliedern gleichgestellt, vertritt aber die Regierung gegen aussen und leitet deren Sitzungen.
Das offizielle Bundesratsfoto wurde in einer Auflage von 40’000 Exemplaren gedruckt. Es kann heruntergeladen und bestellt werden unter www.admin.ch. Dort zeigt ein kurzer Film, wie das Bundesratsfoto entstanden ist. Schreibt das Bundeskanzleramt BK.
2.1.2023 - Tag der Blasphemie und der fliehenden Bundesratsnasen
Ich kann nix dafür, aber als emeritierter Kunsthysteriker erinnert mich das Bundesratsfoto 2023 stark an «Das letzte Abendmahl» von Leonardo da Vinci: Jesus «Alain» Christi mit seinen Jüngerinnen und Jüngern beim letzten Abendmahl? Zumindest für Bundesrat Alain Berset, öfters auch Alain «Berserker» genannt, dürfte es sein letztes Abendmahl als amtierender Bundespräsident im Kreise seiner Apostelinnen und Apostel gewesen sein.
Das Foto hat demzufolge nebst der Blasphemie durchaus auch eine sinnliche Komponente zu da Vincis Kunstwerk. Das übrigens nicht zu seinen besten Schöpfungen zählt. Man sehe sich nur mal die Darstellung der Finger an. Wie menschliche und tierische Glieder in Perfektion auf die Leinwand gemalt werden, zeigt uns beispielsweise Albrecht Dürer auf eindrückliche Art und Weise. Ja, genau der mit dem «Chüngel», falls Ihnen Albrecht Dürer kein Begriff ist und Sie Arthur Schopenhauer mit einem Bierbrauer aus Bayern verwechseln.
Das Bundesratsfoto hat aber nebst der zum letzten Abendmahl durchaus passenden schwarzen Trauer-Kleidung der Magistratinnen und Magistraten noch etwas äusserst Schockierendes an sich: Fällt Ihnen auch auf, dass alle Personen auf diesem Bild den Eindruck fliehender Stirnen, fliehender Nasen sowie fliehender Kinne erwecken? Die müssen alle auf der Flucht zu sein.
Aber vor was fliehen Sie? Vor sich selbst? Vor ihrem Amt? Vor all den Problemen, die sie nicht lösen können? Vor den Versprechen, die sie nicht einhalten können? Vor ihren Untertanen*innen? Vor den kommenden National- und Ständeratswahlen im Jahr 2023? Vor dem jüngsten Gericht am 22. Oktober 2023?
Fragen über Fragen, die uns alle bewegen. Vermutlich übers ganze Jahr 2023 hinweg. Denken Sie an diese Kolumne, wenn der/die/das nächste Bundesrat den Rücktritt erklärt. Oder von fremdem Kampfjets vom Himmel geholt wird. Wer, wenn nicht wir vom AVZ, hält Sie sonst mit den brisanten Details stets auf dem Laufenden?
Herzlichst und mit den besten Wünschen fürs neue Jahr Ihr Dr. Richard Kimble.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube
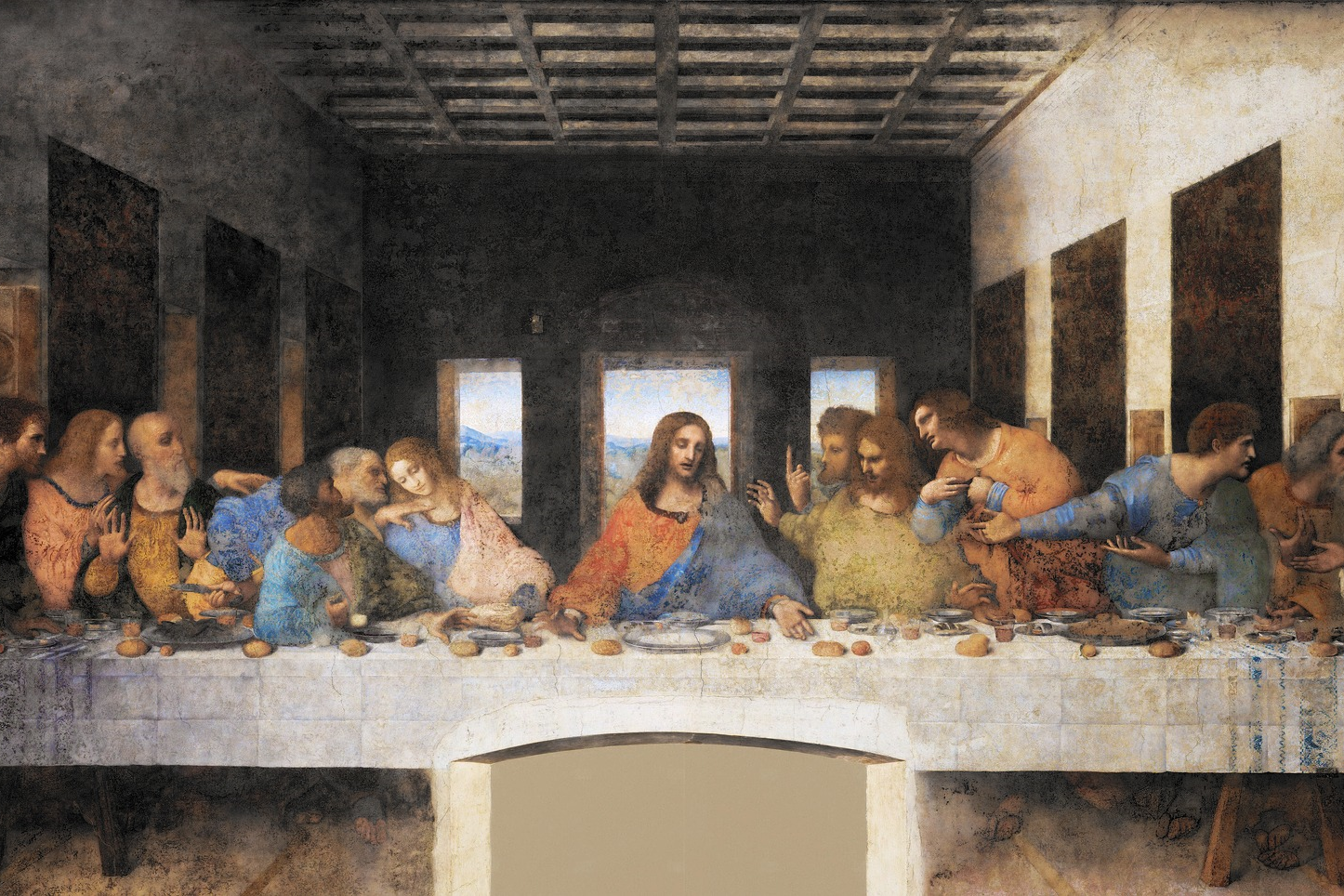
Das letzte Abendmahl von Leonbardo da Vinci
Bild by Pixabay
Noch vor der Berufung: Peter Wüst, Angeklagter im Vincenz-Prozess, verstorben
Peter Wüst, Mitangeklagter im Raiffeisen-Prozess, ist kurz vor Weihnachten gestorben. Er hat stets seine Unschuld beteuert.
Peter Wüst (†68), einer der Beschuldigten im Raiffeisen-Prozess, ist kurz vor Weihnachten an den Folgen einer schweren Demenzerkrankung verstorben. Das berichtet die «NZZ am Sonntag». Da sein Vermögen eingefroren ist, streiten seine Anwälte mit den Vertretern der Raiffeisenbank um Beiträge an die Spitalkosten.
Wüst galt als eine Schlüsselfigur im Zusammenhang mit den Investment-Vehikeln der Hauptbeschuldigten, der früheren Chefs von Raiffeisen und Aduno, Pierin Vincenz (65) und Beat Stocker (61). Sie kamen nach ihrer Verhaftung umgehend wieder auf freien Fuss. Wüst hingegen hatte bei seiner Inhaftierung einen Schock erlitten.
Stets alle Vorwürfe bestritten
Danach ging es mit seiner Gesundheit steil bergab. Er verlor die Fähigkeit zum Sprechen, ab Ende 2020 konnte er sich auch nicht mehr schriftlich zum Fall äussern, wie die «NZZ am Sonntag» weiter schreibt. Bis zuletzt bestritt der ehemalige Spitzenmanager – er hat unter anderem für die Swissair und die Valora gearbeitet – sämtliche Vorwürfe gegen ihn.
Weil seine Vermögenswerte eingefroren sind, müssen die Hinterbliebenen jetzt auch die Auslagen für seine Beerdigung dem Gericht vorlegen – und Raiffeisen kann dagegen Beschwerde einlegen, heisst es im Bericht. In den nächsten Tagen wird das 1200 Seiten lange, erstinstanzliche Urteil publik.
Alle Parteien haben bereits Berufung angemeldet. Wann der Prozess vor Obergericht stattfindet, ist noch nicht bekannt. Schreibt Blick.
1.1.2023 – Tag der unrühmlichen Prominenz und fehlenden Lektoraten
Das neue Jahr 2023 beginnt wie das alte aufgehört hat: Mit Nachrichten über Verstorbene mit Prominentenstatus, von denen es Ende Dezember nicht wenige gab. Eine gewisse «unrühmliche» Prominenz hat auch Peter Wüst durch den Vincenz-Prozess erlangt.
Nun denn. «Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt's alle gleich», wie Ludwig Hirsch - leicht abgewandelt - in einem seiner Lieder singt. Der verstorbene Peter Wüst ruhe in Frieden. Allerdings sei festgehalten, dass er nicht an einer Demenzerkrankung gestorben ist, wie Blick in gewohnter Voreiligkeit schreibt, sondern mit einer Demenzerkrankung.
Solche Falschinformationen passieren halt in der Hitze des Clickbaiting-Gefechtes, wenn die News zur reinen Temposache verkommen und die Lektorate in den Balkan ausgelagert werden, sofern sie überhaupt noch existieren.
Nur so nebenbei: Lektorinnen und Lektoren waren früher hochbezahlte Angestellte in den Zeitungs-Verlagen. Meistens führten sie einen Doktortitel. Doch leider wurden diese Koryphäen der Grammatik, Sprache und Historie dem Kostendruck der Medien geopfert. Dass diese Einsparung Schreibfehler en masse und je nach dem sogar Fake-News produziert, wird von den Verlagen billigend als Kollateralschaden in Kauf genommen.
Falls Sie einen Kommentar zu diesem Kommentar abgeben wollen: Hier geht's zur Senftube